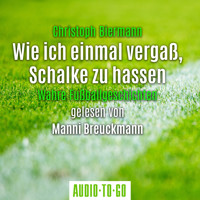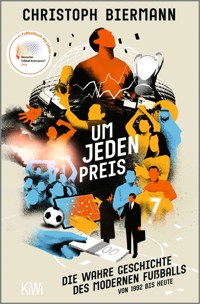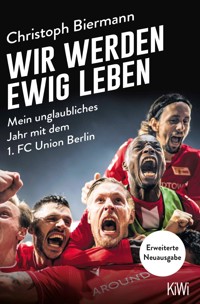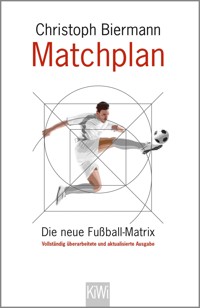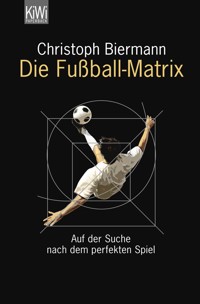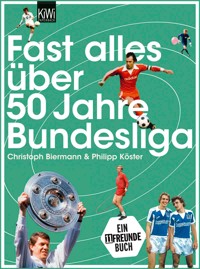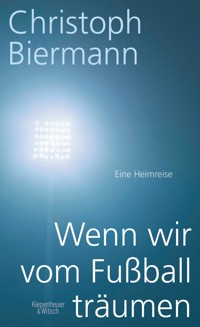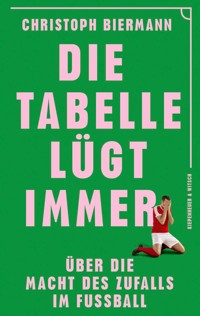
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn nicht stimmt, was wir über Fußball denken: dass trotz aller Anstrengungen von Trainern, Managern und Spielern, den Zufall unter Kontrolle zu bringen, nicht selten die Falschen oben in der Tabelle stehen und nicht die Richtigen absteigen. Wenn wir also die Falschen loben, statt die Richtigen zu kritisieren. Wenn Real Madrid die Champions League ein paar Mal zu viel gewonnen hätte und Pep Guardiola ein paar Mal zu wenig. Wenn wir nach einem Bundesligaspiel zwar tolle Theorien über »Angstgegner« aufstellen oder über »den Lauf«, den eine Mannschaft gerade hat, weil wir nicht wahrhaben wollen, wie zufällig viele Ergebnisse in Wahrheit sind? Und welche Konsequenzen hätte das? Christoph Biermann hat sich auf die Suche nach dem Zufall begeben und mit Trainern, Managern, Vereinsbesitzern und Mathematikern gesprochen. Er hat dabei Erstaunliches herausgefunden, das unseren Blick auf den Fußball verändern wird und wie wir über die Magie des Spiels sprechen. »Als Fußballer habe ich den Zufall schon immer gespürt. Dieses Buch zeigt, wie das Glück vieles lenkt und wie man den Zufall beeinflussen kann. Einfach die pure Tiefe unseres Spiels.« Christoph Kramer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christoph Biermann
Die Tabelle lügt immer
Über die Macht des Zufalls im Fußball
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christoph Biermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christoph Biermann
Christoph Biermann, geboren 1960 in Krefeld, lebt in Berlin und arbeitete für die taz, Stern, Die Zeit und war Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und beim SPIEGEL. Seit 2010 beim Fußballmagazin 11Freunde, inzwischen als Reporter. Biermann gehört seit Jahren zu den profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands und hat zahlreiche Bücher zum Thema Fußball veröffentlicht. »Die Fußball-Matrix« und »Wenn wir vom Fußball träumen« wurden jeweils zum »Fußballbuch des Jahres« gewählt. Zuletzt erschien von ihm »Wir werden ewig leben« (KiWi 1813), 2020.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Was wäre, wenn trotz aller Anstrengungen von Trainern, Managern und Spielern, den Zufall unter Kontrolle zu bringen, oft nicht die Besten oben in der Tabelle stehen und nicht die Schlechtesten absteigen? Was wäre, wenn Real Madrid die Champions League ein paar Mal zuviel gewonnen hätte und Manchester City ein paar Mal zu wenig? Wenn wir nach einem Bundesligaspiel zwar tolle Theorien über „Angstgegner“ aufstellen oder „einen Lauf“, den eine Mannschaft gerade hat, aber nicht wahrhaben wollen, wie zufällig viele Ergebnisse in Wahrheit sind? Und welche Konsequenzen hätte das?Christoph Biermann hat sich auf die Suche nach dem Zufall begeben und mit Trainern, Managern, Vereinsbesitzern und Mathematikern gesprochen. Er hat dabei Erstaunliches herausgefunden, das unseren Blick auf den Fußball verändern wird, und darüber, wie wir über die Magie des Spiels sprechen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © [email protected]/Depositphotos
Grafiken: Katharina Noemi Metschl
ISBN978-3-462-31333-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motti
Die Warnung
Teil 1 Wie der Zufall entscheidet
Katar, 18.12.2022: Ein Schuss, ein Leben
Geschichten, die wir hören wollen, und Geschichten, die wir eher nicht hören wollen
Wie ich Probabilist wurde
Die Vermessung des Zufalls
Die tragische Magie des Fernschusses
Die probabilistische Wende des Fußballs
Wie viele Tore ein Torjäger schießen wird
Sind Torhüter die wichtigsten Spieler im Team?
Der Fluch der Höhenflüge
Freakresultate
Borussia Dortmunds Unglück im Glück
Hey, was geht ab? Höhenflug und Bruchlandung bei Hertha BSC
The Winner takes it all und was das macht
Im Land der Stochastik
Ab wann lügt die Tabelle nicht mehr?
Teil 2 Guter Zufall, schlechter Zufall
Der Zufall und die Erfolgsgeschichte des Fußballs verglichen mit anderen Sportarten
Sind Fehlentscheidungen der Schiedsrichter guter Zufall?
Guter Zufall durch Unforced Errors
Guter und schlechter Zufall im Matsch
Verletzungspech und die Tiefe des Kaders
Teil 3 Geschichten gegen den Zufall
Die Erfindung des »Spielglücks«
Das Ende der Sprechverbote
Den Misserfolg verarbeiten
Die Kontrollillusion
Tragische Selbsterzählung
Zu schnelles Denken
Statt Rückschaufehler von hinten denken
Die Explosion der »Geschichten«
I put a spell on you – Pep Guardiola und der Fluch der Champions League
Die Geschichte vom Angstgegner
Das Erdbeben von Barcelona
Teil 4 Zufallsmanagement
Jürgen Klopp und die Kraft der Überzeugung
Union Berlin: ein eisernes Rätsel
Gibt es das, einen Lauf haben?
Die Wahrscheinlichkeit eines Fehleinkaufs
Das Prinzip der großen Stichprobe
Lionel Messi und die Kunst des Spaziergangs, oder: Wie aussagekräftig sind Daten überhaupt?
Die Rückkehr der Fernschüsse
Elfmeter unter Kontrolle – zumindest fast
Wie berechnet man Standardsituationen?
Marginal Gains, die Arbeit am Detail
Auch in Führung offensiv bleiben!
Die Strategie des sauberen Strafraums, oder: Dem Glück auf die Sprünge helfen
Den Zufall reiten – Johan Cruyff und Helmut Groß
Den Zufall sogar noch forcieren
Anders spielen und den Zufall loslassen: Relationismus
Ein Rezept gegen den Abstieg
Nicht nur Daten erheben – Fußball neu denken
Epilog: Rettet den Zufall!
Dank
Register
»Es gibt keine Gerechtigkeit im Fußball. Wer auch immer gewinnt, verdient den Sieg.«
Diego Simeone
»Erst hast du kein Glück, und dann kommt noch Pech dazu.«
Jürgen Wegmann
»Wenn Menschen Erfolg haben, dann nur, weil sie hart arbeiten. Glück hat nichts mit Erfolg zu tun.«
Diego Maradona
»Fußball ist praktisch das einzige Spiel, wo die bessere Mannschaft verlieren kann.«
Ivica Osim
»Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.«
Andreas Brehme
Die Warnung
Was wäre, wenn nicht stimmt, was wir über Fußball denken? Wenn unsere Diskussionen den entscheidenden Punkt verpassen und in die Irre führen? Was wäre, wenn wir die Falschen loben – und nicht die Richtigen kritisieren? Was wäre, wenn es in Wirklichkeit keine »Angstgegner« gibt und die Theorie vom »Lauf«, den eine Mannschaft gerade hat, nicht stimmt? Was wäre, wenn Real Madrid die Champions League ein paarmal zu viel gewonnen hätte und Pep Guardiola einige Male zu wenig? Was wäre, wenn Deutschland bei der WM in Katar unverdient ausgeschieden wäre? Was wäre, wenn wir uns zwar tolle Geschichten über Fußball erzählen, aber nicht die Wahrheit?
An einem Spätsommertag des Jahres 2024 saß ich mit Michael Reschke vor einem Café in Berlin. Der ehemalige Sportdirektor und Sportvorstand war über ein Vierteljahrhundert bei Bayer Leverkusen und Bayern München, beim VfB Stuttgart und Schalke 04 für Verträge im Wert von insgesamt rund drei Milliarden Euro verantwortlich gewesen, wie er mir en passant vorrechnete. Mit Ende 60 hatte er immer noch viel Spaß daran, engagiert über Fußball zu debattieren. Ich erzählte ihm, dass ich mich gerade mit der Rolle des Zufalls im Fußball beschäftigte, mit Glück und Pech. Er nickte und sprudelte gleich über vor Geschichten von Spielen, in denen eine seiner Mannschaften auf rätselhafte Weise gewonnen oder verloren hatte. Reschke erzählte auch, wie Pep Guardiola, mit dem er in München zusammengearbeitet hatte, eine unglückliche Niederlage bei Manchester City heiter nahm, weil ein spielerischer Durchbruch gelungen war. Ich hatte das Gefühl, dass wir den ganzen Tag da sitzen und über die Macht des Zufälligen im Fußball hätten reden können.
Doch plötzlich schaute Reschke mich scharf an, als sei ihm gerade klar geworden, dass ich ihn dorthin gelockt hatte, wohin er gar nicht wollte. Er klang nicht verärgert, eher machte es den Eindruck, als wollte er mich vor einem Fehler bewahren. Einem Fehler, der nicht nur für mich schwerwiegende Folgen haben würde, sondern für alle in der wunderbaren Welt des Fußballs. Als bestände die Gefahr, dass ich etwas kaputt machen könnte. Die Warnung war klar und deutlich, sie kam als Anweisung daher: »Sie dürfen den Fußball nicht entmystifizieren!«
Wirklich nicht?
Teil 1Wie der Zufall entscheidet
Katar, 18.12.2022: Ein Schuss, ein Leben
Das Endspiel der Weltmeisterschaft 2022 war fast vorbei, aber noch nicht entschieden. In der dritten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung stand es 3:3 zwischen Argentinien und Titelverteidiger Frankreich, und es gab nur noch einen letzten Angriff in diesem furiosen Finale. Es war ein Angriff am Rand der Erschöpfung, ein weiter Ball von der Mittellinie in Richtung argentinischer Strafraum. Wirklich gezielt war dieser Pass nicht mehr, eher mit den besten Wünschen nach vorne geprügelt. Doch unversehens stand der französische Stürmer Randal Kolo Muani frei vor dem argentinischen Keeper Emiliano Martinez.
Lionel Messi schaute aus der französischen Hälfte zu, wie über sein weiteres Leben entschieden wurde. Der vielleicht beste Spieler aller Zeiten war in diesem Moment 35 Jahre alt, und würde Kolo Muani jetzt ins Tor treffen, wäre seine wohl letzte Chance dahin, Weltmeister zu werden. Mit dem FC Barcelona hatte er Titel nach Belieben gewonnen, viermal allein die Champions League und zehnmal die spanische Meisterschaft. Siebenmal war er bereits zum Weltfußballer gewählt worden, aber Weltmeister war er nie. Bei der WM 2006 in Deutschland war er mit seinerzeit 18 Jahren noch zu jung gewesen und hatte von der Bank aus zugesehen, wie sein Team gegen die Gastgeber ausgeschieden war. Vier Jahre später in Südafrika bewies dann Diego Maradona, dass ein genialer Fußballer kein genialer Trainer sein muss, erneut schied Argentinien gegen Deutschland aus. 2014 unterlag Messi mit Argentinien wieder gegen Deutschland, diesmal im Finale der Weltmeisterschaft. Drei Endspiele der Copa América gingen ebenfalls verloren. Nach dem Finale 2016 gegen Chile, als er im Elfmeterschießen vergeben hatte, war Messi frustriert aus der Nationalmannschaft zurückgetreten – wenn auch nur für ein paar Monate. Bei der WM in Russland 2018 schied Argentinien schon im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich aus. Mochte die ganze Welt Lionel Messi verehren, in seiner Heimat fragten sie grollend: Warum ist er mit Argentinien nicht so erfolgreich wie mit dem FC Barcelona? Gibt er wirklich alles, wenn er für unser Land spielt?
Als die Albiceleste ein Jahr vor der WM in Katar endlich zumindest die Copa América gewann, wurden die Beschwerden etwas leiser, aber ohne WM-Titel würde Messi für seine Landsleute ein Unvollendeter bleiben. In Katar spielte Messi dann sein bestes WM-Turnier, führte seine Mannschaft, und Tore schoss er auch. Im Finale brachte er Argentinien in Führung, in der Verlängerung traf er noch einmal zum 3:2, aber Kylian Mbappé glich mit seinem dritten Treffer aus. Schon dieses Remis war schmeichelhaft für Frankreich gewesen, doch nun hatte Kolo Muani sogar die Chance auf den Siegtreffer. Er hob den Blick und holte aus …
Am nächsten Tag konnte man in der argentinischen Sportzeitung Diario Olé lesen: »Die Welt ist heute ein gerechterer Ort. Ehre sei Gott, Ehre sei Messi. Das Schicksal, das so oft so grausam mit ihm umzugehen schien, hatte die beste Rache für ihn auf Lager, den erträumten Tag, die erträumte Weltmeisterschaft, die Weihe, die ewig sein wird. Heute ist Messi in die Ewigkeit eingegangen. Heute ist er für diejenigen, die ihn von Anfang an unterstützt haben, und für diejenigen, die sich ihm später angeschlossen haben, für immer zum Helden geworden. Heute wird Messi der beste Spieler der Geschichte, sorry Diego.« Zur Fußballkultur in Südamerika gehört eine blumige Sprache, und der Autor von Diario Olé trug besonders dick auf, als er einen gerechten Gott beschwor, der Lionel Messi eine ewige Weihe erteilt hatte. Aber andererseits gewannen einige der größten Spieler aller Zeiten nie die WM: Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Michel Platini, Ferenc Puskás, Marco van Basten, Eusébio, Oliver Kahn oder Paolo Maldini. Teilweise erlebten sie bei Weltmeisterschaften dramatische Finalspiele, bei denen sie als Verlierer vom Platz gingen.
Messi jedoch entging diesem Schicksal, denn Randal Kolo Muani hatte nicht getroffen. »Ich glaube, ich werde diese Szene mein ganzes Leben lang nicht verdauen«, sagte der Stürmer Monate nach dem Spiel in einem Interview. »Ich hätte Martinez mit einem Heber überspielen oder links zu Kylian Mbappé passen können.« Doch Kolo Muani schoss, direkt und hart. Ein guter Schuss, aber Martinez reagierte phantastisch und erwischte den Ball mit dem linken Fuß. Wegen dieser Parade und weil er das Elfmeterschießen durch einen gehaltenen Schuss mitentschied, wurde er zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Lionel Messi erhielt den Goldenen Ball als Auszeichnung für den besten Spieler, doch viel wichtiger noch: Er durfte endlich den WM-Pokal in Empfang nehmen. Nach 18 Jahren als Fußballprofi mit Hunderten von Spielen und einer endlosen Reihe epochaler Leistungen entschied der Schuss eines anderen darüber, welche Geschichte wir seitdem über Lionel Messi erzählen.
Geschichten, die wir hören wollen, und Geschichten, die wir eher nicht hören wollen
Am 8. März 2023 war ich in Frankfurt und hatte mich kurzfristig entschieden, eine Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes zu besuchen. Wobei ich vor allem das damals noch neue, etwas überdimensionierte Gebäude des DFB sehen wollte, eine Mischung aus Sport-Universität und Tech-Company. Als ich die Pressekonferenz zwischendurch kurz verließ, traf ich draußen zufällig Dr. Pascal Bauer. Der Sportwissenschaftler und Mathematiker bot mir nach einem kurzen Gespräch spontan an, mich später durchs Gebäude zu führen. Doch während unseres Rundgangs war ich schnell abgelenkt. Denn Bauer erzählte, dass er das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft nach der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2022 in Katar analysiert habe. Wie vier Jahre zuvor in Russland war die deutsche Nationalmannschaft dort bereits in der Vorrunde gescheitert.
Bauer erzählte mir, dass er vor dem Turnier für jede Runde – von der Gruppenphase bis zum WM-Finale – die Wahrscheinlichkeit berechnet habe, mit der die Nationalmannschaft diese erreicht. Das war keine Spielerei gewesen, sondern eine Risikoanalyse, die dem Verband eine bessere Finanzplanung ermöglichen sollte, denn mit jeder weiteren Spielrunde bei einer WM sind höhere FIFA-Prämien verbunden, und diese Einnahmen waren ein wichtiger Posten im Etat des DFB. Bauer hatte seine Berechnungen auf Basis der Wettquoten vorgenommen, weil Wettfirmen verlässliche Einschätzungen der sportlichen Stärke der Mannschaften liefern, schließlich ist ihr wirtschaftlicher Erfolg davon abhängig. In der Vorrundengruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica hatte er so eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit auf ein deutsches Ausscheiden errechnet. Die Wahrscheinlichkeit beschreibt, wie oft ein bestimmtes Ergebnis im Vergleich zu allen möglichen Ergebnissen eintreten könnte. Diese Zahl quantifiziert den Zufall und bedeutete hier: Würde man das Turnier zehnmal mit diesen Mannschaften spielen, würde das deutsche Team zweimal ausscheiden.
Nach dem Aus hatte Bauer die Leistung erneut statistisch durchleuchtet. Die deutsche Mannschaft, so viel war auch ohne eine tiefere Analyse unübersehbar gewesen, hatte in ihren drei Gruppenspielen viele gute Torchancen herausgespielt – und vergeben. Auf der anderen Seite hatte sie zwar nicht viele Chancen zugelassen, aber relativ leicht Gegentore kassiert. Als mich Bauer fragte, was ich vermuten würde, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Ausscheidens aufgrund der gemessenen Chancenverteilung gewesen sei, zuckte ich die Achseln. »Zehn Prozent?«, fragte ich. »Nein, 2,7 Prozent.« Ich dachte, nicht richtig zu hören. Wäre die Gruppe mit der gleichen Chancenverteilung hundertmal gespielt worden, wäre das deutsche Team in 97 Fällen ins Achtelfinale eingezogen.
Wahrscheinlichkeit und Zufall bedingen einander, aber der Begriff »Zufall« ist in diesem Zusammenhang problematisch, wie ich im Laufe meiner Recherche feststellen sollte. Er weckte fast immer heftige Aversionen. Dem liegt das Missverständnis zugrunde, dass der Begriff von vielen Menschen ausschließlich im Sinne von »total zufällig« verstanden wird, wie etwa bei einer Lotterie. Und selbstverständlich ist Fußball kein Glücksspiel mit völlig zufälligem Ausgang. Aber wir sprechen eben auch von Zufall, wenn ein Ereignis nicht komplett kontrollierbar und beliebig wiederholbar ist. Und davon gibt es im Fußball viele, wie wir noch sehen werden. In diesem Sinne war die deutsche Nationalmannschaft in Katar also keinesfalls total zufällig ausgeschieden, aber der Zufall hatte bei einem sehr unwahrscheinlichen Ausscheiden eine große Rolle gespielt. Deutschland hatte bei der 1:2-Niederlage gegen Japan ein lange hoch überlegen geführtes Spiel in der Schlussviertelstunde unvermittelt aus der Hand gegeben. Die Niederlage kam nicht nur aus heiterem Himmel, sie war aufgrund der Chancenverteilung auch nicht verdient. Aber in der Stimmung jener Tage, als die deutsche Mannschaft beim Publikum kaum Kredit hatte, wollte das niemand hören. Auch mochte niemand über die bizarre Tabellenkonstellation in der Gruppe sprechen, die sich aus seltsamen Ergebnissen ergab. Spanien hatte sein Auftaktspiel gegen Costa Rica mit 7:0 gewonnen, dann jedoch besiegte Costa Rica im zweiten Spiel jene Japaner, die gerade Deutschland geschlagen hatten. Dafür gewann Japan im dritten Spiel gegen Spanien, das vorher gegen Deutschland unentschieden gespielt hatte. So reichte ein deutscher Sieg im letzten Spiel gegen Costa Rica nicht mehr fürs Weiterkommen.
Ich verabredete mit Bauer ein Interview für das Magazin 11FREUNDE, in dem er seine WM-Analyse erklärte. Die meisten Leser allerdings wollten davon nichts hören. Der Manager eines deutschen Spitzenklubs fuhr mich geradezu an: »Die sollen beim DFB mit dem Quatsch aufhören. Schon den Elfmeter gegen Japan hätte es nicht geben dürfen.« Ich fand den Strafstoß, durch den Deutschland nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung gegangen war, zwar unstrittig, aber dem Manager ging es sowieso nicht um diesen Elfmeter. Wie so vielen Fußballfans war ihm die deutsche Mannschaft einfach auf die Nerven gegangen. Er wollte nichts davon hören, dass sie möglicherweise aufgrund unglücklicher Umstände ausgeschieden war. Ich verstand das, mir war es nicht anders gegangen.
Das Turnier hatte aus deutscher Sicht schon vor Beginn unter einer Wolke aus schlechter Laune gestanden. Deutschland gehörte zu den Ländern, in denen die WM aus politischen Gründen von besonders vielen Menschen abgelehnt wurde. Der DFB trug dem Rechnung, stellte sich aber in der Debatte über den Umgang mit katarischen Menschenrechtsverletzungen ungeschickt an. So ging es am Ende nur noch darum, ob Torwart Manuel Neuer die »One Love«-Kapitänsbinde tragen würde, ein Statement gegen Homophobie, Antisemitismus und Rassismus sowie für Menschen- und Frauenrechte. Die FIFA verbot sie letztlich, beim Mannschaftsbild vor Anpfiff des deutschen Auftaktspiels gegen Japan hielten sich die Spieler aus Protest gegen das Verbot die Hände vor den Mund. Dann verloren sie das Spiel, und viele Berichterstatter stellten zwischen beidem einen Zusammenhang her. Die deutsche Mannschaft hatte verloren, weil sie sich zu viel mit politischen Botschaften beschäftigt hatte. Das Spiel verwandelte sich in eine Story über moralischen Hochmut, der vor dem Fall kommt.
Solche Arten von Geschichten werden im Fußball jede Saison zu Tausenden erzählt. Das liegt daran, dass unser Gehirn sie eifrig produziert, damit sie uns die Welt erklären. In den vergangenen Jahren ist viel dazu geforscht worden, warum für uns Menschen Geschichten so wichtig sind. Die kurze Antwort darauf: Sie funktionieren ähnlich wie Sex oder Schokolade. Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass wie beim Sex oder beim Essen von Süßigkeiten Hormone freigesetzt werden, wenn wir etwas erzählt bekommen: Endorphine, Dopamin fluten den präfrontalen Cortex unseres Gehirns. Besonders gut funktionieren Storys, die erprobte, klassische Narrative aufgreifen. Beispielsweise die vom Hochmut, der vor dem Fall kommt.
Über Bundestrainer Hansi Flick konnte man ebenfalls klassische Geschichten erzählen. Die erste war eine von Aufstieg und Fall, von Ikarus, der der Sonne zu nah gekommen war. Als Assistent von Bundestrainer Jogi Löw hatte Flick jahrelang im Hintergrund agiert, und das blieb auch so, als er nach dem Gewinn der WM 2014 erst Sportdirektor beim DFB wurde und dann beim Bundesligisten TSG Hoffenheim. 2019 kehrte er als Assistent von Niko Kovač beim FC Bayern München auf den Trainingsplatz zurück. Als dieser entlassen wurde, galt Flick als Bayerntrainer zunächst nur als Übergangslösung, doch dann begann sein Flug zur Sonne. Unter ihm gewannen die Bayern 2020 sensationell das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Als Flick ein Jahr später Bundestrainer wurde, galt er als Ideallösung.
Doch in Katar stürzte er nicht nur ab, neun Monate nach dem Turnier konnte man angeblich sogar zusehen, wie das passiert war: Beim Streamingportal Amazon Prime erschien eine Dokumentation über die deutsche Mannschaft in Katar. In zwei Szenen kamen Spieler zu Besprechungen zu spät, ohne von Flick sanktioniert zu werden. Das legte nahe, dass er keine Autorität hatte. Am meisten diskutiert wurde aber eine Szene, in der Flick seiner Mannschaft ein Motivationsvideo zeigte, dessen Stars Graugänse waren. Ihr Formationsflug sollte zeigen, dass man gemeinsam viel mehr bewirken kann. Flick vermittelte das nicht gerade mitreißend, die Spieler wirkten desinteressiert. Die Szene war peinlich und sorgte für viel Spott. Flick, eben noch Supertrainer, schien entzaubert. Es war – noch so eine Story – wie im Märchen »Des Kaisers neue Kleider«. Der Trainer war nackt.
Fußball liefert idealen Stoff für Geschichten. Gute Geschichten leben davon, dass wir uns mit den Helden identifizieren, mit denen wir gewinnen oder verlieren. Beim Fußball muss diese Identifikation nicht einmal von einem Erzähler kunstvoll hergestellt werden, sie ist schon da. Gewinner wie Verlierer produziert der Fußball im Überfluss. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die 90 Minuten eines Fußballspiels der klassischen Spielfilmlänge entsprechen. Doch nicht nur einzelne Spiele sind ein tolles Erzählformat, jede Saison entspricht einer Serienstaffel und liefert eine Menge aufregender Wendungen, im Englischen benutzt man für beides den Begriff »Season«. Die noch populäreren Kurzformate sind die Welt- oder Europameisterschaften, bei denen eine abgeschlossene Staffel nur kompakte vier Wochen dauert.
Doch nicht jede Geschichte ist gleich gut, das gilt auch im Fußball. Die Story – wenn es überhaupt eine solche war – von der 2,7-prozentigen Wahrscheinlichkeit etwa war miserabel. Denn wer war schuld, wenn nicht Flick, der nackte Ikarus, oder die DFB-Oberen, die als Möchtegern-Weltpolitiker versagt hatten? Aber war Pascal Bauers Berechnung eines sehr unwahrscheinlichen und damit unglücklichen Scheiterns deswegen falsch? Diese Frage wird uns durch dieses Buch begleiten und der damit verbundene Konflikt zwischen Story und Analyse.
Wie ich Probabilist wurde
Ende 2024 reiste ich nach London, um sicherzustellen, dass ich mich nicht verirrt hatte. Monatelang hatte ich mit Schussstatistiken von Robert Lewandowski, Daten aus der sensationellen Meistersaison von Leicester City 2015/16 und dem deutschen Scheitern in Katar gerungen. Ich hatte mich in mathematische Wahrscheinlichkeitsmodelle ein- und an philosophischen Konzepten des Zufalls abgearbeitet. Ich hatte begonnen, eine Schattengeschichte des Fußballs zu schreiben und mit Fußballtrainern, Managern und Sportwissenschaftlern, mit Datenexperten, Spielanalytikern und einem befreundeten Philosophen zu sprechen. Ich fühlte mich, als ob ich ein Opfer des Kaninchenbau-Syndroms geworden wäre, als wäre ich immer tiefer in den Tunneln der Wahrscheinlichkeit verschwunden. So langsam hatte ich die Sorge, dass ich nicht mehr herausfinden würde oder dass ich mich komplett verrannt hatte.
Nach London fuhr ich, weil ich dort 16 Jahre zuvor einen blassen, nervös wirkenden Mann Anfang 40 kennengelernt hatte, der, auch wenn das etwas pathetisch klingt, mein Leben verändert hatte. Allerdings passierte das nicht schlagartig, sondern schleichend. In der Rückschau kommt es mir so vor, als ob bei der ersten Begegnung mit ihm eine Saat gelegt worden wäre, die im Laufe der Jahre aufgegangen war.
Was da heranwuchs, war der Zweifel.
Ich schrieb 2009 über diesen Engländer in meinem Buch »Die Fußball-Matrix«, in dem es um diverse Formen von Optimierung im Fußball geht. Er hatte mich darum gebeten, seinen Namen nicht zu nennen, ich gab ihm das Pseudonym Jim Towers. Der radikale Gedanke, mit dem Towers mich konfrontiert hatte, bestand darin, zwischen der Leistung von Fußballmannschaften und dem Endergebnis ihrer Spiele eine Trennlinie zu ziehen. »Ergebnisse interessieren mich nicht«, sagte er mir damals. Für die Bewertung einer Leistung war es ihm egal, ob das Spiel 2:0, 0:2 oder sonst wie ausgegangen war. Ihn interessierte, welche Mannschaft besser war, und das bemaß er vor allem daran, welches Team ein Chancenplus hatte. Das Resultat zu ignorieren, erschien mir zunächst komplett unverständlich, weil im Fußball die Ergebnisse das Entscheidende sind. Sie lassen Fans jubeln oder fluchen, machen Spieler und Trainer reich oder nicht ganz so reich; sie bestimmen die Diskussionen im unablässig brummenden Bienenstock der Fußballmeinungen. Wie kann man behaupten, dass einen Ergebnisse nicht interessieren?
Aber bei Towers war das der Fall.
Ich wusste natürlich, dass ein gutes Ergebnis nicht immer die Folge einer guten Leistung ist. Jeder Fußballfan weiß das und alle, die jemals Fußball gespielt haben. Ganz selbstverständlich sprechen wir von glücklichen Punktgewinnen oder unglücklichen Niederlagen. Aber letztlich nehmen wir das nicht ernst. Die Leistung einer Mannschaft und das Ergebnis getrennt zu betrachten, passiert nicht wirklich. Es würde ja bedeuten: Das Ergebnis war gut, aber die Leistung war schlecht. Oder, was fast noch schwerer fällt: Man würde eine Mannschaft für ein Spiel loben, das sie verloren hat. Vielleicht sogar ein Team, das uns so auf die Nerven gegangen ist wie die deutsche Mannschaft bei der WM in Katar.
Mich zog bei Towers besonders in den Bann, dass er kein in luftigen Höhen agierender Theoretiker des Fußballs war, dessen Überlegungen unter dem Verdacht hätten stehen können, zwar äußerst interessant, aber abseitig zu sein. Ganz im Gegenteil: Er verdiente seinen Lebensunterhalt damit, sich den Wahrscheinlichkeiten des Fußballs mathematisch zu nähern. Ja, er wurde sogar sehr reich damit. Denn Towers betrieb im Norden Londons eine Art Fabrik für Fußballwetten. Junge Menschen aus aller Welt saßen dort vor Bildschirmen, schauten Spiele aus vielen Ligen an und dokumentierten die Chancenverteilung von Hunderten Partien. Eine Großchance hieß »Uuuuh« nach dem Geräusch, das Fans im Stadion machen, wenn ein Team eine solche vergibt. Dieses »Uuuuh« gehörte zu einem System abgestufter Torchancen, mit denen sich die Betrachter an den Monitoren ein Bild von der sportlichen Gewichtung in den Spielen verschafften, die sie sich anschauten. Diese Informationen bildeten dann die Grundlage dafür, dass Towers’ Unternehmen jede Woche auf Hunderte Spiele in der ganzen Welt wettete. Natürlich ging bei Weitem nicht jede Wette auf, aber das Modell war gut genug, dass Towers’ Unternehmen sehr viel Geld verdiente, viele Millionen.
Dass professionelle Fußballwetter eine probabilistische, also eine auf Wahrscheinlichkeiten beruhende Betrachtung des Fußballs an den Tag legen, leuchtet ein. Sie wollen sich ein möglichst präzises Bild davon machen, wie wahrscheinlich welcher Ausgang des nächsten Spiels ist. Auch die Buchmacher tun das, um passende Quoten anzubieten. In jedem Fall geht es um viel Geld, weshalb Towers und andere, die systematisch auf Fußballspiele wetten, ihr Geschäft kühl betreiben. Sie sind dann erfolgreich, wenn sie die besseren Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen, weshalb Towers nicht nur eigene Daten erhob, sondern promovierte Mathematiker damit rechnen ließ.
Jim Towers heißt in Wirklichkeit Matthew Benham und ist heute vielen im Fußball bekannt. 2011 kaufte er den Klub, dessen Anhänger er schon als Kind war, den FC Brentford. Der war damals noch Drittligist, inzwischen spielt er in der Premier League, und Benham hat ihm ein feines Stadion im Südosten der Stadt gebaut. Regelmäßig belegt Brentford Tabellenplätze, die viel besser sind, als einer der kleinsten Spieleretats der Liga nahelegen würde. Außerdem gehörte Benham bis 2023 der FC Midtjylland, der dreimal die dänische Meisterschaft gewann, nachdem er Mehrheitseigner geworden war.
In »Matchplan« schrieb ich 2018 erneut über ihn. Es ging in diesem Buch um Spieldaten und wie man das Geschehen auf dem Rasen durch sie besser verstehen und genauer analysieren kann. Doch im Nachhinein kommt es mir vor, als hätte ich, als ich es schrieb, übersehen, dass die Datafizierung des Fußballs die Sicht auf das Spiel grundsätzlich verändert hat. Der probabilistische Charakter des Spiels ist nicht mehr zu übersehen, weil er in Zahlen erfasst werden kann.
Benham und ich trafen uns im Tagungsraum einer noblen Wohnanlage in Marylebone, wo ich erst einmal etwas ganz Grundsätzliches klären wollte: Wie sehr sollte man sich überhaupt mit dem Zufall im Fußball beschäftigen? Er antwortete nicht direkt, sondern erzählte mir vom Besuch bei einem Fernsehsender, wo er sich vor nicht langer Zeit mit dem Sportchef über diese Frage unterhalten hatte. Benham sagte: »Wenn eine Mannschaft gewonnen hat, müssen die Experten sagen, dass deren Taktik perfekt war oder diese es mehr gewollt hatte. Ein Teil von mir denkt, dass das Blödsinn ist. Aber ich verstehe, dass die Zuschauer sich abwenden würden, wenn die Experten nur über Zufälligkeiten reden würden. Der Sportchef sagte: ›Sehen Sie, es ist nur Unterhaltung, und die Leute wollen ihre Geschichten.‹«
Doch wie sah er das als Besitzer eines Fußballklubs in der größten Fußball-Liga der Welt? Benham schaute mich an, als ob ich etwas begriffsstutzig wäre. Ich glaubte einen Hauch von Enttäuschung darüber zu spüren, dass ich das immer noch nicht richtig kapiert hatte. Dann sagte er: »Die Leute, die im Fußball arbeiten, sollten die ganze Zeit nur an den Zufall denken.«
Die Vermessung des Zufalls
Als die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zu Ende ging, schrieb der amerikanische Wissenschaftsjournalist John Tierney in der New York Times eine Kolumne mit dem Titel: »Fußball, ein wunderbares Spiel des Zufalls«. Sie begann so: »Ich habe mir die Fußballweltmeisterschaft mit einigen frustrierten amerikanischen Sozialwissenschaftlern angeschaut. Wenn sie sehen, wie eine unterlegene Mannschaft durch einen wundersamen Abpraller oder einen unverdienten Elfmeter triumphiert, springen sie nicht auf und schreien ›Tooooorrr!‹. Sie schütteln nur den Kopf und murmeln: ›Messfehler‹«.
Fußball ist nicht der einzige Sport, in dem es zu solchen »Messfehlern« kommt. Es gibt sie auch in Sportarten, bei denen die amerikanischen Sozialwissenschaftler vielleicht weniger abschätzig die Augen rollen würden. Auch Basketballteams beklagen Tage, an denen Rebounds in unerklärlicher Häufung beim Gegner landen, und manchmal entscheidet sich ein Spiel mit dem letzten Wurf, wenn der Ball in den Korb fällt oder vom Ring zurückspringt. Selbst in der amerikanischsten Sportart, American Football, werden Debatten um »Messfehler« geführt. Der ESPN-Journalist Bill Barnwell erörterte im Jahr 2022, welche Teams in der NFL gerade Glück hatten und welche nicht. Dazu schrieb er: »In NFL-Kreisen kann ›Glück‹ ein Schimpfwort sein. Spieler und Trainer widmen ihr Leben dem Ziel, jede Woche ein Spiel zu gewinnen, und so möchte niemand glauben, dass diese Spiele durch Elemente entschieden werden könnten, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen.«
Im Fußball ist das nicht anders, obwohl das Thema gut erforscht ist. In einer Forschungsarbeit der Deutschen Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2021 heißt es: »Aus theoretischer Sicht kann argumentiert werden, dass Tore im Fußball besonders anfällig für zufällige Einflüsse sind. Mit dem Fuß zu spielen, macht die Ballkontrolle wesentlich komplexer als bei Sportarten, in denen der Ball in der Hand gehalten wird, wie im Handball oder Basketball.« Ebenfalls eine Rolle, so heißt es weiter, spiele der Torhüter, den es weder im Basketball, Volleyball noch American Football gibt. Zudem sei im Fußball die Zahl der Spieler (elf) höher als in Handball (sieben), Eishockey (sechs) oder Basketball (fünf) und das Spielfeld deutlich größer. »Daher ist es einleuchtend anzunehmen, dass ein nennenswerter Anteil der Tore von glücklich verlaufenden ungeplanten oder unkontrollierbaren Umständen begünstigt wird.«
Um diese Hypothese in der Praxis zu überprüfen, untersuchten die Sportwissenschaftler alle 7.263 Tore, die in den 2.660 Spielen der englischen Premier League von der Saison 2012/13 bis zur Spielzeit 2018/19 gefallen waren. Das Ergebnis war deutlich: Bei 46 Prozent aller Treffer spielte mindestens eine von sechs von den Forschern definierten Zufallsgrößen mit. Bei fast jedem zweiten Treffer also. Angesichts der kleinen Zahl von Toren, die im Fußball geschossen werden, schlug das massiv durch. In der Saison 2023/24 beispielsweise fielen in der Bundesliga durchschnittlich 3,22 Tore pro Spiel, in der Premier League waren es 3,28, insofern blieb kaum ein Resultat von Treffern mit Zufallselementen unberührt.
Allerdings tat ich mich mit einigen Teilen der Erhebung schwer. Daher fuhr ich zu Prof. Daniel Memmert nach Köln, der bei dem Projekt federführend gewesen war. Memmert berät schon lange Profiklubs und Trainer: die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen, die Red-Bull-Klubs oder Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick. Wir trafen uns im Gebäude II der Deutschen Sporthochschule, wo er ein schönes Eckbüro hat. Memmert erklärte mir, worum es bei der Untersuchung im Kern ging: »Menschen scheren sich wenig um das Rauschen. Dabei gibt es in vielen Sportdisziplinen ein Grundrauschen, das die Leute als kleinen Fehler abtun, weil sie darüber nichts wissen wollen.«
Der Begriff Rauschen bzw. das englische Noise stammen aus der Statistik und bilden den Gegensatz zum Begriff Signal. Mit Signal bezeichnet man eine aussagekräftige Information, das Rauschen hingegen ist eine zufällige, unerwünschte Variation oder Fluktuation, die das Signal stört. Man kann sich das so vorstellen: Man sucht an einem analogen Radio einen Sender, und beim Drehen des Senderknopfes hört man erst Rauschen und dann langsam immer deutlicher das Signal einer Radiostation. In der Statistik erkennt man ein rauschfreies Ergebnis daran, dass der zugrunde liegende Prozess identisch wiederholt werden kann. Beim Torschuss jedoch ist genau das nicht der Fall. Selbst die besten Spieler der Welt sind nicht in der Lage, drei- oder viermal, geschweige denn zehn- oder hundertmal den exakt gleichen Schuss abzugeben. Deshalb ist der Schuss, der im Tor landet, kein klares Signal, sondern ein verrauschtes. Der Zufall spielt dabei eine Rolle. Es ist nicht die Hauptrolle, aber auch keine, die wir übersehen dürfen.
Memmert erzählte mir, dass er bei Vorträgen sein Publikum oft zunächst einmal fragt, welches Ergebnis die Zuhörer vermuten, hier also: Bei wie vielen Toren spielt der Zufall eine Rolle? »Als ich das vor zehn Jahren gefragt habe, lagen die Vermutungen bei zehn bis 15 Prozent, heute ist es deutlich höher«, sagte Memmert. Dass aber fast jedes zweite Tor von zufälligen Ereignissen beeinflusst ist, verblüfft noch immer. Doch war tatsächlich zufällig, was in Memmerts Studie als zufällig bezeichnet wurde, fragte ich mich.
Die Kölner Forschergruppe griff auf sechs Variablen zurück, die bereits 2018 im Rahmen einer ähnlichen Forschungsarbeit an der TU München definiert worden waren und den wissenschaftlichen Prüfungsprozess überstanden hatten. Mit einigen hatte ich keine Probleme. Etwa Tore, denen abgeprallte Bälle vorausgingen (sie führten zu 7,7 Prozent der Treffer), abgefälschte Bälle (6,5 Prozent) sowie solche, die vorher an Latte oder Pfosten gingen (4,9 Prozent). Das gilt auch für Tore, bei denen der Torwart die Flugbahn zu mehr als 45 Grad abfälscht (3,5 Prozent). Anders war das bei der prozentual am stärksten vertretenen Variable, den Treffern, »bei denen ein Spieler der verteidigenden Mannschaft maßgeblich an der Entstehung beteiligt war«. Auf 22,9 Prozent aller Tore traf zu, dass die verteidigende Mannschaft unfreiwillig die Vorlage für einen Treffer geliefert oder diese das angreifende Team unmittelbar vor dem Assist an den Ball gebracht hatte. Eigentore wurden ebenfalls in dieser Kategorie erfasst. Aber passieren solche Fehler nicht auch deshalb, weil es einer Mannschaft gelingt, den Gegner so zu stressen, dass er deswegen patzt? Memmert stellte das nicht in Abrede, sagte aber: »Die Begründung dafür ist: weil du die Reaktion des Gegners nicht trainieren kannst.«
Das passt insofern in die Logik von Signal und Rauschen, als der unter Stress gemachte Fehler, der zur ungewollten Vorlage wird, nicht reproduziert werden kann. Dennoch überzeugte mich das nicht ganz, denn beispielsweise die Spielweise der von Pep Guardiola trainierten Mannschaften ist stets auch darauf angelegt, gegnerische Fehler zu provozieren. Ihre langen Ballstafetten zermürben Gegner, weil die ständig hinterherlaufen müssen. Dadurch werden Köpfe und Beine müde, die Spieler machen Fehler, die zu Gegentoren führen. Auch den zweitgrößten Faktor in der Kölner Studie fand ich problematisch. 10,9 Prozent aller Tore fielen nach Schüssen von außerhalb des Strafraums sowie des Teilkreises vor dem Strafraum. Memmert sagte, dass selbst für die besten Fußballer der Welt Treffer aus dieser Distanz nicht beliebig reproduzierbar sind. Aber machte das ein Fernschusstor zu einem Zufallsereignis? Selbstverständlich gehören epochales Talent und jahrelanges Training dazu, solch phantastische Fernschusstore zu schießen, wie sie Lamine Yamal in Serie gelingen. Aber sie landen eben auch nicht immer im gegnerischen Tor.
Würde man die beiden Zufallsvariablen »Vorlagen durch die Gegner« bzw. »Fernschüsse« herausnehmen, hätte nicht mehr jedes zweite Tor ein Zufallselement, sondern nur noch jedes fünfte. Allerdings würde der Anteil sofort wieder hochschnellen, nähme man die gesamte Entstehung der Tore in den Blick. Denn bei den Assists oder schon zu Beginn eines Angriffs, bei der Eroberung des Balles, spielt der Zufall ebenfalls eine Rolle. Tore, die von Beginn eines Angriffszuges bis zum Abschluss rauschfrei sind, sind Raritäten.
Memmert und seine Kollegen hatten beim Verfassen ihrer auf Englisch veröffentlichten Studie lange darüber diskutiert, wie sie das Phänomen nennen sollten, das die amerikanischen Sozialwissenschaftler als »Messfehler« abgetan hatten. Memmert sagte: »Im Deutschen würden wir von Zufall sprechen, wir reden von Zufallstoren. Im Englischen gibt es Luck oder Chance, aber wir fanden Randomness am passendsten.« Randomness, also Zufälligkeit, ist ein Begriff, der vor allem von Statistikern und Mathematikern benutzt wird. Chance hat einen etwas weiteren Bedeutungshorizont, und Luck bedeutet neben Glück auch Schicksal. Letztlich sind das viel offenere Bedeutungsräume als beim deutschen Wort Zufall, das oft als »Kann man nichts machen« missverstanden wird. Die Studie trug den Titel »The influence of randomness on goals in football decreases over time. An empirical analysis of randomness involved in goal scoring in the English Premier League«. (Dt.: »Der Einfluss des Zufalls auf Tore im Fußball nimmt mit der Zeit ab. Eine empirische Analyse der Rolle des Zufalls beim Erzielen von Toren in der englischen Premier League.«) Warum der Zufall abnimmt, wird später noch ein Thema. Doch zunächst einmal stellt sich die Frage, was für Folgen es hat, dass der Zufall bei der Torproduktion eine so große Rolle spielt.
Die tragische Magie des Fernschusses
In den 1990er-Jahren konnte man im Dreisamstadion des SC Freiburg einen der seltsamsten Sprechchöre hören, der jemals in einem deutschen Fußballstadion angestimmt wurde. Die Zuschauer riefen: »Schießen, Freiburg, schießen!« Niemand hätte ein grummelnd forderndes »Kämpfen, Freiburg, kämpfen!« erstaunt, wie es damals anderswo oft von Fans zu hören war, die vermeintlich fehlenden Einsatz ihrer Spieler bemängelten. Dass eine frustrierte Zuschauerschaft von ihren Spielern forderte, verdammt noch mal aufs Tor zu schießen, war hingegen einzigartig.
Trainer in Freiburg war Volker Finke und damals bereits eine Legende, weil er den vormaligen Provinzklub nicht nur in die Bundesliga geführt, sondern dort etabliert hatte. Finke war schon durch seinen beruflichen Hintergrund ein ungewöhnlicher Trainer, er hatte ursprünglich als Gymnasiallehrer Sport und Geschichte unterrichtet. Vor der Jahrtausendwende, als der deutsche Fußball bei taktischen Entwicklungen international den Anschluss verloren hatte, wurde Finke zu einem seiner Modernisierer. Als einer der ersten Trainer in Deutschland schaffte er die damals eigentlich sakrosankte Position des Liberos ab, verabschiedete sich von der Manndeckung und flexibilisierte das Angriffsspiel. Ein weiteres Opfer seiner Modernisierungen waren die Fernschüsse.
Finke, Jahrgang 1948, lebt noch immer in Freiburg, wo ich ihn nahe seiner Wohnung im Stadtteil Wiehre traf. »Es ist so, dass mich das ziemlich genervt hat, wenn einer aus 25 Metern aufs Tor schoss, es aber viel bessere Möglichkeiten gegeben hätte, durch Zusammenspiel zum Torerfolg zu kommen«, erzählte Finke. Dann schob er fast schon entschuldigend nach: »Wobei dieses Draufschießen eine Geschichte ist, die tatsächlich die Faszination Fußball ausmacht.« Das stimmt, denn ob Spieler oder Fans, eigentlich lieben es alle, wenn der Ball aus der Ferne abgezogen in die Maschen fliegt. In England ruft das ganze Stadion »Shoot!«, wenn die Chance auf einen satten Fernschuss besteht. Wie sehr auch das deutsche Publikum Fernschüsse liebt, zeigt ein Blick auf jene Treffer, die seit 1971 von den Zuschauern der ARD-Sportschau zum »Tor des Monats« gewählt wurden. In rund zwei Dritteln der Fälle gewinnen Fernschusstore. Es geht ein ewiger Zauber von ihnen aus, das Spiel ist in solchen Momenten ganz bei sich.
Die Sache hatte aus Finkes Sicht nur einen Haken: »Meiner Wahrnehmung nach hatte von unzählig vielen Schüssen von außerhalb des Strafraums nur eine winzige Prozentzahl zum Erfolg geführt. Von daher lag die Vermutung nahe: Die Anzahl der erzielten Tore im Verhältnis zu den gemachten Versuchen ist einfach zu gering.« Das stimmt, denn im Schnitt landen nur vier Prozent der Schüsse von außerhalb des Strafraums im Tor. Also vier von 100, die anderen 96 fliegen irgendwohin. Damals gab es allerdings noch keine Datenfirmen, die solche Werte erfassten. »Deswegen konnte ich den Spielern nur die Empfehlung geben: bitte, wenn es nicht sein muss, noch mal gucken«, erzählte er. Die Bitte des Trainers war in Wirklichkeit eher eine Vorschrift, ich kann mich jedenfalls daran erinnern, wie oft ich mich wunderte, wenn Freiburger Spieler in Situationen nicht schossen, in denen man es zu jener Zeit erwartet hätte. Seine Weitschuss-Doktrin hatte sogar einen Mannschaftsarzt den Job gekostet. Der Mann war neu dabei gewesen, als der SC Freiburg wie immer zur Saisonvorbereitung auf die Nordseeinsel Langeoog fuhr – und er begann bald zu maulen. Der Mediziner beklagte im Kreis der Mannschaft wiederholt laut und deutlich, dass die Spieler nicht aus der Distanz schossen. Selbst nachdem Finke ihm das erklärt hatte, blieb er unbeeindruckt, und so trennten sich die Wege bald.
Finke verzichtete zumeist auch auf einen klassischen Mittelstürmer. Er wollte einfach keinen Typ im Team haben, der nichts anderes machte, als am Strafraum auf Torgelegenheiten zu lauern. Mit seiner im Bundesligavergleich »kleinen Mannschaft« ohne Stars glaubte er sich einen solchen Spezialisten nicht leisten zu können. Finke prägte in dem Zusammenhang den von ihm abschätzig gemeinten Begriff des »Heldenfußballs«. Statt einzelner Helden sollte ein funktionierendes Team auf dem Platz stehen, das seinem taktischen Konzept folgte. In dieser Logik lag eben auch, die heroischen Momente von satten Fernschüssen drastisch zu reduzieren. Wobei ein Treffer seines malischen Stürmers Soumaïla Coulibaly im Februar 2005 trotzdem zum »Tor des Monats« gewählt wurde – er hatte aus 35 Metern getroffen.
Auf eine erste wissenschaftliche Bestätigung seiner Annahmen über Fernschüsse hätte Volker Finke bereits im Jahr 1997 zurückgreifen können. Damals veröffentlichten Richard Pollard und Charles Reep den Aufsatz »Measuring the effectiveness of playing strategies at soccer« (dt.: Messung der Effektivität von Spielstrategien im Fußball). Doch selbst in England dürften ihn nur wenige Trainer wahrgenommen haben, denn er erschien im Journal of the Royal Statistical Society.