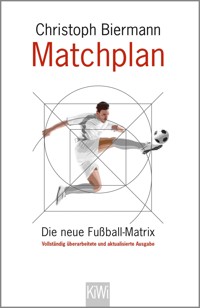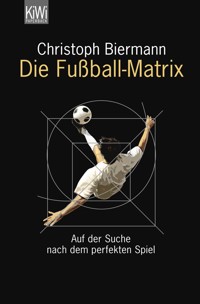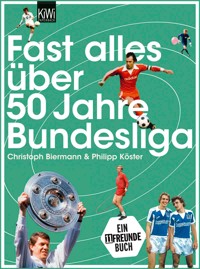9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Fantasie-Ablösesummen und -Gehälter für Superstars. Vereine in den Händen von Oligarchen, Scheichs und Hedgefonds. Gebührenexplosion bei Bezahlsendern. Die WM in Katar … Christoph Biermann legt die Abgründe und Widersprüche einer Blütezeit offen, in der sich der Fußball inzwischen komplett verfangen hat. Und er versucht, Wege aus dem Dilemma zu zeigen. Im Jahr 1992 ändert sich im Fußball alles: Die Champions League wird gegründet. In Deutschland startet mit »ran« das neue Zeitalter des Fernsehfußballs. In England entsteht die Premier League, die heute global erfolgreichste Fußballliga. Es beginnt das Goldene Zeitalter des modernen Fußballs. In neuen Stadien spielen Super-Teams mit Super-Spielern unter der Anleitung visionärer Super-Trainer für ein global wachsendes Publikum. Doch die Erfolgsgeschichte ist von Beginn an durchsetzt von großem Unbehagen und Entfremdung. Alles wird zur Ware: Vereine und Ligen, Spieler und selbst die Emotionen der Fans. Derweil erodiert der sportliche Wettbewerb und bringt die immer gleichen Seriensieger hervor. Nach drei Jahrzehnten gipfelt die Entwicklung 2021 im Versuch, eine exklusive »Super League« zu gründen. Der Krieg in der Ukraine offenbart die geopolitischen Verstrickungen des Fußballs, und die Weltmeisterschaft im Winter 2022 in Katar offenbart den moralischen Ausverkauf des Weltfußballverbandes FIFA.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christoph Biermann
Um jeden Preis
Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christoph Biermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christoph Biermann
Christoph Biermann, geboren 1960 in Krefeld, lebt in Berlin und arbeitete für die taz, Stern, Die Zeit und war Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und beim SPIEGEL. Seit 2010 beim Fußballmagazin 11Freunde, inzwischen als Reporter. Biermann gehört seit Jahren zu den profiliertesten Fußballjournalisten Deutschlands und hat zahlreiche Bücher zum Thema Fußball veröffentlicht. »Die Fußball-Matrix« und »Wenn wir vom Fußball träumen« wurden jeweils zum »Fußballbuch des Jahres« gewählt. Zuletzt erschien von ihm »Wir werden ewig leben« (KiWi 1813), 2020.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Grenzenlose Ablösesummen und Spielergehälter, Vereine in den Händen von Oligarchen, Scheichs und Hedgefonds. Massenhafte Spielertransfers nach Saudi-Arabien und Katar. Gebührenexplosion bei Bezahlsendern. Totalkommerzialisierung und Fan-Widerstand.
Im Jahr 1992 ändert sich im Fußball alles: Die Champions League wird gegründet. In Deutschland startet mit »ran« das neue Zeitalter des Fernsehfußballs. In England entsteht die Premier League, die heute global erfolgreichste Fußballliga. Es beginnt das Goldene Zeitalter des modernen Fußballs.
In neuen Stadien spielen Superteams mit Superspielern unter der Anleitung visionärer Supertrainer für ein global wachsendes Publikum. Doch die Erfolgsgeschichte ist von Beginn an durchsetzt von großem Unbehagen und Entfremdung. Alles wird zur Ware: Vereine und Ligen, Spieler und selbst die Emotionen der Fans. Derweil erodiert der sportliche Wettbewerb und bringt die immer gleichen Seriensieger hervor. Die Weltmeisterschaft im Winter 2022 in Katar offenbarte den moralischen Ausverkauf des Weltfußballverbandes FIFA.
Christoph Biermann legt die Abgründe und Widersprüche offen, in der sich der Fußball inzwischen komplett verfangen hat. Und er versucht, Wege aus dem Dilemma zu zeigen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2022, 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Mario Wagner/2agenten
ISBN978-3-462-31045-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Einleitung
Teil 1 Big Bang
Kapitel 1 Der Weg in die höchsten Kreise
Kapitel 2 Normale Leute
Kapitel 3 Totes Geld zum Leben erwecken
Kapitel 4 Ein ganz neues Ballspiel
Kapitel 5 Das Ende der harten Männer
Teil 2 Alles super!
Kapitel 6 Sie sind die Besten – Superspieler
Kapitel 7 Im Licht der Optimierung – Superfußball
Kapitel 8 Fußball als Kunstrichtung – Supertrainer
Kapitel 9 Goldene Jugend – Supertalente
Kapitel 10 Welterfolg – Superinternationalität
Teil 3 Richtiges Leben im falschen
Kapitel 11 Wo die Liebe hinfällt
Kapitel 12 Sitzen ist fürn Arsch
Kapitel 13 Maximale Liebe gegen den modernen Fußball
Kapitel 14 Legacy Fans
Teil 4 Was ist eigentlich die Fußballindustrie?
Kapitel 15 Eine neue Branche
Kapitel 16 Die Macht der Spieler
Kapitel 17 Rattenrennen
Kapitel 18 Die Ohnmacht der Gierigen
Kapitel 19 Kampf dem Zufall
Kapitel 20 In der Blase
Kapitel 21 Die Vernunft der Unvernunft
Kapitel 22 Deutscher Sonderweg – 50+1
Teil 5 Der gescheiterte Staat des Fußballs
Kapitel 23 Kleptofußball
Kapitel 24 Beschütze mich vor dem, was ich will
Kapitel 25 Machtübernahme
Kapitel 26 Wem gehört die Weltmeisterschaft?
Teil 6 Postmoderner Fußball
Kapitel 27 Wertepolitik
Kapitel 28 Rote Linien
Kapitel 29 Heiße Emotionen
Kapitel 30 Gefühlsansteckung
Nachwort
Zeittafel
Lesen und weiterlesen
Danke
»I don’t know what they want from me, it’s like the more money we come across, the more problems we see.«
The Notorious B.I.G., »Mo Money Mo Problems«
Einleitung
Am 18. April 2021, einem Sonntag, ging die Geschichte des Fußballs zu Ende. Nachmittags war es zunächst nur ein Gerücht, doch im Laufe des Abends bestätigten immer mehr Vereine, dass sie demnächst in einer neuen Liga spielen würden, die sie Super League nannten. Dazu gehörten die größten und legendärsten Klubs des europäischen Fußballs: Real Madrid, der FC Barcelona und Atlético Madrid, Juventus Turin und die beiden Mailänder Klubs AC und Inter sowie die sechs englischen Vereine FC Liverpool, Manchester City und United, Chelsea, Arsenal und Tottenham Hotspur. Sie kündigten an, bereits in der folgenden Saison nicht mehr in der Champions League anzutreten und noch fünf weitere Klubs in ihre neue Liga einladen zu wollen. Die US-amerikanische Bank JPMorgan Chase würde das Projekt mit 3,5 Milliarden US-Dollar finanzieren. Die Idee war ungeheuerlich, denn in diese Super League sollte man nicht durch sportliche Leistung aufgenommen werden, sondern durch die Strahlkraft der Namen. Klubs, die nicht »super« genug waren, sollten draußen bleiben. Es fühlte sich an, als hätte der Fußball damit einen Endpunkt erreicht – nicht zum ersten Mal.
Am 2. Dezember 2010 hatte Fifa-Präsident Joseph S. Blatter einen Briefumschlag geöffnet, eine Karte herausgezogen und laut gesagt, was draufstand: »Qatar«. Die Weltmeisterschaft 2022 war in ein winziges Emirat am Persischen Golf vergeben worden, das noch nie an einer WM-Endrunde teilgenommen hatte. Der reiche Erdgas-Staat hatte sich die WM de facto gekauft, das wurde im Laufe der folgenden Jahre klar. Und weil es im Sommer in Katar zu heiß gewesen wäre, musste das Turnier erstmals von der Mitte des Jahres an sein Ende verlegt werden. In der Welt des Fußball entsprachen die WM-Vergabe nach Katar und die Gründung der Super League der Ungeheuerlichkeit, dass in den USA tatsächlich Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde oder Großbritannien den Brexit vollzog. Sie waren für den Fußball ähnlich einschneidend und bestärkten den Eindruck, dass etwas elementar nicht mehr stimmte.
Im Fall der Super League führte dieses Gefühl zu einem gewaltigen Proteststurm der Anhänger jener Klubs, die dort spielen wollten. Fans von Chelsea demonstrierten am nächsten Abend vor dem Stadion, und als ihre Mannschaft zum Heimspiel vorfuhr, stoppten sie den Mannschaftsbus und verlangten eine Erklärung. Anhänger von Arsenal und Tottenham belagerten die Geschäftsstellen ihrer Klubs, und an der Anfield Road in Liverpool wurden an den Stadionzäunen Protestplakate aufgehängt. Der britische Premierminister Boris Johnson verdammte die Super League, weil Vereine »aus ihren Heimatstädten herausgelöst und in internationale Marken und Waren verwandelt werden können, die nur auf dem Planeten zirkulieren, angetrieben von den Milliarden der Banken, ohne Rücksicht auf die Fans und diejenigen, die sie ihr ganzes Leben lang geliebt haben«. Außerdem kündigte er eine »legislative Bombe« gegen das Vorhaben an. Der europäische Fußballverband Uefa drohte mit maximaler Gegenwehr, während der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain mitteilten, an der neuen Liga nicht teilnehmen zu wollen. Unter diesem Druck zog sich ein Klub nach dem anderen wieder aus der Super League zurück, nur die Bosse von Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin verteidigten die Idee noch entschlossen weiter. Dennoch: 48 Stunden nachdem die Super League das Licht der Welt erblickt hatte, war sie auch schon wieder tot.
»Anders als die Naturgesetze, die in sich stimmig sind, ist jede menschliche Ordnung voller Widersprüche«, schreibt der Historiker Yuval Noah Harari in seinem Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. Das gilt auch für den Fußball, und gerade im Konflikt um die Super League wurden viele Widersprüche offensichtlich. Er war ein gutes Beispiel dafür, wie sich sportliche, wirtschaftliche, kulturelle und politische Fragen unentwirrbar ineinander verknotet haben. Auf der Suche nach einem funktionierenden Geschäftsmodell wurden sportliche Prinzipien aufgegeben und jene kulturellen Verbindungen gekappt, die den Fußball erst groß gemacht hatten. Es ging einiges durcheinander, wie eigentlich dauernd, seit das Zeitalter des modernen Fußballs begonnen hat.
Es gab in der Geschichte des Fußballs, nachdem 1863 erstmals verbindliche Regeln notiert wurden, verschiedene Phasen und unterschiedliche Zeitalter. Die aktuelle Ära kann man die des modernen Fußballs nennen. Sie begann als Reaktion auf eine tiefgehende Krise, und in ihr wurde der Fußball so weit modernisiert, dass er im Vergleich zur vorangegangenen Zeit kaum noch wiederzuerkennen war. Die Wende war das Jahr 1992. Damals fand zeitgleich eine Reihe von Veränderungen statt, die zu entscheidenden Treibern der Entwicklung wurden. Zum ersten Mal wurde die Champions League ausgespielt, die sich zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Sportwettbewerbe der Welt entwickeln sollte. In England löste die Premier League die alte First Division ab und wurde im Laufe der Jahre zur global führenden nationalen Liga. Den Erfolg von Champions League und Premier League möglich machte ein neuer TV-Markt, dessen fast durchgehender Boom für ständig steigende Erlöse sorgte. In Deutschland übernahm 1992 der Privatsender SAT.1 mit der Sendung ran die Berichterstattung und proklamierte: »Die alte Bundesliga ist tot.« Auch das Spiel selbst veränderte sich durch eine Regeländerung massiv: Die Einführung der Rückpassregel trug 1992 dazu bei, das Tempo des Spiels deutlich zu erhöhen und Fußball interessanter zu machen. Und 1992 erschien auch das Buch eines jungen englischen Autors, der zum ersten Mal die Seelenlandschaft von Fußballfans beschrieb. »Fever Pitch« von Nick Hornby.
Für die Geschichte, die sich in den folgenden drei Jahrzehnten abspielte, gibt es zwei sich komplett widersprechende Erzählweisen. Die eine erzählt von einem globalen Boom und einer langen Serie goldener Jahre, denn es gab einen faszinierenden wirtschaftlichen Aufschwung, mit dem eine sportliche und kulturelle Blüte verbunden war. Niemals zuvor wurde im Fußball so viel Geld umgesetzt, das Spiel auf einem so hohen Niveau betrieben und wurde Fußball so ausführlich wie tiefgreifend diskutiert. Fußball ist heute der global erfolgreichste Sport, auf fast allen Kontinenten und in den meisten Ländern ist er Sportart Nummer eins.
Zugleich wird dies alles als Geschichte eines Niedergangs erzählt, einer Entfremdung und eines kulturellen Ausverkaufs. Moderner Fußball ist für viele Fans ausdrücklich negativ besetzt, für nicht wenige von ihnen sogar ein Kampfbegriff. Er steht für einen Fußball, in dem das Wirtschaftliche wichtiger ist als die Werte des Sports und das Sentiment vieler Anhänger. Er steht für eine Inflation des Fernsehfußballs, die einhergeht mit steigenden Eintrittspreisen und der ärgerlichen Notwendigkeit, diverse Abos abschließen zu müssen, um einen Wettbewerb sehen zu können. Er steht auch für eine andauernde Umverteilung von den kleinen zu den großen Vereinen und für sportliche Wettbewerbe, die immer weniger funktionieren. »Die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht«, hat Sepp Herberger, der legendäre Bundestrainer, der mit Deutschland 1954 die Weltmeisterschaft gewann, mal gesagt. Heute wissen die Leute zwar immer noch nicht ganz genau, wie ein Spiel ausgeht, aber wenige Klubs monopolisieren den sportlichen Erfolg wie nie zuvor in der Geschichte des Fußballs.
»Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug«, lautet der berühmte Aphorismus von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Der Philosoph nimmt seine Arbeit auf, wenn die Wirklichkeit Form angenommen hat. Für Historiker gilt das Gleiche, sie schreiben die Geschichte auf, wenn sie als Geschichte erkennbar und beschreibbar ist. Ob das für die Ära des modernen Fußballs schon jetzt gilt, kann nicht eindeutig gesagt werden, aber ihre Abenddämmerung zeichnet sich ab. In den letzten drei Jahrzehnten sind die Widersprüche in der Ordnung des Fußballs so groß geworden, dass sie inzwischen kaum noch aufzulösen sind. Katar und die Super League machen das überdeutlich.
Dieses Buch ist eines über den Profifußball der Männer, es beschäftigt sich also weder mit dem Profifußball der Frauen noch dem Amateurfußball. Das ist kein Ausdruck von Desinteresse oder Geringschätzung, sondern im Grunde Teil der Geschichte des modernen Fußballs. Die Amateure stehen nämlich nur am Rand und die professionell Fußball spielenden Frauen auch, wobei sich das zu ändern beginnt. Dieses Buch streift auch den Männer-Fußball in anderen Kontinenten außerhalb Europas nur, weil er, so bitter das auch ist, ebenfalls ein Phänomen an den Rändern ist.
Ich habe miterlebt, was sich seit 1992 verändert hat, und auch die Vorgeschichte kenne ich noch. Das qualifiziert mich nicht unbedingt mehr dafür, dieses Buch zu schreiben, vielleicht sogar im Gegenteil, weil ich emotional verwoben bin. Ich weiß, dass die Zeit vorher eine dunkle war, dunkler sogar, als viele sich vorstellen. Eine Modernisierung war damals dringend nötig. Obwohl ich also nicht nostalgisch bin, sehe ich aber auch, was dem Fußball im Zeitalter seiner Moderne verloren gegangen ist. Das Wichtigste ist vermutlich, dass er viel unwichtiger war. Eine passioniert betriebene Nebensache, aber auch nicht mehr als das.
Dieses Buch will die verschiedenen und oft unübersichtlichen Stränge der Entwicklung in den letzten 30 Jahren ordnen und die Frage beantworten, wie wir eigentlich an dem Punkt gelandet sind, an dem wir uns nun befinden. Zumal es oft genug erstaunlich chaotisch und verblüffend zufällig zuging. Immer wieder hätte die Chance bestanden, dass die Dinge eine andere Richtung nehmen. Gerade der deutsche Fußball ist ein gutes Beispiel, denn er hat im internationalen Vergleich einen Sonderweg beschritten. Letztlich ist es im Fußball wie in allen Bereichen des Lebens: Die Geschichte kommt nicht nur über uns, wir können auch ihre Subjekte sein. So könnte auch die nächste Ära des Fußballs anders aussehen, wenn wir es wollen.
Berlin, Juni 2022
Teil 1Big Bang
Kapitel 1Der Weg in die höchsten Kreise
Die Geschichte des Fußballs ist in vielerlei Hinsicht eine Mediengeschichte, und sie beginnt beileibe nicht erst mit dem Fernsehen. Als der Fußball im England des späten 19. Jahrhunderts zu einem Sport für die Massen wurde, landete er zum ersten Mal im Bett mit den Medien. Die Herausgeber der zur gleichen Zeit entstandenen Zeitungen drängten darauf, die Spiele der First Division zeitgleich auszutragen, damit sie über den Samstag verteilt nicht immer wieder aktualisierte Ausgaben drucken und ihre Zeitungsjungs damit auf die Straße schicken mussten. Die traditionelle Anstoßzeit in England, samstags um drei Uhr, war also in Wirklichkeit ein Zugeständnis an das wichtigste Medium jener Zeit. So wie die Spiele heute auf Wunsch des Fernsehens übers Wochenende verteilt werden, wurden sie damals gebündelt. Die Zeitungen halfen dem Fußball der frühen Jahre, ein größeres Publikum zu erreichen, während er umgekehrt den Zeitungen neue Leser verschaffte. Später kam das Radio und trug die Namen der Klubs und der Spieler aus dem lokalen Umfeld weit ins Land hinaus. Das Medium jedoch, das den Fußball am meisten veränderte, war das Fernsehen. Es liefert Fußball in bewegten Bildern und das auch noch live – eine unschlagbare Kombination.
Das Fernsehen machte Fußball ab den 1970ern zu einem globalen Sport und veränderte die wirtschaftliche Basis des Spiels grundlegend. Der Verkauf der Übertragungsrechte wurde nach und nach zum größten Einnahmeposten, die Sichtbarkeit auf dem Bildschirm steigerte das Zuschauerinteresse, was wiederum für besser dotierte Sponsorenverträge sorgte. Eine Spirale des Wachstums kam in Gang, die erst durch die Coronapandemie zwischenzeitlich unterbrochen wurde.
Ein Jahr veränderte dabei alles: 1992. Aber warum nicht zehn oder 15 Jahre früher, als Fernsehgeräte auch schon kein Luxusgegenstand mehr waren? Die meisten Fernsehsender in Westeuropa waren bis weit in die 1980er öffentlich-rechtlich organisiert, Privatsender die Ausnahme. In Osteuropa blieb das Fernsehen bis zum Fall der Mauer eine staatliche Angelegenheit. Im Westen finanzierten sich die Stationen entweder durch Rundfunkgebühren oder in einigen Ländern durch direkte staatliche Zuwendungen. Die Sender waren zu einer Programmgestaltung verpflichtet, die alle Facetten des gesellschaftlichen Lebens abbilden sollte, also auch Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen. Aber sie bezahlten nicht viel dafür.
Die ARD und das ZDF in Deutschland zeigten Zusammenfassungen von Bundesligaspielen, live auch große Pokalspiele, gelegentlich Partien im Europapokal und stets die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft. Weil es für die Öffentlich-Rechtlichen keine Konkurrenz gab, stieg der Preis der Übertragungsrechte der Bundesliga nur langsam: zwischen 1970 und 1987 von umgerechnet drei auf immer noch bescheidene 9,2 Millionen Euro pro Saison. Weil die Zuschauereinnahmen höher waren, wollten die Klubs auch nicht, dass zu viel Fußball im Fernsehen zu sehen war. Sie befürchteten, dass dann weniger Zuschauer in die Stadien kommen würden. So gab es bis auf ganz seltene Ausnahmen keine Bundesligaspiele live zu sehen, und selbst die Zahl der Spielzusammenfassungen, die samstags um 18 Uhr in der Sportschau der ARD gezeigt wurden, blieb über viele Jahre auf zunächst drei und später auf vier begrenzt. Europapokalspiele wurden meist erst kurzfristig ins Fernsehprogramm genommen, wenn die Vereine sicher waren, dass ihr Stadion gut besucht sein würde.
Im Laufe der 1980er-Jahre veränderte sich die europäische Fernsehlandschaft massiv. In Deutschland wurden 1984 erste Lizenzen an private Sender auch deshalb vergeben, weil die konservative Regierung des Bundeskanzlers Helmut Kohl der Ansicht war, dass die öffentlich-rechtlichen Sender politisch zu weit links standen. Von neuen Sendern wie SAT.1 oder RTL plus, die keine Rundfunkgebühren erhielten, sondern sich aus Werbung finanzieren mussten, erhoffte sich Kohl ein politisches Gegengewicht. In England knüpfte die konservative Regierung der Premierministerin Margaret Thatcher ähnliche Erwartungen an die gerade entstehende Konkurrenz zur BBC. Die neuen Sender möglich machten die neuen Vertriebswege für Fernsehprogramme über Satellit und Kabel. Dadurch waren auch Spartenangebote für spezielle Interessen möglich wie der Nachrichtensender CNN, der 1980 zu senden begann, oder Musikfernsehen wie MTV, das ab 1987 ein eigenes Programm in Europa hatte. 1984 nahm in Frankreich mit Canal+ der erste Pay-TV-Sender Europas den Betrieb auf. Das Programm wurde verschlüsselt ausgestrahlt, um es sehen zu können, brauchte man einen Decoder. Von Beginn an waren dort die Spiele der französischen Division 1 (später Ligue 1) zu sehen.
Für die Fußballklubs und -verbände bedeutete das: Unverhofft entstand ein Markt für die Fernsehrechte, den es zuvor nicht gegeben hatte. Als 1988 mit RTL plus erstmals ein Privatsender die Fernsehrechte an der deutschen Bundesliga kaufte, verdoppelte sich der Preis sofort auf über 20 Millionen Euro. Für die neuen Privatsender war Fußball deshalb attraktiv, weil er ihnen schnell und zuverlässig ein neues Publikum verschaffte. Der australische Unternehmer Rupert Murdoch bezeichnete Fußball sogar als »Rammbock«, um in England sein Geschäft mit dem Satellitensender Sky zu etablieren. Die Sache begann interessant zu werden.
Das galt auch für die Europapokale, wo es noch reichlich chaotisch zuging. Nach wie vor mussten die Sender die Übertragungsrechte für die Spiele einzeln erwerben – und konnten sie zumeist auch nur kurzfristig ins Programm nehmen. Die Klubs hatten daher das Gefühl, dass der europäische Fußballverband Uefa die neu entstehenden Chancen verpasste. Das aus ihrer Sicht veraltete K.-o.-System im Europapokal sorgte 1987 dafür, dass der italienische Champion SSC Neapel mit Superstar Diego Maradona bereits in der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister gegen Real Madrid ausschied. Das Hinspiel in Madrid sah damals Silvio Berlusconi, der Besitzer des AC Mailand, und er war entsetzt. Einerseits, weil das Spiel selber eine so traurige Angelegenheit war, wegen Zuschauerausschreitungen in der Vorsaison fand es vor leeren Rängen statt. Dem Medienunternehmer Berlusconi erschien es aber auch als Verschwendung, dass der spanische und der italienische Meister sich schon in der ersten Runde des Landesmeisterpokals gegenseitig ausschalteten. Dass sich die Großklubs so früh im Wettbewerb kannibalisierten, zerstörte aus seiner Sicht ökonomische Werte, und die Uefa unternahm nichts dagegen. Also beauftragte er die Werbeagentur Saatchi & Saatchi, das Konzept für einen neuen europäischen Wettbewerb zu entwickeln. Das tat sie auch und nannte ihn (schon damals) Super League. Er sah 18 Klubs vor und »basierte auf Verdienst, Tradition und Fernsehen – und war daher eine Liga für große Fernsehmärkte«, wie sich Alex Flynn erinnert, der als Mitarbeiter der Agentur das Konzept schrieb. Von der Uefa wurde es zwar abgelehnt, aber der Verband stand nun unter Druck.
Zwischenzeitlich wurde nämlich sogar der sportlich zweitrangige Uefa-Cup wirtschaftlich interessanter, weil es dort mehr Runden und Spiele gab – und mehr Geld zu holen. Da bis zu vier Teams aus dem gleichen Land qualifiziert waren, investierten die TV-Stationen lieber dort als in den Meistercup. Denn ein spanischer Sender beispielsweise verlor sofort das Interesse am Landesmeisterpokal, wenn die spanische Mannschaft ausgeschieden war. In Deutschland, England oder Italien war das nicht anders. Die Uefa richtete daraufhin zur Saison 1991/92 im Europapokal der Landesmeister nach zwei K.-o.-Spielen erstmals eine Zwischenrunde mit acht Teams ein. Diese spielten in zwei Gruppen Hin- und Rückspiele aus, die beiden Gruppensieger erreichten das Endspiel. Eine Lösung aber war das noch nicht, für die sorgten zwei Deutsche: Klaus Hempel und Jürgen Lenz. Sie verwandelten den Europapokal der Landesmeister in die Champions League und in kommerzielles Kryptonit.
Dass die beiden den Wettbewerb ganz neu dachten, lag auch daran, dass sie zur ersten Generation der neu entstandenen Branche des Sportmarketings gehörten. Hempel stammte aus Neuss, hatte zunächst als Betriebswirt bei Unilever in Hamburg gearbeitet und war 1977 zur Adidas-Niederlassung nach Frankreich gewechselt. Dort lernte er Horst Dassler kennen, den Sohn des Firmengründers Adi Dassler, und gründete 1982 mit ihm die erste globale Sportmarketingagentur: International Sport and Leisure (ISL). Von ihr wird später noch in anderem Zusammenhang die Rede sein. Lenz, auf Sylt geboren und in Bremen aufgewachsen, war ein Jahr zur See gefahren, hatte dann in New York bei einer Werbeagentur gearbeitet und später sechs Jahre in Hongkong und Japan. Anschließend traf er Hempel bei Adidas und gehörte ebenfalls zum Gründungsteam der ISL. 1991 verließen Hempel und Lenz das Unternehmen und machten sich mit einer eigenen Agentur selbstständig, der Television Event And Media Marketing AG (T.E.A.M.).
Auf der Suche nach Aufträgen trafen sie im Frühjahr 1991 den Uefa-Präsidenten Lennart Johansson zu einem Dinner im vornehmen Hotel Dolder in Zürich. Dabei eröffnete der Schwede ihnen, dass er den Europapokal reformieren wollte, um die Spitzenklubs davon abzubringen, eine eigene Liga zu gründen. Wer dazu die beste Idee habe, werde den Zuschlag bekommen. Hempel und Lenz zogen sich daraufhin für drei Wochen in ein Hotel im Tessin mit Blick auf den Luganer See zurück, machten morgens Fitnesstraining, für nachmittags zwischen zwei und fünf Uhr war Brainstorming angesetzt.
Vor allem ging es ihnen darum, den Wettbewerb zu einer Marke zu machen, die für ein neues Publikum attraktiv war. Fußball war bis dahin weitgehend ein Sport der Arbeiter, der kleinen Leute und fast ausschließlich männlichen Zuschauer gewesen. Nun sollten auch andere Schichten und Frauen angesprochen werden, weil das für Sponsoren attraktiver war. So entwarfen Hempel und Lenz einen bewusst hochwertigen Auftritt für den neuen Wettbewerb. Exemplarisch dafür stand die eigens komponierte Hymne, die der englische Komponist Tony Britten schreiben sollte. Er orientierte sich am großen Barockmusiker Georg Friedrich Händel. Die Hymne dominieren Trompeten und ein Chor, der in den drei Sprachen der Uefa singt: »Ils sont les meilleurs. Sie sind die Besten. These are the champions«. Sie sollte gespielt werden, wenn die Mannschaften auf dem Platz standen, nicht zufällig erinnerte das an Länderspiele. Dazu passend sollte im Anstoßkreis ein Sternenbanner weihevoll geschüttelt werden wie eine Nationalfahne. Für die Sender, die den neuen Wettbewerb übertrugen, gaben sie einen einheitlichen Look vor. Designer in London entwickelten in Silber und Grau gehaltene Trailer, die sich vom grell-bunten Trash abgrenzten, der im Fernsehen jener Zeit sonst zu sehen war. Selbst die Krawatten der Moderatoren waren vorgegeben, denn nichts sollte billig wirken. Das galt auch für den Namen: Champions League.
Mindestens so wichtig wie das Branding war das Vermarktungskonzept. Die Grundidee war, nicht mehr Einzelbegegnungen, sondern den Gesamtwettbewerb zu vermarkten. Kaufte ein Sender die Übertragungsrechte, verpflichtete er sich dazu, ab der ersten Runde je ein Live-Spiel zu zeigen sowie ausführliche Zusammenfassungen aller anderen Matches, egal ob ein Team aus dem Land des Senders dabei war oder nicht. Überraschend stellte sich heraus, dass die Zuschauer den Wettbewerb auch weiter verfolgten, wenn die Mannschaft aus ihrem Land ausgeschieden war. Die Sender bekamen aber nicht nur vorgeschrieben, was sie zu zeigen hatten und welchen Look ihre Übertragungen haben sollten, sondern auch die Sponsoren des Wettbewerbs. Genauso erging es den Klubs, die T.E.A.M. ein sogenanntes clean stadium übergeben mussten. Weder auf den Banden noch anderswo im Stadion durfte für etwas anderes geworben werden als für die Partner der Champions League. Sogar die Namen der Hersteller von Kaffeemaschinen oder Fernsehern in VIP- oder Presseräumen mussten überklebt werden, wenn sie nicht zu den offiziellen Sponsoren gehörten.
Manches davon wirkte damals irre, weil es noch nie so gemacht worden war. Doch Hempel und Lenz setzten sich mit ihrem Konzept gegen sechs Mitbewerber durch. Allerdings verlangte die Uefa von T.E.A.M. eine finanzielle Garantie von 150 Millionen Franken für die ersten beiden Spielzeiten. Auf der Suche nach einem Finanzier trafen sie einen der reichsten Unternehmer Deutschlands, Arend Oetker. Der kannte sich zwar mit Fußball nicht aus, brachte die beiden aber mit seinem ehemaligen Schwiegervater zusammen. So wurde Otto Wolff von Amerongen ihr Partner, der schwerreiche Industrielle und langjährige Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstags. Auf einen Schlag war der Fußball in den höchsten Kreisen angekommen.
Schon in der ersten Saison ging das Konzept auf. Die Sender rissen sich um die Übertragungsrechte, auch die Sponsoringerträge wuchsen gewaltig, sodass sich die Gesamteinnahmen der Champions League im Vergleich zum Europapokal der Landesmeister von einer Saison auf die nächste verneunfachten. Doch das war erst der Anfang.
Kapitel 2Normale Leute
Als 1992 das Buch »Fever Pitch« des 35 Jahre alten Nick Hornby erschien, gab schon dessen erster Satz einen neuen Ton vor: »Ich verliebte mich in Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: unvermittelt, unbegreiflich, unkritisch, ohne einen Gedanken an den Schmerz und den Schaden, den er mir zufügen würde.« Der in diesem Moment Elfjährige verknallte sich an einem Septembernachmittag des Jahres 1968 im Stadion Highbury beim Spiel des FC Arsenal gegen Stoke City. Ein unbedeutender Kick in einem halb leeren Stadion, das einzige Tor fiel per Nachschuss nach einem Elfmeter für Arsenal.
Auf den folgenden 250 Seiten von »Fever Pitch« ließ Hornby den Fan als romantische Figur erstehen. An das, was in seinem ersten Spiel auf dem Rasen passierte, so schrieb Hornby, könne er sich zwar nicht mehr richtig erinnern, doch mehr als zwei Jahrzehnte lang blieb ihm etwas anderes umso deutlicher in Erinnerung: »Ich erinnere mich an die überwältigende Männlichkeit des Ganzen.« Fasziniert beobachtete er die in Zigarrenqualm gehüllten Männer, die neben ihm und seinem Vater saßen und ungeheuerliche Schimpfwörter herausschrien. Wörter, die er nie zuvor gehört hatte, aber sofort verstand. Am meisten in den Bann aber zog ihn etwas anderes: »Den tiefsten Eindruck auf mich machte, wie sehr die meisten Männer um mich es hassten, wirklich hassten, dort zu sein.«
Für Hornby ist die Liebe der Fans eine tragische, weil sie letztlich immer enttäuscht wird. Der Fan hasst sich dafür, dass er seine Zeit in heruntergekommenen Stadien an lausige Kicker verschwendet. Er kommt aber dennoch wieder, weil er dort die Gemeinschaft der Gleichgesinnten und in seltenen Momenten die Delirien eines Glücks erlebt, wie sie nirgends anders zu erleben sind. Ein Spaß ist das aber nicht. »Unterhaltung als Schmerz war eine Idee, die mir völlig neu war«, schreibt Hornby. Der Fan, wie er ihn beschreibt, man kann es nicht anders sagen, ist verrückt.
Die Verrücktheit des Publikums ist ein ewiger Begleiter des Fußballs. Der Begriff »Fan« ist von Fanatiker abgeleitet, der italienische Begriff »Tifosi« von »Tifo«, Typhus. Der Fan ist also krank. Schon der Grundgedanke, Fan einer Mannschaft zu werden, kann schließlich nicht vernünftig erklärt werden. Warum sollte es wichtig sein, dass die Mannschaft in den roten Trikots das Spiel gewinnt und auf keinen Fall die in den blauen? In der Frühzeit des Fußballs folgte das einer tribalistischen Logik, die Verbindung zum lokalen Fußballteam ergab sich aus der Nähe. Das Stadion war in der Nachbarschaft, und oft genug kannten die Zuschauer die Spieler persönlich, weil sie nebenan wohnten oder ihre Arbeitskollegen waren. Das Fußballteam repräsentierte das Stadtviertel oder die ganze Stadt, und ging es gegen ein anderes Stadtviertel oder eine andere Stadt, ergab sich daraus ein Wir-gegen-die. Das konnte schon mal aus dem Ruder laufen, man findet bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts Berichte von spontanen Ausschreitungen, bei denen es dem Schiedsrichter an den Kragen ging, weil er »uns« benachteiligte oder weil etwas anderes die Gefühle in Wallung brachte.
In den frühen 1960er-Jahren änderte sich in den Fußballstadien etwas, weil sich die Gesellschaft veränderte. Jugend wurde zu einem eigenen Abschnitt des Lebens, es entstanden Jugendkulturen mit Lebensformen, die sich von denen der Erwachsenen unterschieden. Ein zentraler Ausdruck dessen war Musik, die für ein Publikum gemacht wurde, das es vorher nicht gegeben hatte: Teenager. 1964 steht ein Reporter der BBC am Spielfeldrand des Liverpooler Stadions an der Anfield Road, hinter ihm auf der riesigen Stehplatztribüne The Kop singen die Zuschauer. Er sagt in die Kamera: »Ein Anthropologe, der The Kop studiert, würde eine so vielfältige und rätselhafte Kultur finden wie in Polynesien. Das rhythmische Auf und Ab ist ein Ritual. Sie scheinen intuitiv zu wissen, wann sie zu singen beginnen. Das ganze Spiel über erfinden sie neue Worte zu alten Liverpool-Liedern, mit schmeichlerischen, gemeinen und obszönen Kommentaren, aber ihre Helden feiern sie im römischen Stil.« Staunend hält die Kamera auf die 24.000 Verrückten, die sich hinter ihm mit strahlenden Gesichtern die Stufen auf und ab, von rechts nach links drängen und dabei »She loves you« von den Beatles singen. Das ist es, wozu dem Mann vom Fernsehen die Arena im alten Rom und rätselhafte polynesische Kulte in den Sinn kommen – mitten in England.
Man sieht auf den Bildern viele junge Gesichter – und keine Frau. Noch sehen diese jungen Männer wie kleine Erwachsene aus, viele tragen sogar Krawatten, aber das wird sich ändern. In den folgenden Jahren kleiden sie sich zunehmend im Stil der Jugendkulturen, Mods oder Rocker, Punks oder Skinheads, oder im Stil von Bands wie den Bay City Rollers mit ihren Schottenkaros. Im Stadion bilden sie eine eigene Kultur und rotten sich als Gruppen auf den billigen Stehplätzen hinter den Toren zusammen, anhand von Schals oder Jeanswesten mit Aufnähern als Anhänger ihrer Klubs erkennbar. Wenn sie auf junge Menschen in den Farben des anderen Klubs treffen, besteht die Gefahr, dass es knallt.
Dieser neue Mechanismus der Gewalt, für den es keine falschen Schiedsrichterentscheidungen mehr brauchte, wurde ab den 1970er-Jahren von Anthropologen, Ethnologen, Soziologen, Sozialpsychologen endlos ausgedeutet. Oft wurde die Delinquenz als Ausdruck einer wachsenden Entfremdung im Fußball gedeutet, denn Spieler und Zuschauer waren keine Nachbarn mehr, sondern hatten sich in unterschiedliche Welten verabschiedet, in die der Bewunderten und die der Bewunderer. In den 1970ern wurden die Hooligans, also Fans, die es explizit auf Gewalt anlegten, in England zu einer eigenen Jugendkultur und in den 1980ern zur dominierenden in den Stadien. The English disease wurde es genannt, die englische Krankheit, wenn sie sich an den Wochenenden auf den Tribünen des Landes oder auf dem Weg dahin prügelten. Als »Fever Pitch« erschien, lagen hinter dem englischen Fußball zwei Jahrzehnte, in denen es, wenn von Fußballfans die Rede war, fast nur noch um die Gewalt der Hooligans ging.
Der Aufstieg der Hooligans wurde auch durch Feedback in den Medien angefeuert. Schon Mitte der 1970er-Jahre veröffentlichte die englische Tageszeitung Daily Mirror eine »League of Violence«: In dieser Gewaltliga standen die Klubs mit den meisten Verhaftungen oben. 1977 sendete die BBC eine berühmte Dokumentation über die Hooligans des FC Millwall, die sich »F Troop« nannten. Daraufhin tauchten überall im Land solche Gruppen auf, die »Headhunters« beim FC Chelsea, die »Inter City Firm« von West Ham United oder die »Zulu Warriors« bei Birmingham City. Die Sache schaukelte sich hoch, und 1985 geriet sie völlig außer Kontrolle.
Das Jahr markierte einen tragischen Tiefpunkt in der Geschichte des englischen Fußballs. Am 13. März 1985 stürmten Fans des FC Millwall beim Pokalspiel in Luton den Platz und lieferten sich Schlägereien mit der Polizei. Millionen Menschen in ihren Wohnzimmern schauten dabei zu, denn die Partie wurde live im Fernsehen übertragen. Am 11. Mai 1985 geriet Müll unter einer alten Holztribüne im nordenglischen Bradford in Brand, 57 Menschen starben, und viele mehr wurden schwer verletzt. Mit Hooliganismus hatte das nichts zu tun, aber die Katastrophe zeigte, wie heruntergekommen die meisten Stadien waren, seit Jahren nicht mehr erneuert und mit katastrophalen Sicherheitsstandards. Am gleichen Tag starb in Birmingham ein junger Fan, weil er bei Ausschreitungen von einer umstürzenden Mauer getötet wurde.
Die Sunday Times bezeichnete Fußball als ein »slum game played by slum people in slum stadiums«, als ein Spiel aus den Slums, das von Leuten aus den Slums in Slum-Stadien gespielt wird. Am 29. Mai 1985 bestätigte sich das beim Europapokalfinale der Landesmeister zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool. Ganz Europa saß vor den Fernsehern und sah, wie im Heysel-Stadion in Brüssel Fans aus Liverpool Jagd machten auf Anhänger von Juventus Turin. In der dadurch verursachten Panik starben 39 Menschen. Anschließend wurden die englischen Klubs für fünf Jahre von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen.
Weil Fußballfans vorwiegend als Gewalttäter wahrgenommen wurden, kam es am 15. April 1989 zur größten Katastrophe in der Geschichte des englischen Fußballs. Im Hillsborough-Stadion in Sheffield, beim Pokalhalbfinale zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest, starben 97 Menschen, weil die Stehplatzbereiche überfüllt waren. Sicherheitszäune zum Spielfeld versperrten den Liverpool-Fans den Fluchtweg, aber Polizei und Organisatoren des Spiels sahen in ihnen keine Menschen in Lebensgefahr mehr, sondern ein Sicherheitsrisiko. Sie öffneten die Tore zum Spielfeld viel zu spät.
Hornby verschwieg in »Fever Pitch« weder die Tragödien noch die Gewaltexzesse, aber er sorgte für einen Perspektivwechsel auf den Fan. Er überhöhte ihn als liebenswerten Irren oder irre Liebenden. Sein Irrsinn mochte manchmal unangenehm sein, weil ihm sein Fußballklub wichtiger war als Liebesbeziehungen und Freundschaften. Er war leicht asozial und hatte die Züge eines Süchtigen. Aber Hornby präsentierte ihn in einem leichten Ton, und er lieferte genug Bezüge zu Popkultur und Literatur, dass auch ein gebildeter Leser sicher sein konnte: Man hatte es wohl doch mit einem zivilisierten Menschen zu tun. Insofern sorgte das Buch auch für eine Befreiung. Jenen schamhaften Fans aus der Mittelklasse, die angesichts ihrer Begeisterung für Fußball ein schlechtes Gewissen hatten, bot »Fever Pitch« eine neue Perspektive. Denn Hornby beschrieb Fußball als eine respektable Form von populärer Kultur, für die man sich nicht schämen musste.
Sein Buch war in England ein riesengroßer Erfolg, allein in den ersten drei Jahren nach Veröffentlichung wurden 275.000 Exemplare verkauft. »Fever Pitch« wurde dadurch zum populärsten Ausdruck des Phänomens, dass Fußballfans über sich als Fußballfans zu sprechen begannen. Als Hornbys Buch erschien, gab es in England bereits rund 200 Fanzines. Bei fast allen Klubs produzierten Anhänger diese Magazine, auch weil das dank billiger Copyshops und Schnelldruckereien problemlos möglich war. Sie schrieben auf vielfältige Weise über das, was sie als Anhänger beschäftigte, oft selbstironisch oder gar sarkastisch.
Worum es ihnen aber vor allem ging, zeigt ein Kommentar in When Saturday Comes nach der Hillsborough-Katastrophe. When Saturday Comes war ein überregionales Fanzine, das später zu einem professionellen Magazin wurde und noch heute erscheint. Dort hieß es: »Wir gelten als passive Komplizen einer soziopathischen Minderheit. Die Polizei sieht uns als eine Masse, die, mit Alkohol abgefüllt, nur eines im Sinn hat: für Chaos zu sorgen, indem wir Dinge zerstören und mordlustig aufeinander losgehen. Daraus folgt, dass ›normale Leute‹ vor Fußballfans geschützt werden müssen. Aber wir sind normale Leute.« Die 1989 in Folge von Hillsborough gegründete Football Supporters Association vertrat die Interessen von Fußballfans unter dem Motto »Reclaim the Game«. Der Anspruch, sich das Spiel zurückzuholen, war auch ein kultureller. Die »normalen Leute« waren nämlich nicht mehr vorgekommen, wenn es um Fußballfans ging.
»Fever Pitch« wurde auch deshalb so erfolgreich, weil es die Perspektive der »normalen Leute« einnahm, die so lange geschwiegen hatten. Das Buch war zudem ein kultureller Wendepunkt, weil es eine im Untergang befindliche Welt des Fußballschauens beschrieb, vor allem aber die Möglichkeit einer kultivierten Form des Irrsinns eröffnete. Nötig war das nicht nur in England. In fast allen westeuropäischen Ländern war ein ähnlicher Teufelskreis der Gewalt in Gang gekommen und nach dem Fall der Mauer mit ungeheurer Vehemenz auch in Osteuropa. Das war oft schlimm, aber es ging auch einher mit einer moralischen Panik. Denn nicht bei jedem Spiel liefen die Dinge aus dem Ruder, und immer noch war es eine kleine Minderheit, die sich prügelte. Sie bekam nur die ganze Aufmerksamkeit, auch zuungunsten der »normalen Leute«.
Hempel und Lenz aber hatten die Champions League für ein neues Publikum entworfen, und auf gewisse Weise öffnete auch Hornby ihm die Tür. Es war kein Widerspruch, ein zivilisierter Mensch und gleichzeitig Fußballfan zu sein. Aber Hornby emanzipierte Fußballfans auch. Sie waren keine amorphe Masse, die man hinter Zäune sperren und dort sterben lassen konnte. Sie hatten ihren Anteil am Spiel, und den begannen sie nun einzuklagen.
Kapitel 3Totes Geld zum Leben erwecken
In England wurde Fußball erfunden, und von dort wurde das Spiel in die Welt getragen. In England wurde der erste Fußballverband gegründet und der erste Meister gekürt. In England begann die Mediengeschichte des Spiels und wurden die ersten Großstadien gebaut. England war immer das wichtigste Land für den Fußball, wenn auch nicht immer sportlich. Von England aus lief der Fußball im Zeitalter des Hooliganismus in eine tödliche Sackgasse, fand wieder heraus, und heute ist die Premier League die mit Abstand führende Liga der Welt. England ist das Schwungrad des Fußballs – im Guten wie im Schlechten.
1885 erlaubte der englische Fußballverband (FA