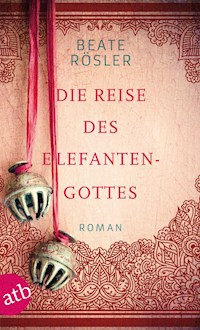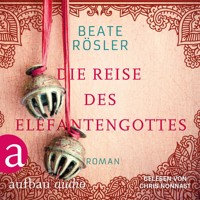Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen uns die halbe Welt.
Nach dem Tod ihrer Stiefmutter findet Tuyet Briefe ihrer Mutter aus Vietnam. Wollte sie den Kontakt zu ihrer Tochter also doch nicht abbrechen? Auf der Suche nach Antworten reist Tuyet von Frankfurt nach Hanoi, der Stadt am Roten Fluss, wo sie die junge Linh trifft und tief in die fremde Exotik ihrer Heimat eintaucht. Als sie eines Tages Linhs Mutter kennenlernt, die als Vertragsarbeiterin in der ehemaligen DDR gelebt hatte, ist Tuyet ihrer Vergangenheit plötzlich viel näher, als sie ahnt …
Exotisch und farbenprächtig: Ein bewegendes Familienepos zwischen Deutschland und Vietnam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 842
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Beate Rösler
Beate Rösler, geboren 1968 in Essen, studierte romanische Sprachen in Berlin und arbeitet heute als Deutschlehrerin am Goethe-Institut in Frankfurt/Main. Seit 2014 lebt sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Hanoi. Im Aufbau Taschenbuch ist bisher ihr Roman »Die Reise des Elefantengottes« erschienen.
Informationen zum Buch
Zwischen uns die halbe Welt
Nach dem Tod ihrer Stiefmutter findet Tuyet Briefe ihrer Mutter aus Vietnam. Wollte sie den Kontakt zu ihrer Tochter also doch nicht abbrechen? Auf der Suche nach Antworten reist Tuyet von Frankfurt nach Hanoi, der Stadt am Roten Fluss, wo sie die junge Linh kennenlernt und tief in die fremde Exotik ihrer Heimat eintaucht. Als sie eines Tages Linhs Mutter kennenlernt, die als Vertragsarbeiterin in der ehemaligen DDR gelebt hatte, ist Tuyet ihrer Vergangenheit plötzlich näher, als sie ahnt …
Exotisch und farbenprächtig: Ein bewegendes Familienepos zwischen Deutschland und Vietnam
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Beate Rösler
Die Töchter des Roten Flusses
Roman
Inhaltsübersicht
Über Beate Rösler
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Frankfurt a. M., Sommer 2015
Hanoi, Oktober 2015
Hanoi, Dezember 1972
Hanoi, Oktober 2015
Hanoi, 1978
Berlin, 1980
Hanoi, Herbst 1980
Berlin, 1980/1981
Hanoi, Dezember 2015
Berlin, 1985 bis 1990
Hanoi, Dezember 2015 bis Januar 2016
Hanoi, Sommer 1993
Hanoi, Februar – April 2016
Epilog Frankfurt a. M., Juni 2016
Anhang
Dank
Impressum
Leseprobe aus: Kristin Hannah – Die Nachtigall
Prolog
Ein kleines Dorf zirka 40Kilometer von Hanoi, Mai1970, sechs Jahre nach Beginn des amerikanischen Krieges
Aus der Bluse, die Hanh gewaschen hatte, tropfte noch Wasser, dennoch wagte sie es nicht, den Stoff fester auszuwringen. Vorsichtig schob sie ihren Zeigefinger in einen der Ärmel und strich mit dem Daumen über das fadenscheinige Gewebe. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es reißen würde. Hanh seufzte. Alle, die in dem Dorf lebten, in das sie vor ungefähr drei Jahren mit anderen Schulkindern evakuiert worden war, hatten ihre Kleidungsstücke so oft geflickt, dass niemand mehr sagen konnte, wie sie ursprünglich ausgesehen hatten. Aber das war noch das kleinste Unglück, das die Amerikaner über ihr Land gebracht hatten. Sachte, um den fragilen Stoff nicht zu strapazieren, zog Hanh ihre Hand aus dem Ärmel und legte ihn an ihre Wange. Sie schloss die Augen und stellte sich vor, die weiche Haut ihrer Mutter zu spüren, die ihr Gesicht liebkoste. Die Bluse hatte sie ihr zum Abschied geschenkt, nach Seife duftend und strahlend weiß. Wie einen zerbrechlichen Gegenstand hatte Hanh sie verpackt und in ihrer kleinen Tasche verstaut. Gut aufpassen wollte sie auf diese Erinnerung an ihr Hanoier Leben. Doch der amerikanische Krieg, der jetzt schon fast sechs Jahre wütete, zerrte selbst an den robustesten Stoffen, bis sie dünn und gräulich aussahen, ebenso wie die Menschen, die sie trugen.
Vorsichtig legte Hanh ihre Bluse auf die Hemden, die sie gerade für ihre jüngere Schwester Tao und die Bauernfamilie, bei der sie untergebracht waren, gewaschen hatte. Im Handumdrehen war alles getrocknet, so heiß schien die Maisonne. Viel besaßen sie nicht, deshalb achtete Hanh penibel darauf, dass regelmäßig gewaschen und gestopft wurde. Die Kleinen schnitten Grimassen, wenn sie sie ermahnte, auf Sauberkeit und Ordnung zu achten, denn das war im Krieg nicht immer einfach. Doch ganz gleich, wie viel Mühe es sie kosten würde, ihre Abschiedsbluse, wie sie sie im Stillen nannte, durfte um keinen Preis auseinanderfallen. Sie musste durchhalten wie Hanh selbst, denn dann, und nur dann, würde ihre Familie eines Tages wieder glücklich in Hanoi zusammenleben. Diesen Pakt hatte Hanh mit ihren Ahnen ausgehandelt, während ihrer ersten Nacht im Dorf, als sie sich stundenlang hin und her wälzte, schlaflos aus Sorge um ihre Familie und sich selbst. Damit die verstorbenen Angehörigen auch wirklich halfen, bot sie ihnen am folgenden Tag ihre Reisration an. An einer dicht bewachsenen Uferstelle des Roten Flusses entdeckte sie ein auf dem Boden liegendes großes Holzstück, säuberte es und verzierte es mit hübschen grünen Blättern. Hierauf stellte sie ihre Reisschüssel. So würdevoll wie ihr Ahnenaltar in Hanoi, den ihre Familie stets mit Blumen und ein paar Leckereien ausgestattet hatte, sah das einfache Holz zwar nicht aus, aber schließlich herrschte Krieg und die Toten würden es ihr nachsehen. Immerhin Räucherstäbchen hatte sie aufgetrieben. Feierlich entzündete sie eins nach dem anderen und sog ihren Duft tief ein. Sie blickte dem aufsteigenden Rauch hinterher, der den Ahnen ihre Gabe überbrachte, und flehte diese an, ihre Familie mit aller Macht zu beschützen. An dem Tag, so schwor sie, an dem ihre Familie wieder vereint wäre, würde sie zum Zeichen ihrer Dankbarkeit ihre Bluse opfern. Obwohl ihr Magen grollte und sie mit stechendem Schmerz dafür bestrafte, dass er warten musste, rührte sich Hanh nicht vom Fleck. Erst, als die letzte Glut des letzten Räucherstäbchens verglommen war, verzehrte sie den Reis.
Obwohl es nichts mehr zu waschen gab, hockte sich Hanh ans Flussufer und grub ihre Zehen in den weichen Schlamm. Wie angenehm er sich anfühlte. Mit einer Hand strich sie durch das warme Wasser und lauschte dem sanften Plätschern, das dabei entstand. Bis auf das Summen der Insekten war es ruhig. Wenn es keine amerikanischen Bomben gäbe, wäre es schön hier. Hanh holte so tief Luft, als könnte sie diesen friedlichen Augenblick durch ihren Atem aufsaugen, denn sie wusste, wie schnell er vorbei sein konnte. Ein wenig beugte sie sich vor, wobei die Spitzen ihrer dunklen geflochtenen Zöpfe die Wasseroberfläche streiften. An heißen Tagen wie diesem wünschte sich Hanh, einfach ihre Bluse und weiten Hosen abzulegen und im Fluss zu baden. Doch da sie nicht schwimmen konnte, wagte sie es nicht. Ein dunkler Gedanke ließ sie inmitten ihrer Wasserspiele verharren. Wie viele Menschen hatte der Rote Fluss im Laufe der Jahrtausende wohl sterben sehen? Unzählige waren in seinen Fluten ertrunken, waren an seinen Ufern erschlagen und erschossen worden, elendig verhungert, oder Bomben hatten sie in Stücke gerissen. Hanhs Herz pochte schneller. Natürlich wusste sie, dass der Name des Roten Flusses von seinem rötlichen Schlamm herrührte, doch auf einmal erschien es ihr, als wäre sein Rot dunkler geworden, intensiver, so, als ergössen sich Tausende Liter Blut in ihn. Eilig trocknete Hanh sich ab und schnupperte an ihrer Hand. Nein, lediglich der Geruch nach Wasser und Erde haftete ihrer Haut an, nicht der Gestank des Todes, den die amerikanischen Bomben verbreiteten. Hanh horchte auf. Das laute Surren der Insekten beunruhigte sie jetzt und so schnell wie möglich wollte sie ins Dorf zurück. Doch dann fiel ihr ein, was ihr Vater bei einem seiner letzten Besuche gesagt hatte.
»Hab keine Angst. Sie halten sich für unbezwingbar, aber das sind sie nicht. Wir werden siegen, denn wir sind zäh, geduldig und vor allem wissen wir, wofür wir kämpfen. Für unser Land. Für unsere Familien. Für ein freies und gutes Vietnam.« Und Hanh glaubte ihm. Er hatte ja Recht. Hatten sie nicht die Franzosen geschlagen? Wie zuvor die Japaner? Und die Chinesen, die gedacht hatten, ihre Herrschaft könnte ewig andauern? Auch die Amerikaner würden früher oder später aufgeben. Dafür kämpften ihre Eltern, ihre älteren Geschwister, und auch Hanh würde nicht feige sein. An jenem Tag hatte ihr Vater sie zum Abschied geküsst, was er selten tat, und sich dann auf sein klapperiges Fahrrad geschwungen. Der Weg nach Hanoi war weit, die Straßen voller Schlaglöcher und Gefahren. Dennoch winkte er ihnen zu, als begäbe er sich auf eine vergnügliche Fahrt. Hanhs Herz überschlug sich vor Stolz darüber, dass dieser mutige Mann ihr Vater war. Tapfer hatten sie und ihre kleine Schwester zurückgewinkt und ihm nachgeschaut, bis er ihren Blicken entschwunden war. Dann hatte die Kleine geweint, und Hanh hatte sie zu der Bauernfamilie zurückgeführt, bei der sie untergebracht worden waren.
»Willst du deinen Schutzhut nicht aufsetzen?«
Ein schmächtiger Junge war wie aus dem Nichts aufgetaucht und streckte Hanh ihren eng geflochtenen Strohhut entgegen. Sie setzte ihn auf, obwohl sie daran zweifelte, dass er sie im Ernstfall vor Bombensplittern schützen könnte.
»Danke.«
Hanh bückte sich und sammelte ihre Wäsche ein. Phong, der ebenfalls zwölf Jahre alt war, erschreckte sie nicht. Wie sie gehörte er zu den wenigen Kindern, die es wagten, sich alleine aus dem Dorf zu entfernen, um nicht unter der ständigen Beobachtung der Lehrer, anderer Schüler und Bauern zu stehen. Als sie sich mit ihren Kleidern im Arm aufrichtete, hatte Phong seinen Blick auf den blauen Himmel gerichtet. Seine ungewöhnlich dichten Brauen, das einzig Kräftige an seiner Erscheinung, zog er so stark zusammen, dass sie eine schwarze Linie bildeten, was ihm einen grimmigen Ausdruck verlieh.
»Was ist los?«, fragte Hanh und suchte den Himmel ab.
Phong legte den Zeigefinger auf seine Lippen. Hanh schauderte, denn nun bemerkte sie es auch. Die Luft war nicht mehr nur erfüllt von den Geräuschen der Insekten. Andere waren hinzugekommen: Die noch entfernten Motoren der gefürchteten B-52-Bomber, auf ihrem Weg nach Hanoi oder in andere Orte im Norden des Landes. Jedes Kind erkannte sie. Ebenso wie die regelmäßigen metallenen Schläge, die jetzt ertönten; es war der Dorf-Gong, der die Menschen aufforderte, Schutz zu suchen.
»Wir müssen zum Bunker!«, schrie Hanh und wollte losrennen, doch Phong verstellte ihr den Weg.
»Und wenn wir uns einfach in den Büschen verstecken? Hier ist so lange nichts passiert, und bestimmt brauchen sie ihre Bomben auch heute für wichtigere Ziele, nicht für unser winziges Dorf.«
Hanh überlegte kurz. Es stimmte. Seit eineinhalb Jahren war nicht eine einzige Bombe auf ihr Dorf gefallen. Aber konnten sie sich darauf verlassen? Andere Dörfer hatten weniger Glück gehabt. Jedoch waren diese, wie sie gehört hatte, erst auf dem Rückflug der Amerikaner bombardiert worden, wenn die Piloten ihre tödliche Fracht bei strategisch wichtigen Zielen nicht vollständig losgeworden waren. Dann öffneten sie selbst über dem unbedeutendsten Dorf ihre Flugzeugklappen und warfen den Rest ab. Hanh mutmaßte, dass sie ihre Bomben nicht unbenutzt zum Stützpunkt zurückfliegen wollten. »Das ist wohl Verschwendung«, dachte sie, »uns zu töten aber nicht.« Wie eine schwere Last sank dieser Gedanke auf Hanh herab, und nur mit Mühe schob sie ihn fort.
Phong hatte Recht. Wahrscheinlich würde rein gar nichts geschehen. Und es war tausend Mal erträglicher, die Flugzeuge hier abzuwarten, als in einem der dämmrigen, muffigen Bunker, wo die anderen Kinder sie mit ihrer Angst ansteckten.
»Ist gut«, stimmte Hanh zu, und Phong zog sie mit sich unter das grüne Blätterdach. Hier waren sie vor den Blicken der Piloten verborgen. Sie kauerten sich dicht nebeneinander auf einen Holzstamm und horchten auf das Dröhnen der B-52.
»Hast du Angst?«, flüsterte Phong in Hanhs Ohr, obwohl niemand ihn hörte.
Hanh schüttelte ihren Kopf. »Und du?«
Anstatt zu antworten, zog Phong ein Buch unter seinem Hemd hervor und hielt es ihr entgegen. Hanh registrierte ein Aufglimmen in seinen Augen, eine Mischung aus Freude und Triumph, wovon weder das eine noch das andere in ihrer gegenwärtigen Lage passend erschien. Sie bemerkte auch, dass sie sich wohl fühlte, so nah bei ihm zu sitzen, und zuckte nicht zurück, als die warme Haut ihrer Arme sich berührte. Da sie sich nicht bewegen wollte, nahm sie das Buch nicht an, sondern fragte: »Ist das Französisch? Woher hast du es?« Sie wunderte sich, dass Phong fähig war, ein derart dickes Buch in einer Sprache zu lesen, von der sie bloß ein paar mickerige Brocken verstand. Überhaupt gehörten Bücher für sie in die Schule, und selbst dort waren sie nach Jahren des Krieges so knapp, dass man sie sich mit anderen Kindern teilen musste. In ihrem Elternhaus hatte es keine Bücher gegeben, und die Idee, ohne konkrete Aufgabe der Lehrer eins zu lesen, wäre ihr nicht in den Sinn gekommen.
Erstaunt sah sie zu, wie Phong liebevoll über den Buchdeckel strich, und bekam eine Gänsehaut, weil sie sich vorstellte, er täte dasselbe mit ihrem Arm. Seine Augenbrauen saßen nun leicht gebogen an der richtigen Stelle über seinen Augen und verliehen seinem Gesicht etwas Männliches, was im Widerspruch zum Rest seiner Gestalt stand. Zöge man Phong sein Hemd aus, da war Hanh sicher, wären seine Rippen genauso gut zu zählen, wie es bei ihr selbst der Fall war.
»Warum sagst du nichts? Hast du doch Angst?«, neckte sie ihn.
Phong lächelte und schüttelte seinen Kopf.
»Mein Vater hat es mir geschenkt«, sagte er, »es sind Geschichten, die vor langer Zeit von zwei Deutschen aufgeschrieben wurden. Von den Brüdern Grimm.«
Der ohrenbetäubende Lärm der Flugzeuge brachte beide zum Schweigen. Nun war das Geschwader über ihnen, und sie wagten kaum zu atmen. Der Schweiß rann in ihre Augen und brannte. An Hanhs Wade juckte ein frischer Mückenstich und ihre Blase drückte. Dennoch würde sie sich nicht rühren, was auch immer pikste oder kratzte. Ein Blättchen zu viel, das sich bewegte, ein Zweig, der knackte, und vielleicht wurden die Piloten doch auf die Kinder aufmerksam. Die Zeit schien still zu stehen, und Hanh und Phong waren zu Steinfiguren erstarrt.
»Wohin fliegen sie? Nach Hanoi?«, fragte Hanh irgendwann mit einer Stimme so heiser, als hätte sie stundenlang gebrüllt. Ihr Bruder, der mit den Viet Cong kämpfte, war nicht dort, aber ihre Eltern, ihre ältere Schwester, Verwandte und Nachbarn schwebten in Gefahr. Hanhs Zunge klebte am Gaumen, so trocken vor Sorge war ihr Mund, und sie hatte das Gefühl, sich nicht richtig zu artikulieren. Ihr zu schneller Atem verursachte Schwindel, und Hanh fürchtete, ohnmächtig zu werden. Bemerkte Phong das nicht? Ruhig öffnete er sein Buch, blätterte von einer Seite zur nächsten, übersprang einige Blätter, huschte mit den Augen über die Buchstaben und klappte das Buch zu.
»Ich erzähle dir die Geschichte von Rapunzel, die von einer bösen Hexe in einem hohen Turm gefangen gehalten wird. Rapunzels Haar ist so lang, dass eines Tages nicht nur die Hexe, sondern ein Prinz daran zu ihr hinaufklettert. So kann er sie retten.« Phong sprach direkt in ihr Ohr, und seine Stimme klang bald wie die sanfte Rapunzel, dann schrill wie eine alte Hexe oder verzweifelt wie die Eltern der Unglücklichen, und nach einer Weile atmete Hanh gleichmäßiger. Phong überflog schon das nächste Märchen und verwandelte sich in eine Prinzessin, die durch den Fluch einer beleidigten Fee in einen hundertjährigen Schlaf gefallen war. Mit kreisenden Gesten seiner Hände ließ er eine Dornenhecke um sie herum wachsen, und spielte anschließend einen mutigen Prinzen, der diese bezwang. Hanh applaudierte, und nicht nur die Motorengeräusche entfernten sich, sondern auch die Hitze, die lärmenden Insekten und ihr ganzes anstrengendes Leben. Ohne dass Hanh es hätte in Worte fassen können, beglückte sie die Aussicht, die die Märchen ihr schenkten: Hatte man es geschafft, Angst, Einsamkeit und Schrecken zu trotzen, erwarteten einen zur Belohnung die liebende Familie und Freude. Wie ein Hoffnungsschimmer erstrahlte diese Vorstellung in Hanhs eigener gefahrenvoller Welt.
»Wie lange man auch in einem Todesschlaf liegt«, dachte sie, als Phong das unsichtbare Dornröschen wachgeküsst und sein Buch geschlossen hatte, »irgendwann kann es weitergehen.«
Kaum, dass dieser Gedanke in ihr zu wachsen begann, knurrte ihr Magen. Aggressiv und schmerzhaft, und unwillkürlich krümmte sie sich. Der Zauber der Märchen verflog. Überdeutlich sah Hanh die Flugzeuge vor sich, die in diesen Sekunden den Tod über Vietnam abwarfen, der Männer, Frauen und Kinder in Flammen aufgehen ließ, zerriss, erstickte oder vergiftete. Es war reiner Zufall, dass sie, Hanh, heute verschont geblieben war. Für Tausende von Menschen würde es morgen kein Erwachen geben, ihr Schlaf währte ewig, und zuvor würden sie leiden. Manche so grauenhaft, dass der einzig gütige Prinz, der sie von den Qualen befreite, der Tod selber war.
Hanh steckte ein paar kürzere Stirnhaare, die sich gelöst hatten, mit ihrer Haarklemme fest. Es war höchste Zeit, ins Dorf zurückzukehren und sich ihrer gerechten Strafe zu stellen, denn mit Sicherheit war ihre Abwesenheit nicht unbemerkt geblieben. Sie hätte längst gehen sollen, anstatt ihre Zeit zu vergeuden. Mit Geschichten, die einen forttrugen, bis hoch über die Wolken, wo es sicher schön war, und die trügerisch das ganze Elend hier unten verdeckten. Es war trotzdem da. Und wenn man nach all den Träumereien wieder auf der Erde landete, stach der Hunger stärker, wuchs die Angst schneller, schien die Wirklichkeit unerträglicher.
Phong, der sich wegen seiner Darbietung als Prinz bereits erhoben hatte, streckte Hanh seine Hand entgegen. Sie ergriff sie und versuchte aufzustehen, doch ihre Beine waren eingeschlafen und knickten immer wieder weg. Mehrmals musste sie auftreten, ehe das taube Gefühl verschwand. Während sie ihre Waden massierte, fragte Phong:
»Haben dir die Geschichten gefallen?«
Hanh zuckte mit den Schultern. Obgleich sie verstand, dass er sich bemüht hatte, sie abzulenken, konnte sie ihren Unmut nicht ganz verbergen.
»Sie sind schön. Aber wir hätten längst nachsehen sollen, ob es allen gut geht oder ob jemand unsere Hilfe braucht. Was wir hier machen ist … unnütz.« Phong hob ihren Wäschestapel auf und reichte ihn Hanh. Dabei sah er ihr fest in die Augen und sagte:
»Findest du? Mich erinnern diese Märchen daran, dass ich glauben möchte, dass es eine andere Welt gibt als eine, die aus Angst, Hunger und Tod besteht. Eine andere als die, die wir kennen. Und Hanh, weißt du, was schrecklich ist? Ich weiß kaum noch, wie es ohne Krieg war. Glaubst du, wir erleben noch einmal Frieden und Freiheit? Manchmal denke ich, ich bin der einzige, der alles tun würde, damit dieser Krieg auf der Stelle endet!«
Hanh schlug ihre Hände vor den Mund, die frisch gewaschene Kleidung fiel zu Boden. Was redete Phong denn da? Zweifelte er daran, dass sie dank der vietnamesischen Kämpferinnen und Kämpfer bald in einer besseren Welt leben würden? Genau dafür riskierten ihre Familie und viele andere ihr Leben. Er konnte froh sein, dass sie nicht vorhatte, den Lehrern von seinem Geschwätz zu erzählen, und von diesem Buch, das einen am logischen Denken hinderte. Insbesondere jetzt, da Ho Chi Minhs Tod die Vietnamesen erschüttert hatte, konnten seine Äußerungen leicht als entmutigend aufgefasst werden. Erführen ihre Lehrer davon, würde er bestraft werden, weil er die Moral der anderen Kinder gefährdete. Und so war es ja auch, denn dass er seltsame Ideen pflanzte, hatte sie gerade am eigenen Leibe erfahren. Zum Glück hatte sie die Stärke besessen, sich das betörend duftende Pflänzchen, ehe es wachsen konnte, wieder auszurupfen. Wie Unkraut.
Phongs Augenbrauen waren erneut düster zusammengewachsen, und er schien auf ihre Antwort zu warten. Die konnte er haben.
»Du bist nicht der einzige, der sich nach einem friedlichen Leben sehnt! Das will ich, das wollen alle. Nicht hungern. Nicht fürchten müssen, jeder Abschied von den Eltern könnte der letzte sein. Dafür kämpft unser Volk, opfert seine Jugend, seine Gesundheit, seine Familie, sein Blut. Mit Waffen, Phong, müssen wir für dieses bessere Leben sorgen, nicht mit Geschichten, nicht mit Träumereien.«
Hastig klopfte sie die Wäsche aus und rannte davon. Im Dorf meldete sie sich unverzüglich bei einem ihrer Lehrer und gestand, dass sie am Fluss geblieben war. Kurz nach ihr tauchte Phong auf und zeigte sich ebenfalls an. Das überraschte Hanh, denn von einem Traumtänzer hätte sie erwartet, dass er versuchte, sich mit irgendeiner Geschichte aus der Misere zu ziehen. Oder hatte er nur angenommen, dass sie ihn sowieso verriet und er als Lügner und Feigling dastünde?
Am nächsten Morgen, die Luft war noch angenehm kühl, standen Hanh und Phong in der Mitte des Dorfplatzes. Ihre Lehrer, Mitschüler und einige Bauern bildeten einen weiten Halbkreis um sie. Alle hatten am Vortag nach ihnen gesucht und waren erleichtert, dass sie nicht verletzt am Boden gelegen hatten oder im Fluss ertrunken waren. Ihrer Strafe mussten sie sich trotzdem stellen. Statt mittags mit den anderen etwas Reis und Gemüse zu sich zu nehmen, würden Hanh und Phong einige Klassenräume aus Bambus ausbessern. Erst wenn das geschehen war, durften sie essen. Außerdem verlangten die Lehrer, dass sie ihr eigenes unverantwortliches Verhalten kritisierten und sich bei der Dorfgemeinschaft entschuldigten. Noch niemals hatte sich Hanh dieser demütigenden Prozedur unterziehen müssen und wäre vor Scham am liebsten im Erdboden versunken. Zwar zeigte niemand mit dem Finger auf sie, das nicht, aber die Blicke der Umstehenden stachen auf ihrer Haut wie Tausende kleiner Glassplitter. Obwohl die Hitze noch gnädig war, rannen Hanh die Schweißperlen von der Stirn. Ein Seitenblick auf Phong zeigte ihr, dass er sich genauso unwohl fühlte wie sie. Das hoffte sie jedenfalls. Hatte nicht er sie auf die Idee gebracht, am Fluss zu bleiben, und sie mit schönen Worten eingelullt? Sie konzentrierte sich auf ihre Freundin Xuan, die sie am Rande der Versammlung erblickte. Die übrigen Gesichter verschwammen zu einer konturlosen Masse. Eine Lehrerin fasste die Ereignisse des Vortages zusammen und mahnte zu Wachsamkeit und Vorsicht. Dann wandte sie sich an Hanh und Phong und rügte ihr leichtsinniges Verhalten. Als sie geendet hatte, gab sie Hanh ein Zeichen, dass sie beginnen sollte.
»Es war falsch, dass ich nicht beim ersten Gongschlag ins Dorf gelaufen bin«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich habe nicht daran gedacht, dass andere Menschen bei ihrer Suche nach mir vielleicht selbst in Gefahr geraten. Das war unverantwortlich. Künftig werde ich mich an alle Regeln halten und meine Pflichten erfüllen. Das verspreche ich.«
Ihre Knie fühlten sich weich an, aber sie hatte es hinter sich gebracht. Ihre Lehrerinnen und Lehrer nickten ihr zu, dann richtete sich die Aufmerksamkeit auf Phong. Niemand sagte etwas, denn alle warteten darauf, dass Phong zu sprechen anhob. Doch dieser schwieg und schwieg. Sein Gesicht verriet Hanh nicht, was in ihm vorging. Hatte er Angst? Blieben ihm seine Worte im Halse stecken? Oder gab es einen anderen Grund, den Hanh sich nicht vorstellen konnte? Schließlich räusperte sich Lehrer Vu und klopfte mit seinem Stock auf den Boden. Hanhs Herz klopfte mit. Endlich öffnete Phong den Mund, und Hanh atmete auf.
»Ich habe andere in Gefahr gebracht, und ihnen kostbare Zeit gestohlen. Anstatt nach mir zu suchen, hätten sie Holz sammeln können, ernten, kochen oder lernen. Ich hätte die Regeln befolgen müssen. Damit kein Chaos ausbricht, das bloß dem Feind nutzt. Ich habe Hanh dazu angestiftet, mit mir am Fluss zu bleiben. Es ist meine Schuld, dass sie nicht ins Dorf gelaufen ist, und ich bitte darum, ihr die Strafe zu erlassen.«
Hanh starrte ihn an. Sein Blick war auf die Lehrer gerichtet, schien diese jedoch zu durchdringen und sich hinter ihnen in der Landschaft zu verlieren. Obwohl sie Phong eben noch selber die Schuld an ihrer misslichen Lage gegeben hatte, war sie nun geradezu empört darüber, dass er öffentlich die ganze Verantwortung auf sich nahm. War sie etwa ein willenloses Geschöpf, das sich von ihm etwas sagen ließ? Nein! Sie war freiwillig bei Phong geblieben, hatte ihre Zweisamkeit, was niemand wissen durfte, sogar genossen. Sie hatte sich für ihr Fehlverhalten entschuldigt und würde es nicht zulassen, dass sie diesen schrecklichen Augenblick umsonst durchgestanden hatte.
Lehrer Vu, ein Mann ohne Alter, seufzte und wandte sich Hanh zu. Er hatte freundliche Augen, vom rechten aus zog sich bis zum Kinn eine lange Narbe, über die man sich verschiedene Heldengeschichten erzählte. Seine Stimme klang sanft, als er sagte:
»Ich möchte niemandem ohne Grund das Mittagessen vorenthalten. Hanh, findest du deine Bestrafung ungerecht?«
Hanh schüttelte energisch ihren Kopf und warf Phong einen wütenden Blick zu. Wegen ihm stand sie noch einmal im Zentrum der Aufmerksamkeit.
»Nein, meine Strafe ist gerechtfertigt.«
Lehrer Vu nickte zufrieden. So als ob er nicht ernsthaft angenommen hatte, dass er sich irrte. Nach abschließenden Worten der ersten Lehrerin, die noch einmal auf das ausnahmslose Einhalten der Regeln bestand, verlief sich die Menge. Die Bauern gingen aufs Feld, Kinder und Lehrer suchten die Klassenräume auf.
»Was sollte das?«, fragte Hanh halblaut, als Phong mit seinen Büchern unterm Arm an ihr vorbeieilte. »Hältst du dich für einen Prinzen aus deinen Märchen? Ich brauche keinen Retter!«
Phong blieb stehen und wartete, bis sie ihn eingeholt hatte.
»Ich weiß, dass du Hunger hast«, antwortete er ruhig. »Und es ist doch wahr, dass ich dich aufgehalten habe.« Er sah sie an und grinste versöhnlich.
»Du hast auch Hunger«, erwiderte sie milder. »Bildest du dir ein, stärker zu sein als ich?«
Jetzt lachte Phong und schüttelte den Kopf.
»Nein, ich glaube, dass du sehr stark bist und viel mehr Ehre im Leib hast als ich. Aber ich werkele liebend gerne an den Bambushütten herum. Es liegt mir, Zerstörtes zu reparieren, und ich muss dabei nicht eine Minute ans Essen denken. Deshalb macht es mir nichts aus, auf die Mittagsration zu verzichten.«
Sie betraten ihren Klassenraum, und Hanh setzte sich auf ihre Bank. Ihre Freundinnen Xuan und Hop, die gerade noch gekichert hatten, drehten sich zu ihr und fragten, ob alles in Ordnung sei.
»Ja.«
Hanh war froh, ihre Freundinnen um sich zu haben, die sie nicht mit seltsamen Ideen bedrängten. Ihr Magen knurrte schon jetzt, und sie fragte sich, wie sie die körperliche Arbeit ohne ihre Schale Reis bewältigen sollte. Trotzdem zwang sie sich zu rechnen.
Inzwischen war es später Vormittag geworden und Hanhs einfacher Schulraum hatte sich aufgeheizt. Er war recht neu, roch nach Bambus und getrocknetem Lehm. Ein Wall aus Erde schützte ihn bei Angriffen und bot Deckung. Hanh hatte selber daran mitgebaut, wie an einigen anderen der Bambushütten, die sie errichtet hatten, weil der Platz für die evakuierten Kinder nicht ausreichte.
Mit ihren Füßen spielte sie auf dem sandigen Boden und ertastete mit ihren Zehen ihr ausgehobenes Schutzloch. Unter jeder Schulbank befand sich eins, und jedes Kind konnte innerhalb von Sekunden hineinrutschen, sollte es überraschend Alarm geben. In den ersten Jahren nach ihrer Evakuierung hatte Hanh viele Stunden in diesem Loch verbracht. Geschwitzt hatte sie, und ihr Körper juckte genau an den Stellen, an die sie nicht herankam. Sie hasste die Enge dieses Loches, in dem sie sich einsam fühlte, lebendig begraben. Da waren ihr die Sammelbunker fast lieber, denn dort konnte man sich wenigstens bewegen. Und allein war sie auch nicht. Noch nie hatte sie mit jemandem über ihre Ängste gesprochen, nicht einmal mit ihren Eltern, wenn diese sie besuchten. Sie wollte nicht jammern und ihnen damit das Herz schwer machen. Wahrscheinlich würde Phong sie verstehen. Aber das Letzte, was Hanh sich wünschte, war, dass er in ihr eine Verbündete sah, die wie er über Entbehrungen und Opfer klagte. Was nützt das schon? Das Leben war, wie es war.
Nach dem Unterricht besserten Hanh und Phong einige Hütten aus, und als es dämmerte, gestattete Lehrer Vu ihnen endlich zu essen. Als der erste Reis schließlich in ihren Magen rutschte, musste sie sich zusammenreißen, um nicht zu schlingen. Ihre Schale war noch halbvoll, als der Gong geschlagen wurde. Sofort erschienen die Lehrer und trommelten die Kinder und Jugendlichen zusammen. Die Aktion ging recht geordnet vonstatten, denn schon die Fünfjährigen wussten, wohin sie gehen mussten. Ihre Reisschüssel in der Hand und ihre Schultasche unter den Arm geklemmt hielt Hanh nach Tao Ausschau, und gemeinsam liefen sie zu ihrem Schutzraum. Auch die Bunker bestanden aus Bambus, der mit Lehm, Erde und Pflanzen bedeckt war. Hier versammelten sich die Menschen, und aus der Vogelperspektive musste das Dorf wie ausgestorben wirken. In den Bunkern hielt das Leben die Luft an.
Aufmerksam lauschte Hanh ihren Lehrern, die die Kinder anwiesen, diszipliniert sitzen zu bleiben und Ruhe zu bewahren, egal was geschehen würde. Dass sogar die Kleinen sich mucksmäuschenstill verhielten, erfüllte Hanh mit Stolz. Auf ihre Art trotzten sie dem mächtigen Feind. Ihre Augen begegneten Phongs, der sich mit angezogenen Beinen an die Wand gelehnt hatte. Der gestrige Streit fiel ihr ein, und ihr war, als könnte sie hören, was Phong gerade dachte.
»Nicht aus Mut sind sie so still, sondern weil sie nichts anderes kennen. Es ist normal für sie, alles stehen und liegen zu lassen, um sich zu verstecken. Wenn wir heute sterben, werden sie nie etwas anderes erleben.«
Ihre Blicke wanderten zu Tao, dann zu Xuan, Hop, Phong, bis hin zu Tuan, einem Klassenkameraden, der neben ihr saß, seine Fäuste so fest geballt, dass die Sehnen und Adern hervortraten. Die meisten von ihnen saßen reglos da, manche tuschelten mit ihrem Nachbarn oder kneteten ihre löchrigen Hemden. Plötzlich pochte eine dumpfe Angst gegen Hanhs Magenwände. Sie schmeckte Säure, die sie hektisch hinunterschluckte. Angestrengt konzentrierte sie sich auf den Ausgang des Bunkers, an dem sich zwei Lehrer als Wachen postiert hatten. Obwohl sie genau wusste, dass sie nichts gegen die Bomben ausrichten konnten, beruhigte Hanh der Anblick. Einer der Lehrer nickte ihr ermutigend zu, dann forderte er die Kinder auf zu singen. Und sie sangen. Von einem Soldaten, der nach gewonnener Schlacht nach Hause zurückkehrt. Xuan zwirbelte dabei ihr langes Haar, Hop spielte mit ihrer Spange, nur Tuan gab vor, einen Hustenanfall zu erleiden, weil er sich im Stimmbruch befand und den Ton nicht traf. Obwohl er etwas älter war als sie, konnte Hanh auf ihn hinabsehen. Das wusste sie, seit er einmal beim Tischtennisspielen neben ihr gestanden und sie sich gewundert hatte, wie klein er war.
Das Dröhnen der amerikanischen Flugzeuge kam näher. Die Lehrer sangen dagegen an und die Kinder taten es ihnen gleich, mit einer Inbrunst, als ob sie durch ihre Stimmen ein Schutzschild errichteten, das die Bomben abhielt.
»Sie sind da! Sie sind da«, schrie Tuan, und griff dabei nach Hanhs Hand. Einen Moment lang ließ sie es zu, dann zog sie ihre Hand aus seiner feuchten und sang einfach weiter. Die Welt schien sich nun nicht mehr zu drehen, sondern nur noch zu vibrieren, der Boden, der Bambus, die Gesichter der anderen, Hanhs Körper. So fest sie konnte presste sie ihre Handflächen auf ihre Ohren, aber es nützte nichts. Das Dröhnen der Motoren durchdrang alles. Gestern am Fluss, von nichts umgeben als den Blättern der Bäume und den Pflanzen, hatte sie sich sicherer gefühlt als hier im Bunker, ohne Sicht, eingekeilt zwischen schwitzenden Körpern und zunehmend verbrauchter Luft.
»Ich will nicht sterben!«, brüllte Tuan, und Hanh roch, dass er sich in die Hose gemacht hatte. Er tat ihr leid, gleichzeitig schämte sie sich für ihn. Manche Kinder fingen an zu weinen, manche riefen nach ihren Eltern. Mit einer energischen Handbewegung sorgte ein Lehrer für Ruhe.
»Reiß dich zusammen, Tuan. Willst du allen Angst machen?«
Keuchend blickte Tuan zu Boden. Aus den Augenwinkeln nahm Hanh war, dass er zitterte und sich verstohlen über die Augen wischte.
»Singt weiter«, ordnete der Lehrer an, und sie gehorchten. Das Wimmern einzelner Kinder mischte sich in die Lieder. Plötzlich bebte ihr Bunker und um Hanh ertönten Schreie, so gellend, dass sie ihren eigenen nicht heraushörte. Sie vergruben ihre Gesichter in den Armen. Klammerten sich an wer immer neben ihnen saß. Lehm rieselte auf ihre Haare herab, der Staub reizte zum Husten, und die Wände schienen nachzugeben.
»Singt lauter!«, rief eine Lehrerin, und Hanhs Lippen sangen weiter, Lieder, die sie noch später im Schlaf können würde. Sie sah, dass sich die Münder der anderen bewegten, aber sie hörte sie nicht. Weder schnell noch langsam verging die Zeit. Sie kauerten in einem Vakuum, sangen und hofften, der Tod möge weiterfliegen.
Als es ruhiger wurde, gingen die Lehrer hinaus, um nachzusehen, was passiert war. Den Kindern befahlen sie, im Bunker zu bleiben und zu warten, bis jemand Entwarnung gab. Niemand hielt es mehr aus, in diesem dunklen, stickigen Raum, der leicht ihr Grab hätte werden können. Es drängte sie hinaus an die Luft, um zu atmen, zu fühlen, dass sie lebten, und zu sehen, dass es den anderen gut ging. Oder war jemand verletzt? Gar getötet worden? Standen die Häuser noch? Doch den Anordnungen der Lehrer war Folge zu leisten, und sie blieben sitzen. Der Staub und Durst hatte ihre Hälse ausgetrocknet und nach Singen war keinem mehr zumute. Für den Augenblick hatten sie überlebt, aber was wäre, wenn die Flugzeuge ihre Mission erfüllt und Elektrizitätswerke, Brücken und Bahnhöfe zerstört hätten? Dann kämen sie zurück.
Hanh zog die weinende Tao in ihren Arm und strich ihr den Lehm aus dem Haar. Danach zog sie aus ihrer Schultasche eine Holzfigur.
»Was glaubst du, ist das?«, fragte sie die Kleine, die keinen Moment zögerte.
»Ein Flussdrache.« Sie zog den Rotz in ihrer Nase hoch und ihre Tränen versiegten. Andere schauten interessiert zu ihnen hinüber.
»Genau«, bestätigte Hanh, »sieh mal, der Kopf, der Schwanz, seine Schwingen. Er ist stark und mächtig. Er hat uns beschützt und wird das auch weiterhin tun.« Das Mädchen rührte sich nicht und blickte ehrfürchtig auf den handgroßen Holzdrachen.
»Woher hast du ihn?«
Tuan, der, während sie sprach, von Hanh abrückte, wohl damit sie seinen Uringeruch nicht bemerkte, streckte gleichzeitig die Hand aus, und Hanh legte ihm den Drachen hinein.
»Den habe ich geschnitzt«, antwortete sie, und hätten sie nicht in einem übel riechenden Bunker gesessen, wäre sie stolz darauf gewesen, dass Tuan den Drachen drehte und wendete, und schließlich anerkennend nickte.
»Nicht schlecht«, sagte er, »für ein Mädchen.«
»Erzähl weiter«, bat Tao und kuschelte sich an Hanh. Eingehüllt in Dunkelheit und Staub konnte Hanh die erwartungsvollen Augen der anderen Kinder nicht sehen. Aber sie spürte sie, und damit auch die Verantwortung, die sie ihr aufbürdeten.
»Ja, erzähl! Was kann dein Drache noch?«
Hanh biss sich auf ihre Unterlippe. Schon ihre Mutter hatte entgeistert den Kopf darüber geschüttelt, dass Hanh Legenden, die sie ihr viele Male erzählt hatte, immer wieder durcheinanderwarf. Sie konnte sich einfach keine Geschichten merken, und eine zu erzählen, lag ihr erst recht nicht. Nein, sie hatte zu ihrem Flussdrachen nichts mehr zu sagen. Je länger Hanh schwieg, desto schneller kroch die Angst in die Kinder zurück. Die ersten wurden unruhig, Tao würde gleich weinen.
»Phong«, sagte sie, und es klang widerwillig und flehend zugleich, »erzähl ihnen eine Geschichte.«
Einen Moment lang herrschte Stille, und Hanh betete, dass er nicht nachtragend war.
»Welche?«
»Eine von denen, die gut ausgehen.«
»In Ordnung«, sagte Phong und begann.
»Es war einmal …«
Er erzählte die Märchen, die Hanh bereits kannte, aber auch neue, von vier Tieren, die Musik machten und eine Räuberbande überrumpelten, von einem schlauen Schneider, von zwei Kindern, die sich im Wald verirrt hatten und eine böse Hexe überlisteten, und schließlich von einem Tisch, der sich wie durch Zauberhand deckte, wenn man es ihm befahl. Zunächst hatte Hanh einen Schrecken bekommen. War es denn richtig, die Kinder an leckere Speisen zu erinnern? Würde es nicht ihren Hunger verschlimmern? Doch bald stellte sie fest, dass die Kinder das Märchen liebten und Phong unterbrachen, weil sie dem Tisch sagen wollten, was er noch hervorzaubern müsse. Bald verlangten sie keine Speisen mehr. Ein Kuss der Mutter sollte es sein, ein Schlaflied der Großmutter, ein neues Hemd, ein bestimmter Mandelbaum, der entlang ihres alten Schulwegs geblüht hatte, ein besonderes Tet-Fest, ein albernes Spiel mit der Freundin, von der man nicht wusste, wo sie gelandet war. Für einen kleinen Augenblick erstand vor den Augen der älteren Kinder ihr früheres Leben und erhellte die Dunkelheit des Bunkers. Die Kleineren schliefen dabei ein oder lauschten mit großen Augen, als ob sie ein weiteres Märchen zu hören bekämen.
Mitten in der Nacht kehrten die Flugzeuge zurück, aber es geschah nichts mehr. Offenbar hatten die Amerikaner ihre komplette Fracht abgeworfen. Die Lehrer berichteten, dass die Bomben, die ihr Dorf erschüttert hatten, in einiger Entfernung niedergegangen waren. Sie hatten Glück gehabt, denn es gab nur wenige Verletzte. Der einzige Verlust, den Hanh in dieser Nacht zu beklagen hatte, war ihr selbstgeschnitzter Holzdrache. Der hatte sich auf und davongemacht.
Als sie den Schutzraum verließen, hielt sie Phong zurück.
»Danke«, sagte sie, und da sie nicht wusste, was sie hinzufügen sollte, wiederholte sie es. »Danke.«
Phong lächelte und die dunklen Schatten unter seinen Augen hellten sich ein wenig auf.
»Ich danke dir, dass du mich gefragt hast. Und Hanh …«, rief er ihr nach, da sie sich bereits auf den Weg gemacht hatte, »sei nicht traurig wegen des Drachen. Er ist vielleicht bei jemandem, der ihn nötiger hat als du. Denn du bist auch ohne ihn mutig.«
Dann schloss er sich ein paar Jungen an, die sich auf den Weg machten, um Holz zu sammeln.
»Kommt er nicht mit?«, fragte einer von ihnen und zeigte auf Tuan, der dabei war, ein paar Steine zur Seite zu räumen, die vor ihrem Bunker gelandet waren.
»Nicht bevor er seine Hosen ausgewaschen hat!«, lachte Lam, ein Junge, auf den viele hörten und für den Hanhs Freundin Xuan ein wenig schwärmte. »Sein Vater ist Soldat, er kämpft mit meinem zusammen im Süden. Was hält er wohl von einem Sohn, der um sein Leben winselt?«
Hanh musste zugeben, dass sie denselben Gedanken gehabt hatte. Andererseits, wer hatte nicht gezittert? Und sich jetzt, da niemandem etwas Ernstes zugestoßen war, über Tuan lustig zu machen, kam ihr wie ein billiger Weg vor, um selbst den Helden mimen. Xuan und Hop gesellten sich zu Hanh. Müde und schmutzig sahen sie aus, aber auch erleichtert darüber, dass sie die furchtbare Nacht überstanden hatten.
»Komm mit, wir trinken etwas«, sagte Xuan zu Hanh und zog sie mit sich fort. Ihr rechter Schlappen, wie Hanhs eigene aus alten Autoreifen gefertigt, war gerissen, und um ihn nicht ganz zu verlieren, zog sie ihren Fuß ein wenig nach.
»Selbst der Bücherwurm hat mehr Mumm in den Knochen als du«, grölte Lam zu Tuan hinüber und schlug Phong anerkennend auf die Schulter. Hanh wandte sich noch einmal um.
»He, Lam«, rief sie, »sollst du nicht Holz sammeln?«
Prustend entfernten sich die Jungen, und irgendwie war Hanh enttäuscht darüber, dass Phong mitlachte. Tuan schichtete weitere Steine und schaute erst auf, als Lam außer Sichtweite war. Ihre Blicke begegneten sich, und Hanh meinte zu erkennen, dass Tuans feucht schimmerten. Eine Grimasse schneidend signalisierte sie ihm, wie dumm sie die Holzsammler fand. Hellte sich Tuans Miene auf? Oder war es ihm am Ende unangenehm, dass sie die peinliche Szene verfolgt hatte? Es blieb Hanh keine Zeit es herauszufinden, denn blitzschnell drehte er sich um und verschwand grußlos. Hanh und ihre Freundinnen schauten ihm nach. Dann zuckte Hanh die Schultern und sie machten sich daran, ihr Dorf wieder aufzubauen.
An einem der nächsten Sonntage kamen Hanhs Eltern zu Besuch. Gerade kochte sie den Mittagsreis, als die Bäuerin erschien und Hanh zu sich winkte.
»Deine Eltern sind da«, erklärte sie, »überlass mir das Kochen.« Sie zwickte Hanh in die Wange und gab ihr, als diese sich nicht rührte, einen freundlichen Schubs.
»Nun lauf schon. Sie haben nicht ewig Zeit.«
Und Hanh rannte los. Seit dem letzten Angriff der Amerikaner hatte sie ängstlich auf ein Lebenszeichen ihrer Familie gewartet. Gehofft. Gebangt. Sie hatte gesehen, dass andere Kinder ihre Eltern umarmten, manchmal jedoch erschienen ein Onkel oder eine Tante und brachten traurige Nachrichten. Wie für Tuan, dessen Vater im Süden gefallen war und dessen Mutter als vermisst galt. Tao hing schluchzend vor Freude und Sehnsucht an den weiten Hosen ihrer Mutter, als Hanh sie außer Atem erreichte.
»Me! Bo!« Sie flog in die Arme ihrer Eltern, und auch sie hätte weinen mögen. Doch war sie die große Schwester und es ging nicht, sich genauso aufzuführen wie Tao. Zuverlässig und bedacht wollte sie wirken, damit ihre Eltern wussten, dass sie sich auf sie verlassen konnten. Ihr Vater hob Hanh hoch, und über seine Schulter hinweg erkannte sie Phong, der ihr fröhlich zuwinkte. Sein Vater, der als Arzt im selben Krankenhaus arbeitete wie Hanhs Schwester Anh, war am letzten Sonntag gekommen. Zwar hatte er Hanh berichtet, dass seines Wissens nach ihrer Familie nichts zugestoßen war. Doch erst jetzt, als sie Me und Bo umarmte und deren schweißnasse Körper an Hanhs klebten, entspannten sich ihre Muskeln und ihr Herz.
»Leider ging es nicht früher«, entschuldigte sich ihr Vater und küsste Hanh aufs Haar. »Im Krankenhaus war zu viel los. Außerdem mussten wir ein zweites Rad für eure Mutter organisieren.«
»Aber ihr seid auf einem angekommen«, stellte Tao mit inquisitorischer Miene fest.
Ihre Mutter drückte sie.
»Stell dir vor, auf halber Strecke sind meine Reifen geplatzt. Wegen eines dummen Schlaglochs.« Beschämt blickte sie ihren Mann an. Hanh konnte sich vorstellen, weshalb. Ihr Vater hatte sie auf den Gepäckträger nehmen und herfahren müssen. Vierzig Kilometer auf einer staubigen, löchrigen Straße zu radeln, war zu dieser Jahreszeit schon anstrengend genug. Ein zusätzliches Gewicht machte die Fahrt noch beschwerlicher.
»Allerdings ist Me so dünn geworden, dass sie wahrscheinlich nicht viel wiegt«, dachte Hanh und schaute ihre Mutter besorgt an. Ihr langes Haar hatte sie bis auf die Schulter abgeschnitten und hielt es im Nacken mit einer Spange zusammen. Ohne die alte Haarpracht schien ihr konischer Reishut auf ihrem Kopf keinen rechten Halt zu finden, und ihr Gesicht sah klein und schmal aus. Dafür wirkten ihre Augen nun größer und dunkler.
»Denkt nicht mehr an das Fahrrad«, bat der Vater. »Wir haben Reis mitgebracht, ein wenig Fleisch und neue Hosen, die eure Mutter genäht hat. Wollt ihr sie sehen?«
Er lachte, und Hanh sah, dass ihm zwei Zähne fehlten.
»Die waren faul und mussten raus«, raunte er ihr zu. Hatte sie ihn angestarrt? Gemeinsam ging die Familie zu Hanhs und Taos Gastfamilie, denen sie ebenfalls Selbstgenähtes mitbrachten, vor allem aber Nachrichten. So erfuhr Hanh, dass die Amerikaner das Nachbarland Kambodscha bombardierten. Hier verlief ein Teil des Ho Chi Minh-Pfades, über den der Viet Cong und die nordvietnamesische Armee Reis, Munition und Kämpfer in den Süden schleusten. Im Ausland protestierten immer mehr Menschen gegen die Amerikaner, was hoffentlich deren Abzug beschleunigen würde. Nach dem Essen forderten die Eltern ihre Kinder auf, ihnen die Hausaufgaben zu zeigen. Hanh hätte die kostbare Familienzeit lieber anders verbracht, aber nicht einmal im Traum fiel es ihr ein, den Eltern zu widersprechen. Also sagte sie nur:
»Ich würde die Amerikaner so gerne vertreiben. Stattdessen sitze ich herum und mache Hausaufgaben.«
Ihre Mutter versetzte ihr einen leichten Klaps auf den Hinterkopf.
»Was redest du denn, Kind. Du bist zwölf, und wir sind froh, dass du einigermaßen in Sicherheit bist.«
Hanh presste ihre Lippen zusammen und legte ihrer Mutter die Aufgaben vor. Wenn sie sie doch nicht wie ein Kleinkind behandeln würde. Der andere Grund, aus dem sie ihre Hefte nicht gerne vorzeigte, war, dass sie weder besonders gut schrieb noch rechnete, was ihre Mutter wohl auch fand, denn ihre Wangen verfärbten sich, ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie ärgerlich war. Mit einem vorwurfsvollen Blick auf Hanh schob sie ihrem Vater deren Hefte hinüber. Dieser war gerade damit fertig geworden, die kleine Tao für ihre guten Leistungen zu loben und besah sich gut gelaunt Hanhs Papiere.
»Hm, hm, hm«, machte er dabei, was Hanh noch schlimmer fand als den offensichtlichen Unmut ihrer Mutter. Kurz darauf reckte er sich und lächelte Hanh an.
»Ich bin stolz auf meine mutige Tochter, die unserem Land dienen will«, sagte er, und sowohl Hanh als auch ihre Mutter sahen ihn verwundert an. Tao hatte den Kopf in den Schoß ihrer Mutter gebettet und schlief.
»Zwölf zu sein ist sicher nicht leicht«, fuhr er fort, »du bist nicht mehr klein, aber zum Kämpfen noch nicht groß genug. Trotzdem hast du eine wichtige Aufgabe, Hanh.« Hanh richtete sich auf. Hellwach war sie mit einem Mal.
»Welche?«, stieß sie hervor.
»Du musst lernen. So viel und so gut wie möglich.«
»Lernen?«, dachte Hanh enttäuscht. »Wie vertreibt man damit den amerikanischen Feind?«
Ihr Vater wartete ab, bis sie ihre Enttäuschung unter Kontrolle hatte. Dann strich er ihr über die Wange. »Nach dem Krieg müssen wir unser Land aufbauen. Dazu brauchen wir kluge, junge Menschen, die wissen, wie das geht. Junge Menschen wie dich, meine Tochter.«
Hanh nickte. Später würde sie sich oft an diesen Moment erinnern, und nie sicher sein, ob sie die Erwartungen ihres Vaters erfüllt hatte. Aber diese Zweifel lagen noch in ferner Zukunft. In diesem Augenblick war sie stolz darauf, dass er zu ihr redete, als ob sie eine Erwachsene wäre. Natürlich wollte sie nichts lieber, als Vietnam aufzubauen, und wenn es dafür so wichtig war zu lernen, dann würde sie das eben tun; so schwer es ihr auch fiel.
Bald war es für ihre Eltern höchste Zeit, den Heimweg anzutreten. Der Himmel färbte sich bereits rötlich und kündigte die Dämmerung an. Wie immer begleiteten Hanh und Tao ihre Eltern ein Stück die Straße entlang. Ein paar andere Kinder, die ihren Besuch verabschiedeten, liefen mit. Ein letzter Kuss. Eine letzte Umarmung. Dann suchte sich Hanhs Mutter eine erträgliche Position auf dem Gepäckträger. Aufrecht saß sie da, ihre Beine leicht angewinkelt, und winkte.
»Lauft zurück!«, sagte der Vater, während er sich auf sein altes Fahrrad schwang und in bedenklichen Schlangenlinien anfuhr. Dann, als er sein Gleichgewicht gefunden hatte, rückte er seinen Reishut zurecht und trat sicher und kraftvoll in die Pedale.
»Und lernt gut!«, rief die Mutter. Ihr Gesicht war im Schatten des Reishutes nicht mehr zu erkennen. Aber Hanh erahnte ihr Lächeln, um das sie sich bemühte, als sie ihnen zuwinkte. Hanh und Tao liefen dem Fahrrad nach, winkten und lächelten ebenfalls so gut es ging. Plötzlich blieb Tao stehen.
»Hanh«, keuchte sie, »ich kann nicht mehr.« Hanh nahm Taos Hand, und zusammen blickten sie ihren Eltern nach, die rasch zu kleinen Punkten unter anderen kleinen Punkten wurden. Hanh kniff die Augen zusammen und versuchte, sie so lange wie möglich im Blick zu behalten. Von einer Sekunde zur nächsten waren sie verschwunden. Schweigend stand die Kindergruppe in der sich herabsenkenden Dunkelheit. Hanhs Herz war so schwer, dass sie unter seinem Gewicht auf ihre Knie sank und Tao an sich drückte. Ihre kleine Schwester küsste sie auf die Stirn, wie es sonst die Eltern taten. Hanh sah sie an und wischte der Kleinen mit ihrem Ärmel das Gesicht sauber, in dem Tränen kleine Kanäle durch den Staub auf ihren Wangen gezogen hatten. Immer mehr Kinder begannen zu weinen, die meisten lautlos. »Ich bringe euch zu Phong«, sagte Hanh bestimmt. »Er erzählt euch eine Geschichte.« Widerspruchslos folgten ihr alle.
Phong staunte nicht schlecht, als die kleine Prozession bei ihm ankam. Aber er zögerte nicht und begann zu erzählen, noch ehe alle Kinder sich auf dem Boden niedergelassen hatten. Eine Weile hörte Hanh zu, dann erhob sie sich und setzte sich allein hinter eine der Bambushütten. Jedes Wort, das sie heute mit ihren Eltern gesprochen hatte, rief sie sich ins Gedächtnis, jeden Blick und jede Berührung. Das letzte Bild ließ sie nicht los. Ihre Eltern auf dem schwankenden Rad, mit dem sie dennoch zielstrebig der Nacht entgegenfuhren. Hanh legte ihren Kopf auf die Knie und ließ ihren Tränen freien Lauf. Ein paar Meter entfernt, verborgen im Dunkel, stand Tuan, der sie beobachtete. Zögernd ging er einen Schritt auf Hanh zu. Und noch einen. Doch dann rief die Bäuerin nach Hanh, und als diese aufstand und sich den Staub aus den Kleidern klopfte, hielt sie den Schatten, der in die Büsche huschte, für ein nächtliches Tier.
Frankfurt a.M., Sommer 2015
Mit einem Seufzen ließ sich Tuyet auf ihren Schreibtischstuhl fallen und streifte ihre High Heels von den Füßen. Bis zum Mittag hatte die Besprechung gedauert und ihre Chefin, Irene Haller, hatte mehr als deutlich gemacht, dass der Fall schleunigst abgeschlossen werden musste.
»Mit anderen Worten, morgen früh muss die einstweilige Verfügung fertig sein«, hatte sie zu Tuyet gesagt. »Schaffst du das?«
»Kein Problem«, hatte Tuyet ohne zu zögern geantwortet, während es hinter ihren Schläfen pochte. Wenn sie als jüngste Mitarbeiterin dieser angesehenen Wirtschaftskanzlei ernst genommen werden wollte, musste sie hervorragende Arbeit leisten, vor allem, weil sie aufgrund ihrer zierlichen Erscheinung und ihres jugendlichen Aussehens stets für eine Referendarin gehalten wurde.
»Wo ist denn die echte Anwältin?«, hatte ihr Mandant Joachim Schleicher süffisant lächelnd gefragt, als sie ihn zum ersten Gespräch empfing.
»Ich bin Ihre Anwältin«, hatte Tuyet gepiepst und hätte sich dafür ohrfeigen können, dass ihre Stimme mindestens zwei Tonlagen höher klang als gewöhnlich. Schleichers in Falten gezogene Stirn verriet ihr, dass weder das strenge, graue Kostüm noch das sorgfältig aufgelegte Make-up den gewünschten Effekt erzielte, älter auszusehen. Immerhin hatte ihr Mandant ohne einen weiteren abfälligen Kommentar Platz genommen, Tuyet war jedoch klar, dass sie eine Bewährungsprobe zu bestehen hatte. Seit diesem Tag raubte Joachim Schleicher ihr den Schlaf.
Mit einer leichten Massage versuchte Tuyet, ihre Kopfschmerzen zu vertreiben, denn einen Migräneanfall konnte sie sich jetzt nun wirklich nicht leisten. Ruhig, Tuyet. Entspann dich und denk an etwas Schönes. Aus einer Schublade zog sie eine Packung Paracetamol hervor und schluckte eine Tablette. Dann trat sie an die komplett verglaste Fensterfront und blickte auf die Frankfurter Skyline. Bereits während ihres Referendariats hatte sich Tuyet in diese Aussicht verliebt. Als sie nach dem Examen eingestellt wurde und ihr neues Büro betrat, jubilierte sie innerlich.
Insbesondere am späten Abend, wenn alle anderen heimgegangen waren, genoss sie es, nicht in irgendeiner Klitsche gelandet zu sein, sondern es gleich nach dem Studium in eine Kanzlei geschafft zu haben, in der jeder Winkel Erfolg ausstrahlte. Zum Nachdenken zog sie gerne ihren Stuhl dicht ans Fenster, stellte ihre Fußsohlen gegen das kühle Glas, nippte an einer Tasse Tee und betrachtete die erleuchtete Stadt. Ihr gefiel das Sommernachtsflair, das Paare und Gruppen junger Leute verbreiteten, die über die angestrahlten Brücken schlenderten oder am Flussufer Bier tranken und Gitarre spielten. Trotzdem war Tuyet stolz darauf, dass sie Wichtigeres zu tun hatte und fühlte sich mit denjenigen verbunden, die hinter den erhellten Fenstern der Hochhäuser zu später Stunde Berichte schrieben oder Entscheidungen trafen.
»Tuyet, du hast dein Handy im Konferenzraum vergessen.«
Aus ihren Träumen gerissen, fuhr sie herum. Grinsend streckte Stella ihr ein klingelndes Handy entgegen, das im selben Augenblick verstummte, als Tuyet danach griff. Stella war zwar nicht viel älter als sie, aber noch nie war jemand auf die Idee gekommen, sie wäre eine Referendarin.
»Danke. Ich hab’s noch gar nicht vermisst.«
»Dabei hätte ich geschworen, dass du dich nicht mal nachts von ihm trennst.« Die Kollegin lachte.
Während Tuyet zu ihrem Platz zurückkehrte, kontrollierte sie den verpassten Anruf. Julian, ihr Bruder. Rasch drückte sie seine Nummer und er nahm ab.
»Ja?«
»Hallo, ich bin’s, Tuyet. Tut mir leid …«
»Schon gut. Warte mal einen Moment.«
Im Hintergrund vernahm Tuyet das Scheppern von Tellern und energische Frauenstimmen. Dann klappte eine Tür und es war ruhig.
»Bist du im Krankenhaus?«
»Ja.«
Tuyet wartete darauf, dass er weitersprach, doch es entstand eine Pause. Ihr Blick fiel auf die geöffnete Datei von Joachim Schleicher und einen Tippfehler, den sie bisher übersehen hatte. Ihr Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt, verbesserte sie ihn und fragte: »Wie geht es Mom?«
Tuyet hörte, dass sich Julian eine Zigarette anzündete.
»Sie möchte, dass du herkommst«, gab er zur Antwort. »Papa fährt nach Hause, um zu duschen und einzukaufen. Ich muss etwas an der Uni erledigen. Dann komme ich zurück und bleibe nachts bei ihr.«
»Wieso über Nacht? Die Lungenentzündung ist doch besser geworden.«
Julian hustete, als hätte er sich am Zigarettenrauch verschluckt. Dann sprach er weiter, wobei seine Stimme belegt klang.
»Die Lungenentzündung ist nicht das Problem. Jedenfalls nicht das größte. Der Krebs ist zurück. Massiv. Sie ist voller Metastasen. Und sie weiß es.« Den letzten Satz presste er mühsam hervor.
Tuyet starrte auf den Bildschirm, bis Joachim Schleichers Name vor ihren Augen zu flimmern begann. Natürlich hatten die Ärzte sie vorgewarnt, dass der Krebs wiederkehren könnte. Aber sie hatten auf irgendeine Art von Gerechtigkeit gehofft, die Marina nach all dem, was sie durchgestanden hatte, weiteres Leiden ersparte.
»Unmöglich! Mom ist regelmäßig zu ihren Untersuchungen gegangen und nie war etwas. Julian! Sie ist doch zu diesen Untersuchungen gegangen, oder?«
Ihr Bruder schluchzte so heftig, dass er nicht sprechen konnte. Als er sich unter Kontrolle hatte, antwortete er: »Ich glaube schon. Aber denkst du, nur weil ich zu Hause wohne, bekomme ich alles mit? Du weißt doch, wie Mom ist. Eher würde sie sich die Zunge abbeißen, als uns mit schlechten Nachrichten zu behelligen.« Seine Stimme zitterte. »Kommst du jetzt?«
»In einer halben Stunde bin ich da«, versprach Tuyet.
Nachdem sie das Gespräch beendet hatte, schloss sie ihre brennenden Augen. Vier Jahre lang hatte ihre Mutter entschlossen gegen ihre Krankheit gekämpft. Obwohl die Operationen und Behandlungen sie auslaugten, hatte sie es fertig gebracht, immer wieder daran zu glauben, den Krebs besiegen zu können. Diese Hoffnung war ihr nun geraubt worden, und ohne sie, das ahnte Tuyet, fehlte ihrer Mutter die Kraft, weitere Torturen zu ertragen. Mom wird sterben, dachte Tuyet, und eine bisher nicht gekannte Verzweiflung überfiel sie und versetzte sämtliche ihrer Organe in Aufruhr. Sie starrte auf den Main, der so ungerührt dahinfloss, als sei nicht gerade eben gnadenlos eine Bombe in Tuyets Welt explodiert. Tränen stiegen ihr in die Augen, doch Tuyet legte ihren Kopf in den Nacken und hielt sie tief durchatmend zurück. Mit einem Mal verflüchtigte sich ihr Drang zu weinen, und nichts als Leere blieb zurück. Das war ihr recht, denn so musste sie sich nicht dem Gedanken stellen, dass sie dabei war, ihre Mutter zu verlieren, den Menschen, der ihr, seit sie denken konnte, den größten Halt gab, liebevoll und vor allem bedingungslos. Wieder wurden ihre Augen feucht, doch ermahnte sie sich, nicht verheult bei ihrer Mutter zu erscheinen. Stark und handlungsfähig zu bleiben, war das einzige, womit sie ihr helfen konnte.
Mechanisch schluckte Tuyet noch eine Paracetamol, steckte die Packung in ihre Handtasche und sammelte ihre Geldbörse, Taschentücher und den Stick mit Schleichers Dateien zusammen.
»Geht es dir gut?« Sorgfältig zog Stella ihre Lippen rot nach und warf einen prüfenden Blick zuerst in ihren Handspiegel, dann auf Tuyet. Rasch beugte sich diese hinab und zog sich ihre Schuhe an. Vor allem aber wich sie Stellas blauen Augen aus, denn ein Tick zu viel Mitgefühl in ihnen und Tuyets Dämme würden brechen.
»Mein Bruder braucht eine Ablösung. Ich fahre in der Mittagspause schnell ins Krankenhaus.«
Ihre Stimme klang tonlos, fremd sogar, aber entweder bemerkte ihre Kollegin nichts oder sie war taktvoll, denn zu Tuyets Erleichterung drang Stella nicht weiter in sie.
»Vergiss nicht, etwas zu essen.«
Im Hinausgehen legte Stella Tuyet einen Schokoriegel auf den Schreibtisch. »Du hast zurzeit ganz schön viel um die Ohren. Kann ich dir irgendwie helfen?«
Tuyet winkte ab. »Nein, danke. Diese Verfügung für Herrn Schleicher schreibe ich heute Abend zu Ende. Das schaffe ich schon.«
Stella sah so aus, als wolle sie etwas erwidern, ließ es dann aber. Freundlich winkte sie Tuyet zu und verschwand dann mit ein paar anderen Anwälten zum Mittagessen.
Vorsichtig, um ihre schlafende Mutter nicht zu stören, stellte Tuyet einen Stuhl an deren Bett. In ihrem Zimmer war es still, der lange, orangene Vorhang bewegte sich leicht und sorgte für ein beruhigendes Licht. Das zweite Bett stand leer und Tuyet war froh darüber, mit ihrer Mutter allein sein zu können. Ihr Gesicht hob sich erstaunlich rosig von den weißen Kissen ab. Zweifellos sah Marina gesünder aus als zwei Tage zuvor. Es war kaum zu glauben, dass sie voller Metastasen sein sollte. Ihr Haar hatte wieder Schulterlänge erreicht, allerdings war es jetzt grau statt braun. »Total egal«, hatte Marina dazu gesagt, »Hauptsache irgendetwas sprießt auf meinem Kahlkopf.«
Tuyet küsste ihre Mutter auf die Stirn. Sie fühlte sich kühl an. Wie hatte sie es geschafft, vor ihnen zu verbergen, wie krank sie war? Oft war sie müde gewesen, ja, aber das erschien Tuyet nach all den Strapazen verständlich. Wann immer sie ihre Mutter zu Hause besucht hatte, wirkte diese aufgeräumt und schien das Leben zu genießen.
Plötzlich fiel Tuyet eine Kindheitsszene ein, als sie ihre Mutter beschworen hatte: »Was ich dir jetzt sage, darfst du niemandem weitererzählen!«
Was es gewesen war, war Tuyet längst entfallen, aber sie erinnerte sich daran, dass Marina ihr einen zärtlichen Nasenstupser verpasst hatte.
»Nichts davon kommt je über meine Lippen, mein Schatz.«
»Wirst du dich auch nicht verplappern?«
»Natürlich nicht! Ich bin die beste Geheimnishüterin, die du dir vorstellen kannst. Glaubst du, ich hätte damals aus der DDR fliehen können, wenn ich ein Plappermaul gewesen wäre? Bis zu dem Tag, als es losging, habe ich so getan, als wäre alles ganz normal.«
Ja, Julian hatte Recht, so war ihre Mutter. Während in ihr der Krebs wütete, mimte sie die Genesende, nur, um ihrer Familie das Leben zu erleichtern.
Eine kühle Hand erfasste die ihre und Tuyet stieß einen kleinen Schreckensschrei aus. Ihre Mutter hatte die Augen geöffnet und lachte leise.
»Liebling, was ist los? Dachtest du, ich sei schon gestorben und eine Tote greift nach dir?«
»Mom, hör auf, das ist nicht witzig.«
Tuyet setzte sich auf Marinas Bett und streichelte deren Hand.
»Es tut mir leid, Liebes. Aber da ich nicht bete, muss ich mich anders bei Laune halten. Pietätlose Scherze helfen.«
Sie lächelte Tuyet an.
»Du weißt Bescheid?«
Tuyet nickte, sprechen konnte sie nicht. Ihre Traurigkeit schnürte ihr den Hals so fest zu, dass sie glaubte, daran zu ersticken. Und dann schaffte sie es nicht mehr, sich zu beherrschen. Wie ein Kind, das hoffte, seine Mutter könnte die Welt in Ordnung bringen, weinte sie, ihren Kopf auf Marinas Brust gebettet. Ihre Mutter streichelte sie und summte dabei eine vertraute Melodie, ein Schlaflied, das Tuyet fast vergessen hatte. Ewig hätte sie so liegen wollen, jedenfalls so lange, bis Marina alles Schreckliche fortgestreichelt hätte. Sorgen und Angst, ihre Krankheit. Den Tod.
Auf einmal schämte sie sich dafür, dass sie sich gehen ließ, während ihre todkranke Mutter sie tröstete. Sie richtete sich auf und strich Marina eine graue Strähne aus dem Gesicht. Auch ihr liefen die Tränen hinab, aber als Tuyet sie anschaute, wischte sie sie fort.
»Gib mir ein Taschentuch«, bat sie. »Und putz dir die Nase.«
Früher hätte Tuyet erwidert, dass sie fast dreißig und erwachsen genug sei, das selbst zu entscheiden. Jetzt sagte sie: »Ich kann mir keine bessere Mutter wünschen.«
Marina hörte auf, ihre Nase zu betupfen, und zerknautschte das Taschentuch.
»An deine richtige Mutter kannst du dich gar nicht erinnern. Bedauerst du das manchmal?«
Tuyet schüttelte ihren Kopf.
»Wozu? Mir fehlt nichts. Du bist meine Mutter. Niemand sonst.«
»Komm dicht zu mir«, forderte Marina ihre Tochter auf und rückte zur Seite. Tuyet quetschte sich neben sie auf die schmale Matratze, zuerst etwas steif, da sie fürchtete, ihrer Mutter durch eine unbedachte Bewegung weh zu tun. Doch als Marina aufmunternd an ihrem Ärmel zupfte, kuschelte sie sich an sie und beide Frauen hielten sich fest umschlungen.
»So ist es gut«, sagte Marina. »Jetzt können wir reden.«
Eine Schwester kam herein und verabreichte Pillen.
»Brauchen Sie noch etwas, Frau Neumann?«
»Nur Zeit«, antwortete Marina. Die Schwester nickte verständnisvoll und schloss leise die Tür. Ihre Mutter streichelte Tuyets verquollenes Gesicht.
»Der Krebs attackiert mich von allen Seiten. Ich habe mich ergeben und empfinde Frieden. Dabei helfen natürlich auch die Schmerzmittel, die ich nehme.«
Tuyet setzte sich auf. »Aber irgendetwas muss man doch tun!«
»Nichts, außer meinen Abschied zu erleichtern.« Marina seufzte. »War es ein Fehler, dass ich nicht früher mit euch gesprochen habe? Aber dann wären alle viel länger traurig gewesen. Für die wunderbar normalen Monate, die wir noch miteinander hatten, bin ich mehr als dankbar.«
Sie hustete und Tuyet reichte ihr ein Glas Wasser.
»Mom, du solltest dich schonen.«
Die Mundwinkel ihrer Mutter zuckten. »Wofür genau? Schon gut, ich reiße keine makabren Witze mehr. Sorg dich nicht, mir geht es wirklich gut. Heute habe ich sogar zu Mittag gegessen.«
Tuyet legte sich wieder hin und weinte lautlos.
»Mit Phong habe ich alles Nötige geklärt. Er weiß, wie ich beerdigt werden möchte. Wir zwei wollen lieber über unser gemeinsames Leben sprechen. Bist du einverstanden?«
In ihrem Gedächtnis nach fröhlichen Kindheitserlebnissen zu kramen, während ihre Mutter im Sterben lag, kam Tuyet unpassend vor. Am liebsten wäre sie in ihre Gefühlsleere abgetaucht, die viel leichter zu ertragen war als tausend schöne Erinnerungen. Doch je mehr ihr davon einfielen und je häufiger sie sich mit Marina nicht einigen konnte, ob ein Kleid blau oder rot gewesen war, ob sie ihr Fahrrad zum siebten oder achten Geburtstag bekommen hatte, desto tröstlicher empfand sie es, diesen wertvollen Alltagsschatz zu teilen. Fest umklammert hielten sie sich, weinten zusammen, manchmal lachten sie über eine Anekdote. Als es Abend wurde, war Tuyet bereit sich einzugestehen, dass Julians Anruf sie nicht aus heiterem Himmel getroffen hatte. In ihrem tiefsten Inneren hatte sie gefürchtet, dass es Marina nicht so gut ging, wie es den Anschein hatte. Doch sie hatte es nicht wahrhaben wollen.
Als sie annahm, ihre Mutter sei eingeschlafen, kontrollierte Tuyet die Nachrichten auf ihrem Handy. Sie übersprang die von Stella und las Julians, der wissen wollte, wann sie das Krankenhaus verlassen würde.