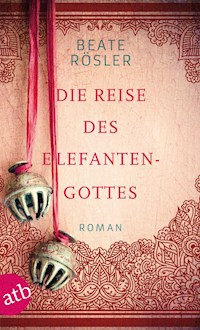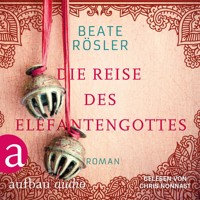12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Reise des Elefantengottes
Bis heute weiß die 39-jährige Priyanka nicht, weshalb ihre Mutter Asha als junge Frau aus Indien nach Berlin fliehen musste. Fast hat sie sich damit abgefunden, dass ihr Ashas Vergangenheit für immer verschlossen bleibt, bis sie von ihrem Mann eine Reise nach Delhi geschenkt bekommt. Priyanka reist allein, nur der kleine Elefantengott, das einzige Andenken ihrer Mutter an die Heimat, begleitet sie. In Neu-Delhi taucht sie in eine farbenprächtige fremde Welt ein und stößt auf ein dunkles Geheimnis. Doch weshalb stoßen auch hier ihre Fragen stets gegen eine Wand aus Schweigen?
Die hochemotionale Geschichte zweier Frauen vor der leuchtenden Kulisse Indiens.
Die Töchter des Roten Flusses
Nach dem Tod ihrer Stiefmutter findet Tuyet Briefe ihrer Mutter aus Vietnam. Wollte sie den Kontakt zu ihrer Tochter also doch nicht abbrechen? Auf der Suche nach Antworten reist Tuyet von Frankfurt nach Hanoi, der Stadt am Roten Fluss, wo sie die junge Linh kennenlernt und tief in die fremde Exotik ihrer Heimat eintaucht. Als sie eines Tages Linhs Mutter kennenlernt, die als Vertragsarbeiterin in der ehemaligen DDR gelebt hatte, ist Tuyet ihrer Vergangenheit plötzlich viel näher, als sie ahnt…
Exotisch und farbenprächtig: Ein bewegendes Familienepos zwischen Deutschland und Vietnam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Reise des Elefantengottes:
Der Geschmack von rotem Curry… Bis heute weiß die 39-jährige Priyanka nicht, weshalb ihre Mutter Asha als junge Frau aus Indien nach Berlin fliehen musste. Fast hat sie sich damit abgefunden, dass ihr Ashas Vergangenheit für immer verschlossen bleibt, bis sie von ihrem Mann eine Reise nach Delhi geschenkt bekommt. Priyanka reist allein, nur der kleine Elefantengott, das einzige Andenken ihrer Mutter an die Heimat, begleitet sie. In Neu-Delhi taucht sie in eine farbenprächtige fremde Welt ein und stößt auf ein dunkles Geheimnis. Doch weshalb stoßen auch hier ihre Fragen stets gegen eine Wand aus Schweigen? Die hochemotionale Geschichte zweier Frauen vor der leuchtenden Kulisse Indiens.
Die Töchter des Roten Flusses:
Zwischen uns die halbe Welt… Nach dem Tod ihrer Stiefmutter findet Tuyet Briefe ihrer Mutter aus Vietnam. Wollte sie den Kontakt zu ihrer Tochter also doch nicht abbrechen? Auf der Suche nach Antworten reist Tuyet von Frankfurt nach Hanoi, der Stadt am Roten Fluss, wo sie die junge Linh kennenlernt und tief in die fremde Exotik ihrer Heimat eintaucht. Als sie eines Tages Linhs Mutter kennenlernt, die als Vertragsarbeiterin in der ehemaligen DDR gelebt hatte, ist Tuyet ihrer Vergangenheit plötzlich näher, als sie ahnt… Exotisch und farbenprächtig: Ein bewegendes Familienepos zwischen Deutschland und Vietnam.
Über Beate Rösler
Beate Rösler, geboren 1968 in Essen, studierte romanische Sprachen in Berlin und arbeitet heute als Deutschlehrerin am Goethe-Institut in Frankfurt/Main. Seit 2014 lebt sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Hanoi. Im Aufbau Taschenbuch sind bisher ihre Romane „Die Reise des Elefantengottes“ und "Die Töchter des Roten Flusses" erschienen.
ABONNIEREN SIE DENNEWSLETTER DER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Beate Rösler
Die Reise des Elefantengottes &Die Töchter des Roten Flusses
Zwei Romane in einem E-Book
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Über Beate Rösler
Die Reise des Elefantengottes
Prolog
Asha
Teil 1: Aufbruch
Priyanka
Asha
Priyanka
Priyanka
Marc
Priyanka
Asha
Asha
Teil 2: Heimkehr
Priyanka
Asha
Priyanka
Asha
Priyanka
Marc
Asha
Priyanka
Marc und Asha
Priyanka
Priyanka
Priyanka
Marc
Priyanka
Priyanka
Priyanka
Epilog
Asha
Danksagung
Die Töchter des Roten Flusses
Prolog
Frankfurt a. M., Sommer 2015
Hanoi, Oktober 2015
Hanoi, Dezember 1972
Hanoi, Oktober 2015
Hanoi, 1978
Berlin, 1980
Hanoi, Herbst 1980
Berlin, 1980/1981
Hanoi, Dezember 2015
Berlin, 1985 bis 1990
Hanoi, Dezember 2015 bis Januar 2016
Hanoi, Sommer 1993
Hanoi, Februar – April 2016
Epilog Frankfurt a. M., Juni 2016
Anhang
Dank
Impressum
Wer von diesen Romanen begeistert ist, liest auch ...
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Die Reise des Elefantengottes
Die Töchter des Roten Flusses
Impressum
Beate Rösler
Die Reise des Elefantengottes
Roman
Für Christian, der das Reisen liebt, und Tanya
Prolog
Asha
zirka 10000 Meter über Indien, November 1968
Asha umklammerte die Armstützen ihres Sitzes. Das Flugzeug jagte durch graue Wolken, die alle anderen Farben verschluckt hatten. Es sackte ruckartig ab, stieg wieder auf und fiel dann erneut in die Tiefe. Ashas Herz schlug gegen ihre Rippen, als wolle es aus der Enge des Brustkorbes ausbrechen, und ihr Blut hämmerte gegen ihre Schläfen. Sie starrte aus dem Fenster, bemüht, gleichmäßig zu atmen, um ihre Angst in Schach zu halten. »Jetzt sterbe ich«, dachte sie, und ihr liefen Tränen die Wangen hinunter.
»Die Götter spielen mit uns«, dachte sie. Sie wischte sich die Tränen ab und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich aus ihrem dicken, geflochtenen Zopf gelöst hatte. Sie glaubte nicht, dass sie Deutschland jemals erreichen würde.
Wieder ruckelte die Maschine so heftig, als würden von allen Seiten mächtige Pranken an ihr zerren. Ihr wurde übel. Gut, dass sie darauf bestanden hatte, vor ihrer Abreise in den Tempel zu gehen und den Elefantengott Ganesha zu ehren. Er beschützte die Reisenden und brachte Glück, ein Gedanke, der sie ein wenig tröstete. Ihre kleine Ganesha-Figur lag über ihrem Kopf im Handgepäck. Wie gerne würde sie den Elefantengott jetzt festhalten. Aber das Flugzeug wackelte so stark, dass sie sich nicht traute, aufzustehen oder Karl zu bitten, ihr die Tasche herunterzuholen.
Plötzlich waren die Wolken verschwunden, und Asha blickte auf die graue Fensterklappe, die Karl heruntergezogen hatte. »Ich glaube, du solltest dir das Gewitter nicht länger anschauen«, sagte er auf Englisch und lächelte. Asha nickte, zupfte ihren gelben Sari zurecht und schloss die Augen. Eine Weile gab sie sich dem Gefühl ihrer Machtlosigkeit hin. Nichts konnte sie ändern, weder an dem Unwetter noch an dem Unglück, das ihre Familie heimgesucht hatte. Noch einmal ruckelte es heftig, die Götter schienen sie nicht fortlassen zu wollen. Sie musste aber fort.
Weit fort, für immer.
Sie spürte, dass sich die Härchen auf ihren Armen aufstellten, wickelte ihren Schal noch enger um die Schultern und trocknete sich dabei ihre verschwitzten Handflächen ab. Nach einem weiteren heftigen Ruck glitt das Flugzeug plötzlich ruhig dahin, und durch das gleichmäßige Rauschen der Triebwerke beruhigte sich ihre Atmung allmählich. Der Pilot verkündete, dass sie ihre vorläufige Flughöhe erreicht und die Turbulenzen hinter sich gelassen hätten. Erleichtert öffnete Asha ihre Augen und sah, dass viele Passagiere aufgestanden waren, um die Toilette aufzusuchen oder um etwas aus ihren Gepäckfächern zu holen. Hier und da lachte jemand auf, ein Baby weinte. Asha schob die graue Fensterklappe nach oben. Die Helligkeit der Sonne und das klare Blau des Himmels trafen sie so unerwartet, dass sie blinzeln musste. Indien – oder war es bereits Pakistan, über das sie hinwegflogen? – lag unter einer dichten Wolkendecke verborgen. Menschen und Häuser, Liebe und Kummer, alles hatte sie zugedeckt, als gäbe es hier oben nichts außer diesem unendlichen Blau, an dem sie vorbeizogen wie ein Vogel über die Weite des Ozeans. Der Anflug einer unbekannten Neugier regte sich in Asha. Ein schönes Gefühl, jedoch nur von kurzer Dauer, denn sofort fielen Erinnerungen an ihre Familie über sie her, die Schreie des Vaters, das Wimmern der Mutter, der starre Blick ihres jüngeren Bruders Rohit, vor allem aber die Todesangst in den Augen ihrer Schwester Neha. Wenige Minuten, die alles verändert hatten. Ashas Magen krampfte sich zusammen und sie kämpfte ein Stöhnen nieder, das sie fast erstickte.
Am Tag zuvor im Tempel hatte sie im Stillen darum gefleht, noch ein einziges Mal neben ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Neha zu stehen, obgleich sie wusste, dass dies nie wieder geschehen würde. Sie waren meistens gemeinsam zur Puja gegangen, hatten die Götter geehrt und danach das Abendessen für die Familie vorbereitet. Arjun, Sakshi und Aditi, Nehas Kinder, rannten dabei vergnügt lachend durch die Zimmer und versuchten Gemüsestückchen zu stibitzen. Ihre Großmutter rügte sie dafür, aber man sah an dem Lächeln ihrer Augen, dass sie es nicht böse meinte.
Während der Tempelzeremonie war es Asha so vorgekommen, als bohrten sich Blicke in ihren Rücken. Doch als sie sich umschaute, ängstlich und hoffend, standen dort nur Fremde. Draußen wartete Karl, der ihre Hand nehmen wollte, aber sie zuckte zurück. »Entschuldige«, sagte er schnell, »ich vergesse manchmal, dass das nicht geht.« Sie waren zu Karls indischen Freunden gegangen, bei denen sie die letzte Nacht vor ihrem Abflug verbrachten.
Asha rieb sich die Augen und versuchte, sich auf die Aussicht zu konzentrieren. Das Flugzeug schien ihr auf einmal ein fliegendes Gefängnis zu sein, aus dem es kein Entrinnen gab. Eine kräftige Hand legte sich auf die ihre. Trocken und warm umschloss sie ihre kalten Finger und massierte sie vorsichtig. Asha blickte zur Seite, direkt in Karls braune Augen, die sie so gerne mochte. Jetzt kamen sie ihr fremd vor. Er lächelte sie an, strich ihr die widerspenstige Haarsträhne hinters Ohr und legte ihren Zopf, der, wenn sie aufrecht stand, bis an die Oberschenkel reichte, sanft über ihre Schulter. Karl hatte schon einige Male den Kontrast ihrer schwarzen Haare auf den leuchtenden Farben ihrer Saris bewundert. Asha fand nichts Besonderes daran. Die meisten Frauen, die sie kannte, kleideten sich in bunten Farben und hatten langes, dunkles Haar.
Asha drückte kurz seine Hand, entzog sie ihm langsam und lächelte ebenfalls. Dann warf sie einen Blick auf die Mitreisenden neben ihnen, ein indisches Ehepaar mit einem Baby. Das Baby schlief und seine Eltern unterhielten sich leise miteinander. Sprachen die beiden über Karl und sie? Hatten sie gesehen, dass Karl ihre Hand gehalten und ihr Haar berührt hatte? Ashas Gesicht glühte und sie wandte sich ab.
Eine blonde Stewardess bot ihnen Getränke an. Karl bestellte eine Tasse schwarzen Kaffee und reichte Asha einen Becher Tee. Sie nahm ihn dankbar an, nippte an dem heißen Getränk und spürte, wie sich die wohltuende Wärme in ihr ausbreitete.
»Thank you«, sagte sie. »You’re welcome. Gern geschehen«, antwortete Karl. In Deutschland würde sie Karls Sprache lernen.
Kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, erklärte ihr Karl einmal begeistert, dass Deutsch und Sanskrit in ihren Wurzeln verwandt seien. Asha sagte ihm nicht, dass ihr Sanskrit-Lehrer sie immer gerügt hatte, weil sie Hindi und Englisch weitaus mehr Interesse entgegenbrachte als der Alt-Indischen Sprache.
Asha nahm noch einen Schluck Tee und blickte wieder aus dem Fenster. Die Wolken waren durchsichtiger geworden und am Horizont war eine gewaltige Gebirgskette, vermutlich der Himalaya, zu sehen. Asha stellte ihren leeren Becher ab und flüsterte: »Unglaublich. Ohne Zweifel ein Heim der Götter.« Da erinnerte sie sich an Ganesha, stand auf und zwängte sich an Karl vorbei. Die Frau mit dem Baby lächelte sie an. Asha nickte ihr zu, und holte endlich die Figur des Elefantengottes aus ihrem Gepäck. Dabei fiel ein Foto heraus, das ebenfalls in ihrer Tasche gelegen hatte. Sie hob es auf, und strich es vorsichtig glatt. Es war das Einzige, was ihr von ihrer Familie geblieben war, das Einzige, was ihr helfen würde, die Gesichter der geliebten Menschen nicht zu vergessen. Schon jetzt hatte sie Schwierigkeiten, sich ihre Eltern genau vorzustellen. Dabei lag das alles nicht mal zwei Wochen zurück.
Das Foto war vor ihrem Elternhaus aufgenommen worden. Ihre Eltern und Großeltern saßen, eingerahmt von Onkeln und Tanten zwischen zwei Palmen. Hinter ihnen stand sie selbst mit ihren Geschwistern Rohit und Neha und einigen Cousinen und Cousins. Neha hatte die kleine Aditi auf dem Arm. Arjun, Sakshi und die anderen Kinder saßen in der ersten Reihe auf dem Boden. »Wie ernst wir alle aussehen«, dachte Asha. Dabei war es ein vergnüglicher Tag gewesen, den sie im Lodhi Garden, Delhis schönstem Park, mit einem Picknick verbracht hatten. Asha hatte die Kinder mit abenteuerlichen Geschichten unterhalten, und Tante Shweta, die älteste Schwester ihrer Mutter, hatte gelacht und gesagt, dass sie Märchenerzählerin werden sollte. Hatte ihr Onkel an diesem Nachmittag nicht sogar zum ersten Mal von dem Sohn seines Geschäftspartners erzählt? Sie hatte nur gehört, dass ihr Vater sagte: »Du hast recht. Asha ist sechzehn, und es ist an der Zeit über ihre Zukunft nachzudenken.« Asha hatte kurz aufgehorcht, sich aber keine weiteren Gedanken gemacht. Viel spannender war es, mit ihren Nichten und Neffen zu spielen oder den Gesprächen der Frauen zuzuhören.
Das war jetzt etwas mehr als zwei Jahre her. Asha schien es, als erinnerte sie sich an ein Leben aus einer längst vergangenen Zeit. Sie hätte nie damit gerechnet, dass sie so bald auf sich gestellt sein würde, allein, auf dem Weg in ein fremdes Land, ohne den sicheren Rückhalt ihrer Familie und an der Seite eines Mannes, den sie kaum kannte. Was wäre aus ihr geworden, wenn der deutsche Student ihr nicht ohne zu zögern geholfen hätte? Asha fühlte einen stechenden Schmerz in ihrer Brust. Sie spürte, dass ihr die Tränen kamen und einige Mitreisende sie beobachteten. Rasch legte sie das Foto in ihre Tasche zurück und setzte sich wieder auf ihren Platz. »Na«, flüsterte Karl ihr zu und klang jetzt etwas schläfrig, »ist das dein Glücksbringer?« Asha sah ihren Begleiter ernst an. »Ganesha schützt die Reisenden«, antwortete sie, »und er hilft uns, wenn wir etwas Neues beginnen.«
»Na, dann passt er doch perfekt!«, murmelte Karl und gähnte. Asha strich Ganesha über seinen Elefantenrüssel und flüsterte: »Bitte, nimm’ ihm seine Scherze nicht übel.« Dann lehnte sie sich zurück, gestattete ihren Augenlidern schwer zu werden und schlief ein.
Teil 1: Aufbruch
Priyanka
Berlin, Montag, 16. März 2009
Meine indische Großmutter, die ich leider nie kennengelernt habe, wusste ihr Leben lang nicht, welcher Tag ihr Geburtstag war. Hat sie sich wohl je Gedanken über ihr wahres Alter gemacht? Vielleicht nicht.
Als mich das Klingeln meines Weckers an diesem sechzehnten März weckte, bestand kein Zweifel: Ich wurde heute neununddreißig und hatte bis zum Abend noch einiges zu tun. Hätte ich gewusst, dass dieser Tag der Beginn einer Veränderung war, die mein Leben auf den Kopf stellen würde, wer weiß, vielleicht hätte ich die Bettdecke über mich gezogen und einfach weitergeschlafen.
An einem ganz normalen Montag nicht gleich aus meinem warmen Bett springen zu müssen, war ein tolles Gefühl. Ich reckte mich und kuschelte mich in meine Kissen. Auf meinem Schreibtisch wartete zwar die Übersetzung einer englischen Bedienungsanleitung auf mich, mit der ich noch ein ganzes Stück vorankommen wollte, aber ich hatte meine Geburtstagsparty heute Abend so gut vorbereitet, dass mein Mann Marc und ich die restlichen Vorbereitungen später mühelos hinbekommen würden. Ich hörte, wie er sich im Bad rasierte und dabei Come on Baby Light My Fire von den Doors vor sich hin summte. Marc sang schief, aber ich mochte es, im Bett vor mich hin zu dösen und ihn in der Nähe zu wissen. Intensiver Kaffeeduft stieg mir in die Nase und vermischte sich mit den eindeutigen Zischlauten unserer Espressomaschine. Marc rannte fluchend in die Küche. Mit Sicherheit war der Kaffee übergekocht. Ich grinste, fühlte mich nicht zuständig und lauschte dem Klappern des Geschirrs, das mein Mann jetzt auf unser braunes Korktablett stellte. Gleich würde er mir das Frühstück mit einer roten Rose ans Bett bringen und Happy Birthday für mich singen. Normalerweise tranken wir zusammen Kaffee, ich bekam ein neues Buch geschenkt und Marc eilte in sein Restaurant. Wie lange war das nun schon so, dass sich mein Geburtstag in genau dieser Reihenfolge abspielte? Ich glaube, es begann, als unser Sohn Felix vier oder fünf Jahre alt war. Ich fand es hinreißend, wenn sich die beiden an mein Bett schlichen, mich mit einem Geburtstagsständchen weckten und mit Frühstück verwöhnten. Wir aßen im Bett, tobten in den Kissen und am Ende war alles zerwühlt und voller Krümel. Damals hat sowas mich nie gestört. Von Marc bekam ich immer ein Buch, und von Felix ein selbstgemaltes Bild, das ich neben meinen Schreibtisch hängte. Dann wurde unser Sohn älter, und vieles, was ich so geliebt hatte, wurde ihm peinlich. Als er dreizehn Jahre alt war, weigerte er sich, Geburtstagslieder zu singen, mit fünfzehn wollte er mir kein Frühstück mehr bringen. Heute war mein Sohn neunzehn und gratulierte mir per SMS. Er leistete seinen Zivildienst in einem Altersheim bei Heidelberg und würde erst am Wochenende nach Hause kommen. Ein wehmütiges Zwicken in der Magengegend vermischte sich mit meinem Frühstückshunger.
In diesem Augenblick stieß Marc die Tür auf, rief: »tataa!« und betrat mit einem Tablett unser Schlafzimmer. »Happy birthday to you …«, schmetterte er los, und stellte das Frühstück vor mir auf der Bettdecke ab. Während er singend den Kaffee eingoss, betrachtete ich ihn. Trotz seines Bauchansatzes sah er immer noch sehr gut aus. Meine Freundin Julia pries ständig seine dynamische Ausstrahlung, am liebsten, wenn ihr Mann Max daneben saß, dessen sportliches Highlight der Woche die Sportschau war. Aber sie hatte recht. Marc war noch immer voller Energie, fast wie mit Anfang Zwanzig, als gerade Felix zur Welt gekommen war und wir noch gemeinsam im Geistesblitz, seinem Restaurant, arbeiteten. Ich küsste ihn auf die Wange. Er reichte mir einen Kaffee ohne Zucker und küsste mich zurück. »Alles Gute zum Geburtstag, Priyanka«, sagte er, »dein Geschenk bekommst du heute Abend.«
Ich lächelte. »Ist schon okay«, antwortete ich und nippte an meinem Kaffee.
»Ich dachte vorhin daran, wie ich es genossen hatte, als Felix klein war«, sagte ich, »merkwürdig, dass er jetzt endgültig ausgezogen ist.«
»Felix war schon ein lustiges Kerlchen«, stimmte Marc mir schmunzelnd zu, »allerdings«, fuhr er fort, und zwei tiefe Falten zeigten sich zwischen seinen Brauen, »erinnere ich mich auch noch sehr gut an seine grausige Pubertät, als er nur rummoserte und uns die Stimmung verdarb. Ich meine, falls er überhaupt mit uns geredet hat.«
»Bist du froh, dass er weg ist?«, fragte ich überrascht. Diese Idee war mir noch gar nicht gekommen.
»So kann man das nicht sagen. Ich bin froh, dass er weiß, was er will, und das auch tut«, antwortete Marc, und biss genüsslich in sein Croissant, »und ja, ich finde es gut, dass wir das Haus wieder für uns haben. Ich habe es lang genug mit lärmenden Kindern und muffeligen Jugendlichen geteilt, die unzählige Male mein Bier ausgetrunken und mich mit ihrer Musik zugedröhnt haben.« Marc schauderte in gespielter Verzweiflung. Ich musste lachen. Ich hatte gar nicht gewusst, dass er so dachte. »Ich erinnere mich an ganz andere Sachen«, entgegnete ich, und biss in ein Apfelstück. »Ich fand den Trubel immer schön.« Ich nahm Marcs Hand. »Und ich habe es genossen, wenn Felix’ Freunde kamen, dein Bier tranken und über Gott und die Welt diskutierten«, fügte ich hinzu, »da fühlte ich mich so mitten im Leben.« Ich stockte. Der letzte Satz hallte in meinem Kopf nach.
Marc sah auf den Wecker. »Mist, ich bin spät dran«, rief er, sprang aus dem Bett und griff nach seinem Pullover. »Wann kommen die Gäste?« Ich wartete, bis sein Kopf wieder aus dem Rollkragen aufgetaucht war, und antwortete: »Gegen sieben.« »So früh?«, fragte mein Mann erstaunt, während er seine Turnschuhe zuband. Ich verdrehte die Augen: »Das haben wir doch besprochen. Die meisten wollen montags nicht so spät ins Bett.« Marc sah mich betreten an: »Das habe ich total vergessen. Tut mir leid. Heute Abend stellt sich ein neuer Koch vor. Lennard ist nicht da, und deshalb muss ich das Gespräch führen.« Ich runzelte die Stirn und starrte auf meine Zehenspitzen. Ich war schon immer der Meinung gewesen, dass Lennard Marc ausnutzte und nie da war, wenn er ihn brauchte. »Vielleicht solltest du dir doch mal einen zuverlässigeren Geschäftspartner suchen«, nörgelte ich. »Und wenn du dir die Party deiner Frau nicht merken kannst, speichere sie doch in einem deiner elektronischen Kalender!«
Früher hatte ich Marc mit seinen blauen Augen, die »Es-soll-bestimmt-nicht-wieder-vorkommen« zu sagen schienen, fast alles verziehen. Heute reizte mich sein geknickter Blick, da ich wusste, dass er sich in diesem Punkt nie ändern würde. Mein Mann warf mir von der Tür aus eine Kusshand zu, die mich nicht versöhnte. »Sei bitte nicht sauer, Priyanka. Ich bin spätestens gegen einundzwanzig Uhr da.« Die Tür fiel ins Schloss, dann war es still.
Ich trank meinen Kaffee aus, stellte das Tablett mit den Essensresten auf meinen Nachttisch und schlug seufzend die Bettdecke zurück. Mein Handy piepte. Julia hatte eine SMS geschickt: Outfit für die Party? Ich schrieb zurück, dass von Pyjama bis Abendrobe alles erlaubt sei. Julia antwortete nicht mehr, aber sie würde bestimmt eher im Kleid als im Nachthemd auftauchen. Ich zog meinen Jogginganzug an, denn meinen letzten Geburtstag in den Dreißigern wollte ich mit einem extralangen Lauf beginnen. Danach blieb mir noch genügend Zeit, um die Salate vorzubereiten und Kuchen zu backen, auch wenn Marc mir nicht half.
Ich öffnete gerade die Haustür, als mein Handy klingelte. Die Nummer meiner Mutter. Ich nahm ab: »Hallo, Mama?«
»Happy Birthday, Priyanka«, gratulierte sie mir mit ihrer angenehm tiefen Stimme. »Hattest du einen schönen Morgen?«
»Ja, Mama, alles wie üblich«, antwortete ich ungeduldig.
»Geht es dir gut?«, hakte sie nach.
»Alles bestens, Mama. Ich bin nur etwas in Eile. Heute Abend kommen immerhin dreißig Gäste.«
»Warum feierst du nicht im kleinen Kreis? Du hast doch auch so schon genug Arbeit.«
Ich hüpfte auf und ab, um mich aufzuwärmen. »Meine Arbeit ist sehr einsam«, erklärte ich, »deshalb mag ich große Feste.«
»Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid«, erwiderte sie, »ich habe heute nichts vor. Ich könnte zu dir kommen.«
»Vielen Dank, aber das ist nicht nötig«, sagte ich, und hörte auf zu hüpfen. Asha, die sich unter vielen Menschen nicht wohlfühlte, wollte zu meiner Party kommen?
»Wir sehen uns morgen zum Kaffee, okay?«, fragte ich. Nachdem wir aufgelegt hatten, joggte ich lustlos unsere Straße entlang. Ich hatte schon einige Male den Verdacht gehabt, dass sich Asha einsam fühlte. Plötzlich tat es mir leid, dass ich ihren Vorschlag so harsch ausgeschlagen hatte. Also blieb ich stehen, verschnaufte einen Moment, zog dann mein Handy aus der Hosentasche und wählte die Nummer meiner Mutter. Sie nahm sofort ab. »Asha Weber.«
»Mama? Es wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Marc kommt erst spät, und wenn ich alles alleine mache, wird es sicher hektisch.«
»Wenn es dir hilft, komme ich gerne«, sagte meine Mutter lebhaft, »wenn du willst, backe ich ein paar Chapatis. Indisches Brot kommt immer gut an.«
»Gute Idee, Mama, bis nachher«, verabschiedete ich mich, dann joggte ich los.
Der Park, durch den ich morgens gerne lief, war um diese Zeit fast menschenleer. So konnte ich in Ruhe meine Runden drehen und meinen Gedanken nachhängen. Mein Gespräch mit Marc über Felix hatte mich berührt. In den letzten Wochen hatte ich viele Aufträge bekommen und wie verrückt übersetzt, ich hatte wenig Zeit für meine Familie gehabt. Felix pendelte an den Wochenenden zunächst zwischen Berlin und Heidelberg und erwähnte vor ein paar Wochen ganz nebenbei, dass er eine Wohngemeinschaft gefunden habe. Ab jetzt würde er nur noch selten zu Besuch kommen. Ich hatte gar nicht richtig bemerkt, dass mein Sohn ausgezogen war, zwar nicht Knall auf Fall, aber leise und endgültig. Mir kamen die Tränen, und ich lief schneller. Meine gleichmäßigen Bewegungen trösteten mich.
Auf dem Heimweg plagten mich Seitenstiche. »Ich atme nicht konzentriert«, dachte ich und verlangsamte mein Tempo. Meine Kondition würde doch nicht nachlassen, nur weil ich ein Jahr älter war? Ich hatte wirklich keine Lust, mich von diesem Thema verrückt machen zu lassen, so wie Julia, die bei jeder Gelegenheit erwähnte, wer sie wieder für Anfang dreißig gehalten hatte. Als ich von meinem Morgenlauf zurückkehrte, fand ich ein Päckchen von Felix vor der Haustür. Ich freute mich riesig, dass er mir doch nicht bloß mit einer SMS gratulierte. In der Küche presste ich mir ein paar Orangen aus und öffnete das Paket. Es befanden sich drei Tütchen mit indischem Tee aus Darjeeling darin und eine CD, auf die er in gelber Schrift »Hits of Bollywood« geschrieben hatte. Dabei lag eine Karte mit dem Bild des Elefantengottes Ganesha.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Hoffentlich bringen dich Tee und Musik gut in Stimmung. Kann ich am Wochenende jemanden mitbringen? Liebe Grüße von Felix.«
Ich legte das Paket beiseite. Jemanden mitbringen? Wieso schrieb er nicht, wen er mitbringen wollte? Während ich duschte, überlegte ich, ob Felix wohl eine neue Freundin hatte, die er uns vorstellen wollte. Als ich fertig war, kochte ich mir eine Kanne des neuen Darjeeling-Tees und ließ meinen Computer hochfahren. Ich hatte noch ein paar Stunden Zeit, bis meine Mutter kommen würde.
Als freiberufliche Übersetzerin hatte ich das Privileg, zu Hause arbeiten zu können. In unserer alten Kreuzberger Wohnung war das im Winter nicht immer angenehm gewesen, da ich zunächst Kohlen in den fünften Stock schleppen musste, wenn ich beim Tippen nicht steifgefrorene Finger bekommen wollte. Aber vor ungefähr zehn Jahren hatte Marc das Haus in Pankow geerbt. Es hatte der kränklichen Cousine seines Vaters gehört, um die er sich nach der Wende kümmerte. Zum Dank dafür bedachte sie ihn in ihrem Testament, und wir zogen in den ruhigen Norden Berlins. Anfangs vermisste ich unseren turbulenten Kreuzberger Kiez, aber Felix konnte hier mit seinen Freunden im Garten Fußball spielen, Marc hatte einen kürzeren Weg zur Arbeit und ich bekam mein erstes Arbeitszimmer, das diesen Namen auch verdiente. Es lag im Erdgeschoss, und durch die deckenhohen Glasfenster konnte ich in unseren Garten schauen. Unbeobachtet von Chefs und Kollegen teilte ich mir meine Arbeitszeit frei ein und machte meine Yogaübungen, wenn meine Schultern schmerzten.
Jetzt öffnete ich die Datei mit dem Namen »drill.doc«, die Bedienungsanleitung für die Bohrmaschine, die ich bis zum nächsten Mittag aus dem Englischen übersetzt haben sollte. Im Gegensatz zu vielen anderen, die sich wünschten, an literarischen Werken zu arbeiten, befriedigte es mich, Gebrauchsanweisungen zu übersetzen. Je komplizierter die Gegenstände und Geräte waren, desto leidenschaftlicher feilte ich an jedem Detail. Das war schon immer so gewesen, und zwar nicht, weil ich mit dieser Art von Texten mehr Geld verdiente, sondern weil ich fehlerhafte und unverständliche Anleitungen verabscheute. Wie oft hatte ich schon ratlos vor halb zusammengeschraubten Regalen gestanden, nur weil irgendjemand die Texte schludrig bearbeitet hatte. Wenn Marc abends heimkam und mich über meinen Wörterbüchern brüten sah, sagte er oft, dass ich bei meiner Arbeit prima meinen Perfektionswahn ausleben könne, ohne anderen damit auf die Nerven zu gehen. Im Gegenteil, fügte er hastig hinzu und küsste mich, alle seien dankbar, wenn sie verstehen könnten, was sie lasen.
Ich gähnte und massierte mit beiden Zeigefingern meine Schläfen. Anstatt endlich mit dem Schreiben zu beginnen, stützte ich mein Gesicht in die Hände und starrte in unseren Garten. Die Sonne schien bereits frühlingshaft. Mein Blick fiel auf die beiden prächtigen Apfelbäume. Hatten sie schon Knospen? Wenn sie in diesem Jahr wieder so viele Früchte trugen wie im letzten, würde ich Apfelmus einkochen. Marc hatte für Gartenarbeit nicht das Geringste übrig. Er mochte die Bäume nur, weil sich seine Hängematte zwischen ihnen befestigen ließ. Dort lag er stundenlang, las oder starrte in den Himmel. Woran er dann wohl dachte? Er lachte immer, wenn ich ihn fragte, und sagte, dass ich ihn für tiefgründiger halte, als er sei, denn er denke nichts.
Nichts. Das konnte nicht stimmen. Schon als kleines Mädchen lag ich abends in meinem Bett und versuchte, alle Gedanken und Bilder zu vertreiben. Ich stellte mir vor, wie sie durch ein Abflussrohr in einen Eimer strömten und in meinem Kopf ein dunkles Loch zurückließen. Dann kniff ich meine Augen zusammen, atmete tief ein und langsam aus und dachte: »Ich denke nichts« – und dachte dennoch etwas. Als ich dann weinte, weil es mir nicht gelang, gar nichts zu denken, nahm mich mein Vater Karl lächelnd auf den Schoß und tröstete mich: »Das, Prinzessin«, sagte er und drückte mich an sich, »das bringen höchstens Gurus fertig, die viele Jahre meditiert haben. Da müsstest du vielleicht mal nach Indien reisen. Stimmt’s, Asha?« Er lachte sein warmes Lachen, das mich glücklich machte, aber meine Mutter warf ihm einen kurzen Blick zu, den ich auffing, und mein Vater verstummte. Ich hörte auf das Ticken der Küchenuhr und das Klappern der Teller, die meine Mutter mit trotziger Miene in den Schrank räumte. Mein Vater machte ein schuldbewusstes Gesicht, wie immer, wenn er etwas gesagt hatte, das Asha bekümmerte. Das geschah leicht, vor allem, wenn es um Indien ging. Ich hätte gerne gefragt, was Gurus seien, aber ich wollte meine Mutter nicht noch trauriger machen.
Ich starrte noch immer auf Marcs Hängematte, die leer und nutzlos zwischen den Apfelbäumen hin- und herschaukelte. Auch heute noch würde ich gern die Fähigkeit besitzen »nichts« zu denken. Durch meinen Kopf tobten unaufhörlich Gedanken: über meine Familie, über ein technisches Wort, das ich nicht im Wörterbuch fand, darüber, ob ich den Herd ausgestellt hatte, ob es wohl bald einen Terroranschlag geben könnte oder ob ich für die Party alles besorgt hatte. Ich strich mir die Haare hinter die Ohren und lehnte mich zurück.
Plötzlich fühlte ich mich erschöpft; Marcs Hängematte sah so verlockend aus. Ich zog meine Strickjacke über und ging durch den Garten auf die Apfelbäume zu. Die Märzsonne wärmte mein Gesicht und die Luft roch nach Erde und Blumen. Mit einem Seufzer sank ich in die Hängematte, schaukelte leicht hin und her und blinzelte in die Sonne. »Du musst arbeiten«, meldete sich mein Gewissen. Aber, ganz entgegen meiner Gewohnheit, hörte ich einfach nicht hin. Schließlich hatte ich Geburtstag. »Ich denke nichts«, dachte ich und merkte, wie ich angenehm schläfrig wurde. Kindheitserinnerungen, für die ich lange keine Zeit mehr gefunden hatte, nutzten den Augenblick der Entspannung, um aufzutauchen.
Ich bin fünf oder sechs Jahre alt, noch hat mich meine Grundschullehrerin nicht in Bianca umbenannt, und liege in meinem Bett, zugedeckt von meiner blauen Lieblingsbettwäsche mit den weißen Wölkchen darauf. Die kleine Stehlampe, die nachts leuchtet, sorgt für ein angenehmes Dämmerlicht. Ich habe meinen braunen Teddy im Arm, dem ich alles anvertraue. »Teddy, was sind denn Gurus?«, flüstere ich, doch er bleibt stumm. Am liebsten liefe ich zu meiner Mutter und würde sie danach fragen, aber ich fürchte ihre Tränen, die so oft aus ihr heraussprudeln. So wie am Tag zuvor, als ich wissen wollte, ob meine indische Oma lieb gewesen und an welcher Krankheit ihre Familie gestorben war. Mein Vater betont, wie stark Asha sei, aber mir kommt sie wie eine richtige Heulsuse vor. Indien scheint sie immer nur traurig zu machen. In solchen Momenten streichele ich ihre Hand, damit sie bloß wieder lächelt. Wenn ich Glück habe, tut sie das auch und erzählt mir vom indischen Gott Shiva, während ihre Tränen versiegen. »Hör zu, Priyanka«, beginnt sie meine Lieblingsgeschichte, der ich fasziniert lausche, als würde ich nicht bereits jedes Wort kennen, »es war einmal ein junger Mann, den sein Vater, der Gott Shiva, für den Liebhaber seiner Frau Parvati hielt. Deshalb schlug er ihm den Kopf ab. Als er seinen Fehler erkannte, war es zu spät, der Kopf lag auf dem Boden. Parvati jammerte und klagte, aber zum Glück war Shiva ein Gott. Er konnte seinem Sohn zwar nicht den eigenen Kopf zurückgeben, wohl aber den des nächsten Wesens, das seinen Weg kreuzte – und das war ein Elefant. Seither gibt es Ganesha, den Elefantengott und er bringt Glück.«
Kurze Zeit später, am nächsten Tag vielleicht, steht meine Mutter in der Küche und schält Kartoffeln. Wieder halte ich meinen Teddy im Arm und tanze, ein Pippi Langstrumpf-Lied singend, um den Tisch herum. »Faul sein ist wunderschön, denn die Arbeit hat noch Zeit, wenn ich wieder komm, will ich fleißig sein, ja, das versprech ich dir!«
»Faul sein hat noch niemandem geholfen«, sagt meine Mutter und spült ihre Hände unter dem Wasserhahn ab. »Sing doch lieber: Summ, summ, summ, Bienchen summ herum.«
Ich höre auf zu singen und starre meine Mutter an. »Mir gefällt aber das Lied von Pippi«, entgegne ich und schmeiße meinen Teddy auf den Boden.
»Warum?«, fragt meine Mutter, hebt den Stoffbären auf und setzt ihn auf einen Küchenstuhl.
»Pippi kann machen, was sie will«, sage ich und stemme meine Hände in die Hüften. Mein Teddy scheint mich vorwurfsvoll anzusehen, weshalb ich ihn mir schnappe und an mich drücke.
»Ja, ja, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.« Meine Mutter beginnt schnell und energisch die Tomaten zu schneiden. »So läuft das aber nicht, Priyanka. Die Welt ist wie sie ist und man muss mit ihr klarkommen. Ob es einem passt oder nicht.« Meine Mutter ist mit den Tomaten fertig und beginnt einen Kopf Salat zu waschen. Dabei seufzt sie.
»Kommst du klar, Mama?«, frage ich.
»Inzwischen ja«, antwortet sie nach einer kleinen Pause und fährt fort, den Salat zu waschen.
»Warum weinst du so oft?«
»Weil ich viel vermisse.«
»Warum sagt Papa, dass du stark bist?«
»Weil ich ein Stück von mir verloren habe und trotzdem lebe.« In ihrer Stimme schwingt Stolz mit. Ich erahne eine Kraft in ihr, die ich nicht verstehe. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ich verstehe vieles an meiner Mutter nicht.
»Mama, ist Indien ein trauriges Land?«
»Nein, Priyanka. Aber für mich ein verlorenes.« Ihre Stimme zittert und ich halte den Atem an. Doch dieses Mal weint sie nicht, sondern verrührt Öl, Essig und Gewürze zu einer Salatsauce.
»Ganesha«, sage ich zu meiner Mutter, »hat sogar seinen Kopf verloren. Trotzdem sieht er nicht traurig aus. Er hat ja einen neuen Kopf bekommen, einen Elefantenkopf. Das ist doch auch ein Glück, finde ich.« Ich werfe meinen Teddy in die Luft und hopse aus der Küche.
Ein schrilles Läuten drängelte sich zwischen meine Kindheitserinnerungen. Eine Weile bemühte ich mich, das Geräusch zu ignorieren, aber da es nicht aufhörte, ließ ich mich widerstrebend in die Gegenwart zurückholen, und erkannte, dass es die Klingel unserer Haustür war. Ein Blick auf meine Armbanduhr verriet mir, dass es schon fast sechzehn Uhr war; ich musste wohl eingeschlafen sein. Ich sprang aus Marcs Hängematte, rannte durch den Garten in mein Arbeitszimmer und erreichte außer Atem die Haustür. Ich öffnete, und vor mir stand, bepackt mit Tupper-Schüsseln und Tüten, meine Mutter. Mit ihren sechzig Jahren war sie noch immer sehr attraktiv. Normalerweise trug sie Jeans und schlichte Blusen, die sie meistens mit bunten Schals und Tüchern aufpeppte. Heute hatte sie eine schwarze, weitfallende Seidenhose mit einer knallroten Bluse angezogen und trug die goldene Halskette, die mein Vater ihr zu ihrem letzten gemeinsamen Hochzeitstag geschenkt hatte. Ihre schwarzen Haare lagen wie ein prächtiger Umhang über ihren Schultern. Niemand außer mir wusste, dass sie ihr Haar regelmäßig nachfärbte. Im Laufe der Jahre war sie etwas molliger geworden, aber ich musste zugeben, dass es ihr gut stand.
Nach dem Tod meines Vaters hatte sie eine Weile gar nichts mehr essen wollen und war so abgemagert, dass ich mir große Sorgen um sie machte. Irgendwann entdeckte sie dann die tröstende Wirkung von Schokolade und Torte und nahm so schnell zu, dass ich fürchtete, sie würde enden wie die Frau unseres Bäckers, die ich nur dick und keuchend kannte, bis sie an einem Herzinfarkt starb. Es hieß, wenn sie dünner gewesen wäre, hätte sie überlebt. Ich war vierzehn und hatte gerade meinen Vater verloren. Jetzt bangte ich um meine Mutter und wollte alles in meiner Macht Stehende tun, damit sie ein gesundes Leben führte und mich nicht auch verließ. Meine Versuche, sie zum Joggen oder Schwimmen zu überreden, schlugen zwar fehl, aber wie schon früher schaffte es meine Mutter auch jetzt, ihr Leid in einem Winkel ihres Herzens einzuschließen und ihre Traurigkeit zu verdrängen.
Jetzt stand sie aufrecht vor mir und sah mich mit ihren dunklen Augen prüfend an. »Darf ich reinkommen?«, fragte sie und lächelte. Ohne eine Antwort abzuwarten, zwängte sie sich an mir vorbei und stellte die Tüten und Tupper-Schüsseln in der Küche ab. »Wie kann man nur so in seine Arbeit vertieft sein!« Meine Mutter schüttelte ihre Handgelenke aus. »Ich habe Sturm geklingelt!« Ich folgte ihr in die Küche und füllte Wasser in die Espressokanne. Marc hatte den Herd natürlich nicht vom übergelaufenen Morgenkaffee gereinigt. Also nahm ich einen Lappen und schrubbte den angetrockneten Espresso von den Herdplatten. »Ich habe nicht gearbeitet, sondern geschlafen«, erwiderte ich noch etwas träge. »Mitten am Tag? Kurz vor deiner Party?«, rief meine Mutter erstaunt, als hätte sie etwas ganz Ungeheuerliches erfahren. Dabei verteilte sie bereits Samosas auf Teller und knetete anschließend den Chapati-Teig, den sie schon fertig mitgebracht hatte. »Ja, ich habe mir heute mal eine Pause gegönnt«, antwortete ich, und ärgerte mich, dass es wie eine Entschuldigung klang. Die Espressokanne brodelte und zischte. Ich nahm sie vom Herd, und goss den Kaffee in zwei Tassen. Meine Mutter hatte inzwischen begonnen, Salat zu waschen und Zwiebeln zu schneiden: »Die Chapatis backen wir später, kurz bevor die Gäste kommen«, erklärte sie, »frisch und warm schmecken sie am besten.« Ich nickte und zerhackte Gurken und Paprika. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich sie. Selbstbewusst wirbelte sie durch meine Küche, in der ich mich plötzlich als Gast fühlte, und im Handumdrehen standen neben leckeren Salaten appetitliche Snackplatten und mit Trauben und Oliven verzierte Käseteller auf dem Küchentisch. Schon als Kind hatte ich festgestellt, dass meine Mutter bei der Zubereitung von Speisen aufblühte. Die Melancholie, die sie sonst umgab, verschwand. So war es immer noch. Plötzlich überkam mich das Bedürfnis, sie zu umarmen. »Du bist wirklich eine tolle Köchin, Mama«, sagte ich. Meine Mutter errötete und tätschelte meine Wange. Dann schob sie mich zur Seite und stellte ein Backblech mit einem Käsekuchen darauf in den Ofen. Sie wusch ihre Hände, trank einen Schluck ihres inzwischen kalt gewordenen Espressos und sagte: »Früher haben wir jeden Tag zusammen gekocht, meine Mutter, meine Schwester, meine Cousinen, Tanten und wer sonst noch zu Besuch war. Dabei haben wir uns Geschichten erzählt, und die Kinder sind zwischen unseren Beinen herumgerannt, aber das hat nie gestört.« Sie schwieg und ihr Blick verlor sich zwischen den Salaten und Käseplatten. Ich wartete gespannt ab, ob sie weiter sprechen würde. Die Momente, in denen sie sich öffnete und etwas über ihre Jugend preisgab, waren selten. Ich wollte keine Gelegenheit verstreichen lassen, etwas über ihr früheres Leben zu erfahren, auch wenn es nur ein kleines Mosaiksteinchen war. Als sie nicht weitersprach, sagte ich: »Ich habe heute auch an früher gedacht. Papa und ich saßen am Tisch unter der alten Küchenuhr, und wir haben dir beim Kochen zugesehen.«
Meine Mutter trank ihren Espresso aus und spülte ihre Tasse. »Anfangs, als ich neu in Berlin war und wir in Karls Wohngemeinschaft lebten, haben wir oft zusammen gekocht. Es gab mir das Gefühl, dazuzugehören.« Meine Mutter lächelte mich an und ihre großen Augen lächelten mit, als sie hinzufügte: »Und wenn es allen schmeckte, dann wusste ich, dass ich etwas richtig gemacht hatte.« Sie drückte mir zwei Snackplatten in die Hand, nahm selbst geschickt wie eine geübte Kellnerin auf jeden Arm zwei Käseteller und wir brachten alles ins Wohnzimmer. Der Gesprächsfaden war zwar abgerissen, aber heute ärgerte ich mich nicht darüber. Ich war froh, dass meine Mutter mir half. Bei unserem gemeinsamen Herumhantieren fiel mir auf, wie ähnlich wir uns in unserer Liebe zum Detail waren.
Nachdem ich Musik ausgewählt hatte, dezente für den Anfang, tanzbare für die Zeit nach dem Essen, sah ich mich zufrieden um. Es gab nichts mehr zu tun. »Ich geh’ jetzt nach oben und dusche«, rief ich meiner Mutter zu, die in der Küche die Chapatis backte. Ich hörte sie in einer ihrer Tüten kramen, dann erschien sie im Rahmen der Küchentür. »Priyanka, ich möchte dir mein Geschenk geben, bevor deine Freunde kommen.« Sie hielt mir ein rechteckiges Päckchen entgegen. »Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Ich glaube, das hast du dir schon als kleines Mädchen gewünscht.« Ich nahm das Päckchen und öffnete vorsichtig das blaue Geschenkband. Meine Mutter sah mich erwartungsvoll an, und ich zerriss mit einer raschen Bewegung das hübsche Seidenpapier. In meinen Händen hielt ich ein großformatiges Schwarz-Weiß-Foto, das in einem mit kunstvollen Schnitzereien versehenen Bilderrahmen steckte. Abgebildet waren ungefähr dreißig ernst dreinschauende Personen, die unter Palmen vor einem Gebäude posierten. Die Familie meiner Mutter. Das Bild hatte nicht den typischen grau-gelblichen Schleier, der Fotos aus früheren Jahrzehnten so aussehen ließ, als seien nicht nur ihre Farben, sondern auch die fotografierten Personen längst verblichen. Die Gesichter und Figuren waren deutlich zu erkennen, die schwarz-weißen Kontraste hoben sich klar voneinander ab. Meine Mutter musste das Bild digitalisiert und bearbeitet haben. Meine Augen huschten über das Foto und fanden sofort die junge Asha. Sie stand im Hintergrund, trug einen hellen Sari und hatte ihren Schal locker um den Kopf gelegt. Ich hielt das Foto näher an mein Gesicht und meinte zu erkennen, dass ihre Lippen ein leichtes, etwas verschmitztes Lächeln andeuteten. Ihr Blick war genauso neugierig wie in diesem Augenblick, als sie auf meine Reaktion wartete. Ich sah sie an und merkte, wie mir Tränen in die Augen schossen. »Vielen Dank, Mama!«, sagte ich und nahm sie zum zweiten Mal an diesem Tag in die Arme. Sie erwiderte meine Umarmung. Meine Mutter war mit Berührungen zurückhaltend; drückte man sie an sich, machte sie sich meistens ein wenig steif, als wäre es ihr unangenehm. Jetzt hielten wir uns einige Sekunden fest, und genossen den Moment. Was für ein rührseliger Geburtstag! Abrupt ließ sie mich los und stürzte in die Küche: »Meine Güte, die Chapatis!«
»Und ich muss mich fertig machen!« Ich rannte die Treppe zu unserem Schlafzimmer hinauf und eilte zur Dusche. Ich hatte noch eine knappe halbe Stunde, bevor meine Gäste kamen. Das reichte gerade noch, um mir in Ruhe meine Garderobe auszusuchen und mich zu schminken. Mein Zeitplan war ein wenig durcheinander geraten, was mir selten passierte und ein Gefühl des Unbehagens hinterließ.
Ich war gerade fertig geworden, als es klingelte. Das war bestimmt Julia. Ich musterte mich noch einmal im Spiegel und fand, dass ich gut aussah. Bevor ich das Schlafzimmer verließ, fiel mein Blick auf das Foto meiner indischen Verwandten. Ich lächelte. Es war das einzige Bild, das meine Mutter als Erinnerung an ihre Familie besaß, und es bedeutete ihr unermesslich viel.
Die Party war ein voller Erfolg. Bis auf meinen Mann waren alle, die ich eingeladen hatte, gekommen, und jeder schien sich gut zu amüsieren. Meine Mutter stand mit Lisa, meiner Nachbarin, und deren Freundin an der Gartentür und unterhielt sich angeregt. Die Drei kannten sich von der Freien Universität, an der meine Mutter lehrte und die jungen Frauen studierten. Die beiden lauschten Asha, die ruhig dastand und etwas erzählte, gebannt. Ab und zu lachten sie. Ich wusste, dass meine Mutter am Fachbereich für englischsprachige Literatur den Ruf einer wortgewandten Professorin innehatte. Nur mir fiel es schwer, ihre Worte aus deren Verstecken zu locken.
Lisa winkte mir zu, und auch meine Mutter wandte sich um und lächelte. Mein Lampenfieber, das mich regelmäßig befiel, wenn ich eine Feier organisierte, hatte sich längst verflüchtigt, und nach einer Weile konnte ich es genießen, der Mittelpunkt des Abends zu sein. Während meine Gäste zu Felix’ Bollywood-CD tanzten, ging ich in die Küche und schaute auf meinem Handy nach neuen Nachrichten. Ich fand einige Geburtstagsglückwünsche, aber keine SMS von Marc. Meine Hochstimmung rutschte in den Magen und formte dort einen unangenehmen Kloß. Ich hätte heute gerne mit meinem Mann getanzt, das hatten wir lange nicht getan, und ich hätte ihm gerne einige Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, die ich im letzten Jahr durch neue Projekte kennengelernt hatte. So lange konnte das Vorstellungsgespräch mit einem Koch doch nicht dauern. Einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich Marc anrufen sollte, entschied mich aber dann doch dagegen und suchte stattdessen die Toilette auf, wo ich meine Lippen mit einem knallroten Lippenstift nachzog. Ich ließ kaltes Wasser über meine Handgelenke laufen und befahl meiner aufgekratzten Stimmung wieder aufzutauchen. Mit einem frischen Glas Sekt betrat ich das Wohnzimmer. Julia rief: »Da ist sie ja!« Es wurde still, irgendjemand machte die Deckenleuchte aus; jetzt brannten nur noch die Kerzen. Melanie kam mit einer wunderbaren Schokoladentorte, die sie wie schon zu unserer Schulzeit mit roten Marzipanrosen verziert hatte, auf mich zu. Sie lächelte und begann Happy Birthday zu singen. Alle anderen fielen ein, und dann kam die Liedstelle, an der mein Name gesungen werden musste. Da mich die Freunde aus meinem Erwachsenenleben als Bianca kannten, überstimmten sie meistens diejenigen, die wissen, dass ich laut Geburtsurkunde Priyanka hieß. Aber meine Mutter hatte eine kräftige Singstimme, in die sich plötzlich der schiefe Bass von Marc mischte. Ich nickte ihm zu, dann wurde ich von allen Seiten umarmt und blies die Geburtstagskerzen aus.
Als Marc mich an sich zog und küsste, raunte er mir zu: »Was macht denn Asha hier?« Ich gab vor, neuen Sekt aus der Küche holen zu müssen und zog meinen Mann hinter mir her. Etwas fester als nötig schloss ich die Tür und sah ihn an. »Was soll die Frage?«, zischte ich, »wenn sie nicht gekommen wäre, hätte ich alles alleine vorbereiten müssen!« Ich schmiss die Tür des Kühlschranks zu und stand mit zwei Sektflaschen da. Marc hob beschwichtigend seine Hände und entgegnete: »Okay. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Sam hat sich verspätet, weil eine Straße gesperrt war. Und dann gab es keinen Parkplatz.«
»Wenn er zu seinem Vorstellungsgespräch nicht pünktlich erscheint, würde ich ihn an deiner Stelle nicht einstellen. Allerdings passt er dann ja hervorragend zum schlampigen Lennard. Und zum vergesslichen Marc!« Mein Mann sah mich verständnislos an. »Was ist denn mit dir los? Nach Asha habe ich nur gefragt, weil ich dir mein Geschenk nicht geben kann, solange sie hier ist.« Ich guckte ihn erstaunt an. »Wieso?«, fragte ich, »Ist es etwas Unanständiges?« Marc grinste mich an und nahm mir die Sektflaschen ab. Ich merkte, wie erleichtert er war, dass meine Wut verrauchte.
»Nein, nichts Unanständiges«, antwortete er, »aber etwas Aufregendes.« Jetzt hatte er mich neugierig gemacht. Was Asha damit zu tun hätte, wollte ich wissen, schließlich wurde ich neununddreißig und musste meiner Mutter keine Rechenschaft ablegen. Marc sah mich zweifelnd an. »Bist du sicher?« Ich erzählte ihm von dem schönen Nachmittag und dem Familienfoto, das Asha mir geschenkt hatte. »Sie hat dir das Familienbild geschenkt? Das Foto, wegen dem es mal Streit gab?«, hakte Marc nach. Ich nickte. Er pfiff durch seine Zähne und sah mich nachdenklich an. »Hm, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn Asha dabei ist.«
Er ging nach oben, um mein Geburtstagsgeschenk zu holen, während ich die Sektflaschen ins Wohnzimmer brachte. Die ersten wollten schon gehen, als Marc in der Tür stand und lächelte. In seiner Hand hielt er ein Päckchen, das die Größe und Form eines Buches hatte. Auf dem Päckchen lag ein länglicher Umschlag, auf dem eine Rose befestigt war.
»Liebe Priyanka«, begann Marc und um uns herum verebbten die Gespräche. Jemand schaltete die Musik aus und rief: »Super, Marc, eine Ansprache!« Alle blickten ihn interessiert an, und er genoss diesen Moment der Aufmerksamkeit sichtlich. Dann fuhr er fort: »Ich wollte tatsächlich eine kleine Rede halten. Aber jetzt ist es spät, und ich fasse mich kurz. Liebe Priyanka, ich wünsche dir ein tolles letztes Jahr in den Dreißigern …« Unwillkürlich blickte ich zu Julia, die bei Marcs letzten Worten die Augen genervt zur Decke schlug, und unterdrückte ein Kichern. »… es wird bestimmt aufregend und voller Entdeckungen.« Er kam auf mich zu und küsste mich. Dann überreichte er mir sein Geschenk. »Aufmachen! Aufmachen!«, riefen meine Gäste im Chor. Marc redete gerne und ließ andere Menschen großzügig an seinem Leben teilnehmen, gleichgültig, ob er sie gut kannte oder nicht. Mich brachte es in Verlegenheit, wenn er Situationen, die ich als privat empfand, öffentlich inszenierte.
Marc sah mich mit ebenso erwartungsvollen Augen an, wie meine Mutter ein paar Stunden zuvor. Ich entfernte die Rose und öffnete den Umschlag. Jetzt hielt ich ein Stück festes Papier in meinen Händen und verstand im ersten Augenblick nicht, um was es sich handelte. Marc hatte mir etwas geschenkt, das mich und mein Leben umkrempeln sollte. Ebenso sein eigenes. Und Ashas. Aber sie war wahrscheinlich die Einzige, die das an diesem Abend ahnte.
»Wahnsinn«, rief Julia aus, die plötzlich neben mir stand. Ich starrte auf das Flugticket, das auf Mrs. Priyanka Sommer für den 15. Mai ausgestellt war. »Wahnsinn, Bianca, du fliegst nach Indien!«
Asha
Berlin, 16. März 2009
Asha hastete durch die menschenleeren Straßen. Bloß weg hier. Sie wollte sofort nach Hause, ein Bad nehmen und sich in ihrem Bett verkriechen. Warum musste Marc Priyanka ausgerechnet eine Reise nach Delhi schenken? Sie blieb stehen und keuchte. Ihre Wut mischte sich mit Traurigkeit. Es war unfassbar, dass dieser Tag so desaströs endete. Wie sehr hatte sie es genossen, mit Priyanka zusammen zu sein. Weder Spannungen noch Missverständnisse waren entstanden, was nicht oft der Fall war. Dann war Marc hereinspaziert und hatte alles kaputtgemacht.
Asha zitterte vor Kälte und Aufregung. Nach Julias begeistertem Ausruf und einer Schrecksekunde hatte sie, steif wie eine Marionette, ihre Sachen genommen und sich mit knappen Worten von Priyanka und Marc verabschiedet. Priyanka hatte wortlos genickt. Dann wurde sie von Julia und Melanie mit Fragen bestürmt, und Asha hatte unbemerkt das Haus verlassen. Draußen war sie einfach losgerannt.
Sie fröstelte und blieb stehen, um ihren Mantel überzuziehen und sich ihren Schal um den Hals zu wickeln. Wahrscheinlich musste sie später eine Schlaftablette nehmen, sonst würden ihre Gedanken die ganze Nacht in einer Endlosschleife kreisen. Sie sah sich suchend um. Wo war nur die U-Bahn-Station? Sie kniff ihre Augen ein wenig zusammen und ließ ihre Blicke über die verlassenen Straßen schweifen. Dann erkannte sie, dass sie in die falsche Richtung gelaufen war. Seufzend steckte sie ihre Hände in die Manteltaschen und machte kehrt. Langsam, fast schleppend, ging sie und sah ihrem Atem zu, der sich in der winterlichen Luft in weißen Nebel verwandelte.
Wenn Karl doch bei ihr wäre! Wie sehr sie ihn auch nach fünfundzwanzig Jahren noch vermisste. Er war der Einzige gewesen, der wusste, was sie durchgemacht hatte. Es war nicht immer leicht mit ihnen gewesen. Gerade in den ersten Ehejahren hatte es oft Tränen und Streit gegeben. Aber sie hatten sich verstehen und lieben gelernt und einander nie aufgegeben. Sein Tod hatte Asha einsamer gemacht, als sich irgendjemand vorstellen konnte.
Plötzlich rang sie nach Luft. Es war, als schnürte ihr etwas den Hals zu. Ihr Herz raste, und in ihrem Kopf rauschte es. Ihre Arme und Beine kribbelten unangenehm. Sie erkannte die ersten Anzeichen einer Panikattacke, die sie immer dann überfiel, wenn sie sich besonders hilflos fühlte. Sie blieb stehen, atmete tief durch und konzentrierte sich auf Karl. Seit seinem Unfall hatte sie alles Mögliche ausprobiert, um mit ihrer Angst und Trauer fertig zu werden. Sie hatte schreckliche Zeiten durchlebt und Priyanka mit ihr. Eines Tages, als sie all die Medikamente, die sie schluckte, anwiderten, hatte sie begonnen, in schlimmen Momenten intensiv an Karl zu denken. Das beruhigte sie. Später fing sie an, mit ihm zu sprechen und überlegte, was er wohl antworten würde. Laut tat sie das allerdings nur, wenn sie sicher war, dass niemand sie hörte. Sie wollte nicht, dass Priyanka ihre Mutter für verrückt hielt.
Asha ging weiter und stellte sich vor, Karl liefe neben ihr, und sie hielten sich, wie ein Liebespaar, an den Händen. Er sähe sie mit seinen braunen Augen an und lächelte ihr zu. Wie sie seine Grübchen geliebt hatte! Zärtlich würde sie seine mit der ihren verschlungene Hand in die Manteltasche führen, um sie zu wärmen. Ihre Schritte fänden dasselbe Tempo. Asha atmete jetzt ruhiger.
»Danke, dass du gekommen bist«, flüsterte sie.
»Es tut mir leid, dass ich nicht sofort da bin, wenn du mich brauchst«, antwortete Karl, »aber das war früher ja auch nicht anders.« Asha lächelte und drückte seine Hand. Dann sagte sie etwas lauter: »Warum schickt er Priyanka nach Indien?« Sie spürte ihre Wut wieder in ihrem Magen brodeln. Karl schüttelte den Kopf. »Asha«, erwiderte er liebevoll, »unsere Tochter ist erwachsen. Niemand kann sie irgendwohin schicken. Sie allein entscheidet, ob sie nach Delhi reist.« Asha war mit Karls Antwort nicht zufrieden. »Aber wozu?«, stieß sie hervor. »Priyanka hat ihr Leben und ihre Familie hier. Ihr fehlt nichts. Was soll sie dort suchen? Eine indische Verwandtschaft, die es für sie nicht gibt? Soll sie auf lauter Fragen stoßen, die ich ihr nicht beantworten kann?« Asha ließ Karls Hand los und ging einen Schritt schneller. »Die du ihr nicht beantworten willst«, sagte Karl ruhig und holte sie ein. »Du weißt, wie ich darüber denke. Priyanka muss ihre Geschichte kennen. Dazu gehört auch deine Vergangenheit.« Karl legte zärtlich seinen Arm um Ashas Schultern. Das tat er immer, wenn er ihr während einer Meinungsverschiedenheit versichern wollte, dass er sie trotzdem verstand. »Wäre es so schlimm, wenn sie durch Delhi liefe und die Stadt kennenlernte, in der auch unsere Geschichte begann? Sie würde die Farben deiner Heimat sehen und ihre Gerüche riechen. Sie bekäme einen Eindruck von Indiens Kultur, seinen Menschen und deren Problemen. Vielleicht fiele es dir danach leichter, Worte zu finden.« Asha schwieg einen Moment und strich sich mit beiden Händen über ihre Stirn. Dann antwortete sie: »Du weißt, warum ich seit vierzig Jahren keinen Fuß nach Delhi gesetzt habe. Es ist, als würde eine unüberwindbare Mauer zwischen mir und Indien stehen. Sie verhindert, dass ich zurückkehre, aber sie hält von mir auch noch größeren Schmerz ab, den ich nur hier ertrage und sie bewahrt mich vor …« Ihre Stimme versagte und sie schluckte. Karl strich ihr vorsichtig über den Kopf. »Ich weiß, vor wem du Priyanka beschützen willst. Aber es sind Jahrzehnte vergangen und ich bin sicher, dass euch niemand mehr schaden will.«
Asha sah zu ihm auf und schwieg. Wie gerne würde sie ihm glauben, aber sie wusste aus eigener Erfahrung, dass manche Wunden nie verheilten. Man konnte sie verdecken und kontrollieren, aber eine kleine Unvorsichtigkeit genügte, um sie aufzureißen und zu entzünden. Und was würde dann geschehen? Karl nahm ihr Gesicht, so wie sie es liebte, in seine Hände und sagte: »Du solltest Priyanka erklären, was dir und deiner Familie passiert ist. Sie hat ein Recht darauf, es zu erfahren.« Asha nahm seine Hand und zog ihn weiter.
Am Ende der Straße konnte sie nun den Eingang der U-Bahn-Station erkennen. »Es ist meine Geschichte. Ich habe das Recht zu schweigen«, entgegnete sie trotzig.« Sie erreichten die U-Bahn-Station und gingen die Treppen zu den Gleisen hinunter. Karl nahm Asha in den Arm. Sie lehnte ihren Kopf gegen seine Schulter. Wie gut das tat. Karl streichelte ihren Rücken. »Asha bedeutet ›Hoffnung‹«, murmelte er leise in ihr Ohr, »vertraue darauf, dass das Richtige geschehen wird.« Er drückte sie an sich, und Asha fühlte sich ruhig. Ihr Herz schlug in seinem normalen Rhythmus und die Panikwelle war verebbt. »Ich habe Angst vor dieser Reise«, flüsterte sie.
Ein eisiger Wind schlug ihr aus dem Tunnel entgegen und zerzauste ihr schwarzes Haar. Der Windzug wurde stärker, dann leuchteten Scheinwerfer auf und die U-Bahn hielt mit quietschenden Bremsen. Noch etwas benommen von ihrem Gespräch mit Karl stieg Asha ein und setzte sich an ein Fenster. Sie fühlte sich, als wäre sie gerade aus einem intensiven Traum erwacht und brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie in der Berliner U-Bahn saß und Karl nicht mitfahren würde. Der Zug rollte los, und Asha betrachtete ihr Gesicht in der Glasscheibe. Sie sah erschöpft aus und fühlte sich alt. Die Linie U2 war noch voller Menschen, und bald vermischten sich deren Unterhaltungen mit Ashas Grübeleien. An der Station Stadtmitte stieg sie um und fuhr weiter bis zum Mehringdamm. Von dort aus lief sie nach Hause.
Als sie ihre Wohnung betrat, war es fast Mitternacht. Sie hatte keine Lust mehr zu baden. Stattdessen zog sie ihren Schlafanzug an und nahm eine Schlaftablette. Bevor sie in einen traumlosen Schlaf sank, ging ihr noch einmal das Gespräch mit Karl durch den Kopf: »Hat er recht, und ich sollte Priyanka endlich alles erzählen? Vielleicht.« Aber wie würde ihre Tochter reagieren, wenn sie erfuhr, dass ihre Mutter sie fast vierzig Jahre lang angelogen hatte? »Und ich?«, dachte sie, »wie würde ich ihre Fragen ertragen?« Nein, sie konnte sich nur dann im Gleichgewicht halten, wenn sie ihre Vergangenheit nicht ausgraben musste. Sie würde mit ihrer Lüge weiterleben. So war es nun einmal.
Priyanka
Berlin, 20. März 2009
Ich kettete mein Fahrrad an einen Laternenpfahl und betrat Hendriks Übersetzungsbüro. Seine Tür stand weit offen, und als er mich sah, nahm er seine Brille ab und winkte mir zu. »Hallo, Bianca. Schön, dass du Zeit hast!« Er stand auf und rückte mir einen Stuhl zurecht. »Willst du einen Kaffee?« Ich setzte mich. »Nein, danke, aber ein Wasser wäre nett.«
»Kommt sofort!« Hendrik verschwand in der Küche, und ich hörte ihn mit seinen Mitarbeiterinnen scherzen. Mein Auftraggeber kam mit einer Tasse Kaffee und einem Glas Wasser zurück und stellte beides auf dem Schreibtisch ab. Er setzte sich, stopfte seine Pfeife und lächelte mich an. »Deine Übersetzung für die Bedienung der Bohrmaschine ist einwandfrei«, sagte er anerkennend, »aber das ist ja nichts Neues bei dir.« Ich lächelte zurück.
»Dabei hatte ich dieses Mal Zweifel, ob du es bis Dienstag schaffen würdest«, fügte er hinzu und zündete seine Pfeife an. Als er an ihr zog, qualmte es stark aus dem Pfeifenkopf und mit dem Rauch, der sich gemächlich im Zimmer verteilte, verbreitete sich auch der würzige Geruch nach Tabak. Blitzlichtartig sah ich meinen Vater vor mir, wie er sich seine Pfeife anzündete, wenn er Asha und mir von seinen Reisen berichtete. Vielleicht lag es an dieser Erinnerung, dass mich der Rauch nicht störte.
»Warum?«, hakte ich nach. Hendrik paffte genüsslich und trank einen Schluck Kaffee. »Na, du hast am Montag bestimmt lange gefeiert.« Der Gedanke an mein Fest, das so vielversprechend begonnen hatte und dann im Ehestreit endete, ließ mich unbehaglich auf meinem Stuhl hin- und herrutschen. »Nicht so lange. Nachdem du weg warst, sind auch die meisten anderen aufgebrochen. Nur Julia hat mir noch beim Aufräumen geholfen.« Hendrik sah mich aufmerksam an. »Marc nicht?« Ich nippte an meinem Wasser. »Nein«, sagte ich, und es klang kläglich. »Wir haben seit Dienstag kaum miteinander geredet.« Hendrik runzelte die Stirn. »Hm«, brummte er, »hat es etwas mit dem Ticket zu tun?« Ich nickte.
Nachdem meine Gäste gegangen waren, hatte ich vergeblich versucht, meine Mutter zu erreichen. Marc fand meine Fürsorge übertrieben und Ashas Gehabe regte ihn auf. Ich warf ihm vor, dass er das Ausmaß der ganzen Geschichte noch immer nicht begreife, woraufhin er lauter wurde und erwiderte, dass er mir diese Reise geschenkt hätte, gerade weil er wüsste, dass es mir gut täte, endlich etwas über meine Herkunft zu erfahren. Aber anscheinend wollte ich das gar nicht. Er hatte seine Jacke genommen und türenknallend das Haus verlassen. Ohne Julia hätte ich die ganze Nacht alleine geputzt, denn ich wollte den nächsten Tag auf keinen Fall im Chaos beginnen.
Hendrik schlug sich mit einer Hand auf den Oberschenkel. »Ich hatte doch gleich das Gefühl, dass deine Stimmung nach der Geschenkübergabe ziemlich im Keller war.« Ich seufzte. »Ich fühle mich von Marc überrannt. Aber ein schlechtes Gewissen, dass er so wütend und enttäuscht war, habe ich trotzdem. Auch Asha gegenüber.« Hendriks Pfeife war ausgegangen und er wurde ernst. »Bianca, ich weiß, wie rücksichtsvoll du mit Asha umgehst, aber sie ist gesund und führt ihr eigenes Leben. Ich an deiner Stelle würde die Gelegenheit ergreifen und nach Indien fahren.« Er starrte auf die Ränder, die seine Kaffeetasse auf der Tischplatte hinterlassen hatte. Ich schluckte. Hendrik pflegte seit vielen Jahren seine kranke Mutter, was ihm kaum Zeit für sein eigenes Leben ließ. Vor kurzem hatte ihn seine Freundin verlassen und war mit einem anderen Mann nach Kreta gegangen. Fast wäre ich aufgestanden, um ihn zu umarmen. Aber ich zögerte eine Sekunde zu lange, und er hatte sich gefasst. Er verschränkte seine Finger und ließ sie knacken. »Tja«, meinte er dann etwas lauter, »das ist mein Rat als Freund. Sieh’ es als Chance. Schau dir Indien an. Asha wird schon damit klarkommen.«
»Vielleicht hast du recht«, antwortete ich und stellte mein leeres Glas auf den Tisch. Hendrik strahlte jetzt wieder. »Denk’ darüber nach. Und bis du dich entschieden hast«, fuhr er fort und öffnete eine Datei in seinem Computer, »sieh’ dir doch mal diese Schattenfugenfräse an. Die ist von einem britischen Hersteller, der eine Übersetzung seiner Bedienungsanleitung ins Deutsche und Französische wünscht. Kriegst du das hin?« Ich sah mir die angefügten Bilder an und nickte. »Bis wann?«
»Bis Mitte nächster Woche wäre gut, auch wenn ich dir damit wahrscheinlich dein Wochenende ruiniere.« Hendrik begleitete mich zur Tür und legte zum Abschied seine Hand auf meine Schulter. »Mach’s gut, Bianca. Und frag dich mal: Wie schrecklich wäre es denn, sich mal zwei Wochen nicht mit Bohrmaschinen und Fräsen zu beschäftigen?« Ich lachte auf und lief irgendwie beschwingt die Treppe hinab.
Unten öffnete ich mein Fahrradschloss und blickte die Gneisenaustraße entlang. Fünf Minuten von hier lag Ashas Wohnung. Sollte ich bei ihr vorbeischauen? Sie hatte keinen meiner Anrufe beantwortet. Warum eigentlich nicht? Schließlich konnte ich ja nichts für Marcs Geschenkidee. Ich beschloss, direkt nach Hause zu radeln und unterwegs noch Gemüse und Fisch für das Abendessen einzukaufen. Felix und seine Freundin kämen sicher bald an. Ich stieg auf mein Rad und schmunzelte. Falls seine angekündigte Begleitung nicht seine Freundin wäre, würde ich enttäuscht sein.