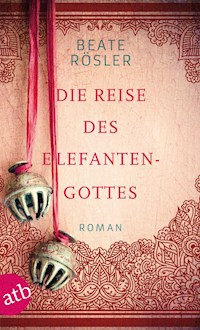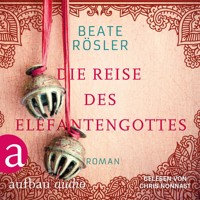9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um ihren Sohn zu retten, muss sie sich von ihm trennen.
New York, 1947: Die in die USA emigrierte Kinderärztin Helene Bornstein sieht nach beinahe zehn Jahren ihren Sohn Moritz wieder. Damals hatte sie ihn mit einem Kindertransport aus Frankfurt fortgeschickt. Jetzt ist Moritz seiner Mutter fremd geworden, aber ihr Versprechen hat er nie vergessen. Gelingt es den beiden, wieder zueinander zu finden? Und wird Helene Fuß in New York fassen, obwohl sie die Kinder, die ihr während des Krieges anvertraut worden waren, nicht vergessen kann? Da trifft sie eines Tages Leon, ihre erste Liebe, wieder ...
Ein bewegender Roman – inspiriert von der wahren Geschichte einer jüdischen Kinderärztin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 796
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Um ihren Sohn zu retten, muss sie sich von ihm trennen
New York, 1947: Die in die USA emigrierte Kinderärztin Helene Bornstein sieht nach beinahe zehn Jahren ihren Sohn Moritz wieder. Damals hatte sie ihn mit einem Kindertransport aus Frankfurt fortgeschickt. Jetzt ist Moritz seiner Mutter fremd geworden, aber ihr Versprechen hat er nie vergessen. Gelingt es den beiden, wieder zueinander zu finden? Und wird Helene Fuß in New York fassen, obwohl sie die Kinder, die ihr während des Krieges anvertraut worden waren, nicht vergessen kann? Da trifft sie eines Tages Leon, ihre erste Liebe, wieder.
Ein bewegender Roman – inspiriert von der wahren Geschichte einer jüdischen Kinderärztin
Über Beate Rösler
Beate Rösler, 1968 in Essen geboren, studierte Rechtswissenschaft und romanische Sprachen in Berlin. Sie ist Übersetzerin und arbeitete viele Jahre als Deutschlehrerin am Goethe-Institut in Frankfurt am Main sowie in Neu-Delhi (Indien) und Hanoi (Vietnam). Im Aufbau Taschenbuch sind bisher ihre Romane »Die Reise des Elefantengottes« und »Die Töchter des Roten Flusses« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Beate Rösler
Helenes Versprechen
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Auf der Marine Flasher in Richtung New York, August 1947
Frankfurt, Sommer 1923
New York, August 1947
Frankfurt, März bis Dezember 1925
New York, August 1947
Frankfurt, März 1926
Frankfurt, April 1933
New York, September 1947
Frankfurt, Juli – Dezember 1933
New York, September 1947
Zermatt und Frankfurt am Main, 1934–1935
New York, Oktober/November 1947
Frankfurt, November 1938 – September 1939
New York, November – Dezember 1947
Frankfurt, November 1940 – Oktober 1943
New York, 26. Dezember 1947
Zehn Jahre später: New York, 1957
Glossar
Nachbemerkungen
Dank
Impressum
Für meine Mutter Sigrid und meine Tochter Tanya
Auf der Marine Flasher in Richtung New York, August 1947
»Und du kommst bestimmt bald nach?«
»So schnell ich kann.«
»Versprochen?«
»Versprochen! Und jetzt gib mir einen Kuss.«
Kinderarme umschlingen sie und Moritz’ weiche Wange drückt sich an ihre, sein warmer Atem streift ihr Ohr. Sie presst ihn an sich, ringt nach Luft und kämpft mit den Tränen.
Es ist Nacht. Am Frankfurter Hauptbahnhof stehen Kinder mit Koffern in ihren kleinen Händen. Um ihre Hälse baumeln Schilder mit Nummern, damit sie nicht verloren gehen. Ein letztes Mal zupfen Mütter und Väter ihnen die Mützen zurecht, ermutigen, versprechen, winken. Ihre Münder bewegen sich, formen Abschiedsworte, doch Helene hört sie nicht, die Welt um sie herum ist dumpf geworden. Nur Moritz’ helle Stimme dringt zu ihr durch.
»Um acht beim Mond.«
Plötzlich ziehen Frauenhände ihren Jungen mit sich fort, nicht grob, aber entschieden. Es ist, als rissen sie dabei ein Stück von Helene mit sich. So sehr schmerzt es. Nicht einmal bis zum Zug darf sie Moritz begleiten. Kein Aufsehen erregen, hat es geheißen.
»Um acht beim Mond«, will sie ihm nachrufen, aber ihre Stimmbänder versagen. Sie haben sich verknotet, bringen nicht einmal ein Flüstern zustande, was gut so ist, denn mit den Worten kämen die Tränen. Und die dürfen jetzt nicht fließen. Mit einem lang gezogenen Pfeifton fordert die Lok alle Kinder zum Einsteigen auf. In der Ferne meint Helene Moritz’ dunklen Haarschopf zu erkennen und reckt ihren Hals, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Dann hat der Zugihn verschluckt. Zischend lässt er Dampf ab und rollt an, um ihr Kind mit sich fortzunehmen. Auf einmal ist Helene sicher, dass es falsch ist, sich von Moritz zu trennen. Sie rennt los, dem Zug hinterher, sollen sie doch versuchen, sie aufzuhalten.
»Moritz!«, ruft sie, beide Hände nach ihm ausgestreckt. »Moritz!«
»Beruhigen Sie sich doch.«
Schweißgebadet schlägt Helene die Augen auf. Die Stimme klingt nicht unfreundlich, bloß müde. Der Boden unter ihrer Pritsche schwankt und knarzt, ihre Augen müssen sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen. Einen Moment braucht sie, um zu begreifen, dass sie sich nicht in Frankfurt befindet, sondern an Bord der S.S. Marine Flasher, auf dem Weg nach Amerika. Der amerikanische Truppentransporter wird sie wie Tausende andere europäische Emigranten über den Atlantik bringen. Menschen, die Konzentrationslager, Zwangsarbeit, Krieg, Verfolgung und Flucht überlebt und fast alles verloren haben, was ihr Leben einmal ausgemacht hat. Es ist ein Schiff beladen mit Menschen, die an Leib und Seele vom Leid des Krieges gezeichnet sind, aber auch ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft suchen an Bord einen Platz. Helenes neues Leben hat bereits begonnen, und zwar in dem Moment, als man ihr die Einschiffungskarte für die Marine Flasher mit Schlafplatz und Stempel überreichte. Ihren Garantieschein dafür, dass sie in New York Moritz und ihre Schwester Marlis wiedersehen wird.
Noch immer hallt Moritz’ Stimme in ihrem Kopf nach, so deutlich, als hätte er vor einer Sekunde noch neben ihr gestanden. Helenes Herz pocht, als sei sie tatsächlich seinem Zug hinterhergerannt, ihre Zunge klebt pappig am Gaumen, was aber auch an der stickigen Luft der Schiffskabine liegen kann.
»Geht es wieder?«
An ihrer Pritsche steht Lisbeth Schwarz, die mit ihrer Mutter und zwei kleinen Mädchen die Schlafplätze neben ihrem belegt. Weiter hinten weint ein Kind, eine Frau hustet, eine andere schnäuzt sich die Nase und eine dritte stöhnt. Vielleicht weil sie schlecht träumt, vielleicht weil sie bei all der Unruhe nicht schlafen kann.
»Habe ich geschrien?«, fragt Helene leise. Lisbeth Schwarz nickt, und erst jetzt bemerkt Helene, dass sie die Hand der Frau umklammert hält. Sofort will sie, peinlich berührt von dieser Intimität, ihre Hand zurückziehen. Doch blitzschnell umschließt Lisbeth Schwarz noch einmal ihre Finger und drückt sie, kurz und kräftig, eine Geste des Verstehens, die versichert, dass Helene sich ihrer Albträume nicht zu schämen braucht. An Bord der Marine Flasher ist sie weiß Gott nicht die Einzige, die davon heimgesucht wird. Zum ersten Mal fällt Helene die Nummer auf, die auf den linken Unterarm ihrer Mitpassagierin tätowiert ist. Rasch schaut sie weg, weil sie Lisbeth Schwarz das Erschrecken in ihrem Blick ersparen möchte. Diese beginnt, obwohl sie erst in einigen Stunden in New York einlaufen werden, ihren Seesack zu packen. Versehentlich stößt sie dabei gegen eine ihrer Töchter, die sich, ohne aufzuwachen, auf die andere Seite wälzt und die Decke von sich strampelt. Zu ihrem Entsetzen entdeckt Helene auch auf dem dünnen Kinderbein eine eingeritzte Nummer. Dieses Mal kann sie nicht wegsehen, zu verstörend ist die Vorstellung, dass jemand in diese zarte Kinderhaut gestochen und die Schmerzensschreie des Mädchens einfach ertragen hat. Ein Mädchen, das jung genug gewesen wäre, um zu vergessen, was ihm in seinen ersten Lebensjahren widerfahren ist, mit dieser Nummer jedoch zum ständigen Erinnern verdammt wurde.
»Sie ist kurz nach unserer Deportation im Lager geboren«, sagt Lisbeth Schwarz, während sie die zu Boden gerutschte Decke aufhebt und vorsichtig über das schlafende Kind ausbreitet. »Auf den Armen eines Babys ist zu wenig Platz für die Kennzeichnung. Da haben sie halt den Oberschenkel genommen.«
Ohne Helene noch einmal anzusehen, schiebt sie ihren gepackten Seesack an die Wand und streckt sich auf ihrer Pritsche aus. Ihre Augen verdeckt sie mit dem Unterarm, als wolle sie damit signalisieren, dass sie von Helene keine Reaktion erwartet. Auch Helene sinkt zurück in ihr Kissen und überlässt sich einen Moment lang dem Hin- und Herschaukeln des Schiffes.
Unfassbar, grauenhaft. Worte, die der Gewalt die man diesem Kleinkind angetan hat, nicht einmal annähernd gerecht werden. Ja, gar angesichts des rohen Schmerzes des Mädchens und der Mutter an Bedeutung verlieren. Deshalb schweigt Helene mit brennenden Augen. Wie so oft seit Kriegsende, seitdem die Alliierten immer mehr Einzelheiten über Auschwitz und andere Konzentrationslager zutage bringen. Millionenfache Anlässe zum Weinen. Und weinen würde sie, wenn sie noch könnte. Aber ihre Drüsen produzieren einfach keine Tränen mehr, als sei Helenes gesamter Vorrat bereits versiegt. Andererseits, wozu weinen? Selbst wenn die ganze Welt in ein Tränenmeer zerfließen würde, so würde auch dies niemals ausreichen, um die furchtbare Wahrheit zu verdünnen: dass sich das, was geschehen ist, nicht rückgängig machen lässt.
Welch ein unbeschreibliches Glück, dass ich Moritz fortgeschickt habe. Einen Schlag lang setzt ihr Herz aus, als müsse es bei diesem Gedanken noch immer nach Luft schnappen. Das nennst du Glück?, schreit ihr Herz wohl zum tausendsten Mal. Dass du dein achtjähriges Kind weggegeben hast, in ein fremdes Land, zu fremden Leuten, ohne zu wissen, ob du es jemals wiedersehen wirst? Die jahrelange Ungewissheit, ob es Moritz gut geht? Dass du nicht dabei sein durftest, als er aufwuchs, nicht erleben konntest, wie seine Stimme dunkler und männlicher wurde? Dass du nicht weißt, wie es sein wird, ihn nach fast neun Jahren wiederzusehen?
Mit aller Macht wehrt sich Helene gegen diese schmerzlichen Fragen. Im Schlaf mag sie ihren Gefühlen ausgeliefert sein, tagsüber aber führt ihr Kopf das Regiment. Und der sagt Ja, immer wieder Ja, es ist ein Glück, und sei es ein noch so verdrehtes. In friedlichen Zeiten hätte sie ihren Jungen niemals hergegeben, aber ihre Wirklichkeit hat nun einmal anders ausgesehen, und deshalb zählt nun nur eins: Moritz lebt und keiner hat ihm eine Nummer ins Fleisch gestanzt, weil er der Sohn einer jüdischen Mutter ist. Mit einem verstohlenen Blick auf die kleinen Töchter von Lisbeth Schwarz bringt Helene ihr wundes Herz zum Schweigen.
So rasch die gedrängt stehenden Pritschen es zulassen, steht sie auf und kleidet sich an. Bloß fort mit all diesen trüben Gedanken, die seit ihrem Aufbruch aus Deutschland durch ihren Kopf schwappen wie graue Atlantikwellen. Mächtiger als in den Jahren zuvor, in denen fast jede Minute damit ausgefüllt war, ihr Überleben zu organisieren: Nahrung, Papiere, Verstecke, nach Kriegsende dann ihre Emigration. An Bord der Marine Flasher jedoch gibt es kaum etwas anderes zu tun, als im Schlafsaal zu dösen oder aufs Meer zu starren, so dass sich die Tage scheinbar endlos hinziehen, sich ausdehnen wie unter der Augustsonne erwärmte Materie, und viel zu viel Raum für gefährliche Grübeleien bieten.
Über die noch leidlich saubere helle Bluse zieht sie ihre beige Strickjacke, die ihr nachts als zusätzliches Kopfkissen dient, schüttelt die Decke auf, faltet sie ordentlich zusammen und legt ihren braunen Lederkoffer abholbereit auf die Pritsche. Mit einem kleinen Metallkamm fährt sie durch ihre schulterlangen Haare, wobei einige zwischen den Zinken hängen bleiben, silbern schimmernd wie der Kamm. Bald wird sie komplett ergrauen, weshalb es keine Rolle mehr spielt, ob ihr Haar noch als blond oder schon als braun zu bezeichnen ist. Beim Ausfüllen der Einwanderungspapiere hat Helene sich für »hellbraun« entschieden, denn die Zeiten, in denen es ihr vielleicht hin und wieder den Hals gerettet hat, als Blondine durchzugehen, sind vorbei. Mit ein paar geübten Griffen und Nadeln steckt Helene ihr Haar zu einem Knoten zusammen, möglichst locker, um zu kaschieren, dass er seine einstige Fülle eingebüßt hat. Mithilfe eines kleinen Taschenspiegels kontrolliert sie das Ergebnis und betrachtet einen Moment lang ihr Gesicht, sieht es durch Moritz’ und Marlis’ Augen: blasse, etwas unreine Haut, dunkle Ringe unter müden, geröteten Augen und über ihrer Nase die Zornesfalten, die den Namen nicht verdienen, weil es nicht die Wut, sondern der ständige Kampf ums Überleben war, der ihre Stirn so durchfurcht hat. Sähe sie mit Anfang vierzig jünger aus, wenn ihr Leben anders verlaufen wäre? Wenn sie das Leben geführt hätte, das sie sich als moderne junge Frau in den zwanziger Jahren vorgestellt hatte, überzeugt davon, dass nach einem großen Krieg so bald kein neuer folgen würde? Rasch klappt Helene den Taschenspiegel zu, denn es lohnt sich wirklich nicht, länger darüber nachzudenken. Es ist, wie es ist.
»Soll ich Ihnen einen Kaffee holen?«, flüstert sie Lisbeth Schwarz zu. Irgendwie hat sie das Bedürfnis, etwas Nettes für diese Frau zu tun, die der Hölle von Auschwitz entkommen ist. Lächeln. Kopfschütteln.
In der Kabine erwachen immer mehr Menschen, weshalb Helene hinausflüchtet, um der Enge zu entkommen, aber auch den unangenehmen Gerüchen, die entstehen, wenn viele Menschen tagelang zusammengepfercht werden und die Waschgelegenheiten begrenzt sind. Noch ist es eher dunkel als dämmerig, durch Wolken und Nebel kämpft sich mühsam der Morgen, ihr letzter auf der Marine Flasher nach zehn anstrengenden Tagen auf See. Dass ein besonderer Tag anbricht, liegt in der Luft wie die gute Laune der heimkehrenden amerikanischen Crewmitglieder, die bereits in ihren tadellosen Uniformen umhereilen, um das Schiff auf seine Einfahrt in New York vorzubereiten. Wie Pingpongbälle fliegen Pfiffe und Rufe hin und her, und Helene glaubt herauszuhören, dass sie sich gegenseitig von ihren Verlobten vorschwärmen, die auf ihre Küsse warten, eine sehnsüchtiger als die andere. Mit Scherzen und Kaugummi, den sie großzügig verteilen, bringen sie die noch etwas verschlafenen Kinder zum Lächeln. Danach bestaunen diese den Sonnenaufgang, den sie trotz der Nebelschleier vielleicht noch nie ungetrübter erlebt haben, weil sich ihnen auf dem Atlantik weder zerbombte Ruinen noch stachelige Drahtzäune in die Sicht drängen. Glatt wie selten auf ihrer Reise liegt das Meer vor ihnen, eine riesige Bühne, auf der die Natur den Tagesanbruch in magischen Farben inszeniert und die Welt in zarte Pastelltöne taucht. Ein zauberhaftes Schauspiel, das den rosigen Beginn einer neuen Zeitrechnung verspricht.
Eine kühle Brise bläst die verbrauchte Luft des Schlafraumes aus Helenes Kleidern, vertreibt aber nicht die bleierne Müdigkeit, die an ihren Knochen und Gelenken haftet. Ausgerüstet mit ihrem Becher macht sie sich auf den Weg zur Küche, wo man mit etwas Glück und einer freundlichen Bitte schon in aller Herrgottsfrühe einen Kaffee bekommt. Im Vorbeigehen schnappt sie polnische, russische und tschechische Worte auf, die sie zwar nicht versteht, deren Klang sie jedoch meint, ihren jeweiligen Sprachen zuordnen zu können. Auch Letten, Esten, Rumänen, Ungarn und Jugoslawen sind an Bord, wie sie von Marek Kaminski weiß, der, obwohl er natürlich nicht alle Sprachen beherrscht, einfach mit jedem ins Gespräch kommt, manchmal dank freiwilliger Dolmetscher, zur Not mit Händen und Füßen. Er ist der Einzige, dem Helene während der langen Überfahrt nähergekommen ist, weshalb sie sich vorgenommen hat, gemeinsam mit ihm die Freiheitsstatue zu begrüßen. Sobald sie ihren Kaffee getrunken hat, wird sie ihn am Bug des Schiffes aufsuchen, wo er gerne sitzt und gelangweilten Kindern mit Zaubertricks die Zeit vertreibt.
Auf den Decks ist mehr los als gewöhnlich um diese Zeit, denn nicht nur diejenigen, die vom Schnarchen, Husten und Wimmern der anderen geweckt oder von ihren eigenen Albträumen aus dem Bett gejagt wurden, sind auf den Beinen. Schon jetzt sichern sich übernächtigte Familien zwischen Tauen, Kübeln, Kisten und Rettungsbooten einigermaßen bequeme Sitzplätze, da sie auf gar keinen Fall den Augenblick verpassen möchten, in dem die amerikanische Küste am Horizont auftauchen wird. Tuschelnd, vielleicht über diejenigen, die sie hoffen, in Amerika wiederzutreffen, oder schweigend kuscheln sie sich aneinander, Wasser und Kaffeebecher werden herumgereicht, Decken um Schultern geschlungen, eine junge Frau singt ein Lied in einer Sprache, von der Helene glaubt, dass es Tschechisch ist. Kleinere Kinder liegen schlummernd auf den Schößen ihrer Mütter. Jedenfalls hofft Helene, dass es die Mütter sind, aber wer weiß das schon bei all den Familien, aus denen Angehörige jäh herausgerissen wurden. Manchmal, wenn die Flaggen schlaff in der Windstille dösen, aber dennoch ein feiner Luftzug Helenes Arme streift und sie glaubt, ein undeutliches Gewisper zu vernehmen, dann hält sie es für möglich, dass sich die Seelen der Toten unter die Passagiere mischen und sie sehnsüchtig berühren. Unsichtbare Begleiter, die ihr immer wieder dieselbe Frage stellen: Weshalb mussten sie sterben, während Helene das Geschenk eines neuen Lebens in ihren Händen hält?
Vorsichtig schiebt sie sich an einem älteren Paar vorbei, das Hand in Hand an der Reling steht, umgeben von dem unfassbaren Glück, einander nicht verloren zu haben. Nicht einmal die Kinder, die wild um sie herumtoben, scheinen sie zu stören. Die Beine der Passagiere dienen den Kindern als Deckung, während sie Fangen spielen. Im Geiste listet Helene ihre Namen auf, sie kennt sie alle. In ihren Schläfen beginnt das Blut zu pulsieren, sie möchte sich abwenden und sie doch gleichzeitig in ihre Arme schließen. Um sie zu beschützen.
Denn plötzlich sitzen die Kinder auf der Reling, nebeneinander, ganz still, als warteten sie darauf, aufgerufen zu werden. Kaum merklich bewegt Helene ihre Lippen, als sie flüstert: »David, Günther, Linda, Edith, Willi, Max, Tilly, Josua, Kurt, Irene, Esther, Helmut …«
Ein Kind nach dem anderen plumpst rücklings ins Wasser. Helene steht wie gelähmt da. Zum Schluss gibt es nur noch die fünfzehnjährige Rosa. Helene fasst nach dem Ärmel des Mädchens, greift jedoch ins Leere.
»Rosa!«
Von der Reling aus blickt das Mädchen sie ernst an. Hinter ihr branden die Wellen gegen den Bug.
»Wenn ich drin bin, atme ich ganz tief ein«, sagt sie. »Dann ist es schnell vorbei.«
Und dann lässt sie sich fallen.
»Nicht!«
Weit beugt sich Helene über die Reling hinab, doch der Atlantik hat das Mädchen bereits verschluckt.
»Seien Sie bloß vorsichtig«, sagt der ältere Herr freundlich. Er hat sich von seiner Frau gelöst und zieht Helene sanft zurück. Die spielenden Kinder tummeln sich nun um die Beine zweier Besatzungsmitglieder, die ihnen ein paar Streifen Kaugummi zustecken.
»Hier, nehmen Sie.«
Die Frau reicht Helene ein Taschentuch, damit sie sich den Schweiß von der Stirn wischen kann.
»Mein Mann hat recht. Vergessen Sie nicht, was dem jungen Russen passiert ist.«
Andrei. Als könnte Helene ihn vergessen. Es ist kein Unfall gewesen, wie manche unbedingt glauben wollen. Andrei starb, weil er dachte, dass kein Ozean so tief sein könne wie sein Schmerz.
Helene massiert ihre kribbelnden Finger, bis diese sich beruhigt haben. Die Frau streicht ihr dabei über den Rücken.
»Geht es wieder?«
»Ja, danke.«
Keiner von ihnen macht ein Bohei um die kurze Szene. Aufschreiende Menschen sind an Bord der Marine Flasher nichts Besonderes, genauso wenig wie weinende und völlig tränenlose. Der Mann legt erneut seinen Arm um seine Frau und zu einer Einheit verschmolzen, gehen sie weiter.
Noch einmal betupft Helene mit dem Taschentuch ihr Gesicht, dann macht sie sich auf, um in der Küche Kaffee zu besorgen. Lässig wie Filmstars posieren zwei junge Männer neben einer amerikanischen Flagge und lachen in die Kamera eines Dritten. Der dunkelhaarige Fotograf bedeutet Helene mit einer einladenden Geste, sich dazuzustellen und ablichten zu lassen. Überfordert von dieser verspielten Geste winkt Helene ab und läuft weiter, sieht aber aus den Augenwinkeln noch, wie sich der abgewiesene Fotograf übertrieben enttäuscht in einen Liegestuhl fallen lässt. Wo er wohl diese Rarität aufgetrieben hat? Das Schiff ist schließlich kein Luxusdampfer, worüber sich Helene aber weiß Gott nicht beschwert. Zwar müssen die Passagiere eigenhändig die Böden schrubben, wenn sich an stürmischen Tagen mal wieder jemand übergeben hat, doch weder dies noch die eintönigen Schiffsspeisen werden moniert. Ohne die ständige Angst im Nacken verzehren die meisten hier an Bord die besten Mahlzeiten, die sie seit Jahren bekommen haben.
»In Amerika sind sogar die Gehwege aus purem Gold«, sagt eine Frau zur Mutter von Lisbeth Schwarz, die an der Reling lehnt und mit einem Fernglas den Horizont abtastet.
»Aus Gold?«
Frau Schwarz lässt das Fernglas sinken. »Und das klaut keiner?«
»Nee, warum denn? Da drüben gibt es doch alles im Überfluss.«
»Ach so. Also, mir reicht es schon, wenn da nicht überall Trümmer herumliegen«, erwidert Frau Schwarz.
Plötzlich duftet der Seewind nach Kaffee, und beinahe wäre Helene mit einem jungen Marinesoldaten zusammengestoßen, der zwei Thermoskannen vor sich herträgt, ein zweiter verteilt Coca-Cola, die er Coke nennt, Brot und etwas Obst.
»Good morning, Ma’am«, begrüßt sie der Soldat mit den Kannen. »Would you like some coffee?«
»Coffee? Oh, yes, please.«
Er füllt Helenes Becher und allein der Geruch des Bohnenkaffees tut ihr gut.
»A beautiful sunrise, isn’t it?«
Der Soldat spricht langsam und deutet auf den Sonnenaufgang, weshalb Helene sofort versteht, was er meint, denn mit ihrem Englisch ist es leider nicht weit her, war es nie, wenn sie ehrlich ist. Warum hat sie die Zeit auf der Marine Flasher nicht genutzt, um es besser zu lernen? Ihr Geist wäre beschäftigt und vielleicht weniger anfällig für Schwermut gewesen.
»Yes, beautiful.«
Der junge Amerikaner lächelt sie an, und sie merkt, dass ihr die Röte in die Wangen steigt. Über zwei Jahre nach Kriegsende empfindet sie noch immer eine übertriebene Dankbarkeit, wenn Fremde ihr spontan mit Höflichkeit und Respekt begegnen.
»Enjoy the sunrise«, rät ihr der Marinesoldat. »You know, you can’t see such a wonder in a big city like New York.«
»But I can see my family.«
Und das ist ein noch viel größeres Wunder, so überwältigend, dass Helene sich fragt, womit ausgerechnet sie es verdient hat. Dass Gott etwas damit zu tun hat, bezweifelt sie, obwohl sie all die Kriegsjahre hindurch so oft gebetet hat wie nie zuvor in ihrem Leben. Aber das haben andere auch getan, Eltern wie sie, deren Glauben gefestigter war als der ihrige, und deren Kinder, falls sie Deutschland entkommen konnten, trotzdem vergeblich auf sie warten werden.
Moritz. Marlis. Heute ist es so weit, ich sehe euch wieder. Im Stillen wiederholt sie diesen Satz viele Male, als müsse sie sich davon überzeugen, dass nicht im letzten Augenblick noch etwas dazwischenkommen könne. Je näher dieser langersehnte Augenblick nämlich rückt, desto unvorstellbarer erscheint es Helene, dass die beiden am Kai stehen werden, um ihr zuzuwinken, dass sie sich umarmen, miteinander sprechen, und schließlich sogar zusammenleben werden. Sie brennt darauf, mit eigenen Augen zu sehen, dass es ihnen wirklich so gut geht, wie Marlis in ihren Briefen behauptet hat. Denn, ja, dann hätten sich Helenes Opfer gelohnt.
Ob sie schon wach sind, vor Aufregung keinen Bissen herunterbekommen und den Mittag herbeisehnen wie Helene? Sind sie vielleicht bereits auf dem Weg nach Ellis Island, um dort, wo die Marine Flasher anlegen wird, einen Platz in vorderster Reihe zu ergattern? Ob sie es genauso wenig wie Helene fassen können, dass sie diesen Augenblick erleben dürfen?
»Excuse me, Ma’am, are you German?«
Erschrocken mustert Helene den Marinesoldaten mit den Thermoskannen, der zurückgekommen ist und ihr nun, ohne nachzufragen, frischen Kaffee nachschenkt. Hat sie ihn richtig verstanden? Warum möchte er wissen, ob sie Deutsche ist? Ihr wird eiskalt, denn sie hat verlernt, diese Frage unbefangen zu beantworten. Für die Nationalsozialisten ist sie keine Deutsche gewesen, nicht einmal ein Mensch.
»Why?«, fragt sie zurück. Frage, Gegenfrage, Zeit schinden, um sich klarzumachen, dass ihr niemand mehr etwas antun will.
Der Marinesoldat zuckt mit den Achseln und wirkt jetzt etwas verunsichert.
»Your accent … I’m just interested.«
Ihr deutscher Akzent interessiert ihn? Wieso? Womöglich, weil es Deutschen grundsätzlich verboten ist, auszuwandern, damit sich all die Nazis nicht einfach aus dem Staub machen und ihrer Verantwortung entziehen? Fast hätte sie aufgelacht bei dem Gedanken, dass der junge Marinesoldat sie für eine von ihnen halten könnte. Soll sie ihm etwa erklären, dass sie Jüdin ist? Reiß dich zusammen, ermahnt sich Helene, gar nichts musst du erklären und dich auch nicht dafür rechtfertigen, wer du bist. Allerdings könnte es einen sonderbaren Eindruck hinterlassen, wenn sie seine Frage ignorierte, deshalb antwortet sie: »Yes, I am from Germany.«
Mit zwei Fingern tippt der Marinesoldat an seine Mütze und sagt, bevor er sich anderen Passagieren zuwendet: »Nice to meet you … and Ma’am? Good luck in America.«
Benommen blickt Helene ihm nach. Er wollte nur nett zu mir sein, denkt sie, und ich benehme mich, als ob er ein Verhör beginnen würde. Mit einem Mal fühlt sie sich einem neuen Leben nicht gewachsen. Unter immensen Gefahren hat sie die Jahre der Nazi-Diktatur überstanden, aber jetzt ist sie unfähig, ein harmloses Gespräch zu führen? Obwohl sie weiß, dass sie nichts mehr zu befürchten hat?
Von der Reling aus blickt Helene aufs Meer, als läge dort der passende Verhaltenskodex verborgen, den sie finden und herausfischen müsste. Noch ist ihr bleicher Verbündeter, der Mond, soeben zu erkennen, die Sonne scheint noch nicht kräftig genug, um die Wolken auseinanderzutreiben.
Helene nippt an ihrem Kaffee, der sie wohltuend wärmt. Ungefähr an derselben Stelle stand sie zehn Tage zuvor, direkt neben Andrei, diesem hübschen, jungen Russen in seinem hellen Staubmantel, der ihr mit ein paar Brocken Deutsch zu verstehen gab, dass er alleine reiste, genau wie sie. Als die Marine Flasher ihr ohrenbetäubendes Signal zur Abfahrt ausstieß, schoben und drängelten sich die umstehenden Passagiere an der Reling, um den Zurückbleibenden am Kai letzte Liebesworte zuzurufen, selbst wenn diese sie nicht mehr hörten, ebenso wenig wie ihr Versprechen, dass man sich eines Tages wiedersehen würde. Helene winkte niemandem und suchte auch nach keinem Gesicht in der Menge. Sie hasste tränenreiche Abschiede und hatte bereits in Frankfurt all ihren Lieben Lebewohl gesagt, auch ihrer engsten Freundin.
Die Abschied nehmenden Passagiere hatten weiße Taschentücher hervorgeholt, die neben den sich blähenden amerikanischen Flaggen flatterten wie kleine Friedenstauben. Derweil sahen Helene und Andrei gefasst zu, wie der Hafen und die Häuser Bremens zu einer vagen Ahnung verblassten, bis schließlich die Küste Europas samt seiner Misere in Dunst und Ferne verschwand.
Längst war das Schiffshorn verstummt, und Stille breitete sich an Bord aus. Ohne dass sie es bemerkt hatte, war ihre Hand auf Andreis Ärmel gelandet, als gehörten sie beide für die Dauer dieses Abschieds zusammen. Der Russe atmete schwer, versuchte vielleicht, seine Tränen zu unterdrücken, Helene selbst spürte, wie sich ihr Herz und Magen verkrampften, weil sich zu viele Gefühle ineinander verhedderten. In dieser Minute hätte sie schwören können, dass alle an Deck dieselben Empfindungen teilten, als steckten sie in einem gemeinsamen Körper, dessen Wurzeln mit jeder Welle gen Westen weiter durchtrennt wurden – und das tat weh. Doch ihre einstige Heimat war zu einem Ort der Qual mutiert, verkommen zu einem Massengrab. Und deshalb wünschte sich Helene, dass das Vergangene in Vergessenheit versinken möge wie ein zerstörtes Schlachtschiff an der tiefsten Stelle des Ozeans, dort, wo kein Lichtstrahl mehr hingelangte.
Als die Menge an Deck sich auflöste, strich sich Andrei sein volles dunkles Haar aus der Stirn und schenkte Helene ein Lächeln mit Grübchen, das, so unwesentlich es für den Lauf der Dinge auch war, auf ewig in Helenes Erinnerung mit diesem Tag verbunden bleiben würde.
In der dritten Nacht auf See, nur eine Woche, bevor die Marine Flasher New York erreichen würde, war Andrei spurlos verschwunden. Es war eine ruhige Nacht gewesen, eine, die keine Gefahren barg. Jeden Winkel des Schiffes suchte die Mannschaft nach ihm ab, auch Helene, Marek Kaminski und ein paar Kabinengenossen von Andrei halfen. Vergeblich.
In einem der Rettungsboote auf dem oberen Deck fanden sie seinen Staubmantel, ordentlich über der Sitzbank ausgebreitet, als wäre er nur kurz aufgestanden und kehrte jeden Augenblick zurück. Doch das tat er nicht. Denn er hatte sich in den Atlantik gestürzt.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht und niemanden ließ sie unberührt. Aber das lag nicht daran, dass sich ein junger Mann, den kaum jemand gekannt hatte, das Leben genommen hatte. Mit dem Gedanken, lieber von eigener Hand zu sterben, als in die Klauen von Hitlers Schergen zu geraten, hatten, wie Helene vermutete, nicht wenige Passagiere einst gespielt, und auch ihr war er nicht fremd. Aber dieser Schrecken war nun vorbei, und sie alle fuhren auf einem Schiff der Hoffnung einem Leben in Freiheit entgegen. Wieso also wählte Andrei den Tod zu einem Zeitpunkt, der ihm einen Neuanfang in Aussicht stellte?
»Mein Mann hätte so gerne gelebt«, sagte Lisbeth Schwarz voller Bitterkeit, als sie abends auf ihren Pritschen saßen. »Alles, alles hätte er dafür getan, nach Amerika zu kommen und seine Kinder aufwachsen zu sehen. Und dieser Russe schmeißt sein Leben weg wie ein Stück Abfall. Da hätte er seine Fahrkarte lieber einem anderen überlassen! Einem, der leben will.«
Wie betäubt saß Helene da, während die anderen über Andreis Schicksal rätselten, es bedauerten und kommentierten. Andreis Tod zerrte an ihr, obwohl sie doch nichts weiter mit ihm verband als jener Augenblick, in dem sie Europa hinter sich ließen und sie in seinem Lächeln Perspektive las, in seinen Grübchen Optimismus.
Hätte es etwas an Andreis Entscheidung geändert, wenn sie noch einmal auf ihn zugegangen wäre? Aber genau das hatte Marek Kaminski getan. Unaufdringlich wirft er seinen Rettungsreifen aus, wenn er merkt, dass es jemandem nicht gut geht. Ein Lächeln, eine aufmunternde Bemerkung, eine Zigarette, ein kurzes Gespräch, falls sprachlich möglich – für jeden hat Marek Kaminski ein offenes Ohr. So hatte auch Andrei ihm sein Herz ausgeschüttet und erzählt, dass er, kurz nachdem Hitler im Sommer 1941 die Sowjetunion angegriffen hatte, in deutsche Gefangenschaft geraten war. Als gerade mal Achtzehnjähriger überstand Andrei Hunger, Kälte, Durchfall und Schikanen. Nach Kriegsende wollte er so schnell wie möglich in sein Dorf zurück, doch Stalin hatte sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene zu Landesverrätern und Kollaborateuren erklärt. Andrei ahnte, was ihm in der Sowjetunion blühte: brutale Verhöre, Arbeitslager, vielleicht Schlimmeres – schon wieder. Von seinen Angehörigen hörte er nichts und fürchtete, dass sie, falls sie den Krieg überlebt hatten, an seiner Stelle bestraft werden würden. Der Weg nach Osten blieb ihm verwehrt, also bemühte er sich um ein Visum für die Vereinigten Staaten als sogenannte displaced person.
Als Helene aufblickt, ist der Mond verblasst, die Wolken sind weitergezogen, nur noch einzelne, die so aussehen, als sei die Gischt bis an den Himmel gespritzt, kontrastieren sein Blau. Also behält der Kapitän mit seiner Prognose recht, und sie werden bei heiterem Wetter in New York einlaufen. Inzwischen ist ihr Kaffee kalt geworden, den letzten, bittersten Schluck kippt Helene ins Meer. Aus ihrer Jackentasche holt sie eine zerknitterte Zigarette und Zündhölzer hervor, die der Wind immer wieder auspustet. Schließlich gelingt es ihr, die Zigarette im Schutz ihrer Hand anzuzünden. Tief saugt sie das Nikotin in ihre Lungen, und als sie ausatmet, trägt der Wind den Rauch davon.
Auch sie hat viel durchgemacht, ist ausgelaugt vom Leben als Verfolgte und vom Krieg, und hat gehofft, dass die Überquerung des Atlantiks ihr eine Verschnaufpause verschaffen würde. Dass die Erinnerungen und Zukunftsängste die Zeit auf See nutzen würden, um erneut hervorzuquellen, damit hat sie nicht gerechnet. Ist es Andrei ähnlich ergangen? Haben diese Gedanken das Pflänzchen Hoffnung erstickt, das er so dringend gebraucht hätte, um an einen Neuanfang zu glauben? Hat Andrei mit jeder zurückgelegten Seemeile stärker gespürt, dass sein Leid nicht mit dem Krieg endet oder dadurch erträglicher wird, dass er Deutschland verlässt? Hat er sich ein Leben ohne Aussicht, seine Liebsten je wiederzusehen, nicht vorstellen können? Was würde sie tun, wenn sie sich nicht sicher wäre, dass Moritz und Marlis gesund und munter ihrem Wiedersehen entgegenfiebern?
»Guten Morgen, Frau Bornstein. Wie wär’s zur Feier des Tages mit einem Kaffee?«
Die Bassstimme Marek Kaminskis reißt Helene aus ihren traurigen Gedanken. Der schmächtige, alte Mann trägt wie immer seinen langen Mantel, der den Eindruck macht, als wäre er etliche Nummern zu groß. Dabei behauptet Marek Kaminski steif und fest, dass er Kleidung dieser Größe in früheren Zeiten locker ausgefüllt habe.
»Auschwitz hat mir jedes Gramm Fleisch vom Leibe gefressen und wie eine Hyäne an meinen Knochen, Sehnen und Muskeln gerissen«, sagte er, nachdem sie vertrauter miteinander geworden waren. »Nun ist nicht mehr viel von mir übrig.«
Nur ein anderes Mal erwähnte er das Vernichtungslager, als er Helene von der Ermordung seiner Frau kurz vor Kriegsende erzählte. Seitdem spricht er nicht mehr davon, und Helene fragt auch nicht, schließlich will Marek Kaminski ebenfalls nicht von ihr wissen, was ihr widerfahren ist oder wie sie überlebt hat. Und das ist ihr nur recht. Anstatt im Sumpf ihrer Vergangenheit zu versinken, konzentriert sie sich lieber auf ihre Zukunft.
Als sie sich gerade Marek Kaminski zuwenden will, stößt sie mit dem Ellenbogen ihren leeren Becher um, den sie auf einem Pfosten platziert hat, und der nun samt ihrer halb gerauchten Zigarette ins Meer plumpst.
»Oh nein«, ruft sie aus, »er war eine Erinnerung.«
»An Ihre Eltern?«
Helene schüttelt den Kopf.
»An eine Freundin.«
»Wie schade«, sagt Marek Kaminski mit seinem charmanten polnischen Akzent und reicht ihr einen seiner beiden Becher, aus dem wohlriechender Kaffeeduft dampft. Einen Moment lang ist Helene beschämt darüber, dass sie ihm nicht wenigstens an diesem letzten Tag mit einer Aufmerksamkeit zuvorgekommen ist.
»Vielen Dank.«
»Auf diesen denkwürdigen Tag.«
Sie stoßen an, als wären ihre Becher Sektgläser. Dabei versucht Marek Kaminski mit seiner anderen Hand den Hut festzuhalten, den der Seewind gerne davongetragen hätte.
Marek Kaminski fragt sie nach Moritz, und Helene beschreibt ihm, wie er aussieht, auch wenn sie es gar nicht genau wissen kann, denn das aktuelle Bild, das Marlis ihr in einem ihrer Briefe geschickt hat, ist aus der Ferne geknipst worden. Helene malt sich aus, wie Marlis ihr amerikanisches Haus eingerichtet hat und worüber sie sich beim Abendessen unterhalten werden. Vielleicht kann Moritz ihr helfen, besser Englisch zu lernen. Marek Kaminski erzählt von seinem Bruder, der bereits früh emigriert und in Amerika heimisch geworden ist. Er ist ihm dankbar dafür, dass er finanziell für ihn bürgt und sein Sohn ihn bei sich und seiner Familie aufnimmt. Ein Garten, in dem er Gemüse anbauen und Blumen pflanzen kann, ist Marek Kaminskis größter Traum. Aber ob das in einer Stadt wie New York überhaupt möglich ist?
»Hatten Sie früher mit Landwirtschaft zu tun?«, erkundigt sich Helene.
»Nein, in Krakau war ich Lehrer«, antwortet Marek Kaminski. »Mathematik und Sport.«
»Und wie haben Sie so gut Deutsch gelernt?«
Marek Kaminski zieht seinen Mantel aus und legt ihn auf eine der großen Kisten an Deck. Seine Hände sind knochig, seine Schultern gebeugt, tatsächlich scheint nur noch seine Stimme von dem kräftigen Mann zu zeugen, der er einst gewesen sein muss.
»Eine ganze Weile habe ich in Deutschland gearbeitet. Mein Bruder lebte dort, er ist schon immer beweglicher gewesen als ich, und schlauer. Als er nach Amerika wollte, weil er das Unheil für uns Juden aufziehen sah, habe ich ihn für verrückt erklärt. Anstatt mit meiner Frau mitzugehen, zogen wir nach Polen zurück.«
Er schweigt, und wirkt noch fragiler.
»Irgendein kleines Gartenstück wird sich schon finden«, sagt Helene leise. »Und wenn nicht sofort, dann fangen Sie eben mit ein paar Blumentöpfen auf dem Fenstersims an. Hauptsache, Sie haben etwas, das Sie hegen und pflegen können.«
Sie lächelt ihn an, und beschließt, sich für die Gesellschaft, die er ihr geleistet hat, zu bedanken.
»Wissen Sie, dass ich Sie die ganze Zeit den Schutzengel der Marine Flasher genannt habe? Sie sind unschlagbar darin, sich um andere zu kümmern. Ich weiß nicht, wie ich diese Reise ohne Sie überstanden hätte.«
Einen Moment lang hellt sich seine Miene auf, doch dann seufzt er.
»Ich danke Ihnen, Frau Bornstein. Oder darf ich Helene sagen? Ich bin Marek, aber das weißt du ja.«
Er streckt ihr seine Hand entgegen und sie schlägt ein. Etwas seltsam erscheint es ihr schon, einen Herrn, der ihr Vater sein könnte, mit Vornamen anzusprechen.
»An andere zu denken und nicht an mich, hat mir geholfen, nicht wahnsinnig zu werden«, sagt Marek. »Und dabei, an Orten, an denen es keine Menschlichkeit gibt, trotzdem ein Mensch zu bleiben. Das ist schwer genug. Aber ein Schutzengel bin ich sicher nicht, sonst würde Andrei heute neben uns stehen.«
Er wischt eine Träne von seiner eingefallenen Wange. Sanft legt Helene ihre Hand auf seine.
»Du hast mit ihm geredet. Was sonst hätte man noch tun können? Wir kannten ihn doch gar nicht.«
Mit tieftraurigen Augen sieht Marek sie an.
»Weißt du, was ich ihm geraten habe? Einen beherzten Schritt in eine ungewisse Zukunft zu wagen. Und, mein Gott, genau das hat er getan. Dabei habe ich natürlich Amerika gemeint. Leben, Licht, gewiss nicht den Tod.«
Er weint leise, und Helene versteht, was Marek so mitnimmt. Seine Angst, das Zünglein an der Waage gewesen zu sein, der letzte Anstoß für Andreis Entschluss, winzig klein, aber ausschlaggebend. Marek hebt seinen Mantel auf und kramt ein Taschentuch heraus, mit dem er sich die Nase schnäuzt. In ihrer Strickjacke findet Helene eine letzte Zigarette, etwas bröselig zwar, aber rauchbar. Sie zündet sie an und bietet sie Marek an, aber er schüttelt den Kopf.
»Ich rauche nicht, danke.«
Ein paar Male inhaliert Helene, wirft die Zigarette aber bald ins Wasser, denn der Tabak ist so trocken, dass er grässlich in ihrem Hals kratzt. Tabakreste bleiben an ihrer Lippe kleben und brennen ein wenig.
»Möchtest du sehen, was mir geholfen hat, durchzuhalten?«
Sie zeigt ihm die einzige Kinderfotografie von Moritz, die sie über den Krieg gerettet hat.
»Mein Talisman«, sagt sie. »Solange ich das Bild bei mir trage, weiß ich, dass ich Moritz wiedersehe.«
Moritz, ihr Kompass. Immer, wenn sie nicht mehr sicher gewesen war, wie es weitergehen sollte, war er ihre Rettung. Vor allem in den Augenblicken, in denen sie dachte, dass es leichter wäre, aufzugeben und zu sterben. Sobald sie diese verknitterte Fotografie betrachtet, hört sie deutlich seine helle Jungenstimme.
»Um acht beim Mond!«
Moritz’ letzter Satz, den er ihr zuflüsterte, ihre winzige Verschwörung gegen die Nazis.
»Um acht beim Mond!« Wenigstens dieses Versprechen hat Helene gehalten.
Jeden Abend, sofern Bomben und Wetter es zuließen, suchte sie den Himmel ab, und fand sie den Mond, schickte sie ihre Liebe zu ihm hinauf, überzeugt davon, dass sie Moritz erreichen würde, wenn er vor dem Zubettgehen zum Gesicht des Mondes hinaufblickte.
Aufmerksam betrachtet Marek das Bild, bevor er es Helene zurückgibt.
»Ein hübscher Junge. Er ähnelt dir sehr, obwohl er dunkelhaarig ist.«
Einen Tag vor ihrem Abschied ist die Fotografie entstanden, in Frankfurt, im Jahr 1939, kurz nach Silvester. Noch hofften die Deutschen, der Frieden würde ihnen erhalten bleiben, doch gegen die jüdischen Mitbürger wütete bereits ein erbarmungsloser Krieg, der ihnen ein menschenwürdiges Dasein unmöglich machte.
Viel zu ernst für einen kleinen Jungen blickte Moritz an jenem Nachmittag in die Kamera, aber Helene erinnert sich gut daran, dass er sich, als das schwarze Hündchen des Fotografen immer wieder an seinen Schnürsenkeln schnupperte, ein Lächeln verkniff, und zwar deshalb, weil ihn der Fotograf dazu aufgefordert hatte, wie ein Erwachsener dreinzuschauen. »Damit deine Mutti sieht, was für ein tapferer, kleiner Mann du bist.« Anschließend durfte Moritz mit dem Hündchen spielen. Mimi hieß es, sogar das weiß Helene noch. Und dass ihr der Anblick von Moritz’ kindlicher Freude tief ins Herz schnitt.
Beklommen steckt Helene die Fotografie in ihre Tasche zurück.
»Ein Neuanfang, ist er überhaupt möglich? Ich meine, mit all dem Ballast, den wir mit uns herumschleppen?«
Kurz hält sie inne und überlegt, wie sich die Aussicht, sich ein neues Leben aufzubauen, anfühlen muss, wenn man Mareks Alter erreicht hat und die verbleibende Zeit überschaubar geworden ist. Gedankenverloren streicht Marek über seine faltigen Finger, als würde er sich gerade dieselbe Frage stellen.
»Leider können wir unser Leben nicht abstreifen wie Schlangen ihre alte Haut. Sie kriechen aus ihr heraus, sobald sie eine frische, unversehrte gebildet haben. Das wäre praktisch, nicht wahr?«
In einer hilflosen Geste hebt Marek seine Hände und lässt sie wieder fallen.
»Ob die tiefen Wunden je heilen? In meinem Alter nicht mehr. Aber ich versuche meine düsteren Erinnerungen mit schönen zu überstrahlen, in das Licht zu schauen, das sie mir schenken. Ich will mich an den Menschen erinnern, der ich einst gewesen bin, bevor Hitler beschloss, einen Untermenschen aus mir zu machen.«
Er breitet seinen Mantel auf der Kiste aus, als wäre er eine Picknickdecke und lädt Helene ein, sich zu setzen.
»Also, wer bist du gewesen, Helene? Was hast du gerne gemacht? Hast du vielleicht einen Beruf erlernt? Ich würde es gerne wissen, natürlich nur, wenn du erzählen möchtest.«
Helene macht es sich neben Marek bequem und hält mit geschlossenen Augen ihr Gesicht der Sonne entgegen, fühlt die Meeresbrise auf ihrer Haut.
»Ich bin Ärztin«, antwortet sie, »Kinderärztin, um genau zu sein.«
»Eine richtige Frau Doktor?«
So viel Hochachtung schwingt in Mareks Stimme mit, dass in Helene ein Funken Stolz aufflammt, wie sie ihn früher, am Anfang ihrer medizinischen Laufbahn, oft empfunden hat.
»Ja«, sagt sie und wendet sich Marek nun zu. »Natürlich sollte eigentlich mein Bruder Medizin studieren und die Praxis unseres Vaters übernehmen.«
Helene ruft sich diesen unbekümmerten Sommertag des Jahres 1923 ins Gedächtnis, der nicht erahnen ließ, dass abends eine wichtige Entscheidung gefällt werden würde. Nachmittags hatte sie zusammen mit ihren Schulfreundinnen Thea und Marie von der Zukunft geträumt. Da Maries Eltern geschäftlich verreist waren, hatten die jungen Frauen das großzügige Haus in der Nähe des Palmengartens ganz für sich gehabt und den gesamten Tag nach ihrem Gusto verbummelt. Waren sie wirklich so unverschämt ausgelassen gewesen, wie Helene es in Erinnerung hat? Immerhin herrschte in Deutschland Krisenstimmung, die Wirtschaft lag in Scherben, alltägliche Lebensmittel oder eine einfache Fahrt mit der Straßenbahn kosteten Milliarden, für viele Menschen war der Hunger der schlimmste Feind. Seit die Franzosen im Januar ins Ruhrgebiet einmarschiert waren, hatte sich die Lage dramatisch zugespitzt. Doch selbst das hatte den Freundinnen nicht die gute Laune verdorben. Vor Kurzem hatten sie erfolgreich ihr Abitur bestanden, waren jung, modern und trotz aller Misere überzeugt davon, dass ihnen die ganze verrückte Welt zu Füßen liegen würde.
Helene sieht sich dort sitzen, in einem schlichten, aber modisch wadenlangen Kleid, aufgestecktem Haar und dunkelrot geschminkten Lippen, die sie verführerisch zu öffnen übt, so wie sie es in Pola Negris Stummfilmen gesehen hat. Zwischendurch nascht sie von dem frisch gebackenen Kuchen, der köstlich schmeckt, obwohl er selbst in Maries wohlhabendem Elternhaus ohne die unbezahlbare Butter und die im Rezept empfohlene Anzahl an Eiern gebacken worden ist. Marie, die sich nach ihrem Schulabschluss die Haare abschneiden durfte, hat Theas neuen Glockenhut aufgesetzt, der zu ihrem modernen Bobschnitt eindeutig besser passt als zu Theas langen kastanienbraunen Locken. Auf ihrem weißen Flügel schlägt Marie Rhythmen an, die nach Jazz klingen, während Thea versucht, sie mit Operettenmelodien zu übertönen. Was für ein fröhliches Tohuwabohu.
Ist das wirklich sie gewesen, diese lebenslustige junge Frau?
»Mein Bruder hätte niemals Arzt werden können, und mein Vater hätte es wissen müssen«, erklärt Helene, als sie spürt, dass Marek sie erwartungsvoll ansieht. »Aber er war immer gut darin, zu ignorieren, was er nicht wahrhaben wollte.«
»War dein Bruder nicht klug genug?«
Kopfschüttelnd lacht Helene auf.
»Nein, nein, daran hat es ganz bestimmt nicht gelegen.«
Frankfurt, Sommer 1923
»Anton kann nun mal kein Blut sehen und vom Geruch der Desinfektionsmittel wird ihm speiübel.«
»Und trotzdem soll er Arzt werden? Der Arme.«
Von ihren Jazz-Akkorden wechselte Marie zu einem Foxtrott-Schlager, den Helene und Thea sofort mitsangen und dazu tanzten.
»Wo hast du denn die schönen blauen Augen her, so treu, so lieb, so rein? Ich glaube fast, das sind schon keine Augen mehr, das müssen Sterne sein!«
»Glaubst du, Marie meint Antons Augen oder meine?«
Theatralisch schlug Helene ihre Augen auf und blinzelte Thea an, die sofort losprustete.
»Na, was denkst du denn? Antons natürlich. Gib’s zu, Marie, du hast eine Schwäche für Helenes Bruder!«
Abrupt hörte Marie auf zu spielen, riss sich Theas Glockenhut vom Kopf und warf ihn lachend nach ihrer Freundin.
»He, nicht so wild, der ist neu!«, rief Thea und fing ihren Hut auf.
»Dann red nicht so einen Unfug! Anton sieht gut aus und ich mag ihn, aber ich kenne ihn länger als meinen eigenen Bruder! Tut mir leid, da ist kein Platz für Zauber.«
»Wie du meinst.«
Schulterzuckend drückte Thea den Hut auf ihre rotbraune Lockenmähne, ließ sich in einen Sessel plumpsen und bedeutete Helene mit einer Geste, dass sie ihr eine Zigarette reichen solle.
»Danke, darling. Kommt, setzt euch zu mir. Marie, nun guck nicht so ängstlich. Nachher lüften wir, dann merken deine Eltern gar nicht, dass wir geraucht haben. Hier, nehmt schon.«
Thea zündete zwei weitere Zigaretten an und gab die eine Helene, die andere Marie. Die beiden streiften ihre Schuhe ab und machten es sich auf den dicken Sofapolstern bequem. Während Marie etwas gequält dreinschaute, inhalierte Helene tief, ohne zu husten, das hatte sie inzwischen gelernt. Auf dem weißen Zigarettenpapier hinterließ ihr Lippenstift einen dunkelroten Abdruck. Schließlich erzählte Helene, wie ihr Bruder letzten Sonntag verkündet hatte, dass er gedachte, sein verhasstes Medizinstudium an den Nagel zu hängen. Seitdem herrschte in ihrem Elternhaus dicke Luft. Wie ein tiefes Grollen hatte die Stimme des Vaters geklungen, als er den Generalanzeiger sinken ließ und Anton fragte:
»Und weiter?«
Helene und ihre Mutter waren dabei gewesen, Strümpfe auszubessern, nun verharrten sie angespannt, Nadel und Faden bereit zum nächsten Stich. In der Stille tickte die Wanduhr wie eine Bombe, die darauf wartete, jeden Augenblick zu explodieren. Tapfer hielt Anton dem Blick seines Vaters stand.
»Ich liebe Zahlen.« Obgleich blass wie Nebel, sprach Anton klar und ruhig. »Außerdem möchte ich unserer maroden Wirtschaft auf die Beine helfen. Wäre das nichts, worauf du stolz sein könntest?« Er versuchte ein Lächeln, das um Verständnis warb. Doch Paul Bornstein antwortete nicht. Unaufhörlich zuckte sein dunkler Schnauzbart, was Helene verriet, dass es vulkanisch in ihm brodelte.
»Bitte, Vater, ich will einen Beruf, der mir entspricht. Du sagst doch selbst, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man liebt, was man tut.«
Helene kam nicht mehr dazu, über Antons Argument nachzudenken, denn da donnerte der Vater derart los, dass der Haushälterin Erna, wie sie später erzählte, in der Küche vor Schreck das Huhn aus der Hand rutschte.
»Stolz will er mich machen! Wie soll ich denn auf eine Memme stolz sein, die beim Anblick von Blut das Bewusstsein verliert?«
»Nicht doch, Paul«, versuchte Helenes Mutter ihn zu beschwichtigen, aber Paul Bornstein war weit davon entfernt, sich zu beruhigen.
Mit ausladenden Schritten lief er zum Fenster und starrte auf den Bethmannpark hinunter, in dem schon Napoleon Bonaparte und Johann Wolfgang von Goethe spazieren gegangen waren, wie der Vater seinen Patienten in einem Ton zu erzählen pflegte, dass man hätte annehmen können, die berühmten Männer hätten gar ihn besucht. Jetzt interessierten ihn weder Kaiser noch Dichter. Wie versteinert starrte Anton Löcher in den Teppich. Die Kiefer der Mutter mahlten, und am liebsten wäre Helene für ihren Bruder in die Bresche gesprungen. Aber damit hätte sie ihm keinen Gefallen getan, es war seine Schlacht.
Abrupt wandte sich der Vater um und ging zum Wohnzimmerschrank, dem er ein Holzkästchen mit echten kubanischen Zigarren entnahm, die ihm ein dankbarer Patient geschenkt hatte. Normalerweise rauchte er sie genüsslich zu besonderen Anlässen, aber an diesem Tag sah es aus, als müsse Paul Bornstein vor allem Dampf ablassen.
»Wärst du nur ein klein wenig früher zur Welt gekommen, hätte man dich vielleicht nach Verdun geschickt. Was glaubst du, ist dort los gewesen? Mensch, Anton, wir haben die Verwundeten aus dem Getümmel der Schlachtfelder geholt, neben uns die Einschläge der Artilleriegeschütze, das Geratter der Maschinengewehre, überall zerfetzte Soldaten. Jede Sekunde hätte es auch uns erwischen können. Zu Beginn des Krieges waren wir über zwanzigtausend Ärzte im Einsatz, übrigens auch Studenten, unsere Feldunterärzte, enorm tapfere junge Männer. Viele Soldaten konnten wir nur retten, indem wir amputierten, auch wenn sie uns anflehten, ihre Arme und Beine behalten zu dürfen. Manche überstanden die Operation, krepierten dann aber an einer Blutvergiftung …«
Schweigend rauchte Paul Bornstein weiter, sein Blick nicht mehr aufgebracht, sondern verloren in den Rauchschwaden seiner Zigarre und der Vergangenheit.
Von seinen Erlebnissen an der Westfront hatte er ihnen schon oft berichtet, von neuartigen Waffen, aber auch davon, dass die moderne Medizin viele Leben gerettet hatte, dank der Entwicklung neuer Impfstoffe, verbesserter Operations- und Narkosetechniken und gut ausgebildeter Ärzte. Mit Leib und Seele war ihr Vater Mediziner, ein mutiger dazu, der sein Leben für andere riskiert hatte und zu Recht stolz darauf war, dass der Kaiser ihn mit dem Eisernen Kreuz erster und zweiter Klasse ausgezeichnet hatte.
Helene verstand durchaus, dass er sich wünschte, sein einziger Sohn möge in seine Fußstapfen treten. Dass er Anton jedoch vorhielt, die Gefahren des Kampfes nicht erlebt zu haben, empörte sie. Schließlich hatten sie auch in Frankfurt unter dem Krieg gelitten. Zum ersten Mal waren Bomben vom Himmel gefallen, die Menschen hatten gehungert, und kurz vor Kriegsende waren nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten zu Hunderttausenden von der Spanischen Grippe dahingerafft worden.
War ihr Vater denn nicht froh, dass Anton wenigstens die furchtbaren Kämpfe erspart geblieben waren? Dass ihm keine Granate Augen und Ohren zerrissen hatte oder das Kinn abgesprengt wie bei den Männern ohne Gesicht, von denen sich die Leute schaudernd abwandten? Auch an denjenigen, die auf Holzbrettern durch die Straßen rollten, sahen sie geflissentlich vorbei. Die wenigsten hatten ja das Glück, vom sogenannten Sauerbruch-Arm zu profitieren, einer Prothese, die der gleichnamige Chirurg während des Großen Krieges entwickelt hatte. War ihrem Vater eigentlich nie aufgefallen, dass der damals dreizehnjährige Anton stets in sich zusammensackte, wenn Dr. Paul Bornstein ihnen schilderte, wie man bei besagter Prothese die im Armstumpf verbliebenen Muskeln und Sehnen so nutzte, dass der Amputierte seine künstliche Hand bewegen konnte? Helene hingegen, zwei Jahre jünger, hatte neugierige Fragen gestellt und wissen wollen, wo im Körper die Muskelstränge verliefen. Jahrelang hatte Anton sich bemüht, seinen Widerwillen zu überwinden, doch vergeblich. Weshalb sah ihr Vater das nicht ein und fragte Anton, welchen Beruf er lieber ergreifen würde? Stattdessen beschoss er ihn mit Vorwürfen.
»Was hättest du getan, Anton, wenn einer deiner Kameraden einen Bauchschuss abbekommen hätte und stöhnend neben dir zusammengebrochen wäre? Hättest du ihn allein gelassen, weil es dich ekelt, Blut zu sehen? Wärst du in Ohnmacht gefallen?«
»Es reicht jetzt, Paul!«
Als der Vater herumfuhr, sah er aus, als wollte er seiner Frau vehement widersprechen. Er unterließ es dann aber, denn wenn Ruth Bornstein schmale Lippen bekam, hielt man sich lieber zurück oder man riskierte, dass sie in eisiges Schweigen verfiel, was sie, ohne mit der Wimper zu zucken, tagelang durchhielt. Paul Bornstein intervenierte nicht, als die Mutter Anton mit einer Handbewegung bedeutete, das Feld zu räumen. Dieser straffte die Schultern und nickte erst der Mutter, dann dem Vater zu, Helene streifte er mit einem Blick, zu kurz, als dass sie ihm ein aufmunterndes Lächeln hätte zuwerfen können. Sekunden später schlug die Haustür zornig zu, und Anton war fort, vermutlich auf dem Weg zu seinem besten Freund Bernd.
Mit finsterer Miene hatte ihr Vater seine Zigarre ausgedrückt und nach dem Generalanzeiger gegriffen.
»Helene, geh und sag Erna Bescheid, dass wir pünktlich essen, und kümmere dich um Ilse.«
»Ja, Mutti.«
Zwar hätte Helene zu gerne gewusst, was ihre Eltern besprachen, doch die Aufforderung ihrer Mutter war eindeutig gewesen. Auf dem Weg zur Küche stieß Helene mit ihrer dreizehnjährigen Schwester Marlis zusammen, die aus dem Bad gehuscht kam, in der Hand Helenes Schminktäschchen. Mit viel zu dunkel bepinselten Augen und knallroten, über die Konturen hinaus bemalten Lippen sah Marlis aus wie ein gruseliger Clown. Offensichtlich hatte sie den Streit genutzt, um sich ungestört über Helenes Puder und Lippenstifte herzumachen. So ein kleines Miststück!
»Her damit!«, blaffte Helene und verpasste Marlis eine Kopfnuss, die sich gewaschen hatte.
»Aua, Hella! Du blöde Kuh!«
»Helene!«, rief die siebenjährige Ilse, die mit ihrer Puppe fuchtelnd, angerannt kam. »Wir dürfen uns doch nicht hauen! Nur Mutti darf das.«
Manchmal ging ihre Familie Helene ganz schön auf die Nerven. Sie schnitt eine Grimasse und nahm Ilses Hand.
»Komm, fragen wir Erna, ob sie nicht eine Leckerei für dein Püppchen abzwacken kann. Und du, Marlis, lass gefälligst meine Schminke in Ruh!«
Thea drückte ihre Zigarette aus und schob sich einen Lutschbonbon in den Mund.
»Ehrlich gesagt verstehe ich deinen Vater. Wer will schon einen Schwächling zum Sohn? Da würde mein Vater auch rotsehen. Aber vor allem …«
»Anton ist kein Schwächling«, brauste Helene auf. »Dafür, dass er kein Blut erträgt, kann er nichts. Unser Essen hat er trotzdem wie ein Raubtier verteidigt. Da war er gerade mal vierzehn, damals in diesem furchtbaren Rübenwinter.«
Ohne zu fragen, schnappte sich Helene eine neue Zigarette aus Theas Schachtel und zündete sie an. Rüben. Ihren Lebtag würde sie diesen Geschmack nicht vergessen. Sie schauderte. Rübensuppe, Rübenkuchen, Bier und Kaffee aus Rüben, Klöße, Marmelade und Mus – dabei hatte man sogar noch dafür dankbar sein müssen, dass dieses Schweinefutter ihnen überhaupt ein paar Kalorien und Vitamine beschert hatte. Trotzdem waren so viele Frauen, Männer und Kinder verhungert. Wann immer sich eine Gelegenheit geboten hatte, war Anton aufs Land gefahren, um bei Bauern Kartoffeln und etwas gammeliges Gemüse zu erbetteln, denn mit ihren Seeblockaden verhinderten die Russen und die Engländer die Lebensmittelimporte. Zudem waren im Herbst 1916 besonders zerstörerische Unwetter niedergegangen. Kartoffeln und Weizen, alles war einfach verfault. Weil sie selbst wenig besaßen, rückten die meisten Bauern nichts heraus, und Anton, der keinesfalls mit leeren Säcken heimkommen wollte, stahl von Feldern und aus Scheunen, was er zu fassen bekam. Manchmal erwischte ihn ein Bauer oder andere Hungerleidende und versuchten gewaltsam, ihm seine kostbare Beute zu entreißen.
»Aber da hättet ihr Anton sehen sollen! Gezielter Faustschlag, dann ab durch die Mitte.« Dass Helene Schmiere gestanden hatte, durfte ihre Mutter, die geflissentlich über Antons blaue Flecken hinwegsah, freilich nie erfahren. Versöhnlich lächelte Thea Helene an.
»Deinem Vater geht es doch nicht darum, dass Anton kein Kriegsheld geworden ist. Er will, dass sein Lebenswerk später nicht an Fremde verhökert wird. Das ist meinem Vater genauso wichtig, darum übernimmt mein ältester Bruder unsere Fabrik, obwohl er sich nicht die Bohne für Regenschirme interessiert.«
Sie seufzte laut. »Dafür muss sich der Glückliche nicht das Hirn über seine Lebensplanung zermartern.«
»Willst du etwa damit sagen, dass du das tust?«
Marie schob die Zigarettenspitze ihrer Mutter zwischen ihren schlanken Fingern hin und her, sah beim Rauchen aber nicht sehr elegant aus, weil sie nach jedem Zug einen Hustenreiz unterdrückte, wobei sie die Augen zusammenkniff und derart rot anlief, dass ihre Freundinnen sich kaum vor Lachen halten konnten. Als Marie wieder in der Lage war zu sprechen, hakte sie nach: »Also womit quälst du deinen schönen Kopf, Thea? Mit der Frage, welchen deiner hundertfünfzig Verehrer du heiraten willst?«
»Pah! Bloß nicht!«, wehrte Thea ab. »Der Hafen der Ehe läuft nicht davon. Aber vielleicht der künftige Ehemann.« Sie lachte. »Deshalb lerne ich vor der Hochzeit einen anständigen Beruf. Aber keinen, für den ich studieren muss. Meine Mutter sagt, die Schönheit verblüht schneller, als ich es mir vorstelle, deshalb will ich mich nicht jahrelang hinter dicken Wälzern vergraben und am Ende ohne Mann dastehen. Vielleicht werde ich Buchhalterin in unserer Firma oder eine dieser flotten Telefonistinnen, die auf ihren Rollschuhen durch die Telefonzentrale flitzen.«
»Aber du verabscheust Leibesübungen«, gab Marie zu bedenken, Thea ging jedoch nicht auf ihren Spott ein.
»Was ist mit euch beiden? Möchtet ihr bald heiraten?«
»Nicht sofort.« In einem hübschen Glasaschenbecher, den sie zwischen sich und Helene aufs Sofa gestellt hatte, zerdrückte Marie ihre Zigarette. »Dabei haben mir schon zwei Geschäftspartner meines Vaters einen Antrag gemacht. Aber der eine ist Katholik, der andere Jude, und meinen Eltern kommt nur ein waschechter Protestant ins Haus.«
»Ich dürfte auch keinen Juden heiraten, wo mein Vater uns doch extra hat taufen lassen und wir in die Kirche statt in die Synagoge gehen«, sagte Thea.
»Du bist Jüdin?«
Marie sah Thea überrascht an.
»Eben nicht. Ich sage doch, dass wir getauft worden sind, ich bin durch und durch protestantisch. Hm, warum heiratest du nicht meinen Bruder? Der ist noch zu vergeben … samt all unserer Regenschirme.«
Thea lachte, Marie winkte entschieden ab.
»Wie ist das bei euch, Helene? Bestehen deine Eltern auf eine jüdische Heirat?«
Helene zuckte mit den Schultern.
»Glaub ich nicht. Aber wieso sprechen wir überhaupt darüber? Irgendein Ehemann wird sich schon finden. Lasst uns lieber überlegen, was wir sonst noch aus unserem Leben machen. Ist es nicht großartig, dass wir heutzutage jung sind und nicht … vor hundert Jahren?«
Aufmerksam betrachtete sie ihre Freundinnen. Thea rauchte lässig und lachte dabei laut, Maries Kleid war über die Knie gerutscht, weil sie nicht im Traum daran dachte, damenhaft gesittet auf dem Sofa zu sitzen. Augen und Lippen hatten sich die drei jungen Frauen dunkel geschminkt, zugegebenermaßen kontrastreicher, als sie es auf der Straße gewagt hätten, dennoch war es ein befreiendes Gefühl, mit ihrem Aussehen zu experimentieren. Ganz, als könnten sie in verschiedene Körper und Rollen schlüpfen und dann entscheiden, wer sie sein wollten. Keine Frauengeneration vor ihnen hatte so viele Freiheiten genossen wie ihre.
»Mir fällt beim besten Willen keine Epoche ein, in der ich lieber gelebt hätte«, pflichtete Marie bei. »Schon allein deshalb, weil es uns Frauen endlich möglich ist, unser Haar abzuschneiden und Bein zu zeigen. Davon konnte meine Mutter als junges Mädchen nur träumen.«
»Du und deine Mode«, sagte Thea kopfschüttelnd. »Aber ja, selbst wenn ein Brot Milliarden kostet und wir unser Geld statt im Portemonnaie in Schubkarren zum Einkauf fahren. Ich würde auch in keiner anderen Zeit leben wollen.«
Noch immer waren die Folgen des Krieges allgegenwärtig. Rund um die Uhr quollen aus den Geldpressen Papierlawinen, mit denen man an Rhein und Ruhr die Streiks der Kumpel und Stahlarbeiter gegen die französischen und belgischen Besatzer unterstützte, die im Ruhrgebiet einmarschiert waren, um die ausbleibenden Reparationsleistungen der Deutschen auf ihre Art einzutreiben. Sogar die Polizeistunde war deshalb verschärft worden und die Lichtspielhäuser schlossen früh. Tanzveranstaltungen blieben zeitweise untersagt und der Karneval, der die Frankfurter im Jahr zuvor begeistert hatte, fiel schlichtweg aus. All diese Maßnahmen sollten, wie die Frankfurter Zeitung berichtete, der Bevölkerung den Ernst der Stunde vor Augen führen, gerade so, als ob den noch niemand mitbekommen hätte. Weshalb gönnte man den Menschen nicht wenigstens ein bisschen Spaß und Ablenkung?
Darauf zu verzichten, beeinträchtigte Helene mehr als familiäre Geldsorgen oder die Frage, wie einigermaßen abwechslungsreiche Mahlzeiten auf dem Tisch landeten. Diese Probleme lösten ihre Eltern, und dass sie dies so klaglos taten, ermutigte Helene, der Zukunft zuversichtlich entgegenzublicken. In vollen Zügen genoss sie die gesellschaftlichen Neuerungen, die ja nicht nur die Mode revolutionierten, sondern auch die Kunst und das Theater beeinflussten und der Musik ganz neue Rhythmen und Töne entlockten. Nach einem Abend mit Tango und Shimmy hatte Theas Bruder Lutz sie mit seinem Automobil heimgebracht und behauptet, dass sich, wäre die Wirtschaftskrise erst überstanden, immer mehr Leute eigene Fahrzeuge leisten würden. Die Vorstellung, selbst ein Automobil zu lenken, faszinierte Helene derart, dass sie Lutz das Versprechen abrang, es ihr beizubringen. Durch ihren Vater wiederum bekam sie mit, welch gewaltige Fortschritte die Medizin machte, so dass die Hoffnung bestand, viele Krankheiten vollends auszumerzen. Das waren doch für alle, arm und reich, gute Nachrichten. Genauso wie das allgemeine Wahlrecht, das seit Januar 1919 auch deutsche Frauen reichsweit ausübten, weshalb bei den Reichstagswahlen im nächsten Jahr auch Helenes Stimme zählen würde. So war sie überzeugt davon, dass so bald kein neuer Krieg ausbrechen würde. Denn welche Frau würde ihren Mann, Sohn oder Bruder in den Krieg ziehen lassen, wenn sie die Mittel besaß, es zu verhindern?
Wie sie nun bei Tee und Gebäck mit ihren Freundinnen über ihre Zukunft sinnierte, drängte sich Helene eine weitere Frage auf. War es denkbar, dass ihre Mutter als junge Frau einmal andere Ziele verfolgt hatte, als sich um das Wohl ihrer Familie zu kümmern? Was wäre aus ihr geworden, wenn sie die Möglichkeiten gehabt hätte, die sich Helene heute boten? Wenn sie eine gute Schule besucht hätte?
Lebhaft erinnerte sich Helene an eine von Mutters Backpfeifen, die es gesetzt hatte, als Helene darüber klagte, wie langweilig es wäre, chemische Formeln auswendig zu lernen oder die Namen von Ländern, die sie nie bereisen würde. Es folgte ein ermüdender Vortrag darüber, wie dankbar sie für die »Preußische Mädchenschulreform« von 1908 zu sein hätte, die einen verbindlichen Lehrplan festgelegt hatte und das erforderliche Abiturwissen garantierte. Der Hauslehrer, den der Großvater immerhin für Ruth Bornstein eingestellt hatte, hatte allein entschieden, welches Wissen ihm ausreichend erschien für ein Mädchen, das sowieso seiner Bestimmung als Ehefrau und Mutter folgen würde. Unerbittlich hatte Ruth Bornstein Hauptstädte, Flüsse und Gebirge abgefragt, bis Helene diese wie eine Maschine herunterratterte.
Ihre Arme Richtung Zimmerdecke gereckt, streckte sich Thea ausgiebig.
»Für unsere Mütter bedeutete der Wunsch zu lernen eben noch, nach den Sternen zu greifen«, kommentierte sie Helenes Geschichte.
»Aber manche haben sich durch nichts und niemanden von ihren Plänen abhalten lassen«, sagte Marie. »Diesen Frauen verdanken wir viel. So wie Coco Chanel, von der auch niemand gedacht hätte, dass sie einmal so erfolgreich werden würde.«
Helene nickte. »Neuerdings dürfen Frauen sogar Anwältin oder Richterin werden.« Sie unterdrückte ein Glucksen, was ihr nicht gelang. »Hör mal, Marie, wäre das nichts für dich?«
Bei der Vorstellung, dass die modebewusste Marie sich im unförmigen schwarzen Talar vor einer Reihe von Richtern aufbauen und flammende Reden schwingen würde, brach Helene in schallendes Gelächter aus, womit sie Thea sofort ansteckte.
»Und als Richterin würde Marie sämtliche Angeklagten zu einem modischen Haarschnitt verdonnern.«
Mit dem Zeigefinger wischte Thea ihre Lachtränen aus den Augenwinkeln, schwarze Spuren ihrer verlaufenen Wimperntusche blieben zurück.
»Warum denn nicht?«, entgegnete Marie ungerührt. »So manch einer würde es mir danken.«
Sie schob sich ein Sofakissen in den Rücken und einen Stapel Zeitschriften zu Helene und Thea hinüber.