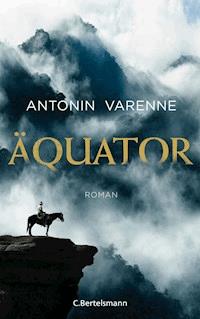4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
«Zwei Außenseiter gegen die beiden herrschenden Familien einer sterbenden Region ... Als Western inszeniert, wilde Natur, archaische Triebe im Kern- und Hinterland Frankreichs.»
FAZ
Zwei rivalisierende Familien kämpfen seit Generationen um die Herrschaft über ein gottverlassenes Nest im Massif Central. Die Courbiers und die Messenets führen ihre Provinzimperien mit harter Hand und unter rücksichtsloser Ausbeutung von Mensch und Natur. Rémi Parrot, der seit seiner Jugend entstellte Revierjäger, kämpft als einsamer Cowboy gegen die verkrusteten Clanstrukturen und um die Liebe der schönen Michèle Messenet. Als er einem Umweltskandal auf der Spur ist, beginnt eine mörderische Treibjagd durch düstere Wälder und unterirdische Tunnelsysteme. Fein gesponnener, archaischer Thriller um Schuld und Sühne vor der grandiosen Kulisse einer einstmals erhabenen Landschaft.
«Das einzige, was in diesem Roman feststeht, ist eine Gruppe von Granitfelsen»
Deutschlandfunk Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Ähnliche
ANTONIN VARENNE, geboren 1973 in Paris, wo er Philosophie studierte. Er war Hochhauskletterer und Zimmermann, arbeitete in Island, Mexiko und in den USA, wo er seinen ersten Roman schrieb. Seine Werke wurden mit den wichtigsten französischen Krimipreisen ausgezeichnet. Sein letzter Roman, Die sieben Leben des Arthur Bowman, stand wochenlang auf der KrimiZeit-Bestenliste.
Er lebt im Departement Creuse, wo dieser Roman spielt.
Die Treibjagd in der Presse:
»Der nächste große Wurf von Antonin Varenne […] nimmt durch seine psychologische Raffinesse und vor allem seinen kunstvollen Aufbau Dante’sche Ausmaße an. […] Varenne entwickelt den Plot mit phänomenalem Geschick, was ihn noch faszinierender und fesselnder macht. Ein brillanter Krimi, der erneut das große Talent von Varenne unter Beweis stellt. Diesen französischen Autor gilt es dringend zu entdecken!«
Cannibales Lecteurs
»Antonin Varenne beeindruckt von Neuem […] durch seine meisterhaft packende Erzählweise, die kein Wort zu viel enthält. Die Treibjagd erinnert an die Abgründe eines Claude Chabrol, umweht von einem düsteren Lufthauch.«
Encore du Noir!
Außerdem von Antonin Varenne lieferbar:
Die sieben Leben des Arthur Bowman (10235)
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.
Antonin Varenne
Die Treibjagd
Roman
Deutsch von Susanne Röckel
Die französische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Battues« bei éditions Écorce / La Manufacture de livres, La Croisille-sur-Briance.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2015 by La Manufacture de livres, Paris
published by arrangement with Agence littéraire Astier-Pécher
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
Penguin Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Cornelia Niere, München
Umschlagmotiv: Christophe Dessaigne / Trevillion Images
Redaktion: Beate Bücheleres-Rieppel
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-19164-1V002
www.penguin-verlag.de
1Zwanzig Jahre nach dem Unfall,
neun Tage nach der Entdeckung der ersten Leiche,
zwölf Stunden nach der Schießerei
»Als ich geboren wurde, war R. noch eine Stadt. Vierhundert Leute haben bei Phillips in der Fabrik gearbeitet. Es gab genauso viele Gründe, hier zu leben, wie anderswo. Es gab ungefähr zwanzig Bistros, es gab Kleiderläden. Die Restaurants hatten genügend Gäste, am Samstagabend stand man vor dem Kino Schlange, am Stadtrand wurden neue Siedlungen gebaut. Die Banken gaben Arbeitern, die sich auf ihre Arbeit verließen, Kredit, um sie bis zur Rente an sich zu binden. Die Jungen machten ihre Ausbildung im Département und kamen zurück, um hier zu arbeiten. Diejenigen, die weiter weggingen, an die Universität, kamen manchmal auch zurück. Es gab Architekten, Maurer, Zimmerleute und Dachdecker. Die kleinen Häuser waren bewohnt, gepflegt, sie waren etwas wert. Man lernte sich in der Realschule, im Gymnasium, manchmal schon in der Grundschule kennen und ließ sich dann in der Kirche und im Rathaus trauen. Die Eltern kannten sich alle, und fast sah es so aus, als wären die Ehen arrangiert. Es ging aber alles gut, und man hatte das Gefühl, das zu tun, was man tun wollte.
Die Chefs von Phillips, von den Gerbereien und Spinnereien, waren noch unbeleckt vom Geist der Achtzigerjahre. Die Gewerkschafter waren keine Revolutionäre, und man einigte sich gütlich. Niemand kann sich an eine Demonstration in den Straßen von R. erinnern. Die Löhne gingen allmählich in die Höhe. Die Stadt war voller Menschen, es gab keine übersteigerten Hoffnungen, aber man hatte den Eindruck, dass alles gut lief. Es war friedlich. Mit zwanzig wusste man, dass man Kinder haben würde. Die Einstellungen gingen vom Vater auf den Sohn, von der Mutter auf die Tochter über. Bei den Familien wusste man, mit wem man es zu tun hatte: gleiche Arbeit, gleiche Kleidung, die gleichen Schultern und Gesichter, die sich von einer Generation zur nächsten glichen. Wenn man einen Platz haben wollte, hielt R. ihn bereit und wartete auf einen. Die Wahlen riefen keine großen Debatten hervor: Es gab Arbeit. Die Kandidaten stammten seit Jahrzehnten aus dem Klub der Unternehmer der Stadt. Die Schulen waren voll, ebenso die Sportvereine und die Orte, wo man seine Freizeit verbrachte. Der Supermarkt war für die Bauern, die einmal pro Woche zum Einkaufen in die Unterpräfektur kamen, eine Attraktion. Zweimal in der Woche blockierte der Markt die Hauptstraße, von der Place d’Espagne bis zum Pont Neuf. Die Höfe hatten zehn bis fünfzig Hektar.
Glauben Sie, ich bin sentimental? Ganz und gar nicht. Ich habe R. immer gehasst. Und ich war nicht die Einzige.
Die Jugend geht nicht verloren, weil man arbeiten gehen muss. Und wenn es nichts Ungerechteres gibt als die etablierte Ordnung, dann genügt das schon, um ein paar Heißsporne so richtig in Wallung zu bringen. Nur R. war unzerstörbar. Niemand musste die Rebellen in den Griff kriegen, die Stadt allein sorgte dafür, dass sie sich beruhigten. Typen, die auf die schiefe Bahn gerieten, die wirklich im Knast landen wollten, die mussten woandershin gehen. Für diejenigen, die nur das Bedürfnis hatten, ein bisschen aufsässig zu sein, hat es immer die Bälle und die Bistros gegeben. Mit dreißig war das zu Ende. In den Läden und in der Fabrik grüßte man die Raufbolde mit einem Lächeln. Die jungen Mädchen betrachteten sie voller Bewunderung, wenn sie sie im Park mit ihrem ersten Baby sahen, sie sagten sich, dass sie so einen auch gern hätten; einen, von dem man, wenn er vierzig und Vorarbeiter geworden war, sagte: ›Der Roger! Mit dem durftest du dich früher nicht anlegen!‹ Solche Legenden waren Teil der Folklore, das kam gut an beim Aperitif. Dass R. heute ein Friedhof ist, das wundert mich nicht. Die Stadt war damals schon tot.
Sie haben ihn nicht gekannt, er ist gestorben, bevor Sie hierherkamen, aber R. ist so wie der alte Barusseau. Er hatte ein Lebensmittelgeschäft in der Rue Vielle. Zehn Jahre lang war sein Schaufenster jeden Monat mit Hakenkreuzen beschmiert, mit ›Scheißkerl‹ und ›Kollaborateur‹. Im Rathaus hatte man sich schon daran gewöhnt, dass er aufkreuzte, rot und mit dickem Hals. Mit Stockschlägen vertrieb er die Kinder, die sich seinem Laden näherten. Er brüllte den Bürgermeister an, er wollte, dass man diese Verbrecher, die das taten, zur Strecke brachte. Die Gemeinde bewilligte ihm einen neuen Anstrich seiner Fassade, aber mit der Zeit hatten sie im Rathaus genug davon. Der Bürgermeister hat von der Polizei verlangt, etwas zu tun. Schließlich hat sich der Streckenwärter dahintergeklemmt. Er legte sich zehn Nächte in einem Terrassengarten oberhalb des Geschäfts des alten Barusseau auf die Lauer. Eines Nachts hat er den Alten herauskommen sehen, mit einem Stuhl, einem Pinsel und einem Farbeimer, und dann sah er ihn die Hakenkreuze malen und ›Scheißkerl‹ in großen Buchstaben auf sein eigenes Schaufenster schreiben. Der Bürgermeister hat ihn aufgesucht, und der Alte hat angefangen zu heulen. Er hat erzählt, dass er im Krieg Schwarzmarktgeschäfte tätigte, den Deutschen Tipps gab und sie über die Widerständler aus seiner Ecke auf dem Laufenden hielt. Am gleichen Abend hat er sich aufgehängt.
Jedenfalls wird die Geschichte so erzählt. Und ich habe mich immer gefragt, als ich sie hörte, aus welcher Familie die Typen stammten, die am lautesten lachten.
Das Leben der Erwachsenen hier gewährt der Kindheit nicht viel Zeit. Mit zwanzig kriegen die Frauen Kinder, und der gängigste Scheidungsgrund ist ein Ehemann, der so stark zuschlägt, dass es nicht mehr zu verbergen ist. Ansonsten hält man sich an das, was man hat, denn R. gibt einem eine Chance, aber nur eine einzige. Wenn man sie verpatzt, ist es vorbei. Der Krebs dieser Stadt ist die Erinnerung. Aber wenn Sie meine Meinung hören wollen, ist die Gastronomie die wahre Plage von R. Haben Sie schon mal das Kartoffelgratin probiert?
Ich bin mit zweiundzwanzig weggegangen. Die junge Messenet. Skandal. Als ich zurückkam … Aber Sie wissen ja, wie die Stadt heute aussieht. Phillips hat zugemacht. Geblieben sind zwei dahinsiechende Spinnereien und ein Tapisserie-Museum. Die Hälfte der Häuser steht leer, alles ist heruntergekommen, die Geschäfte in der Hauptstraße wechseln jedes Jahr den Besitzer, und die Hälfte der Läden steht zum Verkauf. Die Bevölkerung muss die älteste von ganz Europa sein, und die Jungen versammeln sich zum Komasaufen. Sie raufen nicht mehr, sie hängen sich am nächsten Baum auf. Die kleinsten Höfe haben hundertfünfzigtausend Hektar, und meine Familie besitzt den größten von allen. Es gibt drei Supermärkte, und die Fabriken haben geschlossen. Alles, was an Besitz geblieben ist, ist größer und hässlicher geworden.
Warum grinsen Sie? Beantwortet das nicht Ihre Frage?«
»All das erklärt, warum Sie weggegangen sind, aber ich wollte wissen, warum Sie wiederkamen.«
»Mein Vater war krank. Könnte ich einen Kaffee haben?«
»Brigadier, können Sie uns Kaffee bringen?«
»Die Krankheit Ihres Vaters … Krebs, glaube ich?«
»Die Knochen. Aber wegen ihm bin ich nicht wiedergekommen. Es gab jemand anderen, den ich wiedersehen wollte.«
»Monsieur Parrot. Sie wollten es vor dem Brigadier nicht sagen?«
»Den Brigadier, wie Sie sagen, Marsault – ich kenne ihn seit dem Kindergarten. Er ist ein alter Freund von Thierry Courbier. Sein Vater war einer der rabiatesten Typen der ganzen Gegend, seinen Kindern und vor allem seiner Frau gegenüber. Als sie nach Saint-Vaury ins Sanatorium ging, haben die Leute hierherum gesagt, sie hätte eine Blutkrankheit. Ihr Mann hat sie ein einziges Mal besucht. Als er wieder abreiste, hat sie einen ganzen Schrank voll Medikamente geschluckt. Wahrscheinlich ist Marsault genauso böse wie sein Vater geworden. Vielleicht hat er seinem Alten ein Kopfkissen auf den Mund gedrückt, damals, bevor man ihn im Bett gefunden hat, von oben bis unten lila angelaufen. Die Leute sagten, es wäre der Alkohol gewesen. Aber das nächste Mal, wenn Marsaults Frau wieder bei einer Abschiedsfeier oder einer Grillparty der Polizei fehlt, schauen Sie doch nach, ob ihr Make-up nicht ein bisschen zu heftig ausgefallen ist.«
»Mademoiselle Messenet, es tut mir leid, dass ich Ihnen all diese Fragen stellen muss, wo Sie gerade eine so schwierige Zeit durchmachen. Sie sind erschöpft und mit den Nerven herunter. Vielleicht sollten wir die weitere Befragung verschieben?«
»Ich weiß nicht, was man Ihnen über mich erzählt hat, aber ich versichere Ihnen, dass selbst die notorischen Miesmacher die Wahrheit noch nicht erfasst haben. Und ich habe nicht die mindeste Lust, noch länger darauf zu warten, diesen Zirkus zu beenden. Wenn Sie glauben, ich übertreibe, schieben Sie es auf meinen Zorn oder auch auf die Trauer, wenn Ihnen das besser passt. Wenn Sie von hier wären, würden Sie nichts Kriminelles in eine Frau hineindeuten, die nicht weint, obwohl sie es tun sollte.«
»Ich deute nichts in Sie hinein, glauben Sie mir. Möchten Sie, dass ich Marsault auswechseln lasse?«
»Es stört mich nicht, dass er zuhört. So bin ich sicher, dass alle in der Gegend auf dem Laufenden sein werden. Glauben Sie, weil er Polizist ist, wird er nichts erzählen? Dann sind Sie entweder naiv, oder es gibt Gründe für Ihre Blindheit.«
»Wegen der außergewöhnlichen Ereignisse haben wir alle unsere Kräfte mobilisiert. Wir warten auf die Ermittler der Kriminalpolizei. Alle meine Männer sind am Tatort, und Brigadier Marsault ist heute Morgen der einzige Unteroffizier in Bereitschaft.«
»Selbstverständlich.«
»Wir können unter uns bleiben, wenn Sie das wünschen. Wir nehmen Ihre Aussage auf, wie ich Ihnen sagte. Sie müssen vor den Kriminalbeamten nicht noch einmal alles wiederholen. Sind Sie sicher, dass Sie weitermachen wollen?«
»Ich sagte Ihnen bereits meine Meinung dazu.«
»Gut. Sie sagten, Sie seien wegen Monsieur Parrot zurückgekommen. Ist das der einzige Grund?«
»Wollen Sie damit sagen, dass ein Typ wie Rémi als Grund nicht ausreicht, um hier leben zu wollen? Damit bin ich voll und ganz einverstanden. Das Problem ist, dass dieser Idiot nie von hier wegwollte.«
»Wir können weiter darüber reden, aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern noch einmal auf das zu sprechen kommen, was Sie vor Ihrer Rückkehr gemacht haben.«
»Sie wollen über meine Vorstrafen reden?«
»Zucker?«
»Ja, danke.«
»Vor zwei Jahren, in Toulon, wurden Sie festgenommen und wegen Drogenhandels verurteilt. Kokain. Besitz mit der Absicht des Wiederverkaufs. Hundertfünfzig Gramm. Achtzehn Monate, davon zwölf auf Bewährung, ein Monat U-Haft. Sie haben schließlich eine Haftstrafe von drei Monaten im Gefängnis von Farlède verbüßt. Sie haben behauptet, nur als Zwischenträgerin fungiert und nie selbst gedealt zu haben. Haben Sie es wegen des Geldes gemacht oder um an Drogen zu kommen?«
»Das kommt auf das Gleiche heraus, nicht? Aber wenn Sie wollen, ja, ich habe es wegen der Drogen gemacht.«
»War das Ihr Traum, als Sie R. verließen?«
»Ja.«
»Entschuldigen Sie, aber Sie sind eine schöne Frau. Das Gefängnis dürfte nicht einfach für Sie gewesen sein.«
»Ich bin auch das Kind von Bauern. Ich hab mich durchgeboxt. Und in den acht Jahren, seit ich wegging, hat es nicht nur den Knast gegeben.«
»Rémi Parrot hat erklärt, ich zitiere, dass Sie immer viel zu schön waren für diesen Ort. Was bedeutet das Ihrer Meinung nach?«
»Das hat er gesagt?«
2 Zwanzig Jahre nach dem Unfall,
zehn Tage vor der Entdeckung
der zweiten Leiche
Die Leitbache entfernte sich von der Rotte, näherte sich dem Fluss und wandte dem Wasser den Rücken zu, die Schnauze im Wind. Sie hob den Kopf und nahm Witterung auf. Ein Tier von sieben oder acht Jahren. Hundertzwanzig Kilo. Vier Bachen von vier bis sechs Jahren, vier Überläufer, drei Würfe. Rémi zählte zwölf Frischlinge im grünen Licht des Nachtsichtgeräts, die dabei waren, nervös das Gras zu durchwühlen. Die Rotte war bei guter Gesundheit, was für die Intelligenz der Leitbache sprach. Die Weibchen umrundeten den Rehkadaver und warteten auf das Signal. Die Leitbache verließ ihren Posten am Fluss und trottete zu dem toten Tier. Ohne zu zögern, stieß sie ihm ihre Hauer ins Hinterteil. Mit einer einzigen Bewegung ihres Kopfes riss sie ein Stück Haut und Fell von zwanzig Quadratzentimetern heraus und legte die Muskeln frei. Die Mitglieder der Rotte taten es ihr gleich, und die Mahlzeit begann. Die Läufe des Rehs waren in die Luft gestreckt und zitterten, während Rüssel und Hauer seinen Hinterleib durchwühlten.
Allmählich durchdrang die Kälte seine Kleider. Rémi legte das Infrarotnachtsichtgerät langsam auf den Stamm neben sich und blies in seine Handflächen, um sie zu wärmen. Nach der Zählung hätte er jetzt wieder nach Hause gehen können, aber er beschloss, das Ende der Mahlzeit abzuwarten und den Kadaver zu untersuchen. Er rollte vorsichtig auf die Seite, streckte sich auf dem Rücken aus und betrachtete den Himmel, der zwischen den im Wind rauschenden, schwankenden Blättern sichtbar wurde. Er steckte die Hände in die Taschen seiner Jacke, schloss die Augen und schlief ein.
Der Wind hatte sich gelegt, als er die Augen wieder öffnete. Weit weg hörte er das gedämpfte Geräusch des Wehrs. Die Bäume rauschten nicht mehr. Der Fluss war an dieser Stelle fast bewegungslos, da er von dem kleinen Wehr der Fischzuchtanlage gestaut wurde. Rémi rollte auf den Bauch, tastete nach dem Nachtsichtgerät und richtete es auf das tote Reh. Die Frischlinge waren verschwunden, ebenso drei der Bachen. Die jungen Männchen, die Rüssel schwarz vom Blut, standen witternd neben dem Kadaver. Die Leitbache stand bis zum Bauch im Wasser und sah in seine Richtung. Er hielt den Atem an. Im Objektiv des Nachtsichtgeräts sah er ihre Augen: zwei grellgrüne Kugeln, direkt ihm gegenüber. Die Muskeln entlang seiner Wirbelsäule krampften sich zusammen. Er atmete tief ein, um die Spannungen in seinem Brustkorb zu lösen. Die Bache schnaubte laut. Sie blieb noch einige Sekunden reglos stehen, der Rest der Rotte wartete auf ihre Reaktion.
Auch Rémi wartete.
Sie drehte den Kopf nach links und nach rechts, streifte die Wasseroberfläche mit dem Rüssel, schlürfte zwei Schluck Wasser und zog sich in Richtung der Rotte zurück, ohne die Blickrichtung zu verändern. Die Überläufer ließen das restliche Fleisch des Kadavers links liegen, gruppierten sich, ohne einen Laut von sich zu geben, neu, und dann verschwand die Rotte hinter den Bäumen.
Rémi folgte der Thaurille bis zum Wehr, durchwatete sie und ging am anderen Ufer weiter bis zu dem Ort, an dem die Wildschweine ihr Mahl verschlungen hatten. Einige Meter davor lauschte er in der Stille und knipste dann seine Taschenlampe an.
Es war noch Fleisch übrig. Nach den Raben und den Füchsen vertilgten es die Wildschweine gewöhnlich bis auf die Knochen. Doch das Verhalten der Leitbache war eindeutig gewesen. Es waren Tiere ohne natürliche Feinde, die eine Auseinandersetzung instinktiv vermieden.
Der Bock war nicht verletzt, wenigstens an den intakten Stellen des Kadavers nicht. Rémi hob die Lefzen an und öffnete den Kiefer. Er schätzte sein Alter auf drei oder vier Jahre. Er beleuchtete die Wirbelsäule, zog das Jagdmesser aus dem Futteral und untersuchte mit seiner Spitze einen Fleck im Fleisch. Entlang der Wirbel machte er einen dreißig Zentimeter langen Schnitt, schob Fell und Fleisch beiseite. Die Knötchen breiteten sich gleichmäßig auf der Muskeloberfläche aus, die Ausgangsnarben waren schwarz. Infektion. Eiablage und Schlüpfen der Larven waren im Sommer erfolgt. Hypodermose. Der Bock war geschwächt. Die ersten Parasiten des Frühjahrs hatten ihn zur Strecke gebracht.
Nur die Wildschweine hatten etwas von diesem Fleisch. Er zog seine Lederhandschuhe an, packte den Bock am Geweih und zog den Kadaver zehn Meter weiter, damit er nicht mit dem Flusswasser in Berührung kam. In ein, zwei Tagen würde nichts mehr von ihm übrig sein.
Er spürte die Kälte des Wassers. Nachdem er sich hingekniet hatte, zog er die Handschuhe aus, spülte das Messer ab und wusch sich die Hände. Dann bespritzte er sich das Gesicht und die von der Müdigkeit geröteten Augen. Bevor er aufstand, blieb er sekundenlang an der Stelle stehen, wo die Leitbache gestanden hatte, und beobachtete den Stamm, hinter dem er sich am anderen Ufer versteckt hatte.
Er ging wieder zum Wehr, durchwatete die Thaurille, ging fünf Minuten am anderen Ufer weiter, durchquerte den Wald, bis er zu einer Wiese kam, von wo es nicht mehr weit war zu seinem auf dem Forstweg abgestellten Toyota-Pickup.
Am Steuer sitzend, schaltete er die Innenbeleuchtung ein, zog das Protokollheft aus dem Handschuhfach und sah nach der Uhr auf dem Armaturenbrett.
»Behördliche Bestandsregulierung. 25. 3. 2012, 2 Uhr 45. Thaurille, Nordufer. Rotte Nr. 4. Leitbache 6–7 Jahre, +/- 120 kg. Vier Überläufer, 12–24 Monate, vier Bachen (5–6 Jahre), zwölf Frischlinge. Route: durch Kommunen Saint-Feure/Pontgiraud. Parzellen AZ 35/36/41, Nord-West/Süd-Ost. Gartempe-Quelle/Ufer Thaurille, 200 m flussaufwärts vor Fischzucht-Wehr. Nahrung: Rehkadaver +/-#0 0#Jahre. (Todesursache: Parasitenbefall aus Saison 2011, Hypodermose.)«
Er verstaute das Heft wieder im Handschuhfach, schaltete die Innenbeleuchtung aus und fuhr los.
Die Scheinwerfer huschten über Wurzeln und Schlaglöcher. Er schaltete in den zweiten Gang, ließ dann den großen Diesel im Leerlauf, bis das starke Licht in schwankendem Auf und Ab über das Haus glitt. Er stellte den Wagen unter das Garagenvordach und zog den Zündschlüssel ab.
Ohne Licht zu machen, betrat er das Haus, zog die Schuhe und die durchnässte Hose aus, warf die Jacke ab und streckte sich in Pullover und Unterhose auf dem Bett aus. Der Schlaf, der ihn im Wald überfallen hatte, ließ nun auf sich warten.
Bis zum Morgengrauen blieb er auf dem Rücken liegen, im Geruch von Farbe und Lack. Seit dem Krankenhaus suchte ihn an neuen Orten Schlaflosigkeit heim. Er wartete darauf, dass es hell wurde, und sagte sich, dass er sich im Liegen immerhin ein wenig erholen würde.
Als das erste graue Licht hereinsickerte, stand er auf, und um den Schein zu wahren, machte er sich Frühstück. Mit einer Schale Milchkaffee vor der Nase roch er wenigstens das Haus nicht mehr. Mit dem letzten Schluck lauwarmen Kaffees spülte er die Tabletten herunter, stand auf, um die Schale in die Spüle zu stellen, und merkte, dass ihm schwindlig wurde. Einen Augenblick lang nahmen die Möbel die grüne Farbe des Nachtsichtgeräts an. Der Schlafmangel wurde langsam unangenehm. Weil er ständig müde war, brauchte er das Codein immer nötiger.
Er nahm eine gewaschene Uniform vom Wäscheständer. Nicht nur sein neues Haus, sondern auch die frischen Kleider störten ihn. Um die Benommenheit abzuschütteln und den steifen Stoff etwas weicher zu machen, nahm er das Beil und machte sich an den Holzhaufen vor dem Haus. Bei dieser Arbeit entspannte sich sein Körper. Eine Stunde lang beschäftigte das Geräusch des Beils, der die Eichenscheite spaltete, seinen Geist. Er schichtete das Holz an der Hausmauer auf und schützte es mit einem alten Stück Wellblech. Schweiß rann ihm übers Gesicht. Er wusch sich am Außenhahn und machte sich ein Sandwich, das er im Schatten der Veranda langsam aß.
Das Gelände war noch durchfurcht von Rodungs- und Trockenlegungsarbeiten; gerade erst waren Wasserrohre und elektrische Leitungen gelegt worden. Der Rasen, zwei Wochen zuvor gesät, begann zu keimen. Grüner Flaum färbte die dunkle Erde in diesem neu gestalteten Winkel des Waldes. Rémi hatte viele Bäume und Haselnusssträucher stehen gelassen, bis zu den Ginsterbüschen, die auf der Hügelkuppe wuchsen, dort, wo der Granit zum Vorschein kam. Um für das Haus, den Zufahrtsweg und die Kanalisation Platz zu schaffen, hatte er den Wald lichten müssen; die Sonne sollte das Haus bescheinen, und doch sollte es von der Wiese im Norden her nicht einsehbar sein, und es musste geschützt sein vor Wind und Regen, die in diesem südwestlichen Teil des Landes oft zu erwarten waren. Die Lage war gut, und das Haus aus massivem Holz konnte auf die heftigen Temperaturunterschiede der Region flexibel reagieren. In der Mittagssonne zeigte das Thermometer im Schatten der Veranda siebzehn Grad. In dieser Nacht, als Rémi aus dem Wald kam, hatte sich der Boden mit Raureif überzogen. Das Blockhaus hielt einiges aus, und der mit Holz geheizte Ofen genügte, um es warm zu halten; im Sommer würde es angenehm kühl sein. Es knackte morgens, wenn es sich aufheizte, und abends, wenn es abkühlte. Und Rémi gefiel es, diese Geräusche zu hören, mit denen sein Haus auf die Umgebung reagierte.
Die Terre Noire war immer ein schönes Grundstück gewesen, das sein Vater in den letzten Jahren gut in Schuss gehalten hatte. Das Haus, ein Quadrat mit einer Seitenlänge von je acht Metern, war aus an Ort und Stelle gefällten Douglasienstämmen zusammengefügt worden. Die zwei Hektar Wiesen oberhalb des Hauses gaben immer gutes Grünfutter ab; der junge Fernin brachte es ein, seit er das Gelände gepachtet hatte.
Rémi betrachtete die kleine Lichtung, auf der er nun wohnte, und sagte sich, dass die Spuren der Rodungen nach kurzer Zeit verschwunden wären. Das alles ist nur eine Leihgabe, sagte er sich. Die Schönheit des Ortes, mehr als sein Bedürfnis nach Komfort, rechtfertigte – oder entschuldigte –, dass er ihn in Beschlag nahm. Terre Noire war auch, obwohl er sich weigerte, diesem Umstand viel Bedeutung beizumessen, das letzte Stück des Parrot-Hofes.
»Ich will verkaufen«, hatte seine Schwester gesagt.
Rémi war ohne weitere Debatte einverstanden gewesen. Nur Terre Noire hatte er ausgenommen.
Als ihre Eltern gestorben waren, lebte Martine schon lange in der Stadt. Sie hatten ihren Besitz verkauft, als würden sie ein erlegtes Tier zum Schlachter tragen. Wochenlang hatten Courbier und Messenet sie hofiert, die sich um jeden Quadratmeter ausbeutbaren Boden rissen. Der Kampf der beiden Familien um Bauland hatte damals auch die Parrot-Enkel einbezogen. Es war eine Art kalter Krieg gewesen, und sie hatten versucht, sich so gut wie möglich herauszuhalten, ohne von der einen oder der anderen Partei als Geisel genommen zu werden. Rémis Haus war nun eine Enklave an der Grenze der Ländereien der beiden größten Grundbesitzer der Region.
Er breitete seine Papiere und Notizen auf dem Tisch aus.
Die Bestandskontrolle war mit der Überprüfung der Wildschweinrotte von dieser Nacht fast beendet. Er sah den Bericht für die Präfektur durch, dann faltete er die topografische Karte auseinander und plante seine Wege in der Region des Plateaus, indem er mit Bleistift Linien darin einzeichnete. Plötzlich verschwammen Höhenlinien und geografische Namen. Er nahm eine Tablette, bevor die Schmerzen ihn am Denken hindern konnten. Das Codein wirkte nach einigen Minuten. Er ließ die Karte liegen, zog seine Jacke an und ging zum Pick-up. Nachdem er die Plane über der Ladefläche abgerollt hatte, nahm er zwei Käfigfallen und einige Drahtschlingen herunter, um sie im Werkzeugschrank zu verstauen. Die Schlingen waren aus Kupferdraht. Handgefertigt, auf eine Weise, die er kannte. Der Draht war schwarz verbrannt: Es handelte sich um Elektrokabel, deren Plastikverkleidung in einem Zweihundertliterfass abgebrannt worden war. Die Wiederverwertung von Eisen und Kupfer, mit oder ohne Einwilligung der Besitzer, war eine Spezialität der Sinti, die zudem traditionellerweise die besten Wilderer der Gegend waren.
Er steuerte den Pick-up zwischen den Bäumen hindurch auf den Weg. Ein ähnlicher Wagen kam ihm entgegen; ein alter, rostzerfressener Lada, aus dessen offenen Fenstern verworrener Lärm drang: elektrische Gitarren und rauer Gesang. Rémi wich zur Seite der Bäume hin aus, die zwei Vorderräder des Lada blockierten auf dem trockenen Boden und wirbelten eine bräunliche Staubwolke auf. Als sie auf gleicher Höhe waren, ließ Rémi sein Fenster herunter. Einen Moment lang bohrte sich die Musik in sein Trommelfell, und die Wirkung des Codeins setzte aus. Er kniff die Augen zusammen. Der Staub verteilte sich im Wind, und die Musik hörte auf.
»Salut.«
»Salut.«
Die beiden Männer beobachteten einander aus den Kabinen ihrer Pick-ups heraus.
»Hast du fünf Minuten?«
»Kommt drauf an.«
»Los, dreh um.«
Der Lada fuhr wieder an und hielt am Blockhaus neben dem Holzstapel. Rémi schaltete in den Rückwärtsgang.
Jean saß auf den Verandastufen, als er ausstieg.
»Bier?«
»Frag einen Seemann, ob er das Meer wiedersehen will.«
Rémi holte ein Bier und eine Flasche Mineralwasser aus dem Haus.
»Wenn du mehr willst, musst du es kaufen gehen. Das ist alles, was du beim letzten Mal übrig gelassen hast.«
»Lass das, ich muss dir was sagen.«
»Okay.«
Jean schüttete das Bier in drei langen Zügen herunter.
»Du warst gestern nicht auf dem Pfarrfest von Sainte-Feyre?«
Rémi lächelte fast unmerklich.
»Wärst besser gekommen. Vielleicht hättest du den ganzen Quatsch beenden können. Oder vielleicht hätten wir es gemeinsam geschafft.«
»Was ist passiert?«
»Das ganze Kaff war da. Wenn die Courbiers die Runde zahlen, kreuzt die ganze Kommune auf, um sich zu bedanken. Den Nachmittag habe ich mir natürlich gespart. Karussells, Kinder im Sonntagsstaat, Kirchenchor und dieser ganze Kram. Aber danach gab’s den Ball der TechBois.
»Klar, so ein Ball ist nicht besonders schön, aber doch kein Drama.«
»Praktisch alle Jungs von der Fabrik waren da, am Anfang mit Frauen und reichlich krähendem Anhang. Nach Mitternacht waren nur noch die ganz Tapferen da, und auch bei denen war die Luft raus. Thierry Courbier war dabei, natürlich mit fünfzehn Typen um ihn rum, die brav zu lachen anfingen, sobald er auch nur den Mund zum Gähnen aufmachte. Ich war mit Tonio da, der jeglichen Ärger schon eine Stunde vorher wittert – weil es ja auch überall Randale gibt, wo er hinkommt, dieser Idiot. Er sagt also zu mir: ›Ich hau ab, hier stinkt’s.‹ Da waren auch schon ein paar Typen vom Lager Valentine am Eingang, die versuchten reinzukommen. Die Security der TechBois war genervt und wollte keine Sinti durchlassen. Tonio hatte recht, es roch nicht gut. Aber ich war mit Trinken beschäftigt, und außerdem war auch eine gewisse Neugier im Spiel. Ich hätte es mit der Stoppuhr in der Hand verfolgen können. Um eins ist Philippe aufgekreuzt. Hab ihn noch nie in diesem Zustand gesehen. Betrunken, okay, klar, aber vor allem herausgeputzt wie ein Pfingstochse. Er steuert direkt auf Courbier zu und schreit, dass er seinen Vater sehen will. Er schreit noch lauter, dass man die TechBois schließen soll, diese Scheißbude, und so weiter. Du kannst dir ja vorstellen, was Philippe zu diesem Thema ablässt. Gut, wenn man unter sich ist, kann man solche Sachen sagen, aber es war der Ball der Courbiers, in Anwesenheit des Kronprinzen persönlich, dem er vor seinen ganzen Fans ins Gesicht spuckt. Courbier hat nicht einmal die Hand gehoben. Er hat ein Zeichen mit dem Kopf gemacht, wie so ein verdammter Mafiaboss im Kino, und drei Typen haben sich Philippe gegriffen. Holzfällertypen. Ich kenne einen von ihnen. ›Der Dicke‹ wird er genannt. Aber vor allem ist er eins neunzig groß. Dick eher im Bereich des Hirns. Sie haben ihn hinter den Festsaal geschleppt.«
»Was hast du gemacht?«
»Der Alkohol dämpft die Schläge, aber am nächsten Tag tut’s trotzdem weh. Und dann war es auch keine Rauferei unter Besoffenen, es war die reine Wut. Hier kennen sich alle, aber nicht alle sind Freunde. Es gibt welche, die sich nicht mögen. Aber das war Hass, Rémi. Wenn ich mich eingemischt hätte, hätten sich sofort drei Typen von der TechBois auf mich gestürzt. Ich hab mich bei den Sanitäranlagen umgesehen. Als ich ankam, lag Philippe schon am Boden. Dann hab ich abgewartet. Es ist nicht schön, aber es gab nur die eine Chance: auf den Moment zu warten, wenn die Typen genug rumgeprügelt haben, um mit sich zufrieden zu sein – direkt bevor einer von denen einem Bewusstlosen mit dem Fuß ins Gesicht tritt. Philippe musste noch ein bisschen was einstecken. Als die drei dastanden, um wieder zu Atem zu kommen, bin ich zu ihnen gegangen. Der Dicke sagt zu mir: ›Was willst du, Jeannot? Verpiss dich.‹ Ich sag ihm, dass ich gar nichts will, nur dass sie jetzt nicht noch richtig Scheiße bauen sollen. Ich sag ihm, dass der Ökofritze sein Fett abgekriegt hat und dass niemand wegen so was am Ende in den Knast gehen sollte. Die Typen haben mich eine Weile angestarrt, aber mehr war eigentlich nicht nötig, angesichts der Abreibung, die sie Philippe schon verpasst hatten. Der Dicke hat mit mir geredet und mir dabei mit dem Finger auf die Brust geklopft. Es war ungefähr so, als würde er mit dem Hammer draufschlagen. Er sagt, ich hätte doch sicher kein Interesse daran, mich in diese Sache einzumischen, es wäre besser, ich würde den Hippie mitnehmen und nicht in die Bar zurückgehen. Und das hab ich dann auch gemacht.«
»Wie geht’s ihm?«
»Er sieht nicht schön aus, aber es ist nichts Ernstes. Er ist ganz schön kräftig, der Ökofritze. Sollte nur keine Depressionen kriegen oder sonst was, wenn er wieder stehen kann.«
»Ist er in seiner Wohnung?«
»Da habe ich ihn heute Morgen hingebracht.«
Rémi lehnte sich gegen einen Verandapfosten und trank ein paar Schlucke aus der Wasserflasche. Der linke Wangenmuskel, der noch beweglich war, zog sich zusammen und hob den linken Mundwinkel an.
»Ich werde mal bei ihm vorbeifahren.«
Jean stand auf und ging langsam über die Veranda. Das Lärchenholz färbte sich durch die Wirkung des Sonnenlichts leicht gelblich.
»Du solltest lasieren, wenn du nicht willst, dass wir in zehn Jahren alles noch mal machen müssen.«
Er drehte sich zu Rémi um, der gedankenverloren dasaß.
»Mach dir keine Sorgen. Du weißt doch, dass es immer so ausgeht. Mit den Courbiers und den Messenets, mit den Typen aus dem Wald, mit den Jägern, mit allen. Du mit deiner Uniform und deiner Hütte mitten im Wald, du bist einfach nicht mehr daran gewöhnt. Mach dir keine Sorgen.«
»Klar. Alles schön vergessen und begraben, bis zum nächsten Rausch und der nächsten Schlägerei.«
»Du bist doch von hier. Du weißt, wie es ist, Scheiße unter den Teppich zu kehren.«
Rémi hatte seine Mütze wieder aufgesetzt und ging die Stufen hinunter. Mit der Hand auf dem Geländer blieb er stehen.
»Darf ich erfahren, wovon du sprichst?«
»Was glaubst du?«
Rémi senkte den Kopf. Das Gesicht lag im Schatten des Mützenschirms.
»Sie weiß, wo ich wohne. Ich muss fahren. Du kannst bleiben, wenn du willst, aber wenn ich an meinen Kühlschrank denke, nehme ich an, dass du auch nicht lange bleiben willst.«
»Stimmt genau.«
»Wir müssen uns noch um den Werkzeugschrank kümmern, die Garage ist wirklich zu eng. Sag mir, wann du Zeit hast.«
»Bald, weil ich glaube, dass ich danach von hier abhaue. Ich nehme ein Flugzeug und fliege irgendwohin, wo es weniger Menschen und mehr Tiere gibt. Oder einfach dorthin, wo der Unterschied deutlicher zu sehen ist.«
»Was anderes. Ich hab wieder zwei Käfige und Schlingen gefunden, in der Nähe der Fischzucht. Sag Tonio, er soll das im Lager verbreiten. Die von der Jagdaufsichtsbehörde werden allmählich sauer. Die Sinti sind nicht immer verantwortlich für die Wilderei, aber auch wenn die Jäger ihnen alles zur Last legen, muss man zugeben, dass sie bei zwei von drei Malen recht haben. Das nächste Mal muss ich einen Bericht schreiben, und eine Kopie davon geht an die Gendarmerie.«
»Ich geb’s weiter, für alle Fälle.«
Rémi stieg in seinen Pick-up und fuhr wieder auf den Weg, Jeans Lada direkt hinter ihm. In der Jackentasche klingelte sein Telefon. Er hielt es ans Ohr und sah Jean mit seinem Handy im Rückspiegel.
»Was?«
»Du kannst dich ja offenbar nicht entscheiden. Deshalb hab ich jetzt die Einweihungsparty organisiert. Ich hab alle für nächsten Samstag eingeladen.«
»Was heißt alle? Ich habe keine Lust, Leute zu sehen.«
»Keine Panik. Philippe, deine Schwester, ihre bessere Hälfte und ihre Kinder, Bertrand und Marie, Polo, Bertin und seine Frau, die auch mit ihrer Tochter kommen. Ich hab mit Tonio noch nicht geredet, aber …«
»Vergiss es.«
»Wir haben was geleistet, das muss gefeiert werden. Ich bin gestern bei Michèle im Laden vorbeigegangen, um ihr die letzte Rechnung zu geben. Sehr hübsch, ihr Geschäft. Du solltest mal hingehen und dir ein Paar Netzstrümpfe kaufen.«
»Warum erzählst du mir das?«
»Weil ich sie auch eingeladen habe.«
Rémi bremste abrupt.
»Was?«
Jeans Geländewagen fuhr in den Graben und preschte mit gleicher Geschwindigkeit weiter.
»Ich hab ihr gesagt, dass du mich damit beauftragt hättest. Sie sagte, dass sie vielleicht vorbeikäme.«
3 Zwanzig Jahre nach dem Unfall,
neun Tage vor der Entdeckungder ersten Leiche
Rémi raste in die Stadt und bemerkte erst beim Kreisverkehr am Pont Neuf, dass er achtzig fuhr. Als er heruntergeschaltet hatte, nahm er das ganze Ausmaß seiner Nervosität wahr.
Seit wann war er nicht mehr in der Stadt gewesen? Seit einer Woche? Zwei? Je weniger er dort war, desto besser ging es ihm. Er fuhr langsamer, verließ das Zentrum und bog in die Route du Mont ein, die zum Krankenhaus führte, zum Finanzamt, zur Gendarmerie. Nach der letzten Kurve, vor dem Neubaugebiet und der Gendarmeriekaserne, öffnete sich der Blick auf das alte R. und seine drei steilen Täler mit dem Fluss in der Mitte. Die Häuser aus Granit mit ihren Schieferdächern, dicht aneinandergedrängt an den Hängen, die terrassierten Gärten. Der kürzlich restaurierte Uhrenturm, die Hauptstraße. Die Ruinen des alten Schlosses oberhalb des Landratsamtes. Dem Rathaus gegenüber Michèles neuer Laden.
Auf die Hügel hinauf kamen Jugendliche, die knutschen wollten, Betrunkene, um die Nacht zu beenden, Drogenabhängige, um sich zwischen den Ginsterbüschen einen Schuss zu setzen. Man hatte einige Selbstmörder auf dem Turmhügel gefunden. Im Gesträuch lebten Hasen und Kaninchen, Dachse, Marder und Singdrosseln. Es gab zwei oder drei Wildschweinwechsel. Wenn man ein paar Stunden auf dem Ansitz wartete, hatte man gute Chancen, Rehe durchziehen zu sehen. Nachts wimmelte es von Igeln, und die Leute vom Lager legten Schlingen. Rémi hatte Stunden damit verbracht, in diesen Büschen und Wäldern Vögel zu beobachten. Die gleichen Vögel gab es nur hundert Meter vom Hof entfernt, aber er liebte es, Tiere zu belauschen und gleichzeitig die Geräusche der Stadt zu hören.
An einem Abend war er mit Michèle nach La Lune gekommen; sie waren fünfzehn oder sechzehn gewesen. Rémi war die ganze Strecke vom Hof mit dem Mofa gefahren, und er erinnerte sich nicht mehr, ob sie auch mit dem Mofa gekommen war, vom Haus der Messenets auf der anderen Seite des Gartempe-Tals bis hierher. Vielleicht war sie die drei Kilometer auch zu Fuß durch den Wald gelaufen. Es war der Anfang des Sommers, es hätte ihr ähnlich gesehen. Fünfzehn. Sie sollte im darauffolgenden Herbst ins Gymnasium kommen. Für ihn war es anders. Vor den großen Ferien hatte ihn der Schulleiter einbestellt. Rémi war der Gang in dieses Büro verhasst gewesen; er hatte den Eindruck gehabt, mitten in diesen sauberen Büchern und Papieren einen Geruch nach Stall zu verbreiten. An diesem Tag hatte der Schulleiter nicht von Raufereien gesprochen oder von seinen Fehlstunden wegen der Arbeit auf dem Hof, sondern von seiner Zukunft und von seinen »Möglichkeiten«. »Sie müssen aufs Gymnasium, Parrot.« Das hatte er gesagt. Als wäre das so einfach: »Sie sind ein guter Schüler, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie später machen wollen?« Die Frage hatte ihn sprachlos gemacht. Aber die Entscheidung hing nicht von ihm ab. Die Heuernte hatte begonnen. Im Herbst war er dann auf das Landwirtschaftsgymnasium gegangen.
Er hatte versucht, mit seiner Mutter darüber zu sprechen, an jenem Abend. Sie war rot geworden und hatte gesagt, er solle vielleicht warten, bis das Heu eingebracht wäre, bevor er das bei Tisch zur Sprache brachte. Er hatte keine Zeit gehabt, es zu tun.
Mit Michèle zusammen hatte er Stunden damit verbracht, die Stadt von oben zu betrachten, während es langsam Nacht wurde. Ihre schwarzen Augen waren auf die Straßen von R. geheftet, in denen die ersten Lichter aufflammten. Als sie davon sprach, diese verkommene Stadt verlassen zu wollen, hatte sich Rémis Herzschlag beschleunigt. Für ihn gab es kein Weggehen. Die Heuernte und das Landwirtschaftsgymnasium. Der Hof. Er hatte ihre Hand nehmen wollen, aber dann hatte er darauf verzichtet. Er konnte sie nicht zurückhalten. Sie würde gehen, und er würde bleiben.
Dieser Jugendliche, der tastend die Mauern erkundete, die ihn umgaben, er spürte ihn noch in seinem Innern, geduckt unter einem Busch, die Fäuste geballt. Russische Puppen. Stück für Stück hüllte die Zeit Teile seines Selbst in einen Schleier und entzog sie ihm. Je mehr man in der Zeit voranschritt, desto weniger Teile, desto weniger Mischungen umfasste das Selbst. An diesem Abend herrschte die Jugend, das Alter der Trennungen – zwischen Kind und Erwachsenem, Freunden und Bekannten, Dummheit und Intelligenz. Im Collège hatte man nicht mit allen gespielt, es hatten sich Gruppen gebildet, in denen es um Geistesverwandtschaft, um Ähnlichkeit der Neigungen und Interessen ging. In R. hatte das zu einer entscheidenden Wendung geführt.
Rémi war der einzige Spross einer hier ansässigen Familie, die nur auf drei Generationen zurückblicken konnte. Sein bretonischer Großvater war nach dem Krieg hierhergekommen, um Land zu kaufen, das die Regierung billig abgegeben hatte, um diesen durch den Exodus der Bauern entvölkerten Winkel wiederzubeleben. Aber der Legende nach hatte dieser Großvater Parrot auch deshalb die Bretagne verlassen, weil er sich dort zu viel Ärger eingehandelt hatte. Rémi hatte ihn nicht gekannt, aber ein paar Alte erinnerten sich noch an ihn. Parrot, rastloser Arbeiter, Alkoholiker, rabiater Hitzkopf. Wenn man die russische Puppe öffnete, stieß man nach dem Jugendlichen und dem Kind auf einen Großvater, der herumschrie, der soff und seine Frau schlug, weil er sie nicht verlieren wollte; auf einen Vater, dessen Freundlichkeit getränkt war von Wein und dessen Frau sich in einem erbärmlichen Zustand befand. Rémi schleppte in seinem Innern diese Vorfahren mit sich herum, die sich nie assimiliert hatten. Sein Einsiedlerleben und seine einsame Arbeit schien für alle hier das logische Ende dieser entwurzelten und erfolglosen Dynastie zu sein.
In jener Sommernacht oberhalb der Stadt hatte er keinen anderen Ausweg, keine andere Möglichkeit gesehen als den Hof, diesen Hof, der seinen Großvater getötet hatte und nun auch seinen Vater an der Gurgel packte. Es gab nur zwei Kinder. Ihn selbst und seine Schwester Martine, Lehrling in einem Friseursalon der Stadt. Es war sein Erbe als Mann. Mit fünfzehn war er kräftig genug für die Arbeit.
Einige Tage später war das vorbei. Die Ärzte erklärten, dass er nur dank seines robusten Knochenbaus überlebt hatte. Michèle und Rémi hatten noch nichts von ihren Schwächen und ihren Stärken gewusst.
Die Kurve mündete in die gerade Straße des Neubaugebiets. Die weiß verputzten Einfamilienhäuser wurden allmählich alt. Die Industrieziegel waren dunkel geworden und überzogen sich an den Schrägen der Nordseite mit Moos, an Türen und Holzzäunen blätterte die Farbe ab. Als er das Collège besuchte, waren die Kinder, die hier wohnten, in den neuen Häusern oberhalb der Stadt, die Könige. Wie das Büro des Direktors, ein Ort, den Rémi in seinen Bauernkleidern nicht zu betreten wagte. Am Ende der Straße sah er das dunkelblaue Tor der Gendarmeriekaserne.
Von dem kurzen Blick auf die Stadt im schwankenden Verlauf der Kurve blieb nur der Eindruck übrig, den er immer schon gehabt hatte – vielleicht von Michèle übernommen –, dass die drei Täler alles erstickten, was in ihnen lebte. Und dieser Satz, der ihm im Kopf herumging, bis er den Pick-up im Hof der Kaserne abstellte: »Es gab nur zwei Kinder.«
Marsault saß am Empfang. Als er Rémi Parrot erblickte, reagierte er auf eine Weise, die der Revierjäger zu ignorieren gelernt hatte. Sein Blick huschte hin und her, weil er keinen Haltepunkt in seinem Gesicht fand.
»Salut, Arnaud.«
»Salut, Rémi.«
Marsault. Clan Courbier. Als Jugendlicher große Klappe, Raufbold, Kindheitsfreund von Thierry Courbier. Wie fast alle Knirpse von R. war er damals in Michèle verknallt gewesen. Verheiratet mit der älteren Tochter vom Bistro Marcy. Ein, zwei Kinder. Polizist. Rémi fragte sich, ob er am vergangenen Samstag auf dem Ball war, als die Arbeiter der TechBois Philippe zusammengeschlagen hatten.
Rémi hatte seine Beziehung mit der Polizei nie geklärt. Er war vereidigt, besaß polizeiliche Befugnisse, besaß ein Paar Handschellen, eine Dienstwaffe, die er allerdings nur selten trug. In seinem Revier konnte er ermitteln, Verwarnungen aussprechen, Festnahmen veranlassen. Das alles genügte nicht, um sich den Polizisten nah zu fühlen, die hier Dienst taten. Er arbeitete mit ihnen zusammen, gelegentlich, nicht mehr. Der Ausdruck »Polizist der Natur« tat ihm in den Ohren weh.
»Ich hab den Plan für die Drückjagd mitgebracht. Der Jahresabschluss ist beendet. Es ist alles dabei. Parzellen, Posten, Zeitplan. Die Liste der Schützen ist noch nicht vollständig, Valleigeas kümmert sich darum.«
Marsault nahm die Papiere und prüfte die erste Seite. Es war ihm offenbar recht, die Dokumente vor Augen zu haben, um Parrot nicht länger ins Gesicht sehen zu müssen.
»Ja, bei Valleigeas dauert es immer etwas länger, bis er sich mal entscheidet.«
Die Übersetzung war einfach: Bei den großen Treib- und Drückjagden wollte jeder dabei sein. Das heißt, auf der einen Seite die Courbiers, auf der anderen die Messenets. Jeder eine Schusslinie und jeder mit Freunden, die darauf platziert werden wollten. Valleigeas, Feldhüter von Sainte-Feyre, war mit keinem Clan befreundet. Seit zwei Monaten musste er Anrufe und Einladungen zu Partys und Empfängen erhalten, bei denen man ihm Visitenkarten zusteckte und ihm als schlechte Scherze getarnte Ratschläge und Drohungen zukommen ließ. Valleigeas war nicht unentschieden, er versuchte nur wie viele andere, sich nicht mehr Feinde zu machen als notwendig, und die Sache hinter sich zu bringen, ohne Partei zu ergreifen.
»Fünfundachtzig Wildmarken! Lenoir wird keine einzige Tiefkühltruhe mehr zu verkaufen haben. Achtzehn Treiber, achtundzwanzig Schützen. Es wird auch keine Munition mehr geben.«
Marsault hob den Kopf nicht.
»Wirst du auch da sein?«
»Ja, am Sammelplatz. Keine Lust, zwischen die Linien zu geraten, wenn das Geballer losgeht.«
Marsault lächelte ohne Wärme. Er wusste, dass er es dabei bewenden lassen musste: Parrot gehörte weder zur einen noch zur anderen Seite.
»Und du?«
»Nein, kein Platz mehr. Und ich habe Dienst.«
»Siehst du, Valleigeas schafft es doch von Zeit zu Zeit, sich zu entscheiden.«
Marsault war sichtlich bemüht, keine Reaktion zu zeigen.
»Der Commandant hat gesagt, dass er dich sehen will. Er ist in seinem Büro.«
Rémi ging hinter dem Empfangstisch zur Treppe.
Er klopfte an die Tür und trat ein. Der Commandant musste sich auf sein Kommen vorbereitet haben, denn er suchte blitzschnell Parrots Blick und hielt ihn während des ganzen Gesprächs fest, ohne auch nur einen Zentimenter abzuirren.
Er bat ihn, sich zu setzen, doch der Revierjäger in seiner kakifarbenen Uniform blieb lieber stehen.
»Ist alles bereit für die Jagd?«
»Es fehlt nur noch die vollständige Liste der Schützen.«
»Ach, ja. Die Schützen, immer die Schützen. Nach welchen Kriterien werden sie wohl hauptsächlich ausgewählt, was glauben Sie, Monsieur Parrot? Was zählt? Ihre Liebe zur Natur, ihre Freundschaft mit den Nachbarn oder ihre Fähigkeit zu schießen?«
Die linke Hälfte von Rémis Gesicht lächelte.
»Eins von den dreien ist nicht in besonderem Maß erforderlich.«
Commandant Vanberten, dessen nordischer Name nicht den geringsten Bezug zu seiner äußeren Erscheinung eines Händlers aus Bordeaux aufwies, begann zu lachen. Es klang, als würde er in ein Taschentuch husten.
»Ich will nicht wissen, was.«
Auch wenn er seit hundert Jahren hier lebte, Alkoholiker geworden war und zehnmal den »Großen Wettbewerb der Kartoffelesser« gewonnen hatte, würde er nie als Einheimischer gelten.
»Monsieur Parrot, ich wollte mit Ihnen über einen Vorfall sprechen, der mir zu Ohren gekommen ist, anlässlich des Balls der Firma TechBois am letzten Samstag. Wissen Sie, worüber ich reden möchte?«
»Sie werden es mir sagen.«
»Philippe Mazenas, Beamter der Forstverwaltung, soll bei dieser Feierlichkeit überfallen und schwer verletzt worden sein. Können wir über diese Sache sprechen? Schön. Trotz der Bemühungen, die in dieser Brigade unternommen werden, damit ich nicht alles erfahre, was samstagabends passiert, weiß ich in diesem Fall Bescheid. Zudem bin ich in der Lage, zwischen einem Saufgelage und einer Vergeltungsaktion zu unterscheiden. Beteiligt waren besagter Förster und einige Arbeiter des größten holzwirtschaftlichen Unternehmens der Region. Ich kenne Ihre Haltung gegenüber den Beteiligten, und deshalb würde ich gern Ihre Meinung dazu hören. Glauben Sie, dass das Problem Kreise ziehen könnte? Dass es vielleicht sogar noch größer wird? Sie können frei sprechen, ich hole lediglich Informationen ein, und noch glaube ich nicht, dass Brigadier Marsault draußen steht und lauscht.«
Das höfliche Lächeln Vanbertens versuchte nicht, seine Intelligenz zu kaschieren, es war nur eine Ermutigung für die Langsameren.
»Ich weiß nicht, Commandant. Ich habe Philippe noch nicht gesehen. Zwischen ihm und den Betreibern der Fabrik ist die Lage immer gespannt gewesen. Er hatte getrunken, nehme ich an. Wahrscheinlich haben alle getrunken. Das sind keine mildernden Umstände, aber es ist eine Erklärung. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich muss heute noch bei ihm vorbeischauen.«
Vanberten überlegte einen Augenblick. Er scheute davor zurück, seine Antwort allzu vertraulich klingen zu lassen.
»Gut, Sie wissen nicht viel mehr als ich. Aber sollten Sie je erfahren – und betrachten Sie das bitte nicht als Denunziation oder Verrat –, dass das Ganze ernster ist als eine Rauferei am Ende eines Tanzabends, hätten Sie dann die Freundlichkeit, es mir mitzuteilen, Monsieur Parrot?«
»Das werde ich tun, Commandant. Sollten Ihre Männer weitere Auskünfte zur Jagd nächste Woche benötigen, zögern Sie nicht, mich anzurufen.«
Rémi salutierte und legte die Hand auf die Türklinke. Der Commandant rief ihn zurück. Er lächelte noch immer:
»Und Sie, Monsieur Parrot, sind Sie ein guter Schütze?«
Rémi drehte sich halb um, sodass Vanberten nur sein gelähmtes Profil sah, während das Lächeln sich auf der anderen Seite versteckte.
»Davon spricht man nicht, Commandant. Aber man muss es wissen.«
Rémi fuhr im zweiten Gang abwärts und ließ die Motorbremse seine Fahrt bis zum Zentrum verlangsamen. Er steckte das Mobiltelefon in die Halterung, schaltete auf Freisprechen und ging die Adressenliste durch. Nach dem dritten Klingeln hörte er Philippes Stimme. Rémi entschuldigte sich, dass er nicht schon längst vorbeigekommen war, und fragte, wo er sei. Philippe war beim Auszeichnen von Bäumen im Staatswald von Fénières, zwanzig Kilometer entfernt. Das hieß, er war fähig, seine Arme und Beine zu gebrauchen. Rémi kannte die Gegend und fragte, ob sie sich in einer Stunde dort treffen könnten. Der Förster legte auf, und der Revierjäger fuhr weiter bis zur Hauptstraße, drehte auf dem Parkplatz des Rathauses und blieb in der Passage, die zum alten Kino führte, stehen.
Jean hatte gut gearbeitet. Der Laden, ein ehemaliger Hundesalon, war sinnigerweise in eine Boutique für Kleidung und Unterwäsche umgewandelt worden. Michèle wusste immer, was sie wollte, und Jean, was er tat. Fassade und Schaufenster waren frisch renoviert und farblich so gestaltet, wie es die Stadt gerade noch vertrug. Die Abstandszahlung an den Vormieter war nicht umsonst getätigt worden, denn die Lage war ideal. Es handelte sich um den am meisten frequentierten Ort der Stadt: eine gute Chance, dass man hier Geschäfte machen konnte.
Hinter der spiegelnden Windschutzscheibe versteckt, lächelte Rémi, als er den verschnörkelten Schriftzug las: »Michèles Dessous«.
Rechts und links der Eingangstür zwei Schaufenster; das eine mit Kleidung, die den Sommer ankündigte, das andere mit Wäsche.
Mit einem Teppichmesser durchtrennte sie das Verpackungsband eines gerade gelieferten Pakets. Rémi beobachtete, wie sie rosarote und weiße T-Shirts auseinanderfaltete. Sie zwängte sich zwischen kopflosen Schaufensterpuppen hindurch und schob Garderobenhüllen zur Seite. Sie faltete zusammen, stapelte, versah die neuen Sachen mit Preisschildern.
Warum hatte es so lange gedauert, bis er gekommen war? Fünf Monate. Vielleicht um sicher zu sein, dass sie nicht nur vorübergehend eingezogen war. Möglich, aber als Grund nicht ausreichend. Es blieb die Angst. Sie so zu sehen, hier, in diesem Laden, in den sie zu gehören schien, erfüllte Rémi mit einer Erleichterung, die er sich nicht hatte vorstellen können. Er nahm seine Mütze ab, fuhr sich durch die Haare, holte tief Luft und legte die Hand auf den Türgriff. Doch er erstarrte, als er einen großen Mann in Barbourjacke, Hände in den Taschen, mit aufgesetztem Lächeln auf den Laden zumarschieren sah. Didier Messenet, Herr der Paraboot-Fabrik, Erbe des großen Viehhändlers und Michèles Bruder, wurde mit jedem Jahr, das ins Land ging, noch ein wenig arroganter. Seine Schultern waren trotz der Ausstaffierung als englischer Jäger und seinem ganzen vornehmen Gehabe gewölbt wie Bauernschultern.
Rémi ließ sich auf seinen Sitz zurücksinken, wartete, bis Didier im Laden war, und fuhr los. Als er am Schaufenster vorbeikam, hatte sich Messenet umgedreht und sah in Richtung Straße.
Rémi fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der neuen Nationalstraße, die nach Süden führte, auf die Kette der Puys-Berge zu; eine breite, schnurgerade Fahrbahn, die die ältere Straße mit ihren Kurven durchschnitt; aus diesen einstigen Kurven hatte man Rastplätze gemacht. Auf jeder Seite an den immer steiler werdenden Berghängen viele Hektar Douglasien, die Courbier hatte pflanzen lassen; daher der Spitzname dieses neuen Teilstücks glatten Asphalts: »Route Courbier«.
Im vergangenen Jahr hatten die Fällungen begonnen, und entlang der Fahrbahn hatten sich Berge von Holz und Rinde gestapelt, zehn Meter hoch, fünfzig Meter lang. Die Lkw der TechBois wurden damit beladen, worauf sie die Nationalstraße nahmen, die wunderbarerweise ein paar Kilometer weiter direkt in die Zufahrt zur Zellstofffabrik mündete, wo die gefällten Stämme zu Papierbrei und Pressholz verarbeitet wurden. Es steht jedem frei, den Zusammenhang zwischen dem Bau dieser Straße und Monsieur Marquais, dem Präsidenten des Regionalrats, engem Freund der Familie Courbier und Aktionär der ausführenden Tiefbaufirma, zu ignorieren. Courbier und Marquais waren so miteinander verfilzt, dass man im Einzelfall nicht mehr erkennen konnte, wer wem gerade einen Gefallen tat.
Die Fabrik wurde jedes Jahr größer. Ein neuer Schornstein, eine Lagerhalle, ein neues Sägegatter. An der Anlieferung Sattelschlepper mit Nummernschildern aus ganz Europa. Das Werk beschäftigte ein Drittel der letzten Lohnempfänger von R. Ohne die TechBois wäre die Stadt wahrscheinlich untergegangen. Sie hatte jetzt einen Bürgermeister und einen König.
Als das Werk hinter ihm lag, verließ Rémi die Nationalstraße und bog in die Route du Plateau ein, die in Serpentinen hinaufführte zur Gemeinde Fénières. Der Bürgermeister des Dorfes galt in der Gegend als Widerständler, da er sich seit mehreren Jahren weigerte, der TechBois Gemeindewald zu verkaufen, und die Forstverwaltung weiterhin sowohl mit dem Unterhalt als auch mit dem Holzverkauf betraute. Fünf Prozent der Wälder in der Region gehörten noch den Kommunen. Von den übrigen fünfundneunzig Prozent gehörten achtzig der Familie Courbier. Man versteht den Widerstand des Rathauses von Fénières besser, wenn man weiß, dass der alte Messenet die Hälfte des Gemeinderats in der Tasche hatte. Philippe war das egal, er tat alles, um aus diesem geschützten Winkel ein Paradies der Forstlandschaft zu machen, der schönste Stachel im Fleisch der TechBois.
Rémi stellte seinen Dienst-Pick-up auf dem Besucherparkplatz ab, wo der Wanderweg begann, ein Rundweg von zwei Kilometern, der über die Pierres Jaumâtres zum Gipfel führte. Er verriegelte das Auto und machte sich mit langen Schritten auf den Weg. Sauber ausgeästete Bäume, umsichtige Markierungen, sorgfältige Landschaftspflege – während er aufstieg, bemerkte Rémi überall, wie gut Philippe arbeitete. Er erklomm die steile Kante des Spalts, der den größten der gigantischen Granitfelsen teilte, und kauerte oben auf dem Rand, um das schönste Panorama der ganzen Region in sich aufzunehmen. Im Süden und Osten die noch verschneiten Gipfel der Chaine des Puys. Vor ihm das Plateau, der Abschnitt des regionalen Naturschutzgebietes, das bis zu dem höchsten Punkt, den Granitfelsen der Jaumâtres, ging, bevor es im Norden und Westen in eine weite hügelige Ebene überging. Die Ebene von der Landwirtschaft, das Plateau von Wald bestimmt. Zwei Territorien.
Der höchste Felsen der Gruppe wurde der »Drache« genannt, denn der elf Meter hohe Granitblock hatte einen Grat, rund wie ein Knochen und mit kleinen regelmäßigen Zacken wie eine Wirbelsäule. Am Rücken des Drachens konnte man den Lauf des Flusses ablesen, der diese tonnenschweren Steine umhergewälzt und abgeschliffen hatte, bis am Ende der Wasserspiegel so stark abgesunken war, dass sie, der Erosion preisgegeben, hier liegen blieben, auf dem Gipfel dieses Berges von siebenhundert Metern Höhe. Priester und Druiden waren einst hier heraufgekommen, und viele Jungfrauen und Ziegenböcke waren hier schon geopfert worden.
Rémi betrachtete die Grenzlinie, bevor er wieder abstieg. Die Messenet-Weiden, die zum Plateau hin abfielen; die Hochwälder und die abgeholzten Hiebflächen der Courbiers, die sich bis zum Naturschutzgebiet anschlossen. Direkt auf der Linie Fénières. Weiter weg, im Osten, die Gemeinde Banize und der Windpark der Messenets, den Rémi sogar von seinem Grundstück aus sehen konnte, am höchsten Punkt von Terre Noire.
Die Felsgruppe hatte etwas Beruhigendes. Sie intakt zu sehen, nachdem jahrhundertelang verheerende Kämpfe verschiedener Interessengruppen zu ihren Füßen getobt hatten, ließ die Provinzimperien der Courbiers und der Messenets fast lächerlich erscheinen. Doch Philippe lachte nicht darüber. Er kämpfte für die Natur. Rémi wollte das gern glauben, er vermied es daher, allzu tief in die psychologische Struktur des Aktivisten einzudringen. Für ihn selbst als Bauernsohn war die Natur etwas anderes. Die Bauern wissen, wie schnell sich ihre menschlichen Spuren verlieren. Die Erde ist ein Werkzeug, sie gibt dem, der die Kraft hat, sie zu bearbeiten. Der Einsatz von Technik brachte die Gefahr mit sich, dass die Vielfalt des Lebens verkümmerte, doch die Natur, so hatte Rémi immer geglaubt, hatte es nicht nötig, dass man sie verteidigte. Sie würde die Menschen einfach vernichten, wenn sie sich eines Tages ganz von ihr abwendeten. Es war wie in diesem Animationsfilm, den er einmal gesehen hatte, ein Szenario mit wissenschaftlichem Hintergrund, bei dem die Menschen von einem Tag auf den anderen verschwanden. Binnen zwanzig, dreißig Jahren konnten alle Wiesen dieser Gegend vom Wald erobert sein. Die Wölfe, die aus dem Zentralmassiv einwanderten, würden in kürzester Zeit überhandnehmen. Die Hälfte der aus den Zoos entlaufenen Tiere würde sich an das hiesige Klima anpassen, und in nur hundert Jahren würden Giraffen die Bäume auf den ehemaligen Getreideflächen der Messenets kahl fressen. Bären, Wölfe und Tiger würden um das Privileg kämpfen, sich auf dem Gelände der Pierres Jaumâtre zu tummeln, in den vergessenen Wäldern der Courbiers. Die Raubtiere würden sich wie im Paradies fühlen unter den Herden von Rehen und Hirschen. Die Bewohner der Normandie, des Charolais und des Limousin würden ganz von selbst untergehen, sie waren zu gierig, zu unflexibel, es sei denn, sie fanden im Winter Wege, um abzuwandern in den Süden. Vielleicht würden robustere Völker aus den Karpaten im Herbst die Ebene der Beauce durchqueren; einige Generationen von ihnen würden sich aufreiben auf der Suche nach einem günstigen Weg, der weit in den Süden vorstieß, über die Pyrenäen hinweg in die immergrünen Täler Spaniens. Sie würden die hohen Berge der Alpen umgehen und östlich der Puys-Berge auf die Bären, die Wölfe und Rudel verwilderter Hunde stoßen. Denn nach den Erkenntnissen der Wissenschaft wären die Nachkommen unserer Haushunde in Zukunft die wahren Könige der Tiere. Weder die großen noch die kleinen noch die Rassehunde, sondern die mittelgroßen, die Mischlinge, die nicht mehr als zwanzig oder fünfundzwanzig Kilo wogen. Diese Hunde würden über Europa herrschen. Banden strohgelber Hunde. In dem Film kam als Beispiel auch Tschernobyl vor. Flächen, die Menschen zehntausend Jahre lang nicht betreten dürfen, wo aber die Natur nach ein paar fehlerhaften Generationen wieder kraftvoll Wurzeln geschlagen hatte. Fauna und Flora. All das konnte man gut von hier oben auf den Pierres sehen, wenn man ein Bauernsohn war.
Rémi stieg wieder vom Drachen hinunter und ging weiter. Er verließ den markierten Weg und drang in den Wald ein, um eine Stelle zu inspizieren, an der er letztes Jahr Pfifferlinge gefunden hatte. Trotz der Sonne in den letzten Tagen musste man noch die Eisheiligen abwarten, erst dann würden die Nächte weniger kalt sein, und man würde wieder Pilze sammeln können.
Zurück auf dem Weg, ging er an dem kleinen grünen Peugeot vorbei, Philippes Dienstwagen, folgte einer Reihe mittelgroßer markierter Eichen und pfiff, als er glaubte, in Hörweite zu sein. Dann wartete er schweigend auf Antwort. Er ging etwa hundert Schritte nach rechts, signalisierte erneut seine Anwesenheit, ging weiter und pfiff noch einmal. Endlich meinte er, eine Stimme zu hören, weit weg, aber kräftig. Er orientierte sich an dem Ton und sah Philippe schließlich am Ende einer Baumreihe. Er war in Arbeitskleidung, hatte das Handy am Ohr und schrie hinein. Als er Rémi hörte, drehte er sich um, wich zurück und schaltete mit weit offenen, wütenden Augen das Telefon aus. Eine Remington 750 Woodmaster hing an einem Gurt über seiner Schulter.
Philippes Gesicht war mit Striemen und Kratzern übersät. Sein rechtes Auge war dick geschwollen und bis zu den Wangenknochen schwarz umrandet. Ein tiefer Schnitt hatte seine Lippen aufquellen lassen. Seine linke Hand war verbunden, und er hinkte. Jean hatte nicht übertrieben. Philippe hatte heftige Schläge abbekommen. In den kurz geschorenen blonden Haaren war der Rand einer noch unvernarbten Wunde zu erkennen. Unter dem Dreitagebart verbargen sich weitere Wunden. Noch lange würde er diesem zerschlagenen Kinn kein Rasiermesser zumuten können.
Die körperlichen Wunden würden irgendwann verschwinden, aber Rémi war betroffen vom Zustand des Försters, von seinem hasserfüllten Gesicht.
»Salut.«
»Was willst du?«
»Nichts. Sehen, wie’s gewesen ist.«
»Ich bin voll in Form.«
Rémis Blick war auf den Karabiner gerichtet.
»Was machst du mit dem?«
Er lächelte und streckte die Hand aus. Philippe ergriff sie und drückte sie fest.
»Du erwartest Besuch?«
»Ich will Ruhe haben, wenn ich arbeite. Das ist nur, um die Touristen zu erschrecken.«
»Jean hat mir erzählt, was passiert ist.«
»Tja, es wär mir lieber gewesen, er wäre etwas früher aufgekreuzt, aber es war schon gut, dass er überhaupt da war.«
»Was hast du eigentlich gewollt?«
Philippe wandte ihm den Rücken zu und ging hinkend weiter bis zu einer Eiche. Wenige Hiebe mit einer kleinen Axt, auf der Höhe von einem Meter fünfzig, weitere in Bodennähe. Die Markierung sah aus wie eine Wunde auf der dunklen Rinde.
»Ich hatte gesoffen.«
»Daran zweifelt niemand.«
Philippe hob den Kopf, betrachtete die Zweige der umliegenden Bäume, schätzte die Distanz, die sie trennte, und wählte die nächste Eiche aus, die gefällt werden sollte. Zwei präzise Hiebe mit dem Reißhaken.
»Vanberten hat mir Fragen gestellt.«
»Du hast zu viel mit der Polizei zu tun.«
»Ich quatsche nicht.«
»Was gibt es denn eigentlich zu verstehen?«
»Schau dich an. Ich gehe nicht mit einem Gewehr spazieren. Welche Munition?«
Philippe ging von Baum zu Baum und markierte die Stämme schnell und präzise.
»Wird dir nicht gefallen. Norma 7/64.«
»Großwild?«