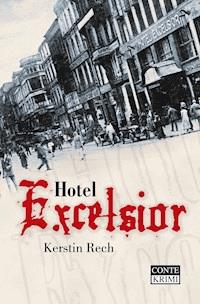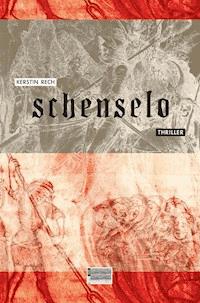Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Im Institut für Forensische Psychiatrie plant die Psychiaterin Dr. Winter ein Experiment mit dem Serienmörder – und Vergewaltiger Heiner Baumann, der unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leidet, bei der verschiedene Identitäten abwechselnd die Kontrolle über sein Denken übernehmen. Baumann bekennt sich zu all seinen Taten – bis auf eine Ausnahme. Dr. Winter will in ihrem Experiment die diversen Persönlichkeiten Baumanns zusammenbringen und so herausfinden, ob sein Leugnen der Wahrheit entspricht. Aber wenn Baumann in dem einen Fall nicht der Mörder war, wer war es dann? Welches Geheimnis lauert hinter der Tür, die durch Dr. Winters Experiment geöffnet wird? Und warum verhält sich der Chefarzt des Instituts, Professor Schwarzkopf, seit Beginn des Experiments so merkwürdig? Hat es damit zu tun, dass sich seine schöne Frau Annemarie auffallend für Heiner Baumann interessiert oder steckt noch mehr dahinter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KERSTIN RECH
DIE TÜR
KERSTIN RECH
DIE TÜR
Thriller
swb media entertainment
Die Handlung und die handelnden Personen sind frei erfunden.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden und bereits verstorbenen Personen ist zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.
Veröffentlicht im Südwestbuch Verlag, einem Unternehmen der SWB Media Entertainment Jürgen Wagner, Waiblingen, Februar 2021
1. Auflage 2021
ISBN 978-3-96438-047-0
© 2021 SWB Media Entertainment, Gewerbestraße 2, 71332 Waiblingen
Lektorat: Catrin Stankov, Bernau
Titelgestaltung: Dieter Borrmann, Kleve
Satz: SWB Media Entertainment
Druck, Verarbeitung: Custom Printing EU
Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.
www.suedwestbuch.de
- I -
Es kam nicht oft vor, dass Heiner Baumann so zufrieden war und, wie es das dicke Weib mit dem Dauerlächeln auf dem Gesicht gerne ausdrückte, in sich ruhte.
Das dicke Weib stand neben der Tür und er spürte ihren bohrenden Blick in seinem Rücken. Sie kam ein paar Schritte näher und spähte ihm über die Schulter, so weit es ihr dicker, kurzer Hals zuließ.
Dann werden wir ihr mal zeigen, was wir können, dachte er.
Mit seinen Händen umfasste er den Hals der Frau, die vor ihm auf der Tischplatte saß. Ihr Gesicht mit den vollen, sinnlichen Lippen, der leicht gewölbten Stirn und den hochstehenden Wangenknochen schaute ihn bewundernd an. Er war der Meister, er hatte sie erschaffen. Sie hockte direkt auf dem glatt polierten Holz der Tischplatte und er hatte seinen Hocker so eingestellt, dass ihre Gesichter auf gleicher Höhe waren.
Er drückte nicht zu. Noch nicht. Mit seinen Daumen strich er über ihren Hals und erfühlte die Stellen, wo das Zungenbein und der Kehlkopf sein sollten.
Langsam und zärtlich fuhr er über ihre Schultern, die Arme hinunter und über ihren Bauch. Dann zog er die Hände zurück, lehnte sich auf seinem Hocker nach hinten und betrachtete ihren Busen. Er war zu groß.
Baumann nahm einen Lappen, der neben seinen Füßen auf dem Boden lag und wischte seine Hände ab. Für das, was er jetzt vorhatte, wollte er saubere Hände haben. Auf Reinlichkeit hatte er schon immer viel Wert gelegt.
Er warf den Lappen mit einem schwungvollen Schlenkern auf den Boden, als wäre er ein Zauberer, der einen Trick vorführte. Schließlich wusste er, was er seiner Zuschauerin schuldig war.
Das dicke Weib kam noch einen Schritt näher. Er konnte an ihrem Atem spüren, dass sie gespannt war.
Er ließ langsam seine Hand über die Pappschachtel mit den Utensilien kreisen, die auf dem Tisch seitlich von ihm lag – ein alter Kochlöffel, Schneidedraht und eine Gabel mit nach unten gebogenen Zinken. Seine Hand stoppte und seine Finger bewegten sich wie bei einem Klavierspieler. Er würde es ein bisschen spannend machen. Aber nicht zu lange. Wartete man nämlich zu lange, fiel die Spannung schneller ab, als sie zuvor gestiegen war. Und die Zuschauer verloren das Interesse. Entschlossen griff er nach dem Schneidedraht.
Das dicke Weib hinter ihm hielt den Atem an.
Und schon ist die Luft besser, dachte er.
Weitere Schritte näherten sich ihm schlürfend, als handelte es sich um alte Männer, die ihre Füße nicht mehr heben konnten oder wollten. Das sind die Tranquilizer, wusste er. Aber so sediert waren die Dummies nicht, dass sie nicht merkten, dass gleich etwas Aufregendes passieren würde.
Sie und das dicke Weib, das noch immer den Atem anhielt, dachten bestimmt, dass er den Draht um den Hals der Frau legen würde. Tat er aber nicht. Er setzte den Schneidedraht unter dem Busen an und verharrte in stiller Erregung. Er hielt ihn an beiden Enden zwischen Daumen und Zeigefinger.
Hinter sich hörte er nervöses Kichern. Die Dummies hatten keine Geduld für das, was er zelebrieren nannte und deswegen waren sie stets enttäuscht – denn ihre Befriedigung kam und ging so schnell wie ein vorzeitiger Samenerguss. Wham! Bam! Thank you Ma’am!
Er hörte, wie sie immer lauter atmeten. Das Atmen wurde rhythmisch und erinnerte ihn an Applaus während eines Konzerts, wenn das Klatschen, das die Band zu einer Zugabe wieder auf die Bühne zurückbringen sollte, immer synchroner wurde.
Es würde gerade noch fehlen, dass sie ihn anfeuerten – diese Banausen, mit denen er nichts zu tun haben wollte und die er nur als Bewunderer seiner Kunst akzeptierte. Wenn einer es wagte, auch nur ein einziges Wort zu sagen oder mit einer Geste plumpe Vertrautheit demonstrieren wollte, würde er die Aktion ohne zu zögern abbrechen.
Außerdem, und das wussten die Dummies nicht, interessierte ihn nebenbei, wie lange das dicke Weib in der Lage war, den Atem anzuhalten.
Sie atmete mit einem lauten Schnaufer aus. Also gut! Er zog mit einer schnellen Bewegung den Draht nach oben und schnitt den Busen der Frau glatt und sauber ab und zwei weiche Massen fielen klatschend vor seine Füße. Das dicke Weib hinter ihm schrie leise auf. Einige der Dummies riefen begeistert, andere stöhnten auf.
Damit hatten sie wohl nicht gerechnet, dachte er hämisch. Überraschung gelungen.
Baumann schaute auf die beiden breiähnlichen Klumpen zu seinen Füßen und lächelte. Als er hochschaute, bemerkte er einen Mann, den er schon öfters hier gesehen, mit dem er aber noch nie ein Wort gewechselt hatte. Er wusste nur, dass man ihn Frosch nannte, weil er so unangenehm schwitzte, und dass er ein Exhibitionist war und, dass er neben dem Entblößen auch noch gerne vor fremden Fenstern stand. In Baumanns Augen war er ein armes Schwein. Dieser Frosch suchte Augenkontakt mit ihm und Baumann wusste in diesem Moment, dass das arme Schwein, das Tag für Tag mit Wasserfarben Blumen und Bäume malte, liebend gerne dasselbe gemacht hätte wie er. Doch es war ein weiter Weg vom armen Schwein zum Serienmörder, aber es war nicht unmöglich, ihn zu gehen.
Er könnte dem Frosch erklären, dass das erste Mal nur ein wenig Überwindung kostete, vergleichbar mit einem Fallschirmsprung, aber die Befriedigung es allemal wert war. Und beim zweiten, dritten, x-ten Mal, wenn die Erfahrung des gewieften Jägers hinzukam, kostete es nicht mehr Überwindung, als einem Kanarienvogel den Hals umzudrehen. Er wusste das, aber diese Psychiater und Therapeuten um sie herum wussten es nicht. Sie glaubten mit Quatschen und noch mehr Quatschen die üblen Gedanken aus ihm und den anderen Insassen heraus … er überlegte kurz … herausquatschen zu können. Er lachte laut über seine Formulierung.
Baumann vergaß den Frosch in derselben Sekunde wieder, als er seinen Blick von ihm abwandte.
Die Dummies schlürften wieder an ihre Tische, wo sie mit Wasserfarben und Buntstiften absurde Bilder malten, die etwas über ihre traumatische Kindheit aussagen sollten.
Er betrachtete die Stelle, wo bis vor ein paar Sekunden noch der Busen der Frau war. Der Schneidedraht hatte ganze Arbeit geleistet. Die beiden Schnittstellen sahen sauber und glatt aus.
Er hob wieder die Hände und legte sie um den Hals der Frau. Diesmal drückte er zu. Nicht weil es ihm gerade jetzt ein tiefes Bedürfnis war. Er hätte auch gerne noch etwas warten können. Er drückte zu, weil er später keine Zeit mehr dazu haben würde. Die Therapiestunde, in der er und andere Sexualstraftäter ihren Gefühlen kreativ Ausdruck verleihen sollten, war nämlich gleich zu Ende.
Er drückte fest zu und der weiche Ton quoll zwischen seinen Fingern heraus. Es war ein schönes Gefühl – er kam sich vor wie ein Kind, das im Matsch spielt. Und weil es ein so schönes Gefühl war, zerquetsche er gleich den ganzen Körper.
„Schade, Herr Baumann“, hörte er die Stimme des dicken Weibes, das jetzt neben ihm stand. „Das wäre eine so schöne Skulptur geworden.“
Er hob den Lappen wieder auf und säuberte sich die Hände. „Fanden Sie sie schön?“
„Aber ja, sehr schön sogar. Die Proportionen haben gestimmt und das Gesicht war fein ziseliert. Hatten Sie jemand Bestimmtes vor Augen, als sie das Gesicht modelliert haben?“
Er stand auf und schaute auf sie herunter. Er war gut einen Kopf größer als sie. „Ja. Das hatte ich. Und ich war auch zufrieden mit ihr. Ich war ganz und gar zufrieden.“
Er schaute zu dem zerstörten Körper, von dem nur noch eine hellbraune unförmige Masse übriggeblieben war.
„Hatte sie einen Namen?“, fragte das dicke Weib.
Baumann kicherte in sich hinein. „Ga…bri…ele.“
„Gabriele? Wie Ihr letztes Opfer? Sah Gabriele so aus?“
Baumann zuckte mit den Schultern.
Sein Gegenüber registrierte mit wachem Blick die herablassende Gleichgültigkeit, die in dieser Geste lag.
Aber Baumann dachte nur: Was glotzt die so dämlich?
Statt eine Antwort zu geben, fragte er: „Kennen Sie den Witz mit Gabriele?“
„Den haben Sie mir schon erzählt, Herr Baumann. Und wenn Sie ihn mir noch einmal erzählen, wird er auch nicht komischer. Er ist einfach nur blöd.“
Baumann sah sie überrascht an. Was erlaubte sich dieses dicke Weib?
Während sie sich umdrehte, sagte sie streng: „Ihr Durcheinander und das Geschmiere machen Sie noch sauber, bevor Sie auf Ihr Zimmer gehen!“
„Ich gehe nicht auf mein Zimmer.“
„Nein? Was haben Sie denn vor?“
„Ich werde im Aufenthaltsraum noch einen Film anschauen.“
„Meinetwegen. Wenn Frau Dr. Winter es Ihnen gestattet hat.“
„Hat sie.“
Sie ließ ihn stehen, aber in einem der Einwegspiegel, die an den Wänden hingen und mittels derer man den Raum von außen beobachten konnte, sah sie ihn genau. Keine seiner Bewegungen entging ihr. Und amüsiert stellte sie fest, dass er verblüfft darüber war, wie angstfrei sie ihm den Rücken zugewandt hatte. Wie konnte er auch ahnen, dass aufmerksame Augenpaare hinter den Einwegspiegeln ihn beobachteten und ihr Sicherheit gaben. Das war der Unterschied zwischen drinnen und draußen, wo ihm die Frauen schutzlos ausgeliefert waren.
- II -
Ein Mann mit Hut jagte mit ausgestreckten Armen einen Hasen, der fast so groß war wie er selbst und dessen Ohren immer länger wurden. Die Arme des Mannes, die nach vorne gestreckt waren und die Ohren des Hasen, die nach hinten flogen, kamen sich immer näher, schafften es jedoch nicht sich zu berühren. Angesichts der Aussichtslosigkeit seines Tuns verwandelte sich der Mann langsam in eine Feder und aus dem Verfolger wurde ein Verfolgter. Ein weißer Vogel, eine Taube oder eine Möwe, folgte mit weit aufgerissenem Schnabel der Feder. Wohin war der Hase verschwunden? Er hatte sich aufgelöst und zog als dünne Gazewolke weiter, durch die die Feder und der Vogel mühelos schwebten und die sie ebenso mühelos absorbierten.
Jetzt kroch von Westen her ein Käfer oder eine Schildkröte durch den Himmel. Die Konturen veränderten sich zu einem Affen, der seine langen Arme eng an den Körper hielt und dessen Ohren immer größer wurden.
Ein Bett, genauer gesagt ein Himmelbett, formierte sich aus dem Affen mit den langen Armen. Ben, von seinen Freunden wegen seiner Leibesfülle auch Benjamin Blümchen genannt, gähnte wohlig. Ein Bett aus Wolken!
Er stand am Wohnzimmerfenster und schaute mit gottergebenem Blick himmelwärts und ergötzte sich an den Schöpfungen aus Wasser und Luft. Er hätte ewig so dastehen und den Himmel betrachten können. Seitlich mit der Hüfte ans Fensterbrett und einer Schulter ans Fensterkreuz gelehnt, stand es sich recht bequem. Das Einzige was sein Wohlbefinden störte, war der Telefonhörer, den er ans Ohr halten musste und mehr noch die Stimme, die auf ihn einredete. Sie gehörte seinem Freund Gottfried. Er schwelgte wieder einmal in Jugenderinnerungen, die Ben überhaupt nicht interessierten. So wie Gottfried jede Gelegenheit ergriff, in die Vergangenheit zu schweifen, lebte er ausschließlich in der Gegenwart. Dafür wurde er geboren. Das war sein Part. Und in diesem Moment wollte er nichts anderes, als diesen herrlichen Himmel betrachten und die Gebilde, die ihn bevölkerten, erraten.
Aber Gottfried redete weiter und Ben sah eine Uhr, eine antike Taschenuhr, deren Zeiger immer schneller liefen. Das war kein Wolkengebilde mehr, das war die Uhr seines Lebens.
Die Sonne war im Laufe von Gottfrieds fortwährendem Geplapper über die Schulzeit, längst vergessene Schulfreunde, belegte Pausenbrote, frisierte Mofas und sonntägliche Kirchenbesuche längst untergegangen. Stand er schon so lange am Fenster und hörte er schon so lange der Rede seines ehemaligen Schulfreundes zu? Es musste wohl so sein, denn seit einigen Minuten konnte Ben die Sonne schon nicht mehr sehen. Dafür strahlte der Himmel nun in einem kräftigen Orange. Eine Kuh, oder war es eher ein Kälbchen, flog strahlend über den Himmel. Lila Kühe kannte er aus der Werbung, aber eine orangefarbene Kuh sah er zum ersten Mal. Er lachte.
„Ben! Ben!“, wie eine schrille Alarmglocke drang Gottfrieds Stimme durch den Hörer. „Hörst du mir überhaupt zu?“
Gereizt löste Ben sich aus seiner bequemen Haltung und fasste mit seiner freien Hand in die Gardine, die er vorhin schon vom Fenster zurückgezogen hatte. Die Hand wurde zu einer Klaue und er fuhr mit den Fingernägeln an dem weißen Stoff herunter. Da sie aus Polyester bestand, war es ein unangenehmes Gefühl in den Fingerspitzen, und das Geräusch von fast zerreißendem Gewebe erschreckte ihn. Er zog seine Hand wieder zurück und steckte sie in die Hosentasche. Gerne hätte er seine Laufschuhe und seine Jacke angezogen, wäre die Treppen aus dem dritten Stock hinunter und auf einen langen Spaziergang nach draußen gegangen. Wäre unter diesem schönen Himmel spazieren gegangen, eine Stunde oder zwei Stunden, und hätte wie Hanns guck in die Luft nach oben geschaut.
„Wenn der Hanns zur Schule ging,
Stets sein Blick am Himmel hing.
Nach den Dächern, Wolken, Schwalben …“
Aber er hing an diesem verdammten Telefon, als wäre es eine verdammte Fußfessel, die ihn zwang in der Wohnung zu bleiben. Oder besser gesagt, wie eine verdammte Ohrfessel, was noch schlimmer war, denn sie transportierte Gottfrieds Stimme in sein Ohr und sein Gehirn. Diese hohe Stimme, die einem Eunuchen gehören könnte und einen wehrlosen Zuhörer mit der Zeit aggressiv machte. Da würde nur noch ein gewaltiger Stimmbruch helfen, dachte Ben. Ob Gottfried abwärts seiner Körpermitte ebenso unfertig entwickelt war?
Die Kuh hatte sich aufgelöst und der Himmel änderte seine Farbe erneut. Von orange in leuchtend rot.
Ist der Himmel rot, backen Engel ihr Brot. Der Spruch aus seiner Kinderzeit gefiel ihm, auch weil er sich reimte. Ist der Himmel rot, backen die Engel Plätzchen, hätte ihm aber noch besser gefallen, weil er als Kind Plätzchen ganz besonders liebte. Jedes Jahr vor Weihnachten hatte er sich darauf gefreut und war immer wieder entzückt über die Vielfalt des Kleingebäcks. Da gab es Engelsaugen, Vanillekipferl, Spritzgebäck, Zimtsterne, Kokosmakronen …
Ben erschrak über sich selbst. Was waren das für Gedanken! Sein Herz klopfte, als hätte er sich wieder einmal der Tür genähert, die zu öffnen ihm strengstens verboten war. Er hatte in der Vergangenheit nichts zu suchen. Diese Tür hatte verschlossen zu sein. Was fiel ihm ein, an Engel, Plätzchen und Kinderzeit zu denken. Außerdem hatten die kleinen dicken Putten, die Harfe spielend die Menschen beschützen sollten, nichts mit diesem schönen Himmelsphänomen zu tun.
Aber, so fragte er sich und kräuselte die Stirn, wie entsteht diese herrliche Pracht?
„Die rote Farbe, mein lieber Ben, entsteht durch die Streuung des Sonnenlichts“, hörte er Gottfried dozieren. Er konnte sich gar nicht daran erinnern, seine Frage laut ausgesprochen zu haben. Aber es musste wohl so sein, denn Gottfried konnte mit Sicherheit keine Gedanken lesen.
Gottfried erklärte weiter mit seiner hellen Stimme, die sich gnadenlos in jeden Gehörgang bohrte und die man nur in homöopathischen Dosen ertragen konnte: „Das Sonnenlicht scheint durch die Atmosphäre auf die Erde und es werden die einzelnen Lichtstrahlen an den Gas-, Staub- und Wasserteilchen in der Atmosphäre gestreut. Dabei spaltet sich das weiße Licht in die Regenbogenfarben auf. Die Lichtstrahlen der einzelnen Farben werden unterschiedlich stark abgelenkt. Je energiereicher das Licht, desto stärker die Ablenkung. Blaues Licht zum Beispiel ist kurzwellig und energiereich. Es wird deshalb stärker umgelenkt als das energieärmere orangefarbene und rote Licht. Bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sieht man vor allem die flachen Lichtstrahlen, die wenig abgelenkt werden – also die rötlichen. Die blauen und grünen Anteile des Lichts werden in eine ganz andere Richtung gestreut, deshalb sehen wir sie nicht.“
Angeber, dachte Ben, wie kann man nur so angeben, das ist doch kindisch. Kein erwachsener Mann benimmt sich so.
„Unser Mathe- und Physiklehrer Herr Bartlow hat uns dieses Himmelsphänomen schon in der fünften Klasse erklärt. Wir schrieben sogar eine Klassenarbeit darüber. Ich weiß nicht mehr, welche Note du bekommen hast, aber ich bekam eine Eins“, hörte er wieder Gottfried mit seiner Herr-Lehrer-ich-weiß-was-Stimme. „Erinnerst du dich noch an Herrn Bartlow? Er hatte dünne hellblonde Haare, lange Zähne und eine rosafarbene Haut. Er sah aus wie ein Nacktmull.“
„Ein was?“, fragte Ben.
„Ein Nacktmull. Das ist ein Nagetier. Ein sehr hässliches Nagetier.“
„Und es ist nackt?“
„Ja, bis auf ein paar wenige Vibrissen.“
„Ach so.“
„Vibrissen sind Sinneshaare.“
„Das weiß ich selbst“, entgegnete Ben unwirsch und unwahr. Gottfried kicherte, wohl wissend, dass Ben das Wort Vibrissen vorher noch nie gehört hatte.
Ben dachte noch, was ist das denn für ein komischer Vergleich, Herr Bartlow und ein nacktes Irgendwas, und wollte gerade diesen Gedanken aussprechen. Doch ohne auf Ben zu achten und ohne jeglichen Übergang, fragte Gottfried: „Erinnerst du dich noch an Ina?“
„An wen?“, fragte Ben gedehnt zurück.
Fragen, Fragen! Ist heute das Telefonat der Fragen? Ist Quizstunde? Und was gibt es zu gewinnen?
„Ina Franke.“
„Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten …“, sang Hape Kerkeling in Bens Kopf. In welchem Film der Komiker dieses Lied gesungen hatte, war ihm entfallen. „Das ganze Leben ist ein Quiz und wir raten, raten, raten …“
Ben wollte nur noch, dass Gottfried endlich Ruhe gab. An Herrn Bartlow würde er sich erinnern können, wenn er sich in die Vergangenheit ziehen ließe. Aber Gottfrieds Frage nach dem Lehrer war mehr eine rhetorische Frage. Auf die Frage nach Ina kam es ihm an. Das spürte Ben. Gottfried führte etwas im Schilde und Ben war mit einem Mal auf der Hut. Er ließ sich nicht zu der verbotenen Tür locken.
Ganz nebenbei hatten ihm Gottfrieds Ausführungen über die Sonnenstrahlung die Freude an dem schönen Himmel gründlich verdorben, sodass er sich vom Fenster wegdrehte und langsam in seinem Wohnzimmer auf und ab ging. Fünf Schritte in die eine Richtung. Bis zum Schrank.
Ein echter Wohnzimmerschrank in Buchedekor und sein ganzer Stolz. Er war das einzige Möbelstück, an das er sich noch aus seiner Kindheit erinnern konnte und durfte. Der Schrank gehörte wahrscheinlich seiner Mutter, an die er auch keine Erinnerung hatte. Genau wusste er nicht, ob der Schrank tatsächlich von ihr stammte, aber dass es so sein könnte, genügte ihm.
Der Schrank war klassisch aufgeteilt. Links und rechts je zwei Türen. Links unter den Türen eine TV-Nische. Rechts unter den Türen ein Barfach und eine Nische. Darunter jeweils eine Klappe. In der Mitte eine geerkerte Vitrine mit Beleuchtung. Und darunter eine Nische und drei Schubladen.
Er blieb stehen und zählte, was in der Glasvitrine stand. Vier bunte Kristallrömer, eine Bonboniere, zwei Zuckerdosen und eine Blumenvase aus weißem Porzellan. Sicherlich waren diese Gegenstände auch Andenken an sein Zuhause.
Er drehte um und machte fünf Schritte zurück bis zum Sessel. Mit seinen nackten Füßen versuchte er immer eines der Rautenmuster des Teppichbodens zu treffen, ohne über den Rand zu treten. Albern, aber was sollte er sonst tun?
Um etwas zu sagen, fragte er nochmals: „An wen soll ich mich erinnern?“
„Ina! An Ina sollst du dich erinnern!“, schrie Gottfried unvermittelt, als wäre Bens Gegenfrage An wen soll ich mich erinnern einzig und allein zu geringer Lautstärke geschuldet.
„Warum schreist du denn so, Gottfried? Ich kann dich gut hören.“ Ben musste gegen seinen Willen lachen, da sich Gottfrieds Stimme beim Schreien so schrill anhörte und dieses Lachen erinnerte Gottfried wiederum an frühere Zeiten.
Ben entschloss sich, ab sofort zuzuhören, um die Chance zu erhalten, bei passender Gelegenheit das Gespräch zu beenden.
„Weißt du noch, wie wir als Kinder über die alten Leute gelacht haben, für die das Telefon ein Novum war und die glaubten, ihre entfernten Gesprächspartner hörten sie nur, wenn sie sich die Seele aus dem Leib schrien, kannst du dich noch daran erinnern? Das war so komisch.“
„Nein. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einem alten Menschen beim Telefonieren zugesehen zu haben“, antwortete Ben. Es ermüdete ihn sukzessive und er erinnerte seinen Freund zum tausendsten Mal daran, dass er nur in der Gegenwart lebte.
„Ich weiß, ich weiß. Aber was Ina angeht, kannst du doch einmal eine Ausnahme machen. Einmal über deinen Schatten springen.“
Ich habe keinen Schatten, ich bin ein Schatten, dachte Ben und überlegte kurz, was Gottfried wohl dazu sagen würde, wenn er das gehört hätte. Aber Gottfried hörte nichts, zum einen, weil Ben es nicht ausgesprochen hatte, zum zweiten, weil er keine Gedanken lesen konnte und zum dritten, weil er immer noch mit Ina beschäftigt war.
„Ich muss es wissen, Benny-Boy. Ich muss wissen, ob du dich noch an sie erinnerst.“
Ben schwieg. Was sollte er auch erwidern.
„Das ganze Leben ist ein Quiz“, sang er so falsch, dass die Melodie nicht zu erkennen war.
„Erinnerst du dich noch an Ina?“, hakte Gottfried nach, der Bens Gesang nicht hören wollte.
„Kein Pardon!“, rief Ben aus.
„Wie bitte?“
„Kein Pardon. So hieß der Film, in dem Hape Kerkeling das Lied Das ganze Leben ist ein Quiz singt. Der Mann mit dem Bembel spielte auch mit.“
„Wer?“
„Der Mann mit dem Bembel, der Hesse vom Blauen Bock. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen.“
„Es geht um Ina. Nur um Ina.“
Gottfrieds Stimme war jetzt so leise, dass sie sich wie die Stimme eines Kindes anhörte. Und Ben dachte zum wiederholten Male bei diesem Telefonat und zum zig-tausendsten Mal in seinem Leben, dass Gottfried ihm auf die Nerven ging. So sehr auf die Nerven ging, dass er ihn am liebsten erwürgt hätte.
In diesem Gespräch sollte es doch eigentlich nur um das jährliche Gruppentreffen der Cleveren 5 gehen, an das Ben jedes Jahr extra erinnert werden musste. Das war so und jedes Jahr übernahm einer aus der Gruppe die Aufgabe, Ben daran zu erinnern, und in diesem war die Aufgabe leider Gottes Gottfried zugefallen, der es liebte weit auszuschweifen.
Jasmin, Max und Wolfgang waren stets knapp angebunden am Telefon. Ort, Zeit und die Aufforderung zu kommen reichten den Dreien. Manch einer hätte das für unhöflich gehalten. Ben wollte es so und nicht anders. Bei dem jährlichen Treffen wurde immer genug geredet. Mehr als genug für seine Begriffe.
Der Ort ihrer Treffen war immer derselbe. Eine Holzhütte mit gemütlicher Wohnküche und Schlafmöglichkeiten für mindestens fünf Personen. Sie lag einsam im ohnehin dünn besiedelten Nordpfälzer Bergland, im Volksmund auch Alte Welt genannt, genau zwischen den Orten Nußbach und Obermoschel. Die Hütte gehörte Jasmin, dem einzigen weiblichen Mitglied der Cleveren 5.
Sie hatte sie von ihrem vier Jahre älteren Cousin Heiner Baumann geschenkt bekommen. Baumann besaß in Kaiserslautern eine Schreinerei und da er selbstredend sehr gut mit Holz umgehen konnte, hatte er die Hütte mit eigenen Händen erbaut. Heiner Baumann war ein fleißiger Mann, ein richtiger Schaffer. Ganz im Gegenteil zu mir, gestand sich Ben ein und auch ganz im Gegenteil zum übrigen Rest der Cleveren 5.
Im Laufe der Jahre expandierte Baumanns Schreinerei zu einer mittelständigen Firma und Baumann hatte immer weniger Zeit die Hütte aufzusuchen. Baumann selbst war kinderlos und seine Frau hatte kein Interesse an der Hütte und wenn man Gerüchten glauben durfte, auch nicht mehr an ihm. Wie Frau Baumann hieß, ob sie noch lebte oder tot war, wusste Ben nicht oder besser gesagt, er wusste es nicht mehr. Es war bestimmt so, dass Jasmin ihm irgendwann davon erzählt und er es vergessen hatte. Es spielte auch keine Rolle mehr.
Jedenfalls war es ein Glücksfall für Jasmin. Sie bekam schon zu Baumanns Lebzeiten, als nächste Angehörige, die Hütte geschenkt. Doch anders als ihr Cousin, der seinerzeit jedes Wochenende in der Abgeschiedenheit der Alten Welt verbracht hatte, nutzte Jasmin die Hütte nur einmal im Jahr für das Treffen der Cleveren 5.
Wenn Ben ehrlich war, mochte er die Hütte, aber nicht die Treffen. Wenn er noch ehrlicher war, mochte er nicht einmal die Cleveren 5.
Wie Gottfried war, konnte er gerade wieder erleben. Er war ein Angeber, der sich für einen Gelehrten hielt. Dieser nur gerade einmal 1, 65 große Wicht hielt sich für sehr schlau und demonstrierte dies gerne schulmeisterhaft. Ben sah ihn vor sich, wie er bei jedem Wort, das er aussprach und für bedeutend hielt, auf den Zehenspitzen wippte.
Jasmin war oberflächlich und neigte zu einem Dünkel, der vollkommen unberechtigt war. Denn sie war nicht schön, nicht einmal im weitesten Sinne attraktiv. Sie war zu lang und zu dünn. Ben schätzte ihre Größe auf über 1,80 und sie wog bestimmt nicht mehr als 50 Kilogramm.
Wenn man sie umarmte, was Ben nur bei der Begrüßung und beim Abschied notgedrungen tun musste, hatte er immer das Gefühl, ein Skelett zu berühren. Und wenn bei einer solchen Umarmung auch noch ihre langen stumpfschwarzen Haare sein Gesicht streiften, hätte er jedes Mal vor lauter Abscheu schreien können.
Ihre Hände waren knochig mit dicken Knöcheln, als würde sie unter Gicht leiden. Ihre Schneidezähne standen zu weit auseinander, dafür standen ihre Augen zu weit beieinander. Und schwarz waren sie, diese Augen, schwarz wie Kohle. Man konnte sie nicht lange ansehen, ohne dass es einem bange wurde.
Max und Wolfgang waren Zwillinge und sie waren sich in ihrer Unauffälligkeit und Fadheit so ähnlich, dass man sie nicht nur auf den ersten Blick verwechseln konnte. Man sollte ihnen Schildchen mit ihren Namen an die Brust heften, überlegte Ben und kicherte bei dem Gedanken.
Max und Wolfgangs Haare waren mausbraun oder grau oder etwas Undefinierbares dazwischen. Die beiden Männer waren unattraktiv und mittelmäßig. Nicht zu groß, nicht zu klein. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Wenn Ben sich richtig erinnerte, trugen die beide immer Stoffhosen und einen beigen oder braunen Pullunder über einem karierten Hemd. In ihren Truthahnhälsen hüpfte ein Adamsapfel beim Sprechen dermaßen heftig auf und ab, dass man ihren Worten nicht mehr zuhören konnte, sondern nur ihre Hälse anstarren musste.
Das waren die Cleveren 5. Was war das überhaupt für ein lächerlicher Name? Sollte die Namenswahl implizieren, dass sie fünf clevere Menschen waren? Er war es nicht. Aus ihm war nichts Cleveres geworden. Er hatte auch nie den Ehrgeiz dazu. Ob die vier Anderen Ehrgeiz hatten, aber am eigenen Unvermögen gescheitert waren, konnte er nicht sagen. Auf jeden Fall waren auch sie nicht herausragend in irgendeiner Art und Weise.
Oder war der Name ironisch gemeint und der Erfinder des Namens machte sich über sie lustig? So wird es gewesen sein und Ben fragte sich, warum ausgerechnet er Teil dieser Gruppe geworden war. So dumm war er nun auch wieder nicht. Er war speziell, aber nicht dumm!
Wer hatte die Gruppe gegründet? Max und Wolfgang waren es bestimmt nicht. Und er selbst natürlich auch nicht. Blieben nur Jasmin und Gottfried.
Und wenn er schon dabei war, über die Gruppe nachzudenken, stellte er sich auch die Frage, wer ihn überhaupt ausgewählt hat. Er war schon als Kind nicht einer, mit dem die anderen gerne befreundet waren. War es Jasmin, die ihn in der Gruppe haben wollte? Wohl kaum. Jasmin mochte keine dicken Männer und machte sich auch immer lustig über ihn. Benjamin Blümchen hatte sie ihn hinter seinem Rücken genannt und geglaubt, er merke es nicht.
Warum war er all die Jahre an diese Gruppe gebunden und nahm jedes Jahr an dem Treffen teil? Er wusste es nicht, aber es interessierte ihn plötzlich. Das hieße jedoch, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sich in die Vergangenheit hineinsaugen zu lassen, wie ein unbedarfter Wanderer, der in einer Moorlandschaft den festen Boden unter den Füßen verliert und langsam aber unaufhaltsam im schmatzenden, schwarzen Schlamm versinkt. Der Gedanke war schrecklich und es schüttelte ihn.
Wie dem auch sei, es gab die Hütte und sie war jedes Jahr der Treffpunkt, nur das Datum des Treffens änderte sich jeweils um ein paar Tage hin oder her – hatte jedoch seinen festen Platz im April. Zur Erinnerung daran, dass sie in jenem Monat die Schule mit der Mittleren Reife in der Tasche verließen und von Tag an getrennte Wege gingen.
„Ina“, hörte Ben Gottfrieds jetzt auch noch leicht zischende Stimme wieder in seinem Ohr und eine Gänsehaut überlief ihn.
Gottfried hatte die ganz Zeit, während Ben in Gedanken mit den Cleveren 5 beschäftigt war, geredet und geredet, wieder ohne zu bemerken, dass er gar keinen Zuhörer hatte. Aber mit der Zeit fiel es ihm auf. „Warum gibst du denn keine Antwort? Wo bist du denn mit deinen Gedanken?“
„Warum fragst du mich so etwas! Ina? Also gut, damit du Ruhe gibst: Ich kann mich dunkel an sie erinnern. Sie hatte vor vielen Jahren einen Unfall und starb. Wie alt war sie damals? Elf oder zwölf?“, entgegnete er unbehaglich. Mit einem Mal wurden seine Wangen heiß und sein Mund trocken.
„Fast richtig, Ben. Du wirst immer besser im Erinnern. Sie war dreizehn.“
„So? Schon dreizehn?“
Gottfried lachte auf. „Schon ist gut. Wirklich gut. Dreizehn ist doch kein Alter um zu sterben.“
„Das habe ich auch nicht gesagt!“, protestierte Ben.
„Du drückst dich eben immer so missverständlich aus. Außerdem hatte sie keinen Unfall, sie wurde ermordet.“
„Ermordet“, wiederholte Ben emotionslos. Er war weder geschockt noch erschrocken.
„Sie war bei uns in der Klasse und saß direkt hinter dir, Ben. Sie war hübsch. Sie hatte lange, braune Haare, die glänzten wie Kastanien in der Sonne. Und braune Augen hatte sie, braune Augen wie ein Reh.“ Gottfried schwärmte und schwelte in Erinnerung. „Sie hatte eine wunderschöne Schrift. Keine in unserer Klasse konnte so schön schreiben. Ihre Buchstaben sahen aus wie gemalt. Hast du jemals von ihr einen Liebesbrief erhalten?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Ich auch nicht“, gestand Gottfried. „Aber ich kann mir vorstellen, dass es schön gewesen wäre, von ihr einen Liebesbrief zu erhalten. Einen mit gemalten Herzchen und einem Kussmund neben dem Namen. Ich kann mir bildhaft vorstellen, wie sie ihre Lippen anmalt und sie dann auf das Briefpapier drückt.“
„Ich muss etwas Kaltes trinken“, sagte Ben und setzte sich in seinen Fernsehsessel, dessen Sitzfläche schon eine tiefe Kuhle hatte, die genau dem Umfang von Bens Hinterteil entsprach.
Umständlich fuselte er die Pantoffeln, die unter seinem Couchtisch lagen, hervor, schlüpfte hinein und stand wieder auf. In den zu großen Latschen schwamm er regelrecht hin und her und musste aufpassen, nicht über seine eigenen Füße zu stolpern. Aber da die Küche im Gegensatz zum Wohnzimmer nicht mit einem Teppichboden, sondern nur mit grauem Linoleum ausgelegt war, war es ihm immer noch lieber, mit den zu großen Pantoffeln als barfuß hineinzugehen.
Noch immer hielt er das Telefon ans Ohr. Er hörte seinen Freund Gottfried am anderen Ende, doch war er sich nicht sicher, ob dieser nur merkwürdig atmete oder noch immer den Namen Ina zischte, den Namen Ina flüsterte oder was auch immer.
Er öffnete den Kühlschrank, der mit Wurst, Käse und mehreren Päckchen magerem Frühlingsquark gut gefüllt war und überlegte, was wohl seinen Durst am besten stillen könnte. Eine angebrochene Packung H-Milch stand zwischen einer Flasche Ketchup und einer Flasche Kirschlikör in der Kühlschranktür. Um die Öffnung herum war die Milchpackung schon angetrocknet. Er würde sie wegwerfen müssen. Er entschied sich für die Bio-Limonade mit Orangengeschmack, die er gestern im Supermarkt während einer Produktverkostung geschenkt bekommen hatte und die auf der untersten Ablage direkt über dem Gemüsefach lag.
Eine junge Frau hatte an einem Stand die Sorten Holunder, Himbeer-Pflaume, Ingwer-Orange, Zitrone-Bergamotte, Litschi und Schwarze Johannisbeere-Rosmarin angeboten. Sie hatte ein schwarzes Top mit einem tiefen Ausschnitt getragen. Eine silberne Kette mit einem kreisrunden, ungefähr 50-Cent-großen Anhänger hing um ihren Hals. In diesem Kreis befand sich ein Lebensbaum mit kleinen weißen Perlchen an den Ästen, die wohl Früchte darstellen sollten. Der Anhänger war fast zwischen ihren Brüsten verschwunden.
Hätte sie nicht eine kürzere Kette tragen können, die einen nicht gezwungen hätte tief in ihren Ausschnitt zu schauen?
Ben wurde es schwindelig bei dem Gedanken an sie und er spürte wieder ihre Fingerspitzen an seiner Hand, als sie ihm die Flasche mit dem Ingwer-Orangengeschmack über den Tresen reichte. Er rieb die Hand an seinem Hemd von der Erinnerung frei und fasste beherzt nach der Flasche im Kühlschrank. An gestern konnte er doch denken, gestern gehörte ein wenig noch zur Gegenwart. Das erlaubte er sich, diese Freiheit nahm er sich.
Die Dauer der Gegenwart soll angeblich 2,7 Sekunden betragen, aber das schien doch wohl etwas zu knapp bemessen, das konnte niemand von ihm verlangen. Wäre es so, müsste er ja selbst den Himmel, den er eben noch betrachtet hatte, ebenso wie den Mann mit dem Hut, den Hasen, den Affen und das Himmelbett vergessen.
Kaum hatte er die Flasche in der Hand, hörte er Gottfrieds Stimme, so klar und laut, als stünde dieser direkt neben ihm und er spürte auch dessen Atem an seinem Ohr: „Wir alle sollten uns an sie erinnern. Einer von uns hat sie doch umgebracht!“
Was geschah denn hier mit ihm? Die Luft begann zu vibrieren. Plötzlich wirbelten Zettel um ihn herum und auf jedem stand ein Wort: Ina, Mord, Nacht, Messer, Blut, Limonadenflasche, Ausschnitt, Finger, Hand.
Und es roch eindeutig nach einem Hustenbonbon mit Eukalyptusöl und Spitzwegerich. Genau die Art Bonbon, die sich Gottfried immer in den Mund steckte, wenn er mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprach. Gottfried hatte immer panische Angst davor, dass seine Gesprächspartner denken könnten, er hätte Mundgeruch.
Ben ließ vor Schreck die Flasche fallen, die auf dem Fliesenboden mit einem lauten Knall in tausend Stücke zerbarst und mit ihm lösten sich die Zettel in Nichts auf. Das süße Getränk war nur noch Schaum und umwölkte die Glassplitter und seine Pantoffeln wie Seifenlauge. Nach Bio sah das nicht mehr aus.
Ben umklammerte das Telefon mit beiden Händen, als wolle er es erwürgen.
Warum nahm das Telefonat mit Gottfried gerade an diesem Abend eine so absurde, mehr noch eine regelrecht gefährliche Wendung?
„Was ist denn passiert?“, frage Gottfried besorgt. „Bist du in Ordnung, Ben? Das hörte sich an wie eine Explosion.“
„Nein hier ist nichts explodiert! Ich habe nur eine Limonadenflasche fallen lassen!“
„Limonade?“, fragte Gottfried mit einer leicht anklagenden Stimme und Ben verstand den Subtext: Limonade ist nichts für Menschen mit Gewichtsproblemen.
„Wegen dir habe ich sie fallen lassen! Wegen deines penetranten Geschwätzes! Du hast mich erschreckt!“
„So? Nun ja. Pass auf mit den Scherben. Bist du barfuß?“
„Nein.“
„Schneide dir nicht in die Füße. Das kann sehr schmerzhaft sein. Und die kleinen Scherben musst du dir dann mit der Pinzette aus den Fußsohlen ziehen.“
„Ich bin nicht barfuß, ich trage Pantoffeln.“
„Ein Glück.“
„Glück? Wie man’s nimmt. Meine Pantoffeln sind jetzt nass und klebrig. Ich werde sie wohl wegwerfen müssen. Hast du gerade eines von deinen Hustenbonbons im Mund?“
„Ja.“ Zum Beweis, dass es so war, schmatzte Gottfried ein paarmal laut, dann sprach er weiter: „Übrigens erinnerst du dich, als Ina einmal mit ihren Rollschuhen die Kapellallee hinuntergefahren ist und mit beiden Armen ruderte, weil sie dachte, dann würde sie schneller werden? Das T-Shirt ist ihr dabei bis über den Bauchnabel hochgerutscht.“ Gottfried stöhnte genüsslich und fügte mit harter Stimme hinzu: „Und kurz danach, genau gesagt zwei Tage später, hat sie jemand von uns umgebracht.“
„Wen meinst du mit uns?“
„Uns, die Cleveren 5. Einer von den Cleveren 5 hat sie umgebracht.“
„Wer soll denn das gewesen sein. Ich war es nicht!“
„Ich war es nicht, hast du immer als Erster geschrien, wenn irgendein Kind etwas angestellt und Herr Bartlow gefragt hat, wer es war. Auch wenn es eindeutig war, dass du es nicht hast sein können, hast du geschrien …“
„Ist ja gut, Gottfried, ich habe verstanden.“
„Mein Gott, warst du ein Hosenschisser. Ich war es nicht“, äffte Gottfried Ben zum Schluss noch nach und dieser fragte sich, ob seine Stimme wirklich so schrecklich klang, wie Gottfried sie gerade imitiert hatte.
„Es gab doch überhaupt kein Motiv für einen von uns. Keiner hatte Streit mit ihr.“
„Es war aber einer von uns.“
„Kinder begehen keine Morde. Das war ein Erwachsener. Hat man damals nicht einen Nachbarn verdächtigt? Oder war es der Onkel?“
„Es ist schön, dass deine Erinnerung wachgerufen werden kann und nicht gänzlich verloren ist. Siehst du, du musstest dir nur ein bisschen Mühe geben, Ben. Es sind nicht nur der Nachbar und der Onkel verdächtigt worden. Auch der Hausmeister und der Busfahrer, der Bäcker, bei dem wir immer Brötchen und Brezeln gekauft haben und natürlich sämtliche Lehrer. Besonders auf dem Kieker hatte die Polizei unseren Sportlehrer. Erinnerst du dich an ihn? Er hat den Mädchen immer so gerne Hilfestellung beim Geräteturnen gegeben.“
„Das kannst du doch gar nicht wissen. Wir Jungs hatten doch getrennt von den Mädchen Sportunterricht.“
„Jasmin hat es mir erzählt.“
„Ach die. Was weiß die denn?“
„Vielleicht mehr, als du denkst.“
„Ist sie auch der Meinung, dass einer von den …“ er brachte die Worte kaum über die Lippen, „Cleveren 5 sie umgebracht hat?“
„Weiß ich nicht. Ich habe bisher nur mit dir darüber gesprochen.“
„Und warum ausgerechnet mit mir?“
„Weil du die schwerste Nuss zum Knacken bist. Du bist die Macadamia-Nuss unter den Nüssen. Du mit deinem Nur-in-der Gegenwart-leben-Fimmel.“
„Das habe ich mir nicht ausgesucht. Es muss so sein. Es ist …“ Er überlegte, „… mir gegeben.“
„Ja, ja, Ben. Gib deinem Knall ruhig eine metaphysische Bedeutung, wenn es dir damit besser geht.“
„Dass Ina von einem von uns umgebracht wurde, behauptest du doch nur. Dafür hast du keinerlei Beweise. Du willst dich nur wichtigmachen, Gottfried.“
„Vielleicht ja, vielleicht nein.“
„Was heißt das schon wieder. Du willst dich wichtigmachen oder nicht wichtigmachen? Du machst mich vollkommen irre!“
Gottfried lachte zufrieden. „Vielleicht ja, vielleicht nein bezog sich auf die Beweise. Vielleicht habe ich Beweise, vielleicht nicht. Wenn ich welche habe, und davon kannst du ausgehen Benny-Boy, präsentiere ich sie bei unserem Treffen in der Hütte.“
Ben kickte seine Pantoffeln in die Ecke, ging zurück ins Wohnzimmer und trocknete seine Füße auf dem Teppich ab. Seinem rotgrünen Teppich mit dem dunkelbraunen Rautenmuster machte das nichts aus. Jetzt müsste ich aber den klebrigen Küchenboden aufwischen, dachte er und wünschte sich, dass Gottfried endlich aufhören würde zu reden.
„Was redest du denn da überhaupt, Gottfried? Das ist doch Unsinn! Wie kommst du denn darauf, dass einer von uns Ina umgebracht hat? Du willst mich verrückt machen, stimmt’s?“
„Vielleicht habe ich etwas gesehen“, stellte Gottfried zufrieden fest. Seine Penetranz hatte sich also ausgezahlt und er atmete zufrieden auf. In diesem Moment hasste Ben ihn wie noch nie in seinem Leben.
Gottfried war sein Freund und das würde auch so bleiben, musste wohl so bleiben. Aber trotzdem hasste er ihn in diesem Moment. Warum spielte sich dieser kleine Wicht mit der schrecklichen Stimme immer als Chronist der Gruppe auf. Wie ein Terrier war er. Ein aufdringlicher, kleiner Terrier, der sich in die Wade verbiss und nicht mehr losließ.
„Wir waren doch noch Kinder“, sagte Ben und seine Stimme klang quengelig. Er erschrak darüber und es ärgerte ihn, denn er war drauf und dran seine Fassung zu verlieren und das durfte nie geschehen.
„Und wenn schon? Ist das etwa eine Entschuldigung?“ Gottfrieds Stimme wurde hart. Und hämisch nachäffend fügte er noch hinzu: „Ich war es nicht.“
„Nein, es besteht keinerlei Veranlassung, dass ich mich entschuldigen müsste. Ich habe nur ganz allgemein gesprochen. Und außerdem finde ich es ungeheuerlich, dass du nach all den Jahren mit einem so schwerwiegenden Vorwurf um die Ecke kommst! Ich will jetzt nicht mehr darüber reden! Aus! Fertig! Vorbei! Und ich war es wirklich nicht und die anderen gehen mich nichts an.“
Die Gegenwart war sein Zuhause und nicht die Vergangenheit mit ihren Geschehnissen, die mit jedem Tag mehr wurden. Die Vergangenheit mästete sich an der Gegenwart, verschluckte sie und wuchs stetig an wie ein bösartiger Tumor. Die Gegenwart hingegen erschuf sich immer neu, war rein und unschuldig, wie eine zarte kleine Blüte. Oder wie die Haut eines Mädchens.
Ben öffnete seine Hand und betrachtete sie, als läge etwas Unschuldiges, Beschützenswertes darin.
„Trotzdem. Wir müssen mit den anderen darüber reden. Wir müssen“, Gottfried war nicht zu bremsen, „wir müssen darüber reden.“
„Aber das haben wir doch gerade. Und jetzt will ich nicht mehr“, sagte Ben, einfach nur um etwas zu sagen und Gottfried nicht misstrauisch werden zu lassen.
„Wir werden darüber reden, wenn wir uns alle treffen.“
„Gottfried, tue, was du nicht lassen kannst. Mir ist es gleich. Ich habe damit nichts zu tun. Bis dann. Auf Wiederhören.“
Ben legte auf ohne auf Gottfrieds Erwiderung zu warten. Er hatte keine Lust mehr zu reden.
- III -
Kaum hatte Ben das Gespräch weggedrückt, fiel ihm ein, dass Gottfried ihm das Datum ihres Treffens gar nicht mitgeteilt hatte. Dabei war das doch der Grund seines Anrufs.
„Was soll’s. Dann gehe ich auch nicht hin“, murmelte Ben gleichmütig und legte das Telefon auf sein Bücherregal, in dem die gesammelten Werke von Karl May und Enid Blyton standen. So gerne er einmal im Jahr die Hütte wiedersah, so ungern würde er es dieses Mal tun. Gottfrieds Drohung, über Ina und den Mord an ihr reden zu wollen, schreckte ihn ab.
Er tappte weiter in die Küche, um die Limonade vom Boden aufzuwischen, bevor er noch klebriger werden würde, und vor allem um die Scherben aufzukehren.
Er durchquerte die Küche auf Zehenspitzen, um nicht in Glassplitter zu treten und keine klebrigen Füße zu bekommen. Er öffnete die Tür zur Abstellkammer, in der neben Putzutensilien auch seine Waschmaschine, ein Bügelbrett und andere Haushaltshelfer untergebracht waren. War seine Wohnung heimelig und wohnlich mit allerlei Krimskrams und Nippes eingerichtet, so war die Abstellkammer einzig nützlich ausgestattet, wie es sich eben für eine Abstellkammer gehörte. Eine nackte Glühbirne hing an der Decke. Er knipste sie an. Auf den Regalen standen leere und volle Flaschen, Konservenbüchsen mit Gemüse, Suppen und Tomatensoße als Inhalt, Päckchen mit Nudeln in allen Formen, von Spaghetti bis Rigatoni, und Päckchen mit Reis.
Ben wollte gerade nach dem Wischmopp in der Ecke greifen und überlegte, was wohl die Mehrzahl von Wischmopp wäre, da stutzte er. Etwas lag auf dem obersten Regal. Etwas, das da nicht hingehörte. Er schob zwei Konservenbüchsen mit Bohneneintopf zur Seite. Eine braune Mappe lag dahinter. Eine Schulmappe, wie auch er sie als Schüler benutzt hatte.
Wie kommt denn meine Schulmappe hierher, dachte er und zog sie ein Stückchen vor. Er fuhr mit der Hand über das Leder. Es war weich und er spürte die vertrauten Maserungen unter seinen Fingern. Plötzlich war da etwas Fremdes. Er zog die Mappe vom Regal, nahm sie in die Hand und betrachtete sie. Zu seinem großen Erstaunen sah er einen herzförmigen Aufkleber mit einem Kussmund auf dem dunkelbraunen Leder. Das war ganz und gar nicht seine Schulmappe. Das war die Mappe eines Mädchens. Nur Mädchen beklebten ihre Schulmappen mit solchen Aufklebern. Er trug sie in die Küche und legte sie auf den Tisch. Der klebrige Küchenboden war ihm jetzt egal. Er setzte sich auf einen Stuhl und öffnete die Mappe. Er glaubte einen Hauch blumigen Parfums zu riechen und hielt die Mappe dicht an seine Nase. In dem Moment, als er den Duft erfassen und ihm nachschnüffeln wollte, verschwand er ohne die geringste Spur zu hinterlassen. War es Janine D. oder My Melody? Beide Marken gehörten damals bei den Mädchen zu den beliebtesten Parfums. Damals, als Ina noch lebte.
„Hallo Janine D., du bist wie die Mädchen von heute …“, hörte er wieder die Melodie des Werbespots, der in jenen Tagen so oft im Fernsehen zu sehen war. Ein Spot, in dem ein junges Mädchen glücklich und selbstverliebt durch die Straßen lief und fest daran glaubte, dass ihm nichts und niemand etwas anhaben konnte.
„Warum erinnere ich mich an diese Mädchenparfums?“ Ben schüttelte den Kopf. Was hatte Gottfried mit seiner Fragerei nach der Vergangenheit nur angestellt! So penetrant wie heute war er noch nie.
Ben nahm ein Schulheft in DIN A4-Format heraus und las die Worte, die auf dem Deckel standen. In Schönschrift war das Wort Mathematik zu lesen, und darunter der Name Ina Franke, verziert mit aufgemalten rosafarbenen Herzchen.
Er konnte nicht fassen, was er sah. Er zog ein weiteres Heft heraus. Auf dessen Deckel war nichts zu lesen. Ben atmete schon erleichtert auf, doch als er die erste Seite aufschlug, stand quer über der Seite Englische Grammatik, Ina Franke, diesmal verziert mit aufgemalten pinkfarbenen Herzchen und einem leicht verschmierten Kussmund.
Sein Herz schlug wie wild. Er spürte, dass sein Penis härter und größer wurde. Er wusste nicht warum er das tat, aber er sah sich verstohlen in seiner Küche um, ob niemand ihn beobachtete. Dann beugte er sich zu dem Schulheft und drückte seine Lippen auf den aufgemalten Kussmund.
Seine Erregung verschwand so schnell, wie sie gekommen war, als er auf seinen Lippen klebrige Krümel spürte, die nicht von einem Lippenstift stammen konnten, dafür schmeckten sie zu süß. Ohne dass er etwas dagegen tun konnte, tauchte Inas Bild vor ihm auf. Sie biss in ein Brötchen, belegt mit einem – wie es damals noch hieß – Mohrenkopf. Der Eiweißschaum klebte Brötchenkrümel an ihre rot geschminkten Lippen.
Ben schüttelte sich und rieb sich mit dem Handrücken den Mund ab.
Hastig leerte er den gesamten Inhalt der Schulmappe auf dem Tisch aus. Mit einer Mischung aus Unverständnis und Neugierde befingerte er jeden einzelnen Gegenstand. Die Schulbücher für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Er öffnete jedes einzelne und las immer wieder den Namen Ina Franke. Die Hefte in DIN A4 und DIN A5-Format – Ina Franke, Ina Franke!
Er öffnete das pinkfarbene Schulmäppchen und leerte auch dessen Inhalt auf den Küchentisch. Er sah den Füllfederhalter der Marke Pelikan, mehrere Bleistifte und einen zweifarbigen Radiergummi. Den roten Teil nahm man zum Ausradieren von Bleistiftstrichen, der blaue entfernte mehr schlecht als recht Tinte. Er nahm den Radiergummi vorsichtig zwischen die Finger und betrachtete ihn genau.