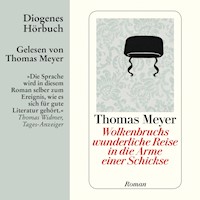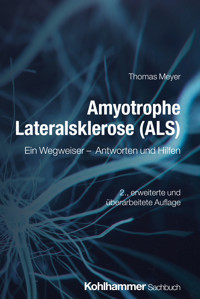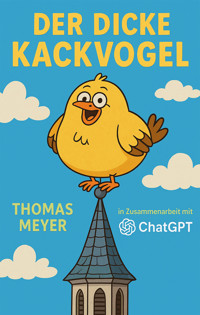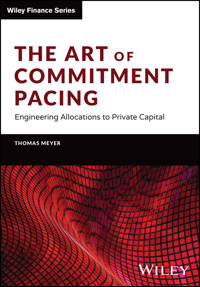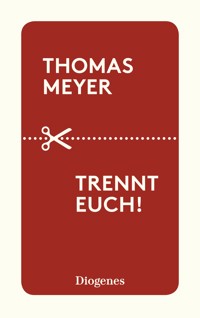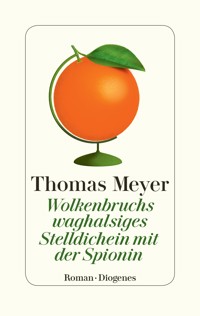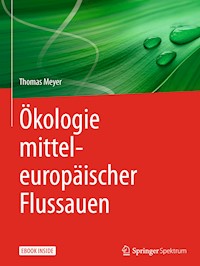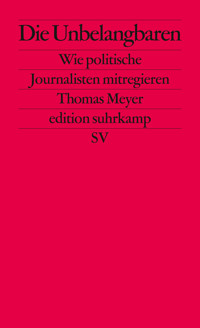
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Eine solche Jagd hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bis dato nicht gegeben.« Mit diesen Worten beschrieb Heribert Prantl die Berichterstattung in der Affäre um Christian Wulff. Wie kaum ein anderes Ereignis in den vergangenen Jahren hat uns die Causa Wulff das spannungsreiche Verhältnis von Presse und Politik vor Augen geführt. Ein spektakulärer Fall. Aber nicht der erste und sicher nicht der letzte seiner Art, denn Journalisten, so die These von Thomas Meyer, nutzen ihre Position immer häufiger, um in der politischen Arena mitzumischen. Eine problematische Entwicklung, schließlich können wir Fernseh- und Zeitungsmacher, anders als Politiker, nicht einfach abwählen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
»Eine solche Jagd hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bis dato nicht gegeben.« Mit diesen Worten beschrieb Heribert Prantl die Berichterstattung in der Affäre um Christian Wulff. Wie kaum ein anderes Ereignis in den vergangenen Jahren hat uns die Causa Wulff das spannungsreiche Verhältnis von Presse und Politik vor Augen geführt. Ein spektakulärer Fall. Aber nicht der erste und sicher nicht der letzte seiner Art, denn Journalisten, so die These von Thomas Meyer, nutzen ihre Position immer häufiger, um in der politischen Arena mitzumischen. Eine problematische Entwicklung, schließlich können wir Fernseh- und Zeitungsmacher, anders als Politiker, nicht einfach abwählen.
Thomas Meyer, geboren 1943, ist Prof. em. für Politikwissenschaft an der TU Dortmund; er ist Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte. In der edition suhrkamp erschien 2001 sein vieldiskutiertes Buch Mediokratie. Die Kolonisierung der Politik durch die Medien
Thomas Meyer
Die Unbelangbaren
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2692.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-74083-5
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Ein demokratisches Paradox
1. Immun gegen Selbstkritik
2. Grenzgänger und Grenzverletzer: Sechs Episoden
3. Die Logik der Massenmedien
4. Eine antagonistische Symbiose
5. Verführung als System
6. Die Macht des Einflusses
7. Journalistische Selbstbilder
8. Meute, Mainstream und Hierarchen
9. Die politische Ökonomie des Rechtbehaltens
10. Die Rückseite des Spiegels
11. Die Kultur des letzten Wortes
12. Wechselnde Aggregatzustände
13. Eine Art Journalistendemokratie
14. Hoffnung Netz
Eine Trendumkehr tut not
Vorwort
Die Unbelangbarkeit der Einflussjournalisten sowie die Folgen, die sich daraus für die Demokratie ergeben, wären möglicherweise längst in aller Munde (vor allem innerhalb jener Gruppe, um die es hier geht: die der politisch einflussreichen Journalisten), hätte ein unerwartetes Ereignis die sich anbahnende Diskussion nicht im Keim erstickt. Im März 2014 meldete sich Frank Schirrmacher, selbst ein Alphajournalist ersten Ranges, dem es immer wieder gelang, zielsicher Themen aufzuspüren und sie mit großer Durchschlagskraft auf die Agenda zu setzen, mit der schonungslosen Analyse eines Phänomens zu Wort, das er als wachsende Tendenz zum »journalistischen Übermenschentum« bezeichnete.[1] Leider beendete Schirrmachers früher Tod die Debatte, bevor sie wirklich beginnen und die Republik in ihren Bann ziehen konnte. Der Artikel, in dem diese beißende und alarmierende Formulierung fällt, befasst sich am Beispiel eines Interviews, das einer der bekanntesten Nachrichtenmoderatoren im heute journal des ZDF mit Joe Kaeser, dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens geführt hat, mit der Neigung maßgeblicher Großjournalisten, ihr Publikationsprivileg zu missbrauchen, um selbst im politischen Prozess mitzumischen, ja, um mitzuregieren, anstatt sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die ihnen in demokratischen Gemeinwesen zukommen: die treuhänderische Information über das politische Geschehen sowie die Orientierung durch Kommentare, die sachlich formuliert und als Meinungsäußerungen gekennzeichnet sein müssen.
In seinem Artikel hat Schirrmacher zwei manifeste Probleme des politischen Journalismus auf informative Weise in ein kausales Verhältnis zueinander gesetzt: zum einen die zunehmende Bereitschaft der Medienleute, per Selbstermächtigung im politischen Betrieb mitzumischen und sich zu politischen Großinquisitoren aufzuschwingen, wenn sich damit ein publikumsträchtiges »Remmidemmi« (Schirrmacher) auslösen lässt; zum anderen die objektiven Produktionsbedingungen in einer Branche, in welcher der permanente Echtzeitdruck dazu führt, dass eine auf Eskalation zielende Dramatisierung immer weniger Raum lässt für Distanz, genaue Prüfung und kritische Selbstreflexion. Schirrmacher arbeitet am konkreten Beispiel des Gesprächs zwischen dem Nachrichtenmoderator und Joe Kaeser, der im Frühjahr 2014 während der Ukrainekrise nach Russland gereist war, heraus, mit welcher Rücksichtslosigkeit ein anderer Alphajournalist sich hier live und vor einem Millionenpublikum die Freiheit nahm, mit allen Regeln der verantwortlichen Informationsvermittlung zu brechen und mit einem inquisitorischen Verhör selbst Politik zu machen. Dieser Polit-Journalist habe sich, so Schirrmacher, angemaßt, »der deutschen Wirtschaft die rote Linie« aufzuzeigen, indem er mit überlegener kommunikativer Cleverness dekretierte, welche Politik gegenüber Russland moralisch erlaubt und welche verboten sei, welcher Akteur noch mit demokratischer Anerkennung rechnen dürfe und wer an den großen öffentlichen Pranger der Nation gehöre.
Dieser Zusammenhang zwischen Produktionsbedingungen und professionellem Selbstverständnis, besonders aber die im Hinblick auf die Bedingungen demokratischer Medienkommunikation mittlerweile destruktive Selbstüberschätzung eines maßgeblichen Teils der politischen Journalisten sind die Themen des vorliegenden Essays – wobei der Autor sich schon an dieser Stelle vor der Handvoll Journalisten verbeugen möchte, die die Grenzen nach wie vor wahren, die im Text selbst aber ebensowenig namentlich aufgelistet werden sollen wie (bis auf wenige Ausnahmen) die exemplarischen Grenzverletzer. Interessanter als individuelle Akteure sind ohnehin ihre Texte sowie die Strukturen, die das von Schirrmacher gegeißelte »journalistische Übermenschentum« möglich gemacht haben und allmählich zur Gewohnheit werden lassen. Dabei handelt es sich vor allem um das enge Zusammenwirken von drei Faktoren: der von der wachsenden Konkurrenz forcierten, an Aufmerksamkeitsmaximierung orientierten Medienlogik; des strukturellen Veröffentlichungsmonopols der Schlüsseljournalisten; und der zunehmenden (auch als »Mainstreaming« bezeichneten) Homogenisierung des journalistischen Feldes infolge der Konzentration und Flexibilisierung des Medienmarkts.
Schon die wissenschaftlich gut untersuchte Ausgangslage erscheint paradox, da die Produktionsgesetze der Massenmedien und die Logik der demokratischen Politik sich offenkundig beißen. Die Folge sind oft systematisch verzerrte Darstellungen der politischen Welt, die Fokussierung auf Gezänk und Geschacher, auf psychologisierende Diagnosen über die handelnden Personen, deren Beziehungen untereinander nach dem Modell privater Beziehungen gedeutet werden. Zwar stemmen sich einige Spitzenjournalisten gegen den Strom, indem sie zeigen, dass die schwierige Synthese von attraktiver Verpackung und dem Ziel, politische Vorgänge wirklich zu verstehen, nach wie vor möglich ist. Der Mainstream hingegen folgt oft und gern der Neigung, das Politische um spektakulärer Effekte willen systematisch zu entpolitisieren. Doch selbst wenn es mehr geduldige und kenntnisreiche Medienleute gäbe, die Kompetenz, sprachliche Virtuosität und die Bereitschaft mitbringen, den Dingen auf den Grund zu gehen, ist guter Journalismus zudem auf zwei weitere Ressourcen angewiesen, die immer knapper werden: ein Zeitbudget, das Entschleunigung und Sorgfalt begünstigt, sowie eine die Vielfalt fördernde journalistischen Kultur der wechselseitigen Kritik. Was die erschlaffende Demokratie heute dringend braucht, ist daher unter anderem eine Erneuerung des demokratisch-kulturellen Mandats des politischen Journalismus.
Eine Klarstellung vorab: Obgleich das Material der folgenden Analysen großteils aus dem Wahlkampfjahr 2013 stammt, soll hier nicht die These vertreten werden, die Medien (allein) hätten diese Wahl entschieden. Das Problem liegt tiefer.
[1] Schirrmacher, Frank, »Dr. Seltsam ist heute online«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (28. März 2014), S. 11.
Einleitung:Ein demokratisches Paradox
»Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.«[1] Dieser beinahe sprichwörtlich gewordene Satz von Niklas Luhmann schließt eine Aussage ein, die man folgendermaßen formulieren könnte: Darum wissen wir kaum etwas über die Medien, denn was wir über sie wissen können, bestimmen sie weitgehend selbst. Ulrich Beck hat den Punkt jüngst zugespitzt: »[D]ie politische Macht hat, wer über die Zulassung von Themen zur Öffentlichkeit entscheidet.«[2] Sobald die beiden Aussagen in Verbindung gebracht werden, zeigt sich das höchst folgenreiche Paradox, dem moderne Demokratien im Zeitalter der Massenmedien unterworfen sind: Die Medien zeigen uns die Welt – allerdings nicht wie in einem Spiegel, sondern unvermeidlich als von ihnen erzeugte Welt, als Ergebnis eines höchst eigensinnigen Auswahl- und Produktionsprozesses. Diesen Prozess selbst zeigen sie aber nicht: weder die Filter noch die Zutaten, noch die »geheimen« Künste ihres Handwerks. Das ist auch nicht in ihrem Interesse, sollen wir doch weiterhin glauben, dass sie uns und unserer Welt lediglich den Spiegel vorhalten. So wie die Medien heute verfasst sind, werden sie zur öffentlichen Selbstaufklärung über ihre Funktion wohl wenig beitragen. Wollen wir uns ein verlässlicheres Bild von modernen Mediendemokratien machen, müssen wir versuchen, uns selbst ein Verständnis der Vorgänge zu erarbeiten; rekonstruiert man die Mechanismen der Branche, sieht man, wie hochgradig fremdbestimmt wir heute sind. Im allgemeinen Bewusstsein wird diese Sachlage allerdings von dem angesprochenen, sich immer wieder aufdrängenden, dabei jedoch gründlich in die Irre führenden Bild der Medien als Spiegel wirkungsvoll überspielt. Selbst wenn wir dieses Bild als grobe Annäherung akzeptieren würden, wären die Massenmedien ja die Rückseite dieses Spiegels. Wer nicht darauf achtet, worauf er gerichtet wird und worauf nicht, wer sich nicht dafür interessiert, wann er auf Vergrößerung eingestellt ist und wann auf Verkleinerung oder gar Verzerrung, wer keine Sensibilität dafür entwickelt, über welche Themen er lediglich hinweghastet und bei welchen er ungebührlich lange verweilt, weiß am Ende nichts Verlässliches von der Welt, die ihm da gezeigt wurde. Und ist doch überzeugt, sie mit eigenen Augen gesehen zu haben. Dass die Sonne am Abend nicht untergeht, ist heute auch jenen klar, die sich von diesem vermeintlichen Abschied noch rühren lassen. Wie jedoch in den Massemedien gesiebt, gewichtet, zugespitzt, gefärbt und modelliert wird, können sogar jene allenfalls ahnen, die prinzipiell wissen, dass es diese Künste sind, die das Geschäft des Journalismus ausmachen.
Das alte Paradox bleibt bestehen, seine Folgen werden immer problematischer: Die Medien (nicht zuletzt das Internet) erreichen immer mehr Menschen, sie sind rund um die Uhr verfügbar, können praktisch in Echtzeit berichten; ihr Einfluss wächst, doch damit wächst auch ihr blinder Fleck – und die Notwendigkeit zu verstehen, nach welchen Regeln sie Themen auswählen und wie sie darüber berichten. Gelingt uns dies nicht, werden wir möglicherweise bald wie Blinde von unbekannten Mächten durch die Landschaften des Politischen geführt. Jedenfalls ist es bereits heute so, dass wir permanent akribisch über alle möglichen Kanäle recherchieren müssen, wenn wir überhaupt die Chance haben wollen, medial vermittelte Schilderungen zu überprüfen. Autonomie sieht anders aus.
Im privaten wie im öffentlichen Leben gibt es Ereignisse, die plötzlich einen Zustand ans Licht bringen, der zuvor verdeckt war. Genau das ist im Zuge des bundesdeutschen Wahlkampfjahres 2013 im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Massenmedien und Politik geschehen. Die entsprechenden Vorgänge haben eine Vielzahl von Kommentaren ausgelöst, sowohl von Betroffenen als auch von Beobachtern. Vor allem haben sie einen kundigen Protokollanten gefunden: Der FAZ-Journalist Nils Minkmar, ein geachteter Vertreter seiner Zunft, hatte über ein ganzes Jahr hinweg nahezu unbegrenzten Zugang zum sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Peer Steinbrück und so die Gelegenheit, das Verhältnis von politischer und medialer Realität zu studieren, die Vorgänge auf und hinter der Bühne zu vergleichen. In seinem aufschlussreichen Buch Der Zirkus gelangt Minkmar zu folgendem Fazit: Die großen Sachthemen, über die in der Wahl eigentlich hätte abgestimmt werden sollen, kamen in dem immer selbstbezüglicher werdenden und auf die Person des Herausforderers fokussierten Spektakel so gut wie gar nicht zur Sprache. Der aufgekratzte Medienzirkus präsentierte ein auf gespenstische Weise verzerrtes Bild der politischen Welt. Politik im engeren Sinne wurde dabei zur Nebensache.
Das Ziel der maßgeblichen Medienleute bestand darin, selbst unmittelbar im Prozess der Machtbildung mitzumischen. Einflussreiche deutsche Journalisten erweckten den Anschein, der Kandidat sei ein kaputter Politiker ohne Programm. Sie wollten verhindern, dass er Kanzler und sein Programm Politik wurde, und konstruierten dabei ein Bild, das am Ende keinerlei Bezüge mehr zur Person des Kandidaten hatte und zu der Sache, für die er einstand. Das Medienkarussell drehte sich mit schwindelerregender Geschwindigkeit, die Journalisten bestätigten sich permanent gegenseitig selbst, die Leitmedien und ihre Gefolgschaft lieferten sich einen Überbietungswettbewerb, der früh geprägte Klischees so lange zementierte, bis nirgends mehr ein frischer Blick auf die Wirklichkeit möglich war. Dem eigentlich politischen Kern dieses Wahlkampfs, nämlich dem Umstand, dass die Amtsinhaberin beharrlich verschwieg, was sie im Fall ihrer Wiederwahl vorhatte, ging niemand auf den Grund.
Die Welt als Wille und Vorstellung eines selbstbewussten Journalismus, der sein Maß nur noch in sich selbst findet, da wirksamer Einspruch bei diesem gesellschaftlichen »Teilsystem« – im Unterschied übrigens zu allen anderen – nicht möglich ist, weil alles, was über dieses System öffentlich gesagt werden kann, durch dieses System selbst hindurch muss. Der politische Journalismus ist durch seine Stellung im gesellschaftlichen Kommunikationssystem unbelangbar geworden und scheint entschlossen, diese Chance nach Kräften zu nutzen.[3] Bei einer zentralen Gruppe von Alphajournalisten ist eine Erosion essentieller professioneller Maßstäbe zu beobachten, sie agieren längst, als hätten sie ein privilegiertes politisches Mandat. Ihren Höhepunkte erreichte diese Entwicklung, als sich einer der Wortführer wenige Tage vor der Wahl ermächtigt wähnte, den ohnehin bereits ins persönliche und psychische Elend heruntergeschriebenen Kandidaten im Spiegel wie einen Psychopathen auf die Analytikercouch zu legen und ihm auf der Zielgeraden in einer seitenlangen, Details akribisch auflistenden Krankenakte politische Unzurechnungsfähigkeit und charakterliche Untauglichkeit zu bescheinigen. Wie anmaßend, wie bar jeden politischen Gehalts dieses unmittelbar vor dem Wahltag präsentierte Bulletin war, fiel nach dem Vorangegangenen schon gar nicht mehr groß auf. Kaum ein Kollege hat es moniert, empört scheint es niemanden zu haben. Was einst als übergriffig wahrgenommen worden wäre, steht im Begriff, sich fest einzubürgern.
Um eines klarzustellen: Nirgends, wo Medienfreiheit herrscht, kann der Journalismus ein monolithischer Block sein. Profil und Farbe, Kompetenz und Ethos, vor allem auch der politische Machtwille begegnen in diesem illustren Berufszweig wie in den meisten anderen (zumal in der Politik) in größtmöglicher individueller Variation. Allerdings ist diese Berufsgruppe für die Gesellschaft und die Politik – also für das, was uns alle unmittelbar angeht – von einzigartiger Bedeutung. Gleichzeitig verbinden sich in dieser Branche auf widersprüchliche Weise zwei strukturelle Momente, ohne dass auch nur ansatzweise klar wäre, ob und wie sich diese Konstellation mit einem Verständnis von Demokratie als wohlinformierte politische Selbstbestimmung der Bürger verträgt – wobei diese Frage nicht zum Gegenstand öffentlicher Erörterungen werden kann, weil die Entscheidung, worüber diskutiert werden soll und worüber nicht, ihrerseits allein in den Händen der Journalisten liegt. Dieses Veröffentlichungsmonopol ist das erste der beiden genannten Momente; in einer freien Welt führt es mehr oder weniger automatisch zum zweiten: der prinzipiellen Unbelangbarkeit des Journalismus, die lediglich von einigen Tatbeständen im bürgerlichen und im Strafrecht eingeschränkt wird, die eng gefasste Persönlichkeitsrechte schützen und daher die Sphäre, in der die politischen Übergriffe stattfinden, gar nicht erfassen.
Um ihren demokratischen Anspruch einzulösen, unterhalten moderne, unübersichtliche Gesellschaften mit ihren Massenmedien ein System der (so hofft man) objektiven Selbstbeobachtung. Journalisten sollen – und so sehen sie es in ihrer Mehrheit tatsächlich bis heute – treuhänderisch dafür sorgen, dass Demokratien sich insgesamt neutral über sich selbst aufklären können. Wo diese Aufgabe jedoch unerledigt bleibt oder systematisch verzerrte Ergebnisse liefert, entstehen defekte Demokratien. Eine intakte Öffentlichkeit ist für die Demokratie daher nicht weniger notwendig als intakte politische Institutionen. Diese Aufgabe rechtfertigt die Privilegien des politischen Journalismus sowie seinen strikten Schutz. Aus diesem besonderen Auftrag folgt angesichts der Verfassung des Medienbetriebs die ihn kennzeichnende Monopolstellung. Luhmanns Aussage über die Medien als zentrale Filter unserer Weltwahrnehmung ist heute wahrer als je zuvor. Der Satz, den der Soziologe folgen ließ, ist weniger prominent geworden:
Andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, daß wir diesen Quellen nicht trauen können. Wir wehren uns mit einem Manipulationsverdacht, der aber nicht zu nennenswerten Konsequenzen führt, da das den Massenmedien entnommene Wissen sich wie von selbst zu einem selbstverstärkenden Gefüge zusammenschließt.[4]
Der vermeintliche Grund für diesen Zirkel (von dem Luhmann meint, er sei praktisch nicht von Belang, solange das Ganze funktioniert) scheint in der elementaren Mechanik des Beobachtens selbst begründet, die Massenmedien sind eben gleichzeitig der Scheinwerfer und der blinde Fleck der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung, sie erhellen viel und lassen vieles im Dunklen. Was jedoch bei jeder einzelnen Beobachtungen am dunkelsten bleibt, sind die Absichten und Techniken derer, die die Welt für uns auf diese Weise sichtbar machen.
Angesichts dieser Tatsache muss es beunruhigen, dass die Medien über ein unangreifbares Monopol verfügen, wobei das System so komplex und verschlungen ist, dass es eine wirkungsvolle Form der Selbstimmunisierung gewährleistet. Einerseits verfügen die Journalisten selbst nicht nur über überlegene Kommunikationsroutinen, sondern auch über einen direkten Zugang zur Öffentlichkeit, so dass sie ihre Produkte mitsamt der darin enthaltenen Weltsicht in den Diskurs einspeisen können; andererseits haben sie mittels eines in sich selbst verschachtelten Systems die Macht zu entscheiden, welche anderen Teilnehmer Zugang zur Öffentlichkeit bekommen. Niemand kommt an ihnen vorbei. Der Einfluss einzelner Journalisten ist freilich beschränkt; sie können nicht nach eigenem Gusto entscheiden, sondern agieren im Rahmen fester beruflich-sozialer Hierarchien. Dies gilt erst recht in einer Zeit, in der die Branche intern von einer höchst folgenreichen Teilung in drei Klassen geprägt ist, die individuellen Akteuren ihren Platz zuweist, Einflussströme kanalisiert und einige herausgehobene Torwächter in Positionen bringt, in denen die Verfügungsgewalt über Stellen und Karrieren mit der über Themen und Tendenzen verschmilzt. Diese kleine, aber deutungsmächtige und machtbewusste Elite von Alphajournalisten und politischen Publizisten dirigiert virtuos und durchsetzungsstark das beschriebene Meinungsmonopol, sie stehen an der Spitze der Hierarchie;[5] danach kommen die festangestellten Redakteure und schließlich das wachsende Heer der Freien und Nebenberuflichen, die überwiegend schlecht bezahlt werden und kaum Einfluss darauf haben, was und wie publiziert wird.
Die politischen Publizisten im engeren Sinne, jene also, die sich mit politischen Ereignissen, Prozessen, Programmen und Akteuren nicht nur berichtend und analysierend, sondern auch kommentierend oder gar fordernd befassen und so als Ko-Politiker selbst zu Akteuren im politischen Prozess werden, können auf eine beispiellose Kombination privilegierter Zugänge zurückgreifen – und tun dies auch regelmäßig, womit sie vielen anderen ein autoritätsgestütztes Beispiel geben. Sie sind die Gatekeeper, die entscheiden, was aus der unbegrenzten Fülle der Ereignisse und Veröffentlichungsangebote – Taten und Texte, Deutungen und Kritiken, Personen und Gerüchte – auf die öffentliche Bühne gelangt und in welchem Licht Ereignisse oder Personen gezeigt werden. Die Deutung des von ihnen Dargestellten, die Herstellung von Zusammenhängen, alles, was das Urteil des Publikums darüber prägen wird, liegt in ihrer Hand. Durch den Spin, also den spezifischen Dreh, den sie den Dingen geben, sowie den Rahmen, in den sie sie einordnen, und indem sie sich verdeckt oder offen für bestimmte Personen und Anliegen einsetzen, werden sie zu Mitspielern im politischen Prozess, über den sie zugleich berichten und zu dem sie auch noch den abschließenden Kommentar liefern, so dass sie wie Schiedsrichter maßgeblich über den Ausgang des Spiels bestimmen. Politiker oder Organisationen, die Einsprüche gegen ihre Berichterstattung und ihre Urteile geltend machen wollen, sind wiederum darauf angewiesen, dass die Gatekeeper ihre Stellungnahmen veröffentlichen. Diese behalten immer das letzte Wort – vor allem auch in eigener Sache. Die Alphajournalisten übernehmen gleichzeitig die Rollen von Staatsanwälten, Zeugen und Richtern. So sind sie zugleich höchst einflussreich und prinzipiell unbelangbar – eine für die Demokratie nicht sonderlich bekömmliche Mixtur.
Gewiss, auch die Journalisten sind in ihren Entscheidungen nicht vollkommen frei, müssen sie sich doch der medialen Funktionslogik unterwerfen, um sich am Aufmerksamkeitsmarkt behaupten zu können. Zwar determiniert diese Logik, anders als die Systemtheoretiker es lehren, das Handeln der Akteure nicht vollständig, doch im Unterschied zum in der Demokratietheorie häufig bemühten Marktplatz, auf dem sich die Bürger dereinst getroffen haben, um von Angesicht zu Angesicht zu diskutieren, funktioniert die Medienöffentlichkeit wie eine hochselektive Schaubühne, zu der nur ganz wenige Profis Zugang haben – wenn sie das richtige Stück mitbringen und die höhere Kunst des Aufmerksamkeitsmanagements beherrschen. Zwei Filter sind es, die den Zugang zu dieser Medienbühne regeln (bei den elektronischen Medien strikter als im Printbereich, beim Boulevard gnadenloser als bei den Qualitätszeitungen); ihre Selektionsmechanismen definieren eine Art mediales Apriori,