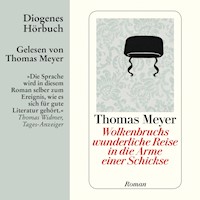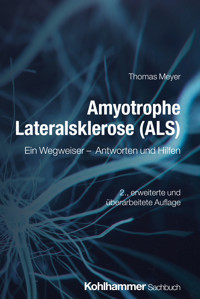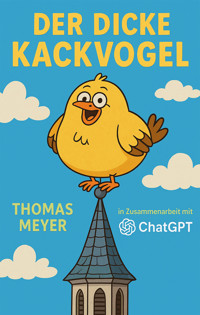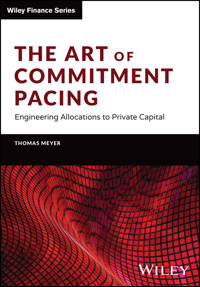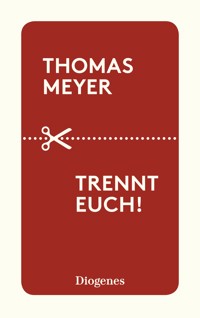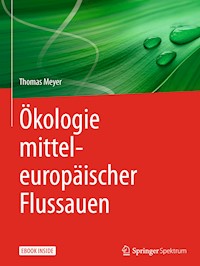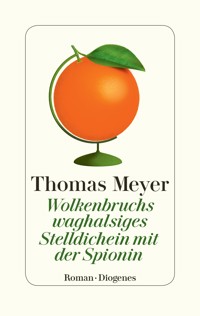
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Bruch mit seiner frommen jüdischen Familie wird Motti Wolkenbruch von Schicksalsgenossen aufgenommen. Wie sich bald zeigt, haben die aber weit mehr als nur Unterstützung im Sinn: Sie trachten nach der Weltherrschaft. Bisher allerdings erfolglos. Erst als Motti das Steuer übernimmt, geht es vorwärts. Doch eine Gruppe von Nazis hat das gleiche Ziel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thomas Meyer
Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin
Roman
Diogenes
In liebevoller Erinnerung an Ruth Duchstein
Der Mensch soll sich zur Hälfte für unschuldig halten und zur Hälfte für schuldig.
Babylonischer Talmud
»Nein, Herr Wolkenbruch, leider nein.«
Mordechai schaut aus dem Fenster und fragt sich, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen solle. Elf Stockwerke unter ihm sind lauter Menschen unterwegs, zu Fuß, auf dem Rad und im Auto. Mordechai beneidet sie darum, ein Ziel zu haben. Außer der Hotelbar hat er derzeit keines. Er sucht sie jeden Abend etwas früher auf, wobei er die Schwelle zum Nachmittag gestern eindeutig unterschritten hat. Die Uhr an der Wand hat ihm das mitgeteilt. Und die Mimik der Dame, die ihm seinen Gin Tonic hingestellt hat. Und die Tatsache, dass er ihn nicht hat ordern müssen.
Das Telefon auf dem Nachttisch klingelt. Mordechai setzt sich auf die Bettkante, hebt ab und meldet sich mit dem Einzigen, was ihm von seiner Familie geblieben ist: dem Namen.
»Guten Morgen, Herr Wolkenbruch!«, grüßt ihn die Dame von der Rezeption. »Sie haben Besuch. Von Herrn Hirsch. Er wartet in der Lobby auf Sie.«
Motti – eigentlich nennen ihn alle nur so – bedankt sich und legt auf. Er kennt keinen Herrn Hirsch. Der Name klingt zwar jüdisch, sagt ihm aber nichts. Nun gibt es Leute, die hätten den Fremden an den Apparat verlangt: Woher kennen wir uns? Was wollen Sie von mir? Andere hätten ihn einfach fortschicken lassen. Aber Motti ist wohlerzogen. Wenn ihn jemand sprechen will, putzt er sich die Zähne und tritt diesem Menschen gegenüber.
Im Spiegel des Aufzugs begegnet Motti Wolkenbruch einem Motti Wolkenbruch, der nur wenig Ähnlichkeit hat mit jenem, den er bis vor kurzem kannte: Er trägt keine orthodoxe Kleidung mehr, keine Kippa und keinen Bart, sondern Jeans und T-Shirt. Außerdem hat er aufgehört, zu beten und koscher zu essen. Er isst überhaupt kaum noch. Und das alles wegen Laura.
Als er die Lobby betritt, schaut er sich links und rechts nach diesem Herrn Hirsch um. Aus einem der Ledersessel erhebt sich ein kleiner, rundlicher Herr mit Haarkranz, einer dicken eckigen Brille, wie Politiker sie früher getragen haben, und einem ebenso altmodischen beigefarbenen Polohemd, aus dessen Kragen ein goldener Davidstern herausglänzt. Motti geht auf ihn zu. Der Mann, er dürfte um die fünfzig sein, streckt Motti seine Rechte hin und sagt erfreut und mit jiddischem Akzent: »Herr Wolkenbruch! Gideon Hirsch, mein Name.«
Motti schüttelt ihm zaghaft die Hand. Ist er ein Abgesandter seiner Eltern? Soll er Motti wieder nach Hause bringen? Für eine solche Mission sieht er allerdings nicht fromm genug aus.
»Bitte«, sagt Hirsch und weist einladend auf den Sessel gegenüber seinem.
Sie setzen sich. Von irgendwoher erklingt leise klassische Musik. Hirsch studiert einen Moment lang Mottis Gesicht und fragt: »Nu, Herr Wolkenbruch, wie geht es Ihnen?«
»Gut«, lügt Motti.
Hirsch nimmt einen Schluck von seinem Mineralwasser. »Aber Sie haben den Kontakt zu Ihrer Mischpuche verloren, nicht wahr?«
Also doch, denkt Motti. Ihm wird warm in der schmalen Brust. Er stellt sich vor, wie seine Mame, während hier über seine Heimkehr verhandelt wird, eine Hühnersuppe für ihn zubereitet, mit schwingendem Löffel und wackelndem Tuches.
»Ja. Und Sie sind gekommen, um zwischen uns zu vermitteln?«, fragt Motti. Überflüssigerweise, findet er.
Doch wie Hirsch nun aufhört zu lächeln und den Kopf schüttelt, so gut das bei seiner Halslosigkeit eben geht, ahnt Motti, dass die Verhältnisse wohl anders liegen.
»Nein, Herr Wolkenbruch, leider nein«, sagt Hirsch leise. »Gäbe es in Ihrem Fall noch etwas zu vermitteln, würde Ihr Rabbiner hier sitzen. Nicht ich.«
Motti wird unruhig. Wenn dieser Mann nicht gekommen ist, um ihn mit seiner Familie zu versöhnen – wozu denn dann?
Hirsch bemerkt Mottis Irritation, hebt die Hände und sagt feierlich: »Ich bin von den Verlorenen Söhnen Israels. Und Sie, mein lieber Herr Wolkenbruch, sind nun einer von uns.«
»Die Verlorenen Söhne Israels?«, fragt Motti verwirrt.
Hirsch nickt: »Wir sind eine Gruppe von Jidn, die nicht mehr orthodox leben und deren Familien deswegen mit ihnen gebrochen haben. Wir unterstützen einander, bei der Suche nach Arbeit und einer Wohnung und so weiter. Und wir möchten auch Ihnen helfen.«
Das Wort gebrochen schmerzt Motti. Gerade aus fremdem Mund macht es ihm bewusst, wie endgültig das Geschehene ist. Aber was hat er auch erwartet? Dass seine Eltern ihn, nachdem er sich mit einem nichtjüdischen Mädchen eingelassen hat, bloß zum Spaß rauswerfen und ihre Handynummern wechseln? Es ist wahr: Man hat mit ihm gebrochen, er ist ein verlorener Sohn. Hirsch, der sich wohl einst in einer vergleichbaren Situation befunden hat, beobachtet ihn teilnahmsvoll und winkt einen Kellner herbei, damit der Mottis Getränkewunsch aufnehme. Kurz darauf werden eine halbleere Flasche und ein halbvolles Glas Orangensaft auf den Clubtisch zwischen ihren Sesseln gestellt.
Motti trinkt, als hätte man ihm die pure Hoffnung serviert, und fragt schließlich: »Aber wie haben Sie denn von meiner Geschichte erfahren? Und mich hier gefunden?«
»Nu, wenn ein frommer Jid auf einmal Jeans trägt und etwas mit einer Schickse anfängt, bleibt das nicht lange ein Geheimnis«, antwortet Hirsch. »Ich habe dann einfach ein paar Hotels angerufen und nach einem Herrn Wolkenbruch gefragt. Beim sechsten hatte ich Erfolg. Zürich ist ja zum Glück keine Millionenstadt.« Hirsch schaut Motti einen Moment lang unbestimmt an. »Von Ihrem Fall konnte man allerdings auch in der Jüdischen Zeitung lesen«, fährt er fort, greift in den abgewetzten Lederrucksack, der neben seinem Sessel steht, und reicht Motti ein Stück Zeitungspapier. Es ist eine Todesanzeige.
Mordechai Wolkenbruch, steht da.
Er ist uns verlorengegangen, steht da.
Judith und Moses Wolkenbruch mit Familie, steht da.
Motti blickt entsetzt auf.
»Ich finde es auch sehr extrem. Aber leider ist so was nicht selten«, sagt Hirsch. »Die Eltern von Benjamin Stern haben sogar – kennen Sie Benjamin Stern? Aus Berlin?«
»Nein«, antwortet Motti und denkt sich: Ständig wollen die Jidn wissen, ob man die Jidn kenne, die sie kennen.
»Seine Eltern haben für ihn sogar eine Beerdigung abgehalten, mit leerem Sarg, bloß weil er ihnen gestanden hat, dass er sich nicht für Frauen interessiere. Das müssen Sie sich mal vorstellen: Da steht ein Grabstein in Berlin, und der Mann, zu dem er gehört, läuft noch herum!« Hirsch schüttelt empört den Kopf.
»Und was macht er jetzt?«, fragt Motti.
»Jetzt ist er bei uns. Wie Sie bald!«
»Wie meinen Sie?«
»Wir fliegen jetzt nach Hause. Nach Israel.«
Motti macht ein ratloses Gesicht, wie so oft in den vergangenen Tagen und Wochen. Er muss aufpassen, dass es nicht sein normales Gesicht wird.
»Unsere Maschine geht« – Hirsch schaut auf seine Armbanduhr – »in drei Stunden.«
Nach Israel. Nach Hause. Das waren schon vorher eng verwandte Begriffe. Und nun sollen es Synonyme sein?
Motti denkt nach. Aus der Hühnersuppe der Mame wird allem Anschein nach nichts. Laura hat sich auch nicht mehr gemeldet. Offenbar hat sie keine Lust darauf, einen Mann dabei zu begleiten, sich aus der Umklammerung einer jüdischen Mutter zu befreien. Und das Hotel hat seine Ersparnisse beinahe aufgezehrt. Das Hotel und dessen Bar, um genau zu sein.
»Okay«, sagt er.
Nachdem Motti seine Tasche aus dem Zimmer geholt und dieses sowie die Getränke aus der Lobby bezahlt hat, nehmen die beiden Männer vor dem Hotel ein Taxi und lassen sich in leichtem Regen und zu lautem Radiogeschwätz zum Flughafen bringen. Motti fällt auf, dass Hirsch nicht so gut riecht. Der Wagen nimmt die Einfahrt zur Autobahn, lässt die Stadt Zürich hinter sich und hält, weil in der Schweiz alles so dicht beieinander steht wie Joghurt im Kühlschrank, nur wenige Minuten später vor dem Flughafeneingang. Motti begleicht die Fahrt. Es ist das Mindeste, was er beitragen kann, wenn man ihn schon aus seiner Lage befreit, deren Misslichkeit ihm in der vergangenen Stunde immer bewusster geworden ist.
Der Flug geht aber nicht nach Tel Aviv, wie Motti feststellt, er geht nach Paris.
»Dort haben wir vier Stunden Aufenthalt«, erklärt Hirsch. »Das Ticket war so viel günstiger. Wissen Sie, wir haben nicht viel Geld. Und müssen manchen helfen.«
Motti sieht das ein. Sie geben seine Tasche auf, passieren die Sicherheitskontrolle und spazieren zum Gate, wobei Hirsch arg ins Schnaufen gerät. An einer Bar trinken sie einen Kaffee, erneut auf Rechnung von Motti, der nun ganz mitteilsam wird und sprudelnd die Ereignisse der letzten Monate zusammenfasst: erfolglose Versuche der Mame, ihn mit einer jüdischen Frau zu verheiraten, erfolgreicher Versuch seinerseits, mit einer nichtjüdischen Frau zu schlafen, erfolgloser Versuch, es mehr als zweimal zu tun, Abbruch sämtlicher Beziehungen. Hirsch hört aufmerksam zu und fragt schließlich: »Und wie fühlen Sie sich bei all dem, Herr Wolkenbruch? Aber sagen Sie bitte nicht wieder ›gut‹.«
»Ich weiß nicht …«, antwortet Motti, »… verraten. Und ungeliebt.« Indem er seine Empfindungen ausspricht, nimmt er sie noch viel stärker wahr. Seine Augen werden feucht.
»Nu, so würde es an Ihrer Stelle jedem gehen«, sagt Hirsch nach einer taktvollen Pause. »Aber ich denke, das liegt vor allem daran, dass Sie passiv erzählen.«
»Passiv?« Wieder das ratlose Gesicht.
»Ja. Sie sagen beispielsweise: Meine Mame hat mich von zu Hause rausgeworfen.«
»Hat sie ja«, schnieft Motti.
»Nein. Das haben Sie gemacht.«
»Ich?«
Hirsch nickt.
»Verstehe ich nicht.«
Im Hintergrund wird ein Flug nach Stockholm aufgerufen. Schon bei den ersten Worten federn reihenweise Leute von ihren Stühlen hoch und bilden eine Warteschlange, die sich in den nächsten zehn Minuten keinen Meter bewegen wird.
»Haben Ihre Eltern Ihnen etwa befohlen, mit dieser Frau intim zu werden?«
Motti ist nicht klar, worauf Hirsch hinauswill, muss aber zugeben, dass eine solche Anweisung nicht erteilt worden ist. Er schüttelt den Kopf.
»Sie hätten auf diese Geschichte verzichten können«, fährt Hirsch fort. »Ich sage nicht müssen. Ich sage nur können. Sie hätten sie zumindest verschweigen können. Sie hätten mit einem Dutzend weiterer Schicksen schlafen und einfach den Mund halten können.«
Ein Dutzend weiterer Schicksen, das gefällt Motti. Er grinst.
»Stattdessen haben Sie das getan, von dem Sie eigentlich wussten, dass es Ihre Eltern maximal verstören würde«, fährt Hirsch fort. »Sie sind mit einer Nichtjüdin ins Bett gegangen und haben zu Hause brühwarm davon erzählt. Das waren beides Entscheidungen. Ich sage nicht Fehler. Ich sage Entscheidungen.«
So hat Motti das noch nicht gesehen. Bisher empfand er sein Verhalten mehr als … nun, als Verhalten eben. Nicht als Umsetzung irgendeines Plans.
»Wissen Sie denn, warum Sie so gehandelt haben?«
»Mir hat diese Frau halt gefallen«, sagt Motti nach längerem Nachdenken. »Und ich wollte meine Eltern nicht anlügen.«
»Oh, hier wäre lügen aber klug gewesen!« Hirsch lacht. »Oder eben auch nicht. Kommt ganz darauf an, was man will.« Er hebt ironisch die Schultern und lässt sie wieder fallen. »Man könnte jedenfalls behaupten, dass Sie sich mit der Lage, in die Sie sich gebracht haben, einen Herzenswunsch erfüllt haben.«
»Es soll mein Wunsch gewesen sein, kein Zuhause mehr zu haben?« Motti klingt gereizt. Was bildet sich dieser Kerl eigentlich ein? Stellt ihm nach, hält ihm eine Todesanzeige unter die Nase und unterstellt ihm hirnrissige Absichten.
»Nicht grundsätzlich«, antwortet Hirsch. »Aber vielleicht nicht mehr dieses Zuhause? Mit all seinen Zwängen? Den 248 Geboten und 365 Verboten? In diesem Fall wäre Ihr Verhalten doch ausgesprochen vernünftig gewesen, nicht?«
Motti überlegt. Um sie herum starren die Leute auf ihr Smartphone, stecken es in die Tasche, wechseln ein paar Worte miteinander oder lesen kurz in einer Zeitschrift, nur um eine halbe Minute später das Gerät wieder hervorzuholen. Eine elegant gekleidete Frau gähnt, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Wie ein alter Löwe im Zoo sieht sie aus. Motti erinnert sich, wie ihn seine Mame jedes Mal zurechtgewiesen hat, wenn er sich in ihren Augen zu intensiv mit seinem Telefon beschäftigte, und wie sie ihm, als er noch ganz klein war, diesen Spruch beigebracht hat: Gähnen, husten, niesen: Hand muss Mund verschließen! Es waren nicht alle Regeln schlecht, findet er. Es waren einfach zu viele. Zu viele und zu absurde. Zum Beispiel das Verbot, am Schabbes von der Elektrizität Gebrauch zu machen – als könnte man Gottes Liebe mit einem Lichtschalter abdrehen. Oder die zwanghafte Trennerei zwischen milchigen und fleischigen Nahrungsmitteln – am Ende landet doch alles in derselben Schüssel!
Nun ist auch Mottis und Hirschs Flug zum Einsteigen bereit, und wieder stürzen die Passagiere zum Gate, als gäbe es nicht genügend Sitzplätze in der Maschine. Erst recht keine längst zugewiesenen.
»Sie wollten Ihr altes Leben nicht mehr, Herr Wolkenbruch«, sagt Hirsch mit seinem rollenden jiddischen R, während er die allgemeine Hektik beobachtet. »Sonst hätten Sie es noch.«
»Mit noch glühenderem Eifer!«
Als am frühen Morgen des dreißigsten April 1945 amerikanische Infanterie aus mehreren Richtungen in München einmarschierte, weckte das bei den Einwohnern gegensätzliche Empfindungen. Die einen fühlten sich befreit, die anderen besiegt. Darüber, dass der Krieg nun aus war, herrschte angesichts der fremden Übermacht allerdings Einigkeit. Die Greise des Volkssturms und die Kinder der Hitlerjugend legten ihre Waffen nieder, die Straßenbahnfahrer hielten auf offener Strecke an, und alle gingen, sofern sie noch eines hatten, nach Hause.
SS-Obersturmbannführer Erich Wolf, ein schneidiger Vierundzwanzigjähriger mit teichgrünen Augen und Stirnglatze, beurteilte die Lage etwas anders. Gewiss, die Dinge standen nicht zum Besten, seit die Plutokraten und die Bolschewisten gemeinsame Sache machten. Aber der Krieg verloren? Das Reich am Ende? Niemals! Erst zwei Tage zuvor hatte er diese Worte ein paar Drückebergern der Freiheitsaktion Bayern, die doch allen Ernstes kapitulieren wollten, ins Ohr gebrüllt, bevor er sie niederstreckte. Allerdings waren da die Amerikaner auch noch nicht hier gewesen.
Nun, da deren Panzer und Lastwagen unablässig in die Stadt rollten, zog sich Wolf mit seinem noch rund vierhundert Mann starken Bataillon in den Außenbezirk Obergiesing zurück, ließ die Fahrzeuge tarnen und erklomm mit seinem Stellvertreter, Sturmbannführer Kurt Hartnagel, den unversehrten Turm der Heilig-Kreuz-Kirche.
»Denen werden wir Saures geben«, sagte Wolf, während er durch seinen Feldstecher verfolgte, wie Straßenzug um Straßenzug an den Feind fiel. Als Münchner nahm er die Sache zutiefst persönlich.
Hartnagel, ein gewissenhafter Offizier mit Nickelbrille, erlaubte sich die Frage, was der Herr Obersturmbannführer gegen die Amerikaner auszurichten gedenke.
Wolf ließ das Fernglas sinken und starrte Hartnagel an. »Glauben Sie etwa nicht an den Endsieg?« Nur eines hasste er noch mehr als die Juden: Treulosigkeit.
»Doch, natürlich«, versicherte Hartnagel. »Aber was wir konkret tun wollen, meine ich.«
Die Frage war nicht unbegründet. Nebst Wolfs Kommandeurswagen – einem offenen Mercedes Benz Typ 320, in dem er auch unter Beschuss aufrecht zu sitzen pflegte – verfügten sie über zwei Opel-Blitz-Lastwagen und ein Halbkettenfahrzeug, das eine reichlich ausgeleierte 8,8-cm-Kanone zog und noch elf Granaten dafür mitführte. Es mangelte außerdem an Gewehrmunition, Treibstoff, Medikamenten und Verpflegung.
Wolf blickte wieder durch sein Glas. Er beschloss, getreu der jüngsten Anordnung des Führers, den Kampf in den Wäldern fortzusetzen. Hinterhalt. Sabotage. Partisanenkrieg. Was die Russen konnten, das konnten sie schon lange.
»Mit noch glühenderem Eifer«, befahl er.
Doch Eifer hatte das Kriegsglück zuvor schon nicht zu begünstigen vermocht und tat es auch jetzt nicht. Wo die Einheit in den folgenden Tagen und Nächten hinkam, wimmelte es von wohlgenährten und ausgeschlafenen amerikanischen Truppen, die ausgesprochen humorlos auf den Anblick der gefleckten Waffen-SS-Tarnanzüge reagierten und sofort das Feuer eröffneten. Gingen Wolf und seine Männer ihrerseits zum Angriff über, tauchten beängstigend schnell aluminiumglänzende P-47 oder P-51 über ihnen auf und nahmen sie unter Beschuss. Binnen einer Woche hatten sie so ihr Geschütz, sämtliche Fahrzeuge und über achtzig Mann verloren. Mehr als zweihundert weitere waren verwundet worden, darunter auch Wolf, der seit neuestem mit einer Bahre herumgetragen werden musste; auf dem Bauch liegend, weil ihn eine amerikanische Kugel am Hintern erwischt hatte. Bei der einen Backe rein und wieder raus und das gleiche bei der anderen. Seine Leute nannte ihn jetzt heimlich den »Mann mit den fünf Arschlöchern«. Das war aber auch der einzige Grund zum Lachen, den sie noch hatten. Sie, die es gewohnt waren, dass man ihnen entweder zujubelte oder sich vor ihnen in den Staub warf, mussten sich verstecken. Und das in Deutschland! Schlimmer noch, in Bayern. Sie zogen durch die Wälder, schliefen im Laub, aßen Wurzeln und Eicheln, schlichen nachts über die Äcker und stahlen Eier und Hühner von den Bauernhöfen. Und sooft sie die charakteristisch heulenden Motoren der amerikanischen Fahrzeuge nahen hörten, drückten sie, die einstige Elite, sich bang auf den Boden. Es war peinlich.
»Diese verfluchten Judenschweine«, schimpfte Wolf leise auf seiner hastig abgestellten Bahre, während keine zweihundert Meter entfernt eine Kompanie US-Soldaten in ihren olivgrünen Uniformen am Waldrand vorbeizog, im Gefolge zweier Sherman-Panzer. Nicht singend und plaudernd, wie bisher, sondern schweigsam und mit schussbereiten Karabinern und Thompson-Maschinenpistolen. Eine Gruppe trug einen zerlegten Mörser. Offenbar machte man mittlerweile gezielt Jagd auf Wolfs Einheit.
»Wo?«, flüsterte Hartnagel, der neben ihm auf dem Waldboden lag.
»Na, da vorn! Sind Sie blind?«, herrschte Wolf, für den die Amerikaner quasi eine Übersee-Import-Version der Juden darstellten, seinen Untergebenen gepresst an.
Hartnagel sah bloß die Amerikaner. Mochte sein, dass Juden darunter waren. Er versuchte angestrengt, in ihren Gesichtern die typischen Merkmale zu erkennen – die kolossalen Nasen, der verschlagene Blick. Aber sie waren zu weit weg.
»Kaum haben wir diese Ratten vertilgt, kommen schon neue«, zischte Wolf, der offenbar die besseren Augen hatte.
Hartnagel schwieg. Es war ihm ja keine Frage gestellt worden. Er hätte auch keine Antwort gewusst. Sich abknallen zu lassen oder sich selbst zu erschießen schienen derzeit die einzigen Optionen.
Die feindlichen Soldaten entfernten sich. Wolf dachte nach. Solange seine tapferen Männer lebten, bestand das Reich fort. In jedem einzelnen von ihnen. Doch wie lange würden sie noch durchhalten? Die Kommandostrukturen waren zusammengebrochen, die Nachschubwege ebenso. Sie waren völlig auf sich allein gestellt. Tatsächlich? Waren sie wirklich die letzten Nationalsozialisten? Es musste doch noch welche geben, die dachten wie sie! Und bereit waren, entsprechend zu handeln.
Just in dem Moment hörten Wolf und Hartnagel hinter sich Schritte im Laub und zogen gleichzeitig ihre Walther P.38. Während sie sich umwandten, sagte ein Mann in breitem, fröhlichem Bairisch: »Sieh an, sieh an! Man darf also noch hoffen!«
Wolf und Hartnagel zielten mit ihren Pistolen auf einen gutgelaunten, pausbäckigen Mann in Jägerkluft. Er hatte ein Gewehr, aber es war geschultert, und er war offenkundig Deutscher. Sie steckten die Waffen wieder ein und erhoben sich.
Der Jäger, eine wuchtige Gestalt mit listigen, baumrindenbraunen Äuglein, streckte seinen rechten Arm hoch und rief: »Heil Hitler!«
»Heil Hitler!«, riefen Wolf und Hartnagel, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass keine Amerikaner mehr in der Nähe waren.
»Wobei man das ja leider nicht mehr so sagen darf«, meinte der Jäger, auf einmal betrübt.
»Wieso nicht?«, fauchte Wolf. War der Kerl etwa auch so ein Wehrkraftzersetzer von der Freiheitsaktion? Dann war er hier aber zum letzten Mal auf der Pirsch!
»Sie wissen es nicht? Dass unser Führer … dass er … nicht mehr unter uns ist?«, überbrachte der Jäger die schreckliche Nachricht möglichst behutsam.
»Um Himmels willen!«, rief Hartnagel und schlug sich die Hand vor den Mund.
»Nein, das ist uns neu«, sagte Wolf mit der ihm eigenen Nonchalance.
»Die Russen haben ihn dazu getrieben, seinem Leben ein Ende zu setzen. Vor zwei Wochen.«
Hartnagel machte ein Geräusch, das klang, als würde er gleich anfangen zu weinen.
»Reißen Sie sich zusammen, Mann«, wies ihn Wolf zurecht.
Vögel zwitscherten. Die Sonne schien golden durch die Fichten. Richtiges Hitlerwetter, dachte Wolf und beschloss, es weiterhin so zu nennen.
»Ja, eine traurige Geschichte«, sagte der Jäger. »Aber wenn Sie gestatten, meine Herren: Sie wirken etwas erschöpft.«
»Wir sind nicht erschöpft«, widersprach Wolf.
»Eine gute bayrische Leberknödelsuppe würde aber keinen Schaden anrichten, oder?«
Hartnagel, gut zwölf Kilo leichter als zu Kriegsbeginn, warf seinem ebenfalls ausgezehrten Kommandanten einen flehenden Blick zu.
»Nein, bestimmt nicht«, erwiderte Wolf, dem das Wasser im Mund zusammenlief.
»Haben Sie eine Karte der Gegend?«, fragte der Jäger, holte einen Flachmann aus seiner Jackentasche und nahm einen tüchtigen Schluck.
»Selbstverständlich.« Wolf machte eine gebieterische Geste, woraufhin Hartnagel das Gewünschte entfaltete.
»Hier, das ist mein Hof«, sagte der Jäger, zeigte auf die betreffende Stelle und dann auf eine andere. »Am besten gehen Sie da lang.« Er schraubte den Deckel wieder zu.
»Das ist aber unwegsam«, sagte Hartnagel, der nur noch essen wollte, nicht klettern.
»Weswegen da auch keine Amis rumstreunen«, folgerte Wolf.
»Richtig. Wir dürfen also mit Ihrem Besuch rechnen, Obersturmbannführer? Ihre Leute können bei uns in Ruhe zu Kräften kommen.«
Wolf nickte.
»Ausgezeichnet. Meine Mägde werden schon mal den Kessel aufsetzen. Oh, verzeihen Sie … Huber, mein Name. Martin Huber.«
Er hob seinen grünen Jägerhut, unter dem kurzes graumeliertes Haar zum Vorschein kam.
»Wolf.«
»Hartnagel.«
Man verabschiedete sich mit dem Heilswunsch für den Mann, der zu ihrer aller Betrübnis nicht mehr lebte.
Wolfs Bataillon zählte jetzt noch 130 Mann, gut ein Sechstel der Sollstärke. Den letzten Sanitäter hatte es auch erwischt. Die abgerissene Truppe quälte sich durch den Wald. Dem einen fehlte ein Unterschenkel, dem anderen ein Arm, vielen der Helm. Sie stützten und trugen einander und fluchten leise vor Anstrengung, Schmerz, Hunger und Wut über den Krieg, der zweifelsfrei verloren und damit für alle vorbei war, außer für sie, weil Wolf gedroht hatte, jeden zu erschießen, der sich davonmachen wollte, was er in zwei Fällen auch bereits vollzogen hatte.
Die Verpflegung, die sie auf Hubers weitläufigem Hof bekamen, in einer großen Scheune vor Blicken geschützt, hellte ihre Stimmung erheblich auf. Dazu trug auch bei, dass Huber in seinem schwarzen Audi 920 ein paar Freunde hergebracht hatte: einen Bäcker mit kiloweise frischen Brötchen sowie einen Arzt namens Bauer und dessen Gehilfin Greta, eine überaus attraktive Zweiundzwanzigjährige mit steingrauen Augen und weißblondem Haar. Ihr bloßer Anblick ließ so manche Pein vergessen.
»Keine Sorge, die sind aus dem richtigen Holz geschnitzt«, sagte Huber, als Wolf die drei Zivilisten, die seine Leute versorgten, mit kritischen Blicken maß. »Und nun lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wie es weitergehen könnte mit dem Reich.«
»Ja, aber er hat ein neues Album!«
Nach zahllosen Flugmeilen und widerlichen Sandwiches verlassen Motti und Hirsch den nach Israels Staatsgründer David Ben Gurion benannten Flughafen und betreten das gegenüberliegende Parkhaus. Es ist erst März, aber schon sommerlich warm. Hirsch sucht lange nach dem Ticket und findet es schließlich in seiner Hosentasche. Er entknittert den kleinen Halbkarton, stopft ihn in den Automaten, der sich mehrmals weigert, ihn anzunehmen, stöhnt dann, als er sieht, wie hoch die Gebühr ist, und beginnt, Münzen aus diversen Taschen zu klauben. Diesmal kann Motti nicht helfen, da er kein israelisches Geld dabeihat, und das freut ihn nun ein wenig, nach allem, was er seit seinem Zusammentreffen mit Hirsch finanziert hat. Schließlich bringt dieser den Betrag doch noch zusammen und führt Motti zu seinem Auto, einem Subaru Justy, aus dessen Radhäusern der Rost hervorsprießt. Der Boden ist bedeckt mit flachgetretenem Müll. Es riecht nach Zwiebeln.
»Ich sollte hier mal aufräumen«, sagt Hirsch und weist auf die Deponie zu ihren Füßen, während er mit der anderen Hand den kleinen Wagen rückwärts aus dem Parkplatz lenkt.
Motti denkt: Ja, solltest du. Aufräumen und duschen. »Wohin fahren wir?«, fragt er.
»Zu unserem Kibbuz«, antwortet Hirsch und legt den Vorwärtsgang ein. »In einer Stunde sind wir da.« Er beginnt, Reihen geparkter Autos zu umkurven.
»Wie heißt er?«
»Kibbuz Schmira.«
Schmira. Schutz. Motti ist also auf dem Weg zu Menschen, die ihn beschützen.
Ihm fällt auf, dass der Motor des Autos kaum zu hören ist. Eigentlich gar nicht. Er nimmt bloß ein Summen wahr.
»Wieso hört man den Motor nicht?«, fragt Motti.
»Weil keiner drin ist. Zumindest kein Benzinmotor.«
»Sondern?« Ein Subaru Justy fällt eindeutig nicht in die Epoche der Elektroautos.
»Unser Gründer war Ingenieur, der hat mal was gebastelt. Keine Ahnung, war vor meiner Zeit.«
Sie fahren an Lod vorbei in Richtung Be’er Scheva. Zu ihrer Rechten sinkt die Sonne ins Meer, was so aber gar nicht stimmt, wie Motti sich erinnert. Ein Tag endet vielmehr, indem der entsprechende Erdteil aus dem Licht der Sonne hinausrotiert, mit bis zu 1640 Stundenkilometern. In den vergangenen Jahren hat Motti das im Religionsunterricht gewonnene und beim Beten vertiefte Wissen über die Entstehung der Welt – am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde – durch die heimliche Lektüre von Wikipedia-Einträgen ergänzt. Dabei hat er von einer Molekülwolke erfahren, die vor langer Zeit zu Staub zerfallen ist, der sich zu zahllosen Miniplaneten verdichtete, die so lange ineinanderkrachten, bis daraus die Erde entstand. Auf diese Weise wurde Motti zu einer Art orthodoxem Agnostiker: Tagsüber las er unter einem Gebetsschal heilige Texte und abends unter der Bettdecke auf dem Smartphone solche, die ersteren deutlich widersprachen. Irgendwann kam er zum Schluss, dass ein Schöpfergott durchaus existieren kann, genausogut aber auch nicht. Dass etwa aus bloßem Weltraumstaub ein fruchtbarer, belebter Planet wird, lässt sich physikalisch erklären – aber ist es nicht auch göttlich? Selbiges gilt für den winzigen Samen, aus dem ein Baum wächst. Und Lauras nackter Körper erst – wer will da noch von bloßer Biologie sprechen! Doch was für ein Gott soll das wiederum sein, der solche Wesen erschafft, sie dann aber für verboten erklärt? Ein Koch, der lauter Köstlichkeiten zubereitet, nur um sie dann von der Menükarte zu streichen – ist er nicht vollkommen verrückt?
Wie es aber auch immer dazu gekommen ist, dass die Welt existiert; ob sie nun das Opus einer unsichtbaren Kreativgewalt ist oder das Ergebnis millionenjähriger Geröllverklumpung: Fest steht, dass nicht die Sonne hinter der Erde untergeht, sondern letztere sich von ersterer wegwälzt, und wie Motti dank Hirschs Anregungen erkannt hat, verhält es sich mit seiner Familie ganz ähnlich: Nicht sie hat sich von ihm abgewendet, sondern er sich von ihr. Ihm wurde nichts angetan, er hat gehandelt. Nicht unbedingt bewusst, aber effektiv. Auf einmal gut gelaunt, lehnt er sich in den durchgesessenen, jeglichen Seitenhalt vermissen lassenden Autositz zurück und schließt die Augen. Hirsch schaltet das Radio ein. Sinnigerweise lautet der Text des Liedes, das nun gegen den Fahrtwind anzukämpfen beginnt: »Close your eyes and pray this wind don’t change.«
»Das ist das neue Album von Roger Waters!«, sagt Hirsch freudig und dreht lauter.
»Der ist doch ein Antisemit?«, sagt Motti, ohne die Augen zu öffnen.
»Ja, aber er hat ein neues Album!«, entgegnet Hirsch, anscheinend ein Spezialist für perspektivische Flexibilität.
Etwas später, Roger Waters hat das Mikrophon längst an einen Berufskollegen weitergereicht, fährt Hirsch vom Jitzhak-Rabin-Highway auf die Landstraße 264 ab. Motti erwacht, setzt sich gerade hin und blinzelt durch die staubstarrende Frontscheibe. Der Himmel ist inzwischen dunkelblau. Nach ein paar Minuten verlangsamt Hirsch, setzt den Blinker, lässt einen mit Betonröhren beladenen Lastwagen vorbeidonnern und biegt auf eine holprige Piste ab, die das kleine Auto auf und ab wackeln lässt. Das spröde Nichts rundherum verwandelt sich innerhalb weniger Meter in eine oasenartige Ansammlung von sattgrünen Sträuchern und Bäumen. Der Duft von trockener Erde und wilder Minze dringt durch das offene Seitenfenster.
Unter einem alten Wasserturm steht ein noch älteres landwirtschaftliches Kettenfahrzeug, beide scheinen noch in Gebrauch zu sein. Der Subaru hält vor einem hell erleuchteten eingeschossigen Gebäude mit breiter Glasfront, das von diversen kleineren flankiert ist. Jetzt sind nur noch Grillen zu hören.
Als Motti seine Tasche aus dem mikroskopischen Kofferraum hievt, erscheint ein hochgewachsener alter Mann vor dem Gebäude. Er dürfte etwa siebzig sein, trägt einen gepflegten Bart, einen beigen Leinenanzug mit hellblauem Hemd, offenem weißem Kragen und Strohhut. Eine elegante Erscheinung, ganz anders als Hirsch mit seinem müffelnden Polohemd und dem wirren Resthaar.
Der Alte kommt näher. Er hat klare, himmelblaue Augen; sie wirken eher wie die eines Kindes als eines Greises.
»Das ist er also«, sagt er. »Der Schicksenheld aus Zürich.«
Sein Jiddisch ist noch viel kratzender und singender als das von Hirsch; er sagt nicht Zürich, er sagt Ziirich. Er betrachtet Motti eindringlich, während er aus seinem Jackett ein silbernes Etui befördert, es aufschnappen lässt, ihm eine Zigarette entnimmt, sie mit einem ebenfalls silbernen Benzinfeuerzeug entfacht und schließlich tief inhaliert.
»Ein ganz Gefährlicher ist das.« Hirsch lacht. Er hat sich neben Motti gestellt und tätschelt ihm die Schulter wie einem siegreichen Rennpferd.
»Steve«, sagt der Alte und reicht Motti eine kühle Hand.
»Motti«, sagt Motti und blickt ehrfürchtig zu Steve auf, der mit seinem Hut die Zweimetermarke problemlos überragt.
»Willkommen bei den Verlorenen Söhnen!«, sagt Steve, weist auf den Pavillon und geht voran. Seine Statur und der Zigarettenrauch lassen ihn wie einen spazierenden Fabrikschlot erscheinen. Motti hebt seine Tasche auf und folgt ihm. Eine weiße Katze setzt sich und beobachtet ihn. Der Wind greift in die Krone einer nahen Pappel.
»Nach Stalingrad … danach begann ich, am Endsieg zu zweifeln«
»And who are you?«
Der US-Militärpolizist fixierte den Mann, der in einem hellbraunen, schlechtsitzenden, da nicht ihm gehörenden Dreiteiler auf dem Beifahrersitz von Martin Hubers Audi saß. Huber kannte er. Den anderen nicht.
Huber erklärte dem Mann in bestem Englisch, dass sein Begleiter den Direktor seiner Brauerei ersetzen werde, der bedauerlicherweise beim Luftangriff am 21. April ums Leben gekommen sei. Letzteres stimmte. Ersteres nicht.
»Papers, please.«
Wolf reichte dem Soldaten eine graue Kennkarte. Dieser nahm sie entgegen und las neben einem Foto, das den Obersturmbannführer in Zivil zeigte:
Name: Wagner
Vornamen: Kurt Julius
Geburtstag: 30. Juli 1908
Geburtsort: München
Beruf: Kaufmann
Unveränderliche Kennzeichen: blaue Augen
Veränderliche Kennzeichen: keine
Der Militärpolizist prüfte das Dokument genau. Er wusste, dass in diesen Tagen überall Naziverbrecher untertauchten, und war auch über die SS-Einheit informiert, die sich nicht ergeben wollte und für diverse Feuerüberfälle in der Gegend verantwortlich war. Aber der Ausweis schien echt. Er war es auch; Huber hatte überallhin beste Kontakte.
»Thank you, Sir«, sagte der Militärpolizist und gab den Weg frei.
Es war ein warmer Frühlingstag, und solange man den Blick zu den putzig am Himmel herumeilenden Wölkchen gerichtet hielt, war es die reine Pracht. Ließ man ihn aber sinken, sah man die vielen halb oder ganz eingestürzten Häuser und all die Menschen auf der Suche nach Wasser, Essen und Kleidung. Viele zogen einen Handwagen mit ihren letzten Habseligkeiten hinter sich her.
»Diese Schweinerei haben wir den Juden zu verdanken«, schimpfte Huber.
Wolf nickte. Es gab in diesen Tagen kaum etwas, das nicht den Juden zu verdanken war. Aber wem waren eigentlich die Juden zu verdanken? Gab es so etwas wie einen Urjuden? Den Übervater des Bösen? Eine Frage, die Wolf schon als Kind beschäftigt hatte.
»Wir werden das alles wieder aufbauen«, sagte Huber und wies auf ein ausgebranntes Kaufhaus. »Alles. München, das Reich, die Partei, die Wehrmacht. Es wurden viele Fehler gemacht. Aber wir werden daraus lernen. Und stärker sein als zuvor.«