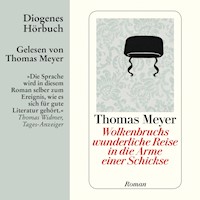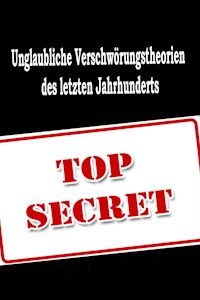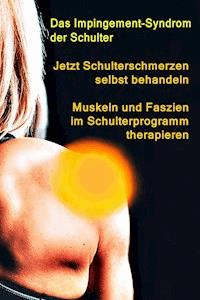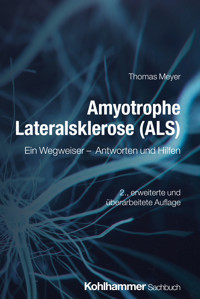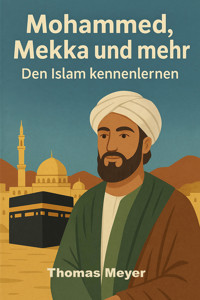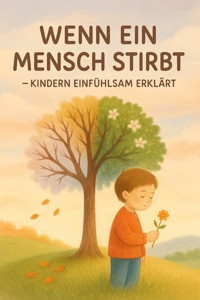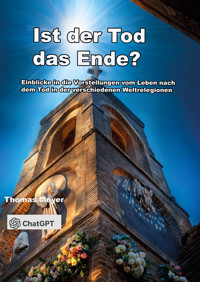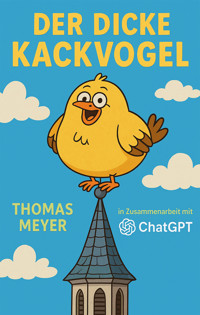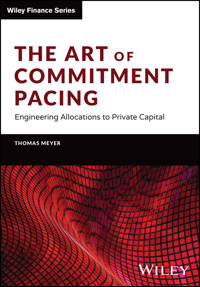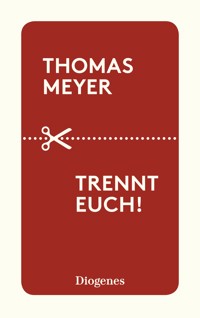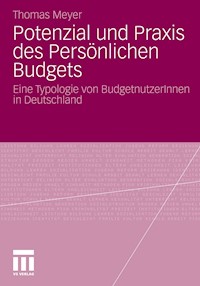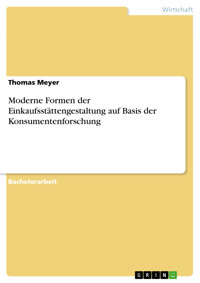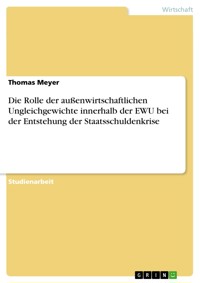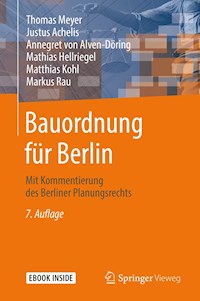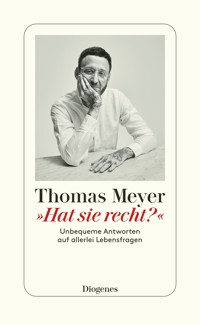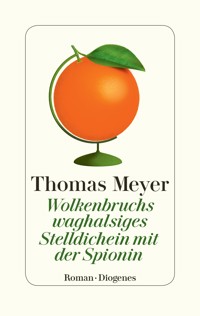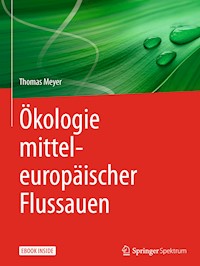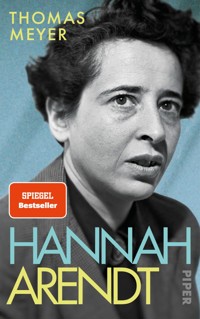
27,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 27,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die große Denkerin und ihr Werk - auf Basis neuer Quellen »Meyer ist eine völlig überraschende Biografie einer intellektuellen Ikone gelungen, der man im Ringen um das Leben anderer so schmerzlich nahekommt wie noch nie.« Peter Neumann, DIE ZEIT »Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken, der Sache nach – denken.« Für Thomas Meyer bilden diese Sätze den Leitfaden seiner Biografie Hannah Arendts. Ihm folgt Meyer, wenn er anhand neuer Quellen ihr Leben und Werk von Königsberg nach New York, von der Dissertation über Augustin bis hin zum unvollendeten Opus magnum »Vom Leben des Geistes« nachzeichnet und deutet. Seine Biografie beleuchtet die Faszination und die Kritik, die ihre Person und ihre Schriften zeitlebens auslösten, und macht dabei sowohl für Interessierte wie für Kenner das Phänomen »Hannah Arendt« verständlicher. Der hier gewählte Zugang unterscheidet sich radikal von der bisherigen Forschung. Erstmals werden bislang völlig unbekanntes Archivmaterial und andere zuvor ignorierte Dokumente herangezogen, um Arendt in ihrer Zeit dazustellen. Dabei konzentriert sich die Biografie auf zwei Lebensphasen Arendts: die Pariser Jahre nach der Flucht aus Deutschland und die Zeit in den USA bis zur Publikation ihres ersten Hauptwerkes »Origins of Totalitarianism« 1951, auf Deutsch 1955 unter dem Titel »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« erschienen. Daraus ergeben sich neue Perspektiven auf Arendts revolutionäres Denken. Thomas Meyers Biografie ist der Ausgangspunkt für eine notwendige Neubewertung von Arendts Leben und Werk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: picture alliance / Fred Stein | Fred Stein
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Vorwort
Prolog
Das letzte Tau
Einleitung
Zuhause auf der »Insel Venedig« – Familiengeschichte(n) in Königsberg
Neustart am Pregel – Stammvater Aron Arendt
Geschäfte und Generationen – Steter Wandel als Begleiter
Vom roten Schlips zum Oberingenieur – Hannahs Vater Paul
Ein neues Leben – Johanna, die »Schulfremde«
Vom »Sophistes« zu Rahel – Wege in der Wissenschaft
Abenteuer des Geistes – Bei Heidegger in Marburg
Liebe gibt es nur im Himmel – Bei Jaspers in Heidelberg
Blitzhochzeit bei Potsdam, Förderung in Frankfurt
»Zu 100 Prozent jüdisch« – Pariser Jahre
Verantwortung bis zuletzt
Frankreich heißt Freiheit
Die erste Karriere – Taten und Worte
Alles für die jüdische Jugend
Adieu Alijah, Bonjour Blücher
Publizistin in Paris
Atemlose Zeiten
Rückkehr zur Alijah
Mitten im Sturm
Es war einmal in Amerika – Origins of Totalitarianism
Mittendrin in New York City
Der Ursprung der Ursprünge
Im Einsatz für die jüdische Sache
Ein Atlas der blinden Flecken
Ein Brief an die Deutschen
Literatur – Quellen der Erfahrung und des Verstehens
Gewandelte Wege zur Welt
Französische Zustände
Ein fruchtbares Feld – Lektorin bei Schocken
Über die Gleise der Tradition – Brücken in der neuen Welt
Dreiklangsdimensionen – Medienintellektuelle und Medienprofi
Im Zweiten zum »Star«
Klartext in allen Belangen
Der Sturm-Erprobte & der Leviten-Leser – Heidegger und Jaspers
Martin Heidegger
Heim ins Uralte – die Würdigung zum Achtzigsten
Karl Jaspers
Wahrheit verbindet – das Nachkriegstrio
Denken in Worten – Arendts Werke
Gewaltiger Korpus und eigener Klang
Sammelband im Schatten – Fragwürdige Traditionsbestände
Wieder auf festerem Grund – Fallgeschichten
Anfänge im Aufbau
Die Ungarische Revolution
Little Rock
The Critic
On Revolution
Eichmann in Jerusalem
In Abwesenheit anwesend – Frauen über Frauen
Neun minus eins
Frauenfragen
Das Ende aus der Mitte
Dank
Abkürzungs- und Siglenverzeichnis
Bildteil
Bildnachweis
Anmerkungen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Sonja
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Zwei Jahre sind vergangen, seitdem meine Biografie Hannah Arendts erstmals erschien. Zwei Jahre, das ist keine Zeitspanne, die nach einem Resümee verlangt, die das bilanzierende »Was seither geschah« aufruft. Die Arbeit an dieser Biografie war ein großes Privileg. Hannah Arendts Leben und Werk genauer kennenzulernen und dabei allmählich zu verstehen, warum ihre Schriften auf der ganzen Welt gelesen, gedeutet und für die konkrete politische Arbeit genutzt werden, war und ist für den Autor ein Glücksfall. Arendt beobachtete mit Goethes Kaiser im zweiten Teil des Faust zwar »Die Menge schwankt im ungewissen Geist, / Dann strömt sie nach, wohin der Strom sie reißt«, doch hielt sie das nicht davon ab, theoretisch und praktisch Alternativen für jeden Einzelnen aufzuzeigen. Denn darauf kam es Arendt an: Veränderung beginnt bei einem selbst, für Veränderungen aber benötigt man die Anderen. Hannah Arendt tat, was sie dachte und dachte aus ihren Erfahrungen.
Dem Vorwort der Hardcover-Ausgabe schicke ich nur wenig voraus, auch wenn einiges präzisiert und erweitert werden konnte. Ich habe in der Zwischenzeit meine Recherchen in Archiven fortgesetzt. Die Ergebnisse sind teilweise in dieser Ausgabe eingearbeitet. Bei der Berücksichtigung neuer Funde ist es nicht geblieben: Zusätzlich habe ich habe das Buch vollständig durchgesehen, dabei mir bekanntgewordene Fehler korrigiert und hoffentlich dort gedankliche und sprachliche Klarheit herstellen können, wo sie von Kritikerinnen, Lesern und vor allem von den Übersetzerinnen der Biografie vermisst wurden.
Mein besonderer Dank gilt Marina Touilliez, mit der ich im vergangenen Jahr Gespräche führen und zahlreiche Archivfunde teilen konnte. Ihre 2024 bei der Pariser Éditions L’Échappée veröffentlichte Studie Parias. Hannah Arendt et al »Tribu« en France (1933–1941) stellt eine wesentliche Erweiterung unseres Wissens über das Leben Arendts und ihres Umfeldes in der französischen Exilzeit dar.
Während ich diese Zeilen schreibe, wird der letzte Band der von mir verantworteten Studienausgabe der deutschen Texte Hannah Arendts gedruckt und Ende November 2025 erscheinen. Nimmt man den 2024 publizierten Band Über Palästina hinzu, der zwei bis dahin unbekannte Texte der politischen Theoretikerin erstmals auf Deutsch samt Kommentaren und einem ausführlichen Nachwort präsentiert, so wurden während der Arbeit an dieser Biografie insgesamt dreizehn Bände in Zusammenarbeit mit elf Kollegen und Kolleginnen veröffentlicht. Nunmehr kann also überprüft werden, ob die angestrebte Einheit von Biografie und Studienausgabe erreicht wurde. Die Absicht der angestrebten Einheit hat sich jedenfalls nicht verändert: Arendts Leben und Werk in seiner Zeit möglichst umfassend und dabei anders als bisher bekannt darzustellen.
Thomas Meyer
Berlin-Charlottenburg, 25. August 2025
Vorwort
»Aktuell« oder auf Deutsch »gegenwärtig«, das ist die häufigste Zuschreibung, die Hannah Arendts Schriften erfahren. Seit gut dreiJahrzehnten wird sie als Zeitgenossin betrachtet, gelegentlich als »Denkerin der Stunde« verstanden.
Die tiefe Krise der liberalen Demokratien, der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die dramatische Zunahme von Flüchtlingen weltweit, die drohende Selbstentmündigung des Menschen durch eigene Erfindungen: Müsste eine Biografie über Hannah Arendt nicht diese und andere Entwicklungen zum Anlass nehmen, um ihre fortdauernde »Aktualität« herauszustellen? Waren nicht ihr Denken und Handeln dem Kampf gegen die gänzlich neuen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts verschrieben? Dem Einsatz für die Schwachen und auch deren Recht, Rechte zu haben?
Oder ist es genau umgekehrt? Ist Arendts Aktualität eine, die belegt, dass international auf das falsche Pferd gesetzt wird? Stand sie nicht aufseiten der Kolonialisten, Rassisten, Israel-Verächter? Hatte sie überhaupt Interesse an den sozialen Fragen, dem Feminismus, der Geschlechtergerechtigkeit? Stand sie nicht knietief in den Vorurteilen ihrer Zeit und ist daher für uns nur noch ein interessanter Fall?
Ich habe mich dafür entschieden, einen Schritt zurückzutreten und Hannah Arendts Leben und Werk nahezu vollständig in ihrer Zeit darzustellen. Auf die eigene Gegenwart nämlich ließ sie sich in einer besonderen Weise ein, wie diese erste auf Archivrecherchen beruhende Biografie belegt. Denn Arendt ergriff zwischen 1934 und 1940 die Gelegenheit, sich in der Pariser Emigration aktiv für jüdische Kinder und Jugendliche einzusetzen und dabei mitzuhelfen, zahlreiche Leben zu retten.
Später dann, nunmehr in den Vereinigten Staaten lebend, setzte sie ihr Engagement im Rahmen der Jewish Cultural Reconstruction fort – insgesamt zwanzig Jahre, die Arendts Handeln und Denken entscheidend beeinflussten. Diesen Jahren gilt die besondere Aufmerksamkeit dieser Biografie, denn sie sprach nicht über ihre Erfahrungen, ließ sie nicht Teil ihres Werkes werden – und doch waren diese zwei Jahrzehnte prägend für ihr Denken, das sich aus dem Handeln ergab und das wiederum von ihr reflektiert wurde. Nicht um eine Deutung dieses Zeitraumes geht es, sondern um dessen prononcierte Darstellung.
Angesichts der selbst gestellten Herausforderungen und der beschränkten Mittel, sie zu meistern, erinnerte ich mich immer wieder an eine Entdeckung Wolfgang Hildesheimers: Im Jahr 1981 veröffentlichte er Passagen eines bis dahin unbekannten Gesprächs Goethes mit dem englischen Kunsthistoriker Andrew Marbot.
»Ich mißtraue jeglicher Überlieferung, Exzellenz«, erwiderte Marbot, »auch der wahrscheinlichen. Für mich ist nur das Wahre wahr, das Wahrscheinliche dagegen Schein.« »Nicht übel, junger Freund«, sagte Goethe, »mir scheint, wir haben es hier nicht nur mit einem Zweifler zu tun, sondern auch mit einem Aufsässigen.«
Thomas Meyer
Berlin-Charlottenburg, am 8. August 2023
Einleitung
Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken, der Sache nach – denken.
Hannah Arendt, 16. September 1964
Dem weltweiten Interesse an Hannah Arendts Leben und Werk steht eine bemerkenswerte Zurückhaltung der biografischen Forschung gegenüber. Seit Elisabeth Young-Bruehls Standardwerk aus dem Jahr 1982 gab es keinen umfassenden, das heißt Leben und Werk gleichermaßen in den Blick nehmenden Versuch einer Biografie mehr.[19] Für die Schülerin Arendts waren der exklusive Zugang zum Nachlass und die intensiven Gespräche mit den Freundinnen und Freunden für ihre Erzählung maßgeblich. Die Voraussetzung dafür aber war, dass sie sich über Jahre in der Nähe Arendts bewegte. Young-Bruehl musste viele Informationen, Geschichten und Anekdoten, die sie von der Denkerin selbst erhalten hatte, nur noch mit dem ihr von anderen Berichteten abgleichen. Was von Arendt direkt überliefert wurde, was aus ihren Umfeldern hinzutrat und wie daraus die immer noch wichtige Biografie entstand, lässt sich nur zu geringen Teilen nachvollziehen. Zahlreiche Freunde und Freundinnen und Bekannte Arendts, die Young-Bruehl ihr Material zur Verfügung stellten, vernichteten vor ihrem Tod Briefe und andere Dokumente. Der Nachlass von Arendts enger Mitarbeiterin Lotte Köhler muss als verschollen gelten.
Gut vierzig Jahre später haben sich die Voraussetzungen für eine Biografie vollständig verändert. Wer über die Abertausend Publikationen zu ihrem Werk, die kritische Edition ihrer Schriften und die veröffentlichten Briefwechsel hinaus noch mehr über Hannah Arendt wissen möchte, der kann unmittelbar auf den vollständig digitalisierten und frei im Netz verfügbaren Nachlass zugreifen, der in der Library of Congress in Washington, D. C., verwahrt wird. Beschreibt man die entstandene Situation mit zwei Begriffen, die sehr häufig mit Arendt verbunden werden – »privat« und »öffentlich« –, so kann man sagen, dass sich in ihrem Fall jedwede Unterscheidungsmöglichkeit aufgelöst hat. Hannah Arendt gibt es nur noch als öffentliche Person.
Warum also diese Biografie? Wie jeder Annäherungsversuch nach Young-Bruehl möchte sie Arendts Leben und Werk für die eigene Gegenwart erschließen. Der hier gewählte Zugang unterscheidet sich gleichwohl radikal von allen bisherigen Werken. Die Biografie wertet bislang völlig unbekanntes Archivmaterial und andere bislang von der Forschung ignorierte Dokumente aus, um Arendt in ihrer Zeit darzustellen.
Das bedeutet für das erste Kapitel, dass die darin erzählte Geschichte von Arendts Familie in Königsberg neu zu schreiben war. Die recherchierten Informationen stimmten nicht mit dem überein, was hier und dort über Arendts Vorfahren zu lesen war, wichtige Personen, etwa ihre Tante Henrietta Arendt, fanden gar keine Erwähnung und vor allem ließen sich behauptete Zusammenhänge nicht belegen.
Weitaus weniger war eine Neuerzählung für ihre Zeit in der Weimarer Republik möglich, da hier die Quellenlage noch sehr viel schlechter ist. Daraus erwuchs der Entschluss, Arendts Entwicklung in einen größeren Rahmen zu stellen und jenseits der bekannten Personen, der Philosophen Martin Heidegger und Karl Jaspers, nach weiteren Einflüssen zu schauen. Die Suche ging von der schlichten Frage aus, wie die Philosophin eigentlich dazu kam, noch in den frühen Dreißigerjahren zur Historikerin und Soziologin zu werden, die das Thema der jüdischen Emanzipation in der Aufklärung zum Mittelpunkt ihrer Überlegungen machte.
Die vorliegende Biografie konzentriert sich auf zwei Lebensphasen Arendts: die Pariser Jahre nach der Flucht aus Deutschland und die Zeit in den USA bis zur Publikation ihres ersten Hauptwerkes Origins of Totalitarianism 1951, jenes Buches, das in der vier Jahre später erschienenen deutschen Fassung den Titel Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft trägt. Wenn es bislang in der Biografie Arendts, von der man immer annahm, dass sie völlig durchleuchtet sei, einen blinden Fleck zu geben schien, dann waren es die Jahre von Oktober 1933 bis zum Sommer 1940, die sie nahezu vollständig in der französischen Hauptstadt verbrachte und über die sie selbst wohl nur selten öffentlich sprach. Eine insgesamt zweijährige Archivrecherche in zahlreichen Ländern förderte nun eine überraschende Menge an Briefen und Texten von oder über Arendt zutage, die in Teilen erstmals für diese Biografie genutzt wurden. Das nach und nach deutlicher werdende Bild »Paris« unterscheidet sich grundlegend von dem bislang Bekannten. Eine kommentierte Auswahl der hier erstmals erschlossenen Materialien wird in Zusammenarbeit mit Cedric Cohen-Skalli (Universität Haifa) und Marie Behrendt (Universität Potsdam) veröffentlicht werden.
Nunmehr kann auf der Grundlage dieser Dokumente ihre Tätigkeit für mehrere, bis auf eine Ausnahme jüdische Organisationen detailliert nachvollzogen werden, vor allem für jene, die sich der Kinder- und Jugend-Alijah – der jüdischen Immigration aus der Diaspora ins »Land Israel« – verschrieben hatten. Die Folgen, die ihre Erfahrungen bei der Auswahl von Kindern und Jugendlichen angesichts der unvorstellbaren Zahl derer, die nie auch nur in die Nähe einer Chance auf Rettung kamen, für Arendts Denken, ihr Verhältnis zu Menschen, ihre Biografie im umfassenden Sinne des Wortes hatten, können in diesem Buch gleichwohl nur angedeutet werden. Der Kampf der überzeugten Zionistin für das Weiterleben ihres Volkes war ebenso durch ein unbedingtes Engagement wie durch eine tiefe Verzweiflung über die Mittel gekennzeichnet, die ihr und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern zur Verfügung standen, eine Verzweiflung, die sie aber keinen Moment von ihrer Aufgabe abhielt. In diesen Jahren lernte Arendt äußerst schmerzhafte Lektionen über Bürokratie, Hierarchien und die Ohnmacht angesichts eines Feindes, der seine totale Herrschaft über alle bisher bekannten Grenzen menschlicher Abgründe hinausführte. Die von Arendt häufig geäußerte Einsicht über die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden – dass da etwas geschehen sei, was nicht hätte geschehen dürfen, und »wir alle nicht mehr darüber hinwegkommen« würden – fußte auf ihren Pariser Erlebnissen und dem, was sie dann ab 1941 in den USA über die Ermordung der letztlich über sechs Millionen Opfer erfuhr. Aus dem hier Gesagten wird bereits klar: Arendts Werk benötigt aus dieser Perspektive eine Neubewertung.
Ihre Erfahrungen aus den Pariser Jahren fanden einen ersten Niederschlag in Texten, die nach und nach zu den Origins wurden, welche sich ganz und gar den jüdischen Kontexten verdanken, in die Arendt hineingestellt war und in die sie sich bewusst begab. Das Buch kartiert erstmals umfassend und in bewusster Einseitigkeit einen völlig zerstörten »Erfahrungsraum«, dem zu diesem Zeitpunkt jedweder »Erwartungshorizont« genommen schien. Der »Erfahrungsraum«, das ist in der Formulierung von Arendts Frankfurter Lehrer Karl Mannheim weit mehr und insofern etwas gänzlich anderes als ein Hilfsinstrument historischer Erkenntnis – es ist ein Existenzial, eine Kategorie des Lebens, die »zwischen uns in gemeinsamer ›Für-einander-Existenz‹ entstanden ist«. Zudem gilt, dass »alle gemeinsamen Erlebnisse, die sich auf außenweltliche Dinge (Landschaften, Mensch, Politik usw.) beziehen, auf diesen Erfahrungsraum bezogen werden« und »auf ihn bezogen ihre Orientierung« erhalten.[20]
Diesen gemeinsamen »Erfahrungsraum« gab es nicht mehr. Das »Meer von Blut« (Leo Strauss), das sich zwischen Jüdinnen und Juden auf der einen und Deutsche auf der anderen Seite geschoben hatte, verlangte die Arbeit der »Geretteten« am Wie des Geschehenen. Anders als das lächerliche und verräterische »Warum die Juden?« war das Wie hinsichtlich des absoluten und zu vertilgenden Feindes eine Herausforderung, die Arendt dazu verpflichtete, eine mögliche Antwort zu finden. Die Origins und weit mehr und auf andere Weise die Elemente sind ihre Antwortversuche. Die Bücher entstanden in zwei Zusammenhängen. Erstens war Arendt von 1944 bis 1952/53 Mitarbeiterin, schließlich Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction. Die insgesamt knapp zwanzig Jahre im Dienst jüdischer Organisationen waren nicht einfach Angestelltenverhältnisse, sondern Positionen, bei denen es immer ums Leben und Überleben ging. Zweitens ist die öffentliche Neuerfindung ihrer Person zu nennen. Arendt ergreift die Möglichkeiten, die ihr angeboten werden: als Publizistin, als Intellektuelle, als – so begreift sie sich – politische Theoretikerin, als Philosophin, was ihr ganz in Übereinstimmung mit der sokratischenTradition kein Beruf ist, vielmehr eine Lebenshaltung. Ihre Nachrichten aus dem beschädigten Leben zielen gleichwohl nicht auf dessen Negativität, vielmehr richten sich die Überlegungen an dem Ziel aus, dem unwiderruflich zerstörten »Erfahrungsraum« einen »Erscheinungsraum« an die Seite zu stellen. Dass dieser denkrevolutionäre Ansatz in einem Buch entwickelt wird, das den Titel Vita activa trägt, weist darauf hin, dass Arendt einen »Erwartungshorizont« erschafft, der jenseits der mitzerstörten Traditionen von Politik und Philosophie liegt.
Sie folgt auch hier jenen Einsichten, die Karl Mannheim, mit dem sie zu dieser Zeit im Austausch stand, 1935 so formulierte:
Ganz anders ist aber der Erwartungshorizont der Menschen, die in Zeiten gesellschaftlichen Strukturwandels leben. Sie rechnen dann nicht nur, womit auch der Mensch der statischen Gesellschaft rechnet, mit einer Unzahl von unbekannten Einzeltatsachen, sondern mit dem möglichen Wandel des Prinzips, nach dem die neuartigen Tatsachen als neuartige geschaffen und zusammengehalten werden. Man rechnet dann etwa nicht nur mit schwankenden Werten in der Kaufkraft des Geldes, sondern mit einem völligen Zusammenbruch einer Währung; man rechnet nicht nur mit einem Kabinettswechsel, sondern mit der Möglichkeit, daß eine nicht parlamentarische Regierungsform oder daß überhaupt keine Staatsmacht sich etablieren kann, oder daß eine Staatsmacht ihre Prinzipien in Bezug auf die Verwendung von Gewalt und Überredung ändert. Man kann plötzlich auch damit rechnen, daß nicht nur Einzelne unzuverlässig und verlogen sind, sondern daß aus einer ganzen Sphäre der Beziehungen, aus dem ökonomischen Bereich, aus dem des Privaten die vormalige Zuverlässigkeit und Solidität der Menschen, auf die man sich durchschnittlich verlassen konnte, plötzlich verschwindet, weil Krieg, Revolution, dem Bürgerkrieg ähnliche Auflösungsprozesse jenes Rahmenwerk im sozialen Geschehen zerstören, auf dessen Bestand letzten Endes die ältere Verhaltungsweise eigentlich gegründet war. In solchem Falle können wir dann von einem Aufgeben des früher beschränkteren Erwartungshorizontes zugunsten eines erweiterten Erwartungshorizontes reden. In solchen Zeiten zeigt sich die Geschichte den Menschen in einer viel wesentlicheren Form, sie gewährt dem Beobachter einen Einblick in die beweglich gewordene Schicht jener »principia media«, die das Rahmenwerk und die Struktur nur eines Zeitalters im Gesellschaftsgeschehen ausgemacht haben. In solchen Fällen entsteht für die Wissenschaftler die Möglichkeit, Strukturgesetze, die sie für ewig gehalten haben, von denen, die nur eine Epoche oder ein Gesellschaftsstadium begründeten, abzuheben. Es entsteht ferner die Möglichkeit, jene zunächst scheinbar einzeln und isoliert auftretenden Tatsachen, die aus dem alten Rahmenwerk herausfielen und das neue Prinzip nur andeutungsweise enthielten, richtig zu diagnostizieren und das in ihnen sich durchsetzende und sie tragende neue Strukturgesetz auszusprechen.[21]
Arendt lebte in Zeiten eines grundsätzlichen »Strukturwandels«, der zum einen durch den Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg und die Shoah ausgelöst und geprägt wurde und der zugleich durch die fortdauernde Präsenz des Sowjetkommunismus und seiner invasiven Gewaltexzesse eine Kontinuität erhielt, die Kants Frage »Was ist der Mensch?« eine zuvor unbekannte existenzielle Dringlichkeit gab. Der Kern dieser Entwicklung wird in den zwei Kapiteln zum französischen Exil und zur Entstehung ihres Hauptwerkes Origins of Totalitarism (1951) nachgezeichnet.
Die weiteren Kapitel bieten jeweils in sich geschlossene Geschichten, Rekonstruktionen, Überlegungen und bilden zusammengenommen eine Neuverortung von Arendts Leben und Werk.
Arendts Bücher und eine mit dem Begriff »zahlreich« allenfalls angedeutete Menge an veröffentlichten wie in Archiven liegenden Texten werden in einem separaten und kompakten Kapitel behandelt, aber nicht, weil sie in irgendeiner Weise weniger wichtig wären als die Origins bzw. die Elemente. Vielmehr folgen sie allesamt der Logik Arendts, lassen ihre Denkentwicklung erkennen, geben Auskunft über die Fort- und Umschreibung einmal gewonnener Einsichten. Sehr zugespitzt formuliert, sind sie bei allem Außergewöhnlichen, das sie jeweils zu sagen haben, Ergebnisse eines beruhigten Schreibens. Arendts Prosa ändert sich nach dem Abschluss der beiden großen Werke fundamental: Sie verfügt über das Material und bewegt sich darin souverän. Sie stellt Thesen auf und behauptet, sie argumentiert und widerspricht, sie befürwortet und lehnt ab. Die Texte begründen Diskurse, zugleich enthalten sie – wie verändert auch immer – das, was sich in den traditionellen Antwortregistern findet. Das bedeutet, dass sich die aufgerufenen Zusammenhänge selbst ändern. Wie noch nachgewiesen wird, gilt die Auseinandersetzung mit den fragwürdig gewordenen Traditionen. In Arendts gesamtem Œuvre gibt es zwei Ausnahmen davon: »Reflections on Little Rock«, ihren Aufsatz zu den gewaltsamen rassistischen Ausschreitungen in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Arkansas im Jahr 1957, und Eichmann in Jerusalem. Beide reagieren nochmals ausdrücklich auf den zerstörten »Erfahrungsraum«.
Des Weiteren sind Martin Heidegger sowie Gertrud und Karl Jaspers zu nennen. Arendts Verbindung mit dem Philosophen kann dank der großartigen Edition von Jaspers’ Buch »über Hannah« durch Georg Hartmann als erforscht gelten. Die vorliegende Biografie rekonstruiert die Binnenperspektive, Arendts Reaktionen auf Heidegger, die Diskussionen zwischen ihr und dem Ehepaar Jaspers. Gertrud Jaspers wurde von ihr immer als gleichberechtigte Partnerin ihres Mannes betrachtet – und so schrieben sie sich auch. Damit wird eine Konstellation wiederbelebt, wie sie seinerzeit tatsächlich bestanden hat.
Die nächsten Kapitel folgen der Fluchtlinie der vorherigen und entstanden aus der Verwunderung darüber, dass Arendts Leben und Werk zwar durchleuchtet scheinen, aber das Offensichtliche – womöglich, weil es das Offensichtliche ist – umgangen wurde. Da wäre zum Beispiel Hannah Arendt, die »Medienintellektuelle«. Dass sie eine solche war, dürfte nicht zuletzt durch das 1964 im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlte Gespräch mit dem Journalisten Günter Gaus keine Frage mehr sein. Aber war’s das? Arendts Präsenz in den Medien zu betrachten – das bedeutet zu überlegen, wie, wann und wo sie sich zu Wort meldete, glaubte, intervenieren zu sollen, und wie sie die wurde, die alle zu kennen glauben.
Auf den ersten Blick ähnlich verhält es sich mit Arendts Rolle als Frau – dass über sie Anfang der 1970er-Jahre eine intensive Diskussion in New York stattgefunden hat, die einen Blick zurück bis auf Arendts Anfänge als Publizistin erlaubt. Das Kapitel »Frauen über Frauen« macht auf übersprungene Stufen in Arendts Leben und Werk aufmerksam, die zudem das gerne gepflegte Vorurteil widerlegen, dass das Interesse an ihrer Biografie ein Phänomen ist, das erst nach ihrem Tod eintrat.
Der Schluss schließlich führt in Kürze bis zu Arendts plötzlichem Tod am 4. Dezember 1975.
Wie jede Biografie, so besteht auch diese aus einer Reihe von Annäherungen. Damit verschiebt sich naturgemäß jeder Anspruch auf Vollständigkeit dorthin, wo bereits reichlich Material angehäuft liegt: in jenes Mythenreich, aus dem die Vorstellungen einer »Essenz« des Lebens immer neu geschöpft werden. Biografien sind im Zugang und in der Ausführung so verschieden wie das, womit sie sich beschäftigen – dem jeweils dargestellten Leben. Daher gibt es auch keine Rezepturen, keine Standardisierungsmöglichkeiten, nichts, was stets gilt, sieht man von Geburt und Tod einmal ab. Einzig die vorgenommenen Annäherungen sind begründungsbedürftig. An dieser Stelle mag genügen, dass der vorliegende neue Versuch einer Biografie sich ganz auf das konzentriert, was in der bisherigen, kaum mehr zu überblickenden Literatur zu Arendts Leben und Werk gar nicht oder allenfalls am Rande behandelt wurde.
Diese Biografie ist auch darin die erste, bewusst damit umzugehen, dass Kolleginnen und Kollegen andere Schwerpunkte gesetzt haben. Gleichwohl ist sie keine bloße Ergänzung, erzählt vielmehr eben eine andere Geschichte. Sie ist nicht gegen andere Deutungen geschrieben, vielmehr bietet sie eine eigenständige, gänzlich neue an.
Die Entscheidung, sich an neu entdeckten Quellen zu orientieren, hat naturgemäß Folgen. Manche Geschichte, die sich als Teil der Überlieferung und damit ihrer »persona« etabliert hat, wird man hier vergeblich suchen, in der Regel weil sich keine Belege für sie finden ließen oder sie längst den Blick auf Arendt verzerrt, wenn nicht entstellt haben. Sehr knapp gehalten werden die Ausführungen zu Menschen und Themenfeldern, zu denen auch durch intensive Recherchen keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Dank der Forschungen des Leipziger Kulturwissenschaftlers Ringo Rösener und der in Yale lehrenden Germanistin Barbara von Bechtolsheim hat sich im Falle Heinrich Blüchers die Situation vollständig geändert. Zu ihm, wie auch zu Günther Stern Anders, der dank sorgfältiger Editionen seit Jahren in seiner Bedeutung wächst, können gleichwohl zahlreiche neue, wichtige Informationen vorgestellt werden.
In dieser Biografie werden Zusammenhänge Beachtung finden, Namen fallen, die bislang nicht im Rampenlicht der Arendt-Biografik standen oder gänzlich unbekannt waren. Dabei geht es nicht um späte »Gerechtigkeit« für bislang Übersehenes oder weniger Beachtetes, sondern um andere, gelegentlich neue Blicke auf Vertrautes. Leopoldine Weizman, Martha Mundt, Juliette Stern und Eva Stern etwa wären weitere Personen, denen Arendt in wichtigen Phasen ihres Lebens begegnete. Es ist kein Zufall, dass es sich dabei zum Großteil um Frauen handelt. Sie standen entweder in direktem Arbeitskontakt mit Arendt oder waren in ähnlichen praktischen Zusammenhängen tätig.
Dass sich Leben und Werk in besonderer Weise aufeinander beziehen, wurde von Hannah Arendt selbst immer wieder zum Gegenstand ihrer Überlegungen gemacht. Folgt man diesen, so steht zwischen Leben und Werk die »Erfahrung«, genauer: die »persönliche Erfahrung«. Das hieß für Arendt nicht, dass jeder Text autobiografisch zu sein habe, vielmehr nahm dieses »Selbst« die gemachten Erfahrungen zum Anlass der Reflexion. Damit ist bereits ein Abstand bezeichnet, der entscheidend ist für die Beziehung zwischen den beiden Polen Leben und Werk, die sich durch das Denken gegenseitig durchdringen, ohne ineinander aufzugehen.
Obwohl Arendt sich seit den frühen Dreißigerjahren mit der Wechselwirkung von Leben und Werk und den Einflussfaktoren auf Biografien in Geschichte und Gegenwart auseinandergesetzt hatte, sollte es bis ins Jahr 1961 dauern, bis zur »Einleitung« ihrer auf Englisch publizierten Textsammlung Zwischen Vergangenheit und Zukunft, dass sie auf die Problematik zu sprechen kam:
Wenn man die Geistesgeschichte unseres Jahrhunderts nicht in der Form aufeinanderfolgender Generationen schreiben würde, wo der Historiker der Abfolge von Theorien und Standpunkten buchstäblich treu bleiben müsste, sondern in Form der Biografie einer einzelnen Person, die lediglich auf eine metaphorische Annäherung an das zielt, was tatsächlich in den Köpfen der Menschen vor sich ging, würde sich herausstellen, dass der Geist dieser Person gezwungen war, nicht nur einmal, sondern zweimal den vollen Kreis zu durchlaufen: zuerst, als er aus dem Denken in das Handeln flüchtete, dann wieder, als das Handeln, oder vielmehr das Gehandelthaben, ihn zurück ins Denken trieb. Wobei es von einiger Relevanz wäre zu bemerken, dass der Aufruf zum Denken in der seltsamen Zwischenzeit entstand, die sich manchmal in die historische Zeit einfügt, wenn nicht nur die späteren Historiker, sondern auch die Akteure und Zeugen, die Lebenden selbst, sich einer Zeitspanne bewusst werden in der Zeit, die ganz bestimmt ist von Dingen, die nicht mehr sind, und von Dingen, die noch nicht sind. In der Geschichte haben diese Intervalle mehr als einmal gezeigt, dass sie den Moment der Wahrheit enthalten können.[22]
Wenn es eine methodische Anleitung und einen Verständniszugang zu Hannah Arendts Leben und Werk gibt, dann findet er sich hier. In der Tat: Die Heidegger- und Jaspers-Schülerin wurde durch die Zeitläufte politisiert, bewegte sich aus der Philosophie in die moderne jüdische Geschichte und wählte mit Rahel Varnhagen eine etablierte Außenseiterin, um das Innere einer mit sich selbst ringenden Minderheit auszuleuchten. Mit dem 1933 einsetzenden Traditions- und Zivilisationsbruch flüchtete sie aus dem Denken ins Handeln der Kinder- und Jugend-Alijah, einer seltsamen Zwischenzeit, die es erlaubte, wieder mit dem Denken zu beginnen, um dann der Vernichtung der europäischen Judenheiten zusehen zu müssen und schließlich die eigenen Erfahrungen mit den Erinnerungen erneut und gänzlich anders nach-denkend zu verbinden.
Zweimal durchlief Arendt den »vollen Kreis«. Beide Kreisläufe wurden »verarbeitet« in einem umfangreichen Werk, das nicht verschweigen wollte, dass die Grenzen, die vermeintlich zeitenthobene Philosophie und eine traditionsvergessene politische Theorie ihr setzten, nicht anerkannt werden durften. Ihre Verwerfungen betrafen aber nicht nur Philosophie und politische Theorie, sondern auch die Erwartungshaltungen, die man gegenüber Arendt hegte: Sollte die Tatsache, dass sie ihr Leben der zionistischen Sache in Europa widmete, sich über viele Jahre für den sprichwörtlich »Geretteten Rest« engagierte, wirklich mit der Kritik an einer politischen Entscheidung – der Gründung des Staates Israel – null und nichtig geworden sein?
War es wirklich so, dass die scharfe Kritik an einzelnen Persönlichkeiten und dem aus ihrer Sicht gänzlich unpolitischen Verhalten der leitenden Funktionäre des jüdischen Volkes zwischen 1940 bis 1945 in dem Buch Eichmann in Jerusalem zu Recht mit dem Absprechen der »Liebe zum jüdischen Volk« beantwortet wurde? Oder war Gershom Scholems »Ahavat Israel«, ganz anders als man meinen könnte, eben keine in der jüdischen Traditionsliteratur verwendete Phrase, sondern eine zionistische Formel, der Arendt aufgrund ihrer Erfahrungen in Paris, Gurs und Lissabon einfach nicht entsprechen wollte? Warum aber sprach sie nie offen aus, dass ihr Kampf gegen den Nationalsozialismus einer war, in dessen Zentrum die Rettung von Kindern und Jugendlichen stand? Ob es nun 120 Kinder und Jugendliche waren, für deren Fahrten nach Palästina sie direkt verantwortlich war, oder doch die mindestens 500 bis 700, deren Namen und Lebensläufe auf ihrem Schreibtisch landeten oder denen sie in Ausbildungslagern begegnete und über deren weitere Schicksale sie zumindest nicht nachdenken musste – die Differenz ändert nichts daran, dass die Frage nach Arendts »Liebe zum jüdischen Volk« womöglich nochmals neu zu stellen sein wird.
Diese und ähnliche Fragen sollen und können jetzt nicht beantwortet werden. Die Biografie stellt gleichwohl das Material vor, mit dem künftige Antworten gefunden werden können. Sie ist ein erster umfassender Versuch, das bislang Unbekannte zu beleuchten.
Zuhause auf der »Insel Venedig« – Familiengeschichte(n) in Königsberg
Hannah Arendt war eine Jüdin aus Königsberg.
In der Stadt am Pregel verbrachte sie mit ihrer Familie, ihren Verwandten und einer großen Zahl von Freundinnen und Freunden Kindheit und Jugend, besuchte dort verschiedene Schulen und legte nach Umwegen ihr Abitur ab. Fotos belegen, dass sie sich gerne in der Umgebung der Stadt und an der nahen Ostsee aufhielt. Das vertraute Königsberg war ihr Rückzugsort, wenn sie Ruhe suchte, so etwa, als sie ihre Dissertation über den »Liebesbegriff bei Augustin« zu schreiben und später umzuarbeiten begann. In Königsberg, wie wir später sehen werden, hielt sie auch den einzigen nachweisbaren öffentlichen Vortrag, bevor sie 1933 aus Deutschland floh.
Verständlicherweise spielte der seit dem 1. Januar 1920 zu Hannover gehörende Geburtsort Linden nie eine Rolle in ihren Lebensrückblicken, da ihre Eltern mit ihr im Alter von zwei Jahren 1908 oder Anfang 1909 nach Königsberg zogen. Doch selbst an die Studienorte Marburg und Heidelberg erinnerte sie sich öffentlich in erster Linie über Martin Heidegger und Karl Jaspers – die Städte selbst kamen kaum vor. Das Intermezzo in Frankfurt Anfang der Dreißigerjahre wurde ebenfalls nur über Personen gewürdigt.
In New York dann, wo Arendt seit der Flucht aus Lissabon im Mai 1941 bis zu ihrem Tod am 4. Dezember 1975 lebte, gab die Staatenlose 1948 eine Schrift des Königsberger Historikers Ferdinand Gregorovius unter dem Titel The Ghetto and the Jews of Rome heraus, die im deutschen Judentum seit der Erstpublikation 1853 eine wichtige Rolle spielte. Dass Arendts Name zu Königsberg gehörte und sich in ihm ihr Jüdischsein dokumentierte, davon war sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der Shoah überzeugt.[23] So war sie in dem Fernsehinterview mit Günther Gaus am 16. September 1964 sehr darauf bedacht, ihre Familiengeschichte – und das war in erster Linie die Geschichte der Familie Arendt und ihrer Mutter Martha Cohn – ganz auf Königsberg zu beziehen, eine Stadt, die seit 1946 Kaliningrad hieß, zur Sowjetunion gehörte und für niemanden im Westen mehr erreichbar war. Nur einmal, in ihrem zeitgleich zu dem Gespräch mit Gaus erschienenen Buch Eichmann in Jerusalem, kam Arendt ausführlich auf Königsberg zu sprechen. Sie zitierte aus dem seinerzeit viel gelesenen Ostpreußischen Tagebuch von Graf Hans von Lehndorff[24] und leitete die Passage mit folgenden Sätzen ein:
Die nächste Geschichte trifft den Kern der Sache noch besser, da sie von einer Frau berichtet, die keine »Führerin« und wahrscheinlich nicht einmal Parteimitglied war. Sie spielt in einer ganz anderen Gegend Deutschlands, in Ostpreußen im Januar 1945, einige Tage bevor die Russen Königsberg zerstörten, die Ruinen der Stadt besetzten und die ganze Provinz annektierten.[25]
In Arendts Veröffentlichungen, aber auch in Briefen oder in zeitgenössischen Berichten über sie gibt es fast keine melancholischen Anwandlungen, kaum ein Zurücksehnen nach vergangenen Zeiten und keine das Erlebte beschwörende Nostalgie. Und wenn doch, dann blieb sie äußerst knapp, immer auf konkrete Personen und nie auf Allgemeines bezogen.
Aber welches war das Königsberg von Arendts Kindheit und Jugend? Gab es Lieblingsorte? Buchhandlungen, Cafés, Plätze? Wo traf sie sich mit ihren Freundinnen und Freunden? Oder war Königsberg letztlich wie andere Städte doch nur der Name eines Raumes, in dem sie fast ihr gesamtes Leben bis zum Herbst 1924 verbrachte?
Die zahlreichen Geschichten über Arendts Brillanz, die ihr den Beinamen »Pallas Athene« einbrachten, über die junge Nietzsche-Leserin, die die griechischen Klassiker ebenso las wie Karl Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen, die häufig fehlende Schülerin – all das und noch viel mehr wurde teils von ihr, teils von anderen erzählt, zumeist Jahrzehnte nach den Ereignissen. Doch will man sich nicht mit den vielen kursierenden Episoden und einer Auswahl an Stellen zufriedengeben, die eindeutige Antworten vorgeben, ist ein Blick in die Königsberger Zeit der jüdischen Familie Arendt geboten.
Neustart am Pregel – Stammvater Aron Arendt
Folgt man den zugänglichen Quellen, dann beginnt die Geschichte der Familie Arendt im gut dreißig Kilometer Luftlinie entfernten, südwestlich von Königsberg gelegenen Zinten, das 1313 die Stadtrechte erhielt. Die Chroniken verzeichnen um das Jahr 1810 erstmals eine dauerhaft dort wohnende jüdische Bevölkerung. Eine Zählung im Jahr 1831 ermittelte 2069 Einwohner, davon etwa 80 Jüdinnen und Juden. Zwei von ihnen heirateten laut Königsberger Heiratsregister am 6. Januar 1839: Aron Arndt und Henriette Levi – der Urgroßvater und die Urgroßmutter Hannah Arendts. Gelegentlich werden noch die Eltern von Aron Arndt (in der Schreibweise Arendt) erwähnt, doch zu Joseph und Rosa Arndt konnte nichts ermittelt werden. Dass sie aus Bartenstein kamen, wo zum Beispiel Arons Bruder Simon geboren wurde, ist durchaus möglich, würde die Geschichte der Familie Arndt in Ostpreußen folglich um eine weitere Generation verlängern. Der 1818 geborene Aron firmierte in den Akten zur Zeit der Heirat als »Handelsmann«, aber worin seine Geschäftstätigkeit genau bestand, lässt sich ebenso wenig herausfinden wie genauere Angaben zu seiner Ehefrau.
Kurz nach der Heirat erfolgte die Übersiedlung nach Königsberg, wo am 3. April 1841 die Tochter Fanny zur Welt kam. Knapp zwei Jahre später, am 3. Februar 1843, folgte Marcus, im Jahr darauf Charlotte, im Anschluss die im Kindesalter verstorbene Dorothea, dann Selly und Rosalie, Benno 1853 und Margarethe 1855, die auch nur acht Jahre alt werden sollte.
1859 wurde schließlich Johanna geboren, nach der, so eine Variante der Familiengeschichte, Hannah Arendt benannt wurde. Johanna würde den sehr vermögenden jüdischen Königsberger Kaufmann Georg Holldack heiraten, sich später evangelisch taufen lassen und zwei Söhne haben, derer man sich bis heute erinnert. Hans Holldack war ein international bekannter Pionier der technisierten Bodenbearbeitung und Professor für Landmaschinenlehre in Leipzig. Der ein Jahr jüngere Jurist und Rechtsphilosoph Felix Holldack lehrte an der Technischen Hochschule Dresden und der Forstakademie Tharandt und setzte sich u. a. mit rechtlichen Methodenfragen auseinander.[26] Als sogenannte Halbjuden mussten die Brüder 1934 (Felix) und 1935 (Hans) aus ihren Ämtern scheiden; Johanna starb 1936.
Über Aron Arendt, wie er sich bald nannte und unterzeichnete, während er bei den Behörden weiterhin als Aron Arndt geführt wurde, ist nur sehr wenig überliefert. Gelegentlich findet man ihn in den vielen, häufig auf unklaren Quellen beruhenden Geschichten, die über Hannah Arendt und ihre Vorfahren im Umlauf sind. Nur selten jedoch lassen sich Übereinstimmungen zwischen dem, was über ihre Familie »erzählt« wird, und den Fakten, die sich in den Archiven finden, feststellen.
Zumeist ist man auf Mutmaßungen angewiesen: Sehr wahrscheinlich waren die Arendts in Arons Generation observant, womöglich sogar orthodox. Über das sogenannte Landjudentum wurde im Verhältnis zur städtischen jüdischen Bevölkerung nur wenig geforscht, sodass über die Zusammensetzung der Gemeinde in Zinten und die Gründe für den Umzug nach Königsberg nichts gesagt werden kann.[27] Gleichwohl gab es nur sehr wenige ostpreußische jüdische Landgemeinden, die wesentlich durch die jüdische Emanzipation geprägt waren, das heißt, bei denen sich liberale und säkulare Tendenzen durchgesetzt hatten. Dass es hingegen ökonomische Gründe waren, die die Haupt- und Residenzstadt Königsberg für Aron Arendt attraktiv erscheinen ließen, darf angenommen werden, wenn man die Entwicklung der Königsberger Judenschaft in den Blick nimmt.
Deren Gemeinde konnte Aron in jedem Fall wachsen sehen und auch die Etablierung einiger ihrer Mitglieder in Politik und Wirtschaft miterleben. Aber verfolgte er konkret etwa die politischen Aktivitäten des berühmten Arztes, 1848ers und späteren Sozialdemokraten Johann Jacoby? Spielte die Geschichte der vermeintlichen geistigen »Weltbürgerrepublik« (Jürgen Manthey) Königsberg eine Rolle in seinem Leben? Und war ihm die mutmaßliche Inkarnation des Königsberger Charakters, der bedeutendste deutsche Philosoph, Immanuel Kant, bekannt, dessen Berühmtheit zudem bei den ersten Ambitionen, die Stadt für auswärtige Besucher attraktiv zu machen, von einiger Bedeutung war? Diese und zahllose andere Fragen sind nicht zu beantworten. Auch lässt sich nichts über Arons mögliche Wahrnehmung des wichtigen intellektuellen Politikers Theodor von Schön sagen, der über viele Jahre maßgeblich die Königsberger und ostpreußische Geschichte bestimmte.[28]
Wechselt man die Perspektive, so stellt sich die Frage, ob Aron Arendt Kenntnis über die Geschichte der jüdischen Gemeinde Königsberg erlangte, die Joseph Levin Saalschütz, ein gebürtiger Königsberger und der erste Jude, der an der 1544 gegründeten Albertus-Universität promoviert wurde und sich dort habilitierte, von 1857 bis 1859 publizierte.[29] Drei Jahre später veröffentlichte Saalschütz einen »Nachtrag«, in den er eine Information aufnahm, die auch die Situation Aron Arendts besser verstehen lässt. Denn dem »Handelsmann« kann nicht entgangen sein, dass sich der für die politische Entwicklung Königsbergs seit dem Ende der 1830er-Jahre maßgebliche Bürgermeister, der spätere Oberbürgermeister Carl Gottfried Sperling, für die Gleichstellung der Juden in Preußen eingesetzt hatte. In Saalschütz’ »Nachtrag«[30] wurde Sperling ausführlich mit einer Rede zitiert, die bereits die Zeitgenossen bewegte und maßgeblich zu einer Verständigung zwischen antijüdischen Hardlinern und liberalen Pragmatikern beitrug, wie sie sich in dem 73 Paragrafen umfassenden »Gesetz über die Verhältnisse der Juden« vom 23. Juli 1847 ausdrückte.[31] Sperling war Berichterstatter dieses für die behauptete Gleichstellung – »neben gleichen Pflichten auch gleiche Rechte mit unseren christlichen Untertanen«, wie es in § 1 über die »Bürgerliche(n) Verhältnisse der Juden« heißt – so wichtigen, über das Emanzipationsedikt von 1812 weit hinausgehenden Gesetzes. Er argumentierte laut der Dokumentation von Saalschütz sehr modern: Der Staat solle sich auf die »äußeren Bekenntnisformeln« beschränken, die die Bürger abgäben, und nicht etwas über deren Religion in Erfahrung bringen wollen, was er noch nicht wisse. Folgt man Saalschütz, war Sperling offensichtlich ein genauer Kenner der gängigen antijüdischen Stereotype und ein geschickter Rhetor.
Insbesondere die Möglichkeit der Ämterübernahme durch Juden wurde in Königsberg umgesetzt und die Stadt in der Folge für aus dem Baltikum, Weißrussland und Polen kommende jüdische Kaufleute attraktiver, da sich die politische Offenheit auch auf den schon immer intensiven Ost-West-Handel auswirkte. Aron Arendt war folglich Zeuge und vermutlich auch Profiteur des wirtschaftlichen Aufschwungs. Weil er aus einer preußisch-jüdischen Familie stammte, musste er nicht wie die meisten osteuropäischen Kollegen und Konkurrenten im stark regulierten Kommissionsgeschäft reüssieren, sondern konnte direkt im Handel tätig werden.[32]