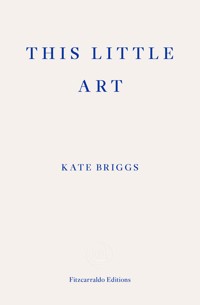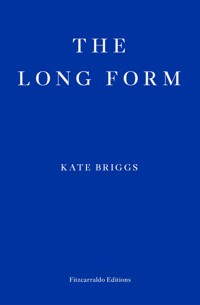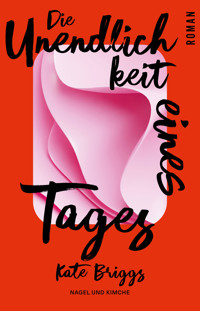
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kate Briggs erzählt die Geschichte von Helen und ihrem Baby Rose, zwei Menschen, die gemeinsam einen Tag komponieren. Es ist ein Tag voller Bewegungen und Improvisationen, gewöhnlicher und ungewohnter Rhythmen, bestimmt vom Anhalten und Wiederanfangen. Die Dinge und Aufgaben des Alltags erhalten im Licht der gemeinsamen Aufmerksamkeit von Mutter und Kind eine epische Qualität. Doch dann wird ihr morgendlicher Rhythmus unterbrochen: Ein Bote bringt ein gebrauchtes Exemplar von Henry Fieldings »Tom Jones« und der intime Raum, den Helen mit ihrem Baby teilt, verbindet sich mit Fieldings Roman und lässt Abschweifungen zur Form des Romans und Themen wie Care-Arbeit, Klasse und Freundschaft entstehen.
»Die Unendlichkeit eines Tages« erzählt von den überwältigenden ersten Wochen der Elternschaft, von der Nähe zwischen Mutter und Kind, von Fürsorge und Schlafmangel und ergründet dabei die Funktion von Zeit im Roman auf einzigartige Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Kate Briggs erzählt die Geschichte von Helen und ihrem Baby Rose, zwei Menschen, die gemeinsam einen Tag komponieren. Es ist ein Tag voller Bewegungen und Improvisationen, gewöhnlicher und ungewohnter Rhythmen, bestimmt vom Anhalten und Wiederanfangen. Die Dinge und Aufgaben des Alltags erhalten im Licht der gemeinsamen Aufmerksamkeit von Mutter und Kind eine epische Qualität. Doch dann wird ihr morgendlicher Rhythmus unterbrochen: Ein Bote bringt ein gebrauchtes Exemplar von Henry Fieldings »Tom Jones«, und der intime Raum, den Helen mit ihrem Baby teilt, verbindet sich mit Fieldings Roman und lässt Abschweifungen zur Form des Romans und Themen wie Care-Arbeit, Klasse und Freundschaft entstehen.
»Die Unendlichkeit eines Tages« erzählt von den überwältigenden ersten Wochen der Elternschaft, von der Nähe zwischen Mutter und Kind, von Fürsorge und Schlafmangel und ergründet dabei die Funktion von Zeit im Roman auf einzigartige Weise.
Zur Autorin
Kate Briggs ist Schriftstellerin, Lektorin und Übersetzerin. Sie stammt aus Somerset in Großbritannien und lebt in Rotterdam, wo sie das Projekt @shortpiecesthatmove gegründet hat. Sie ist Autorin von »This Little Art«, einem erzählerischen Essay über die Praxis des literarischen Übersetzens; 2021 wurde sie mit dem Windham-Campbell Prize ausgezeichnet. »Die Unendlichkeit eines Tages« ist ihr erster Roman und stand auf der Shortlist für den Goldsmiths Prize und den Republic of Consciousness Prize.
Kate Briggs
Die Unendlichkeit eines Tages
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Voß
NAGEL UND KIMCHE
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel The Long Form bei Fitzcarraldo Editions, London.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
© Kate Briggs, 2023
Deutsche Erstausgabe
© 2025 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGEL UND KIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von FinePic®, München
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783312014170
www.nagel-kimche.ch
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberinnen und des Verlags bleiben davon unberührt.
»Die Schwierigkeit für mich: Wie könnte der Übergang … von einer kurzen, fragmenthaften Form (›Notiz‹) zu einer langen, zusammenhängenden Form (üblicherweise als ›der Roman‹ bezeichnet) gelingen?«
Roland Barthes
»Die schöpferische Tätigkeit im Bereich der Prosa schreitet nur langsam voran, beginnt in abgegrenzten Bereichen und ereignet sich unauffällig. Wir bemerken sie kaum und erwarten deswegen, dass Erneuerung von anderswoher kommt.«
Gary Saul Morson & Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics
Gleich als Erstes
Mutmaßungen und Bewegungen im Wohnzimmer
Der Anfang jedes neuen Projekts war immer zugleich eine Fortsetzung. Im Augenblick ging es um das grundlegende, aber keineswegs klar umrissene Projekt Schlaf.
Ein Gemeinschaftsprojekt: Helens und das ihres Babys, die beide jeden Morgen gleich als Erstes genau dort weitermachten, wo ihre lange, gemeinsam durchwachte, interaktive Nacht geendet hatte.
Helen: groß im Verhältnis zum sie umgebenden Raum, das schwere Haar offen herabhängend, sodass sie im Nacken schwitzte.
Das Baby: hellwach, wand sich lebhaft auf ihrem Arm.
Am Boden ausgebreitet die Spieldecke: ein dickes, aus vier unterschiedlichen Teilstücken zusammengesetztes Quadrat.
Die Farben schon etwas ausgeblichen. Von der Sonne, von den vielen Runden in der Trommel in der Waschmaschine von jemand anderem. Die Oberfläche abgegriffen, abgelutscht; die Gewebestruktur zum Teil bereits bis in die feineren Fäden hinein ausgeforscht.
Und doch waren diese Spieldecke, die in einer riesigen wiederverwendbaren Einkaufstasche verpackt gewesen war, sowie die in einen Plastikstern integrierte Lightshow und die gebrauchten Strampler für Helen und das Baby etwas vollkommen Neues.
Eigenartig, gnadenlos, erschreckend neu.
Ging man über die Spieldecke, ließ sie den dünnen Teppichboden darunter weicher wirken.
Überhaupt hatte sie die Art, den Raum zu bewohnen, insgesamt verändert.
Schlaf
Einer der Spieldeckenbereiche wirkte landwirtschaftlich: seidiges Getreide in unterschiedlichen Grüntönen, durchfurcht von dunkelbraunem Kunstfell.
Helen wollte den Kopf auf diesen Feldfleck betten.
Sie war müde.
Wir könnten doch hier ein bisschen schlafen, dachte sie.
Sie blickte nach unten. Der Kopf des Babys lag als warme, schwere Kugel in ihrer Armbeuge, sein übriger Körper war zappelig und leicht.
Die Kleine hob das Kinn, schaute mit festem Blick zurück.
Helen ließ ihren Gedanken zum Gesichtsausdruck werden: lächelnd und nickend. Schickte ihn als Angebot zum Baby.
Ganz bewusst ließ sie seinen Blick dabei ihr Gesicht erkunden.
Dann aber überlegte sie es sich anders, zog ihr Angebot zurück: Nein, ich entscheide hier.
Sie wandte den Blick ab und bekräftigte vor sich selbst: Ich entscheide.
Und ich sage, wir legen uns jetzt hier hin und schlafen.
Sich ohne Abstützen hinknien: erst in die Hocke gehen, dann auf die Knie. Eine wackelige, ungraziöse Angelegenheit, diese Übung mit einem Baby auf dem Arm auszuführen.
Sie legte das Kind vorsichtig auf dem Plüschfeld ab.
Es drückte den Rücken durch und trat mit den Füßen, denn es spürte eine Veränderung der Oberfläche: diese plötzliche Ebenheit unter sich; wie es in sie einsank.
Helen legte sich ebenfalls hin, streckte sich der Länge nach aus, drehte sich dann zum Baby und rückte ganz nah an es heran.
Die Gerüche des Feldes vermischten sich mit den verschiedenen warmen Gerüchen des Babys.
Das Feld roch zitronig.
Und noch nach etwas anderem: leicht chemisch.
Es gab nach, war bequem: fast wie ein Federbett. Nur spitz und uneben an manchen Stellen, weil Plastikteile und andere grobe Sachen darunter lagen.
Sie stupste mit der Nase die Schulter des Babys an, zog ihre Knie so weit hoch, bis sie die winzigen Fersen der kleinen Füße berührten und ihr Körper zu einer schützenden Behälterwand geworden war.
Das Baby verdrehte die Händchen ineinander, seine Beine zuckten leicht. Es öffnete und schloss den Mund. Schräg über ihm erregte – fesselte – etwas seine Aufmerksamkeit.
Helen legte den Kopf auf ihren Arm, atmete aus. Ihr Atem wehte als warme Brise über das Gesicht des Babys.
Dann überlegte sie es sich anders, verlagerte ihre Position: bettete die Wange in die rechte Handfläche.
Sie flüsterte schlaf gut und schloss die Augen.
Nach und nach ließ sie einen Körperteil nach dem anderen sich entspannen.
Aber kurz darauf war sie schon wieder aufgestanden und stieß mit dem Kopf gegen den Rand der Deckenlampe, die hin und her zu schwingen begann und eine große Staubwolke in die Luft entließ, während sie das Baby noch immer im Arm hielt, das, weil es unten auf der Spieldecke zu wenig Halt, Bindung, geschweige denn Grenzen gespürt hatte, lieber gehalten werden wollte.
In immer wieder anderen Positionen.
Und dabei leicht gewippt werden.
Am frühen Morgen
Die Nacht, die sie hinter sich hatten.
Die Spieldecke.
Ihr drängendes Projekt.
Es musste alles noch einmal durchdacht werden.
Helen fing noch einmal von vorne an
Die Spieldecke war ein großes Quadrat.
Auf dem Boden ausgebreitet, ließ sie einen Weg um sich herum entstehen.
Einen schmalen Teppichpfad, der die Umrisse des kleinen Wohnzimmers nachzeichnete.
Sie war ein Garten. Ja, sie war ein Garten.
Ein flaumiger, klar gegliederter Garten zum Umrunden, nicht, um darin ein Nickerchen zu machen oder darauf herumzulaufen.
Innerhalb dieses Quadrats Zonen: das nun zu einem Rasenfleck verkleinerte Feld. Im Beet daneben wuchsen Stoffblumen. Leicht schimmernd zwischen ihnen: die kleinen Kreise der zerkratzten, auf Karton geklebten Spiegel.
Helen war müde. Es war angenehm gewesen, sich auf dem Boden einzurollen. Nun aber entschied sie – wieder neue Entscheidungen, die frühere Entscheidungen ablösten, unbegrenzt abwandelbare Vorsätze –, das Quadrat auf Umwegen zu umrunden, schaukelnd, haltend.
Das Baby zum Schlafen zu bewegen.
Auf der dritten Zone der Matte wuchsen Aufklappbilder, Zickzacklinien und Tupfenmuster.
Und auf dem vierten und schlichtesten Beet wuchsen Geräusche (tiefe Taschen, die überraschend Untergrundtöne freisetzten).
Wohnungswanderung
Langsam anfangen. Eile führte zu nichts, das hatte sie während der letzten Wochen schon herausgefunden.
Keine Eile also.
Gleichmäßiges und leicht federndes Gehen. Abwechselnd im Takt die nackten Füße heben. Beim Anheben des einen Fußes gleichzeitig den anderen absetzen. Wodurch Zeitlücken entstanden, erst eine, dann wieder eine. Diese altmodischen Maßnahmen – sie hatten etwas mit Rhythmus, Gleichgewichtssinn und ausgefeilter Körperkoordination zu tun.
Der Pfad bestand aus geripptem, robustem Teppich. Er führte die kurze Strecke bis zum Fenster an der Wand entlang.
Und schon die erste Pause.
Helen machte halt, verlagerte ihr Gewicht, wiegte so das Baby und sah dabei durch einen freien Fleck oberhalb der Berge hinunter auf die Straße. (Über Nacht hatte die kondensierte Feuchtigkeit eine Bergsilhouette auf der Fensterscheibe entstehen lassen.)
Da war der Teenager von ein paar Türen weiter: mit hängendem Kopf und Ohrhörern schleppte er sich zur Schule. Wie spät war es überhaupt?
Sie schaute zum Baby hinunter.
Es war hellwach.
Schlafenszeit.
Im Baum vor dem Fenster hörte sie etwas ausdauernd, unregelmäßig und versetzt zu den Geräuschen der startenden Autos singen: einen Vogel.
Im Augenblick nur diesen einen.
Einen einzigen, laut zwitschernden Vogel.
Abwechseln
Mit einer Abfolge großer, flacher und schwerer Schritte, die den hoch ausgreifenden, leichtfüßigen Zehenspitzengang ablösten, folgte sie, schräg vom Fenster herkommend, dem Pfad bis zum Schreibtisch. Ein Stück Sperrholz auf zwei Böcken. An dessen hinterer Kante hatte Helen mit Schraubzwingen den Plastikhalter eines Mobiles befestigt; und zwar so, dass es über die Tischkante hinausreichte und sich wie ein schwebendes Gewölbe über der Babywippe aufspannte, die ihnen beim Abbiegen um die Spieldeckenecke nun unmittelbar im Weg stand.
Sie stieg darüber hinweg.
Jetzt waren es noch zwei, drei Schritte bis zur Armlehne des Sofas.
Dann um die Ecke biegen, am Sofa entlang, an der großen Pflanze vorbei und hinaus – hinaus aus der Geräumigkeit des Wohnzimmers und hinein in den engeren, dunkleren Schattenbereich des Flurs.
Hier wieder haltmachen, ausruhen.
Sie war kurz: ihre Runde um die Spieldecke, die Dauer ihrer Wohnungswanderung. Den geöffneten Mund dicht am großen Kopf des Babys, stand Helen im Flur, atmete in das feine dunkle Haar und ließ den Dingen ihren Lauf.
Dann ging es wieder zurück auf den Pfad und in Richtung Fenster.
Hallo, Straße.
Noch geparkte Autos; kräftig zwitschernder Vogel.
Straßenlaterne und großer Baum mit den frischen Blättern.
Auf dem Schreibtisch stand eine Lampe – ein matt schimmernder Weidenlampenkörper mit einem großen Schirm aus Papier. Darüber: ein paar Regalbretter mit Büchern. Helen veränderte ihre Halteposition, indem sie das Baby etwas höher schob und dabei seinen Hinterkopf mit einer Hand abstützte. Die Lampe: Die beiden blinzelten zu ihr hinunter, schauten, wie es der blaugrauen Glühbirne so ging. Fühlte sie sich allein?
Ja? Nein?
Was für eine Frage. Wir wissen es nicht.
»Kunst als Erfahrung«
Eines der Bücher stand mit dem Cover nach vorn auf dem Regal. Absichtlich so aufgestellt, damit das Titelbild sich dem Raum zuwandte. Schwarz auf weißem Grund, scherenschnittartig und kontrastreich: stimulierend für das Baby. Helen gefiel das Bild. Es zeigte einen Mann, der auf der Erde lag: breiter Rücken, Knie angewinkelt, das Gewicht des großen Oberkörpers auf einen Ellbogen gestützt. Die weiß abgesetzten Falten seiner Kleidung deuteten die Beugung der Gliedmaßen an. An den abfallenden Schultern und den großen Ohren war klar erkennbar, dass er kein junger Mann war.
Er studierte etwas.
Blattwerk spross seitlich von ihm: Zweige eines Gebüschs mit spitzen, stacheligen Blättern. Es war keine Wiese dargestellt, aber Helen erkannte, dass er etwas untersuchte: eine Blume oder irgendein Getier. Sie stellte sich eine Schnecke vor, die sich auf ihrer Schleimspur durchs Gras tastete.
Eine Szene außerhalb der Zeit: Sie vermittelte Ruhe und Konzentration.
Und da – die eine auf seinem kahlen Kopf, die andere auf seinem abgewinkelten Knie, die Flügel ausgebreitet, aber ohne seine Beschäftigung zu stören, eher so, als hätten sie etwas damit zu tun oder würden sich sogar daran beteiligen – hockten zwei Enten.
Oder waren es Hühner?
Helen verlagerte das Baby etwas nach unten, in eine Brust-an-Brust-Position.
Eine Sumpfhuhnart?
Das Baby schlug mit seiner Stirn leicht gegen Helens Schlüsselbein.
Ein Sumpfhuhn und das andere eine Holz- oder eine Linolschnitt-Ente?
Und weiter.
Brust an Brust
Das sei eine gute Position, hatte sie gelesen: Das Baby kann Ihr Gesicht nicht sehen, hört aber Ihr Herz schlagen.
Der gemeinsame Spaziergang hatte ein langsames Tempo.
Er war ein abgezirkeltes Projekt, ein regelmäßiges Viereck.
Hin und wieder ging es aber auch schneller: mit hoch ausgreifenden Schritten über die Babywippe hinweg und tänzelnd am Sofa vorbei.
Dann wieder eine Pause, erneut die große Pflanze betrachten: ihren Drang, sich auszubreiten, zur Seite, nach außen, nach oben, in seltsamen, unerwarteten Winkeln; bemerken, wie sich immer mehr Staub auf ihren fedrigen Blättern sammelte, und sich fragen, ob das die Pflanzenatmung womöglich störte – und dann hinaus, über die Schwelle des Wohnzimmers, zurück zu den Schatten, den Dingen an Haken, dem weiten Mantel, dem grellbunten Hut, dem straff zusammengebundenen Schirm und den abgelaufenen Turnschuhen im schummrigen engen Flur.
Ungefähr so
Helen, die mit einem Baby spazieren ging; mit ihrem Baby.
Die sich sagte, dass sie ihm alles zeigen, ihm die Welt in ihrer ersten häuslichen Erscheinung vorstellen werde; in winzigen Dosen.
Die Dinge hervorhob und Aufmerksamkeit lenkte. Die müde war und voller Hoffnung. Dass sie es schaffen würde, das Baby mit den verschiedenen Ansichten ihrer gemeinsamen Umgebung schläfrig zu machen.
Im Zentrum die Spieldecke – ein Klang-, Farb-, Muster- und Struktur-Garten, der nicht betreten werden durfte.
Die Lampe, der Schreibtisch und daran befestigt und über ihn hinausreichend: das Mobile. Seine Formen schwerelos im unteren Bereich des Raums tanzend.
Das Fenster.
Schau, die Berge auf der Innenseite der Scheibe.
Dahinter der Baum, die Autos, die Häuser und Wohnungen gleich auf der Straßenseite gegenüber; all diese Elemente der entfernteren Welt, der überwältigenden Noch-mehr-Welt da draußen.
Das Baby, das die Augen weit und ungerichtet aufriss: vom Außen angezogen und von einer Veränderung in seinem Gesichtsfeld bewegt; das immer wieder und unerwartet mit der Nähe zu Helens weitem Pullover zurechtkommen musste: einem plötzlichen Dunklerwerden; dem beschleunigten Herzschlag; das alles zu nah, kratzig und ein bisschen zu heiß.
Das diese Aufeinanderfolge aushalten musste, irgendwie.
Gleichzeitig
Helen, die mit sich selbst spazieren ging. Helen, die sich selbst Dinge zeigte.
Helen, die sich selbst und wie zum ersten Mal die Einzelheiten des Raums beschrieb, um dieses Projekt zu verstehen: ihre Art zu denken, ihre Begeisterung; die subjektive Logik ihrer Handlungen und den tieferen Sinn dahinter, etwas zu tun, zu dem sie, wäre da kein Baby, nicht die geringste Veranlassung hätte.
Diese Gedanken an einem Dienstagmorgen denken, am Beginn eines ganz normalen Arbeitstages.
Immer wieder um eine Spieldecke herumgehen, um jemand anderen zum Schlafen zu bewegen, aber auch in der Absicht und mit der Aussicht, sich endlich auch ein wenig ausruhen zu können. Und weil ihr gerade keine beruhigendere Wohnungsaktivität einfiel, die sie beide in diese Lage hätte versetzen können.
Es handelte sich um ein Gemeinschaftsprojekt, um eine komplexe Interaktion, bei der aufseiten beider Beteiligter dieses Nur-für-dich – dieses Gefühl, eine Handlung beziehe sich in erster Linie und mit eindeutiger Absicht auf dich – immer wieder ausgeglichen, abgelehnt oder bestärkt wurde von der Gegenkraft eines Ich.
Nicht nur du. Sondern, in diesem Fall, auch Helen. Mit ihren Eigenarten: dem Schritthalten mit den eigenen Bedürfnissen, Sehnsüchten, Interessen und Fantasien.
Eine weitere Viereck-Runde.
Der Spieldeckengarten. Grüner Plüsch außen herum: eine Hecke, um den Mix aus Strukturen und Farben zu umhegen.
Nicht darauf treten.
Helen, die aufpasste, nicht darauf zu treten.
Sie hatten etwas Abergläubisches, diese krummen Deals, die sie neuerdings machte. Verhandlungen mit dem Universum, mit den höchsten Mächten: auf dem Weg bleiben. Ich bleibe auf diesem Weg, sagte sie zu sich selbst. Als Gegenleistung: (bitte) ein tief und fest und lange schlafendes Baby.
Artikel
Die unterschiedlichen Möglichkeiten ausprobieren:
»Ein« Baby: Das hatte etwas Unspezifisches, Ungenaues, wo sich doch ein eindeutiges Gewicht, eine anwesende, bewegliche Kraft – nämlich dieses Augenwesen hier, das die ganze Welt voller Ernst und feierlich in sich aufnahm – auf ihrem Arm reckte.
»Ihr« Baby drückte Nähe, Verbundenheit, Beschütztsein aus. All die Formen einer Beziehung, die Helen wollte und spürte. Aber auch Besitzanspruch und etwas Beherrschendes. Als ob sie die Situation beherrschte, als ob sie dazu in der Lage gewesen wäre, das Wesen dieses neuen Menschen, seinen Charakter, seine Tragweite, einschätzen zu können – ermessen zu können, was sie beide füreinander waren und wer sie selbst war.
»Das« Baby meinte: genau dieser eine Mensch – in seiner Ungeschütztheit und Not – und niemand sonst. Damit war »das einzige Baby« in dieser Umgebung gemeint, ungefähr wie »das einzige Sofa im Wohnzimmer« oder »dieser spezielle Baum«. Von all den möglichen neu eingewanderten und heimischen Baumarten genau diese eine, die da draußen wuchs, die vom Fenster aus zu sehen war – wie war noch mal der Name?
Die Baumart, deren Rinde sich dehnt, aufplatzt und dann Flecken bildet. Schwarz-braun-weiß und grau marmoriert. Helen ließ dem Namen Zeit, der kurz vorm Auftauchen immer wieder versank, um dann erneut zu erscheinen, bis er endlich vor ihr stand: die Platane.
Weitergehen, herumgehen
Die Pflanze mit ihrer langgliedrigen Form, die schwereren Zweige gestützt von langen Bambusstöcken (vor langer Zeit hatte Helen sie außerdem mit irgendwelchen Schnurresten zusammengebunden).
Das kleine umrundete Sofa.
Auf dem aufgebockten Schreibtisch ein Laptop und Helens an der Steckdose angeschlossenes, leuchtendes, sich aufladendes Handy.
Das Gemurmel des Babys, das sich krümmte, langsam quengelig wurde und nicht mehr so leicht zu halten war. Helen, die merkte, dass sie es forcierte: einen Weg und einen Vorgang auszudehnen, der nur so lange andauern würde, wie sie die Dinge im Raum benannten.
Was hatten sie stiefmütterlich behandelt, noch nicht gewürdigt?
Da, schau! Eine Ansichtskarte von Rebba, als kleine Ablenkung an die Wand geheftet.
Und wieder die konzentrierte Szene.
Schwarz-weiß: diese erstaunliche Freude am Kontrast. Eine Scherenschnittfigur in Studierhaltung, die gelassene Aufmerksamkeit verkörpert und, so nach außen gewandt, ihre ruhige Stimmung dem Raum mitteilt.
Helen merkte, wie ihre linke Brust schmerzte und eindeutig die Nähe des Babygesichts suchte.
Es handelte sich um ein Buch mit Vorlesungen, die der Philosoph John Dewey in den 1930er-Jahren gehalten hatte. Die Worte AS EXPERIENCE im Titel waren – und das fiel Helen in dem Moment auf – in einem feuchten, frischen Grün gedruckt, das den Blättern des Baums vorm Fenster und einem der seidigen Spieldeckenfelder glich.
Wippend gingen sie am Sofa vorbei.
Flur, Schatten. Schuhe.
Kurz Energie tanken.
Das Beste aber war das Fenster.
Zurückgehen zum Fenster.
Die enge Wohnstraße.
Hallo, Scheibe.
Fass sie mal an. Ist schon gut. Ich mach das für dich.
Sie ist feucht.
Sie ist feucht, weil es draußen kälter ist als hier drin.
All die Autos, in die die Menschen vorhin eingestiegen sind, werden inzwischen fort sein.
Die Berge haben ihre Form verändert. Wir können sie abwischen.
Horch, wie still es jetzt ist. Stiller und schon ein bisschen später.
Nimm dir ruhig Zeit, unsere Zeit, und hör dem Vogel zu.
Dem Vogel, der sich immer gleich anhört.
Achte auf die leichte Zunahme. Morgen: Der Raum wirkt schon ein bisschen heller.
Und weiter und wieder herum. Vom Viereck der Spieldecke am Boden ausgehen. Ihre Form dabei für die eigenen Zwecke nutzen. Während der Staub der Deckenlampe ihnen folgte, auseinandertrieb und sich noch nicht entschieden hatte, worauf er sich niederlassen sollte.
Bis schließlich die Energie, sich gemeinsam fortzubewegen, und ihrer beider Aufnahmefähigkeit erschöpft waren und Helen, erst offen für diesen Zustand, dann an die äußerste Grenze der Müdigkeit getrieben und dies auslotend, etwas zum Hinsetzen suchte. Sich vortastend, sah sie sich im Raum nach einem Landeort um. In der Nähe des Sofas, gleich beim Babystuhl, gab es eine gute Stelle am Boden. Um sie zu erreichen, lief sie einfach quer über den Garten und zertrampelte dabei den Rasen und die Stoffblumenbeete. Ihre großen Füße verdunkelten die Spiegel, und beim Hinsetzen mit dem Baby auf dem Arm knüllte sie eine der weichen Ecken zusammen und drehte sie auf links, wodurch sich die fein getrennten Zonen nun berührten und ballten. Egal. Die Spieldecke konnte eine Zeit lang ein Klostergarten sein: ein temporäres Fantasiegebilde, an dem man sich orientieren und um das man herumgehen konnte.
Jetzt durfte es einstürzen.
Geräusche und Landungen im Wohnzimmer
Schlaf
Mit einer freien Hand schob Helen ihren Pullover und das von Milch dunkel befleckte T-Shirt hoch. Sie stopfte beides unter eine Achsel und befreite eine harte Brust vom BH. Das ohnehin schon quengelnde Baby geriet noch mehr außer sich. Es erkannte den süßen Geruch – ein überwältigendes Wiedererkennen. Doch genau da fiel Helens dicker Pullover samt T-Shirt über sein Gesicht, und es fing an zu weinen. Einige nicht enden wollende, nervenaufreibende Augenblicke lang kämpften Helen, das Baby und die Kleidungsstücke vergeblich miteinander, scheiterten beim Versuch, ihre Körper in Stillposition zu manövrieren, bis Helen sich die feuchte Kleidung vom Körper riss und auf das Sofa schmiss. Als es dann endlich warme Haut spürte, konnte das Baby seine luftdichte Saugverbindung mit der Brust herstellen. Und Helen begann mit dem Countdown. Sie zählte in Gedanken zügig von fünf ab rückwärts –
vier,
drei,
zwei,
kurzes Zögern bei zwei.
Dann
eins –
und die Milch trat aus.
Sie tat das, weil sie sich damit von dem Schmerz ablenkte, der zu Beginn des Stillens in den Tiefen ihrer Brust jederzeit explodieren konnte (das passierte eher selten, dann aber immer ganz plötzlich, was es schwierig machte, sich darauf einzustellen): spitze Sterne, die an den Arminnenseiten hinunter zu ihren Handflächen schossen, dann wieder zurück in die Brust und von dort ins Gehirn. Sie tat das auch, weil es albern und ein bisschen kindisch war: das Baby an sich andocken zu lassen, so als wäre es das kleinere von zwei Raumschiffen. Und auch, weil Kindischsein für sie ein Akt privaten Widerstands war, eine Möglichkeit, die Monstrosität und das Drückende eines vor Kurzem aufgetauchten Gedankengangs abzuwehren: Egal, welche für sie verfügbare Rolle sie im Lauf ihres Lebens noch übernehmen würde, ob aus eigenem Antrieb oder nur zögernd, eines jedenfalls würde sie nie wieder sein, wobei dahingestellt bleibt, ob überhaupt irgendwer dies ausschließlich oder ganz eindeutig jemals sein könnte, sie, Helen würde es jedenfalls nicht mehr sein – das Kind.
Sie fütterte das Baby. Eine Schleuse öffnete sich. Das Baby ernährte sich von ihr.
Ungefähr so.
Ungefähr so.
Mit zuerst schneidenden, kurzen und schnellen, dann ruhiger werdenden Zügen und schließlich rhythmisch saugend. Während die Anspannung langsam aus ihren Körpern wich. Helen konnte spüren, wie ihre harte linke Brust weicher wurde, wie das Baby, ihr Baby, sich entkrampfte und entspannte.
Die Beine quer über den früheren Garten ausgestreckt, mit Oberkörper und Kopf durch ein All treibend, fütterte sie das Baby.
Ganz still, dann sanft summend.
Sie spürte, wie sie mit dem Rücken den Stoff herunterzog, den sie als Überwurf für das Sofa besorgt hatte. Erst nachdem sie diese blaue Decke auf dem Markt gekauft und das Sofa damit vollständig bedeckt hatte, gehörten das Wohnzimmer, die kleine Küche, das Schlafzimmer, das Bad, der Flur, gehörten alle vier Räume und selbst die Zwischenräume der Wohnung ihr – ihnen. Als der Stoff nun heruntergerutscht war, wie es oft geschah, zum einen, weil das Obermaterial des Sofas beschichtet und sehr glatt war – gar nicht wirklich eine Textilie –, zum anderen, weil der Überwurf nicht groß genug war und deswegen das laute rot-schwarze und grau-weiße Blockmuster darunter erkennen ließ, wurde sie daran erinnert, dass, bis auf die Lampe, die Bücher, die Spieldecke und den Babystuhl, alles, nämlich ihr großes Bett, der Herd, die Waschmaschine, der Kühlschrank, die Räume und die Grundausstattung ihres neuen Zuhauses, das sie für sie beide geschaffen hatte, der kleinen, stämmigen, kurzhaarigen und kurz angebundenen Frau gehörte, die über ihnen wohnte.
Sie fütterte das Baby, schuf und garantierte die Bedingungen dafür, dass es sich von ihr ernähren konnte.
Ungefähr so.
Beim Summen von Popmelodien, dann von rauerer Clubmusik, die als Unz, Unz, Unz aus den Tiefen ihrer Kehle drang wie aus der Ferne, Beats, gehört wie durch eine gekachelte Wand oder durch eine Schwingtür. Wobei sie sich selbst mit einem kleinen Kopfschütteln dabei ertappte und kurz darüber nachdachte. Dann wieder neu einsetzte, diesmal zielführender, mit einem Schlaflied, von dem sie sich selbst ein wenig einlullen ließ. Bis auch dieses sich wieder veränderte und überging in die Refrains fast vergessener Schulversammlungslieder.
Sie änderte ihre Position, legte ein Bein über das andere.
Das Sofa diente ihr als Rückenstütze. Sie gab ihr Gewicht an das Sitzpolster ab, und ihr Kinn sackte auf die Brust. Sie schluckte. Den Kopf nach vorn gebeugt, schloss sie die Augen. Müdigkeit brach über sie herein. Überfiel sie wie die anbrechende Nacht, sank in sie ein. Ließ sie an der Stelle auf dem Teppich, wo sie saß, selbst leicht einsinken. Sie konnte jetzt einschlafen. So hätte sie ganz leicht einfach einschlafen können.
Doch ein sanfter Luftzug bewirkte, dass sich die Haare zwischen den Sommersprossen auf ihren Armen aufrichteten. Und da waren auch das Gewicht und das Drücken des Babys, das noch an ihrer Brust trank. Alles zusammen bewirkte eine innerliche Anspannung, die sie wachhielt.
Sie fütterte ihr Baby, bis ihm die Augen zufielen, die Saugkraft seines Gaumensegels nachließ und sein Mund sich endlich von ihr abkoppelte.
Blieb dann noch ein wenig sitzen, summte weiter. Senkte das Baby in Erinnerung an die Wippbewegungen hin und wieder leicht ab. Richtete den Blick gelegentlich aus dem Fenster.
So ruhig war diese Straße. Viel ruhiger als alle anderen, in denen sie je gelebt hatte.
In der Nacht hatte es geregnet.
Von dort, wo sie saß, durch den Nebel und die Unschärfe der Kondensation, konnte sie die marmorierte Rinde des Baumes erkennen.
Sie ging in den Vierfüßlerstand.
Und zur Babywippe: Mit dem Baby auf dem Arm legte sie die kurze Strecke auf Knien zurück.
Weit ausgrätschend.
Konzentriert darauf, die Abstände zwischen Summen und Wippen immer weiter auszudehnen.
Ein Seufzer entwich dem Baby; Atemhauch kitzelte sie am Arm.
Über den Stuhl gebeugt, den pulsierenden Kopf des Babys mit der Hand stützend, ging sie tiefer. Dachte, wie so oft während der letzten Wochen, wenn sie diese Bewegung ausgeführt oder es zumindest versucht hatte: Das also ist mit »behutsam« gemeint.
Vorsicht.
Umsicht.
Eine Reihe feinfühlig auszuführender Schritte: ausgesprochen vorsichtig sein, um niemanden zu verletzen, auch nicht sich selbst, um niemandes Ruhe zu stören, auch nicht die eigene.
Immer weiter ließ sie das Baby nach unten sinken, schwerelos durch offenen Raum gleiten.
Und durch die Zeit: durch die sich unkontrolliert ausdehnende, schier endlose Zeit.
Wiegte es weiter, aber jetzt in immer tiefer führenden und weiter ausholenden Bewegungen, jede ein bisschen tiefer gehend als die davor.
Summte mit Unterbrechungen weiter, im Tempo und im Rhythmus der leichten Senkbewegungen.
Der Ursprung all dessen war prähistorisch:
Selbst als die Tage noch um so vieles kürzer waren und der Teppich unter ihren Füßen eine hochschäumende, erst dunkelgrüne, dann mulchig-trockene braune Schicht mit umgeknickten Waldfarnen war, wäre sie so wippend gegangen – hätte sie wirklich so gesummt und gewiegt? Sie hätte einen Kontaktlaut ausgesandt und gesungen:
Ich bin da.
Ich bin doch da.
Die Atemzüge des Babys hatten manchmal den gleichen Rhythmus wie die übrigen Takte im Raum – die langsameren Atemzüge Helens, ihr Herzschlag, die langsamen Drehbewegungen des Mobiles und das unregelmäßige Zwitschern des beharrlichen Vogels –, manchmal hatten sie einen anderen Rhythmus.
Ich bin da.
Nicht weit von ihnen entfernt bildete die Spieldecke, die weggekickt worden war, einen bunten Haufen.
Sie landete.
Ließ das Baby in den Stellvertreterarmen der schicken pinken Babywippe landen.
Der Wippe, deren Rückenlehne sie in Liegeposition gestellt hatte, in die Alles-gut-, Alles-in-Ordnung-, Du-kannst-ruhig-schlafen-Position.
Ich bin immer noch da.
Sie hielt Kontakt. Hielt noch einen ausgedehnten weiteren Augenblick lang Kontakt mit dem Baby. Hautkontakt. Hautkontakt mit einem flauschigen Neugeborenenstrampler. Ihr vorgebeugter Körper, ihre Hände, leicht feucht, alles dazu da, die Wärme zu erhalten.
Ungefähr so hockte sie da, einen Atemzug noch, noch einen Takt lang stillhalten, während ihr Körper den des Babys überwölbte, Schutz suchte unter dem wogenden Schirm des Mobiles – seinem laminierten Baldachin aus hüpfenden und Lücken bildenden schwarz-weißen Formen.
Da bin ich.
Das Baby trieb langsam weg.
Und weißt du was?
Ich bin da.
Dann zog sie sich zurück. Beide taten das. Zogen sich weit voneinander in unterschiedliche Richtungen zurück. Helen war froh, sich entziehen zu können, ihre Hände und Arme wiederzuentdecken, war begierig nach dieser vorübergehenden Trennung.
Ich bin da.
Helen ging in die Hocke. Sie kreiste mit den Schultern und rollte ein Gummiband von ihrem Handgelenk.
Ich bin doch da.
Jetzt, wo sie die Hände frei hatte, wollte sie sich die Haare hochbinden.
Und weißt du was?
Genau in dem Moment: eine Klingel.
Also?
Also! (Ein Ausruf, um damit einen neuen Satz einzuleiten. Eine Pause zu markieren. Oder um ganz unterschiedliche Emotionen auszudrücken: Überraschung, die reflexartig in Ärger kippt; noch keine Resignation, eher das wütende Gegenteil von Erleichterung.)
Zuerst war es nur der Schreck, ausgelöst durch ein plötzliches lautes Geräusch. Das kurze Ereignis einer Intervention. Aber dann klingelte es erneut, sehr energisch, und hörte sich an wie der Buzzer in einer Quizshow.
Jemand weiß die Antwort!
Wer? Moment:
Worauf denn?
Auf das Klingeln an der Tür.
Jemand war an der Tür. Wollte unbedingt, dass sie herauskam. Oder wollte ihr unbedingt etwas bringen.
Das Baby zuckte kurz auf. So als wollte es nach etwas greifen und es zurückholen: Gegenwärtigkeit, Helen.
Es klingelte erneut.
Ein Finger drückte aufdringlich den Knopf – und ließ wieder los.
Drückte länger und aufdringlicher – und ließ wieder los.
Ein erneuter Ruck ging durch den Körper des Babys, seine Lider flatterten, öffneten und schlossen sich.
Nicht zu fassen: Ihr wegtreibendes, von ihr getrenntes Baby war wieder wach.
Helen schüttelte den Kopf.
Hitze kroch ihr den Rücken hoch.
Die Klingel, ihre Wirkung. Sie spürte sie körperlich.
Arschloch, entfuhr es ihr zischend.
Die Hitze im Rücken pulste jetzt in ihren Achselhöhlen; pumpte ihr Röte ins Gesicht.
Erneut ertönte die Klingel. Arschloch.
Diesmal sagte sie es lauter, energischer. So wie sie es aussprach, hieß es, du machst wohl Scherze. Es hieß, will das Universum mich jetzt komplett verarschen!?
Die Klingel. Sie wollte, dass sie auf ihren Ruf reagierte.
Das war ihr klar.
Ihr fielen die Kleidungsstücke ein, die sie auf dem Sofa abgeladen hatte. Den BH hatte sie nur halb angezogen. Aber das Problem war wohl eher, der springende Punkt war wohl eher:
Sie konnte nicht.
Sie blickte zum Baby. Aber dem ging es gut. Sein Ausdruck ließ sich als interessiert interpretieren. Als entschlossen und beteiligt. Es hatte von der Liegeposition in seiner Babywippe aus die Tatsache, dass es wieder wach war, bereits als neue Gegebenheit akzeptiert.
Also gut. GUT!
Sie konnte.
Sie würde.
Sie rappelte sich auf, zog T-Shirt und Pullover über. Dann brach sie sich mit langen Schritten Bahn, ein Gewaltmarsch durch das ganze Wohnzimmer und die kurze Strecke den Flur entlang. Ein wütender Marsch im Rhythmus ihrer Schimpfworte:
Arschloch
Du Arschloch –
Du dreckiges Arschloch –
Sie riss die Tür auf.
Der kalte Luftzug steigerte noch das Hitzegefühl in ihrem Gesicht.
Sie konnte den Menschen, der da vor ihr stand, nicht ansehen.
Konnte ihn nicht grüßen.
Er reichte ihr etwas.
Sie wollte auf etwas einschlagen, aber nicht auf ihn, eher auf sich selbst oder zumindest gegen den Türrahmen treten.
Sie riss ihm das Ding – einen Pappumschlag – mit einer theatralischen Bewegung aus der Hand.
Schlug die Tür zu.
Gut, dachte sie.
Gut.
Warum nicht?
Hoffentlich hatte sie ihm die Fresse eingeschlagen.
Denn das Problem.
Was war das Problem?
War es nur: ihr Problem? Sie richtete diese Frage an sich selbst.
Der Flur roch nach Regentagen. Nach ihrem Mantel und den Einlagen ihrer Schuhe, vermischt mit der Vergangenheit: den Geruchsschichten anderer, früher hier wohnender Menschen.
Es ging nur um die Zukunft.
Eine Klingel, betätigt zu einer normal frühen Aufstehzeit, hatte den Ablauf, die Zukunft ihres ganzen Tages verändert.
Sie durchkreuzte den Morgen, teilte und lenkte ihn um. Jetzt nämlich würde entweder das gesamte hinter ihnen liegende Programm wiederholt werden müssen. Diesmal nur schneller, verkürzt und mit einer wesentlich geringeren, ja verschwindend geringen Wahrscheinlichkeit, das Baby ruhig und schlafend in der Babywippe absetzen zu können:
das Halten,
das Gehen zum Fenster und zur Glühbirne in der Lampe.
Der quadratische Weg.
Der Gang zur Pflanze und die Frage, ob sie atmete und ob man das feststellen konnte – nein, noch nicht.
Die Augen und ob sie zufielen (sachte, sachte).
Die prähistorische Hockstellung und die Landung, Hocken und Landen … Jede dieser Aktionen aufs Neue ausführen, bis sie schließlich beide, nur jede anders und aus ihren jeweils anderen Beweggründen, den Punkt erreicht haben würden, an dem sie einander endlich loslassen konnten: Helen, die das Baby loslassen, es lehrbuchmäßig absetzen und eine Armlänge von sich entfernt in der Babywippe anschnallen würde; das Baby, das Helen loslassen würde; das Baby, das Helen, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, von ihrer nervösen Daueraufmerksamkeit erlösen würde.
Oder das Baby würde wach bleiben.
Es würde nun einfach wach bleiben – und zwar so lange, wie sie beide dafür brauchen würden, einen weiteren Zyklus aus Aufmerksamkeitschenken und Hungerstillen und Benommen-in-den-Schlaf-Sinken zu durchlaufen. Nur würde ihr Geduldsfaden diesmal höchstwahrscheinlich dünner sein, das wusste Helen. Weil ihr Haar immer noch offen war und feuchtwarm, würde es wahrscheinlich schwer herunterhängen: über dem Gesicht des Babys baumeln und sie beide stören. Und weil sie genau spürte, dass sie diesmal schneller überfordert sein würde, würde sie wahrscheinlich durch etwas hindurchhetzen, was nur in gemessenem Tempo funktionieren konnte, und das Baby würde ihre Stimmung auffangen und seinerseits, als Antwort auf Helens Ungeduld und Erregung, auch immer hibbeliger und aufgeregter werden. Während es also wahrscheinlich war – eigentlich wusste Helen, dass es tatsächlich so war; sie hatte es ja durch Erfahrung gelernt und lernte jeden Tag dazu –, dass diese Schlaf-Wach-Zyklen in einer Art Endlosschleife abliefen, was hieß, dass, auch wenn eine Gelegenheit zu schlafen verpasst wurde, man sich darauf verlassen konnte, dass eine neue kam, so war es doch ebenso eine Tatsache – und vielleicht sogar eine noch viel überwältigendere –, dass die Art, wie sie beide zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag durch eine solche Phase, ein solches Intervall hindurchkamen, von Folgendem abhing: dass kein Muttersöhnchen im hellen, luftig-lockeren Sweatshirt und in weichen, leichten Jogginghosen die Treppen heraufgetrabt kam. Dass kein gedankenloser Finger im Tempo schleierhafter Dringlichkeiten genau dann, wenn das Baby gerade abgelegt und in den Schlaf entlassen worden war, unnachgiebig den Klingelknopf bearbeitete. Aber eben auch davon, dass das laute Klingeln eben nicht nur ein Mal ertönte und dann aufhörte,
oder zwei Mal und dann aufhörte,
sondern wieder und wieder –
bis dieser Finger sich in einen GROßEN FUß verwandelt hatte, die Tür EINTRAT und auf ihrer Zeit HERUMTRAMPELTE, auf diesem kleinen Bündel gewonnener Zeit, das sie für sich selbst auf ihrem Weg durch die verschiedenen Phasen des Morgens geschnürt hatte – kapiert, du
ARSCHLOCH?
Eine ältere Frau rumpelte draußen auf dem Pflaster mit ihrem Einkaufstrolley vorbei. Weiter die Straße hinunter wurde eine Autotür zugeschlagen. Jeden Morgen zog die langsam gehende Frau dieses Wägelchen mühsam hinter sich her und legte dann bei der Bank an der Ecke eine kleine Pause ein, um die Tauben mit Brotkrumen zu füttern. Auf ihrem täglichen Weg zu den Geschäften; immer die gleiche Bank. Bei der sich auch die Teenager nach der Schule trafen.
Helen wollte weinen. Sie wollte – Entschuldigung sagen.
Der Zorn, an dem sie auf ihrem Marsch zur Tür so schwer getragen hatte, fiel nun wie eine Verkleidung, wie ein Umhang von ihr ab.
Entschuldigung, sagte sie, ohne genau zu wissen, wofür. (Für das Fluchen, das Schreien. Für ihre Aufgeregtheit; dafür, dass sie jemand anderen aufgeregt hatte.)
Das Gefühl, weinen zu wollen – es wurde stärker. Es schmerzte. Es ging vorbei.
Entschuldigung, sagte sie und wollte diese Botschaft durch den Briefschlitz schicken, damit sie den jungen Boten vielleicht noch einholte, sich besänftigend auf seinen Arm legen konnte.
Entschuldigung: ein Gewohnheitswort. Aber auch ein Wort mit Erneuerungskraft. Ein Zauberspruch, um etwas wieder zusammenzufügen, von vorn zu beginnen.
Alles wieder gut.
In dem Pappumschlag war ein Buch. Ein dickes Buch. So dick, weil es so lang war; zu dick, um durch den Briefschlitz zu passen.
Helen wusste, was der Umschlag enthielt, weil sie es bestellt hatte. Sie hatte schon darauf gewartet. War immer wieder zum Fenster gegangen, in der Hoffnung, dass es an diesem Tag geliefert werden würde. Der Roman. Alt, antiquarisch, aber ganz neu für sie. Ein interessantes Objekt, mit dem man Zeit verbringen konnte.
Helen ging zurück ins Wohnzimmer.
Ihr Baby war gesund. Und schau – es weinte ja gar nicht.
Alles wieder gut.
Die große Pflanze war staubig, lebte aber noch, und durch das Fenster fiel Licht.
Ihr neues altes Buch war angekommen.
Es bot einen anderen Ort, auf den sie ihre Aufmerksamkeit richten konnte.
Sie hatte noch Reserven. Durchaus.
Sie würde sich eine Tasse Tee machen.
Warum sich nicht vorstellen, dass alles (ihr Tag und die Zukunft) mit hoher Wahrscheinlichkeit – und zwar, weil Helen und das Baby zu den Privilegierten gehörten – gut werden würde?
Sie würde noch mal versuchen, das Baby zu füttern, selbst etwas essen und sich eine Tasse Tee machen.
Ein weiteres Mal stellte sie sich auf einen veränderten Morgen ein.
Sie fand es bemerkenswert – anregend und ermüdend zugleich –, dass das so oft geschehen konnte: dass man zu immer neuen Anpassungsleistungen fähig war, indem man nach immer weiteren Schichten mit Reserven grub, an deren Vorhandensein man grundlegend zweifelte, um dann ganz unerwartet doch auf sie zu stoßen, wie auf den Mond zur Mittagszeit. Darauf verließ sie sich. Manchmal fand sie es auch besorgniserregend, wie sehr sie darauf angewiesen war: dass durch das Baby ihre Reserven wieder aufgefüllt wurden, durch eine überraschende Geste, einen neuen Gesichtsausdruck; oder durch etwas anderes, eine Nachricht von Rebba. Die merkwürdigen Farben des Flusses im Park; oder eine Ente, die mit ihrem hochgereckten Bürzel und komischen grauen Gummifüßen unerwartet ihre Stimmung aufhellte. Denn was, wenn sie plötzlich nicht mehr verfügbar wären? Diese Geschenke, die sich selbst verschenkten.
Und was, wenn sie damit aufhörte? Nicht mehr die Fähigkeit, die innere Offenheit besaß, sich von all dem verändern und bewegen zu lassen?
Helen ging wieder zu ihrem Platz auf dem Teppich.
Der Roman, den sie bestellt hatte, war Tom Jones. Die Geschichte eines Findlings von Henry Fielding.
Erstmals veröffentlicht 1749.
Sie hatte das Buch antiquarisch für 1 Pfund 32 gekauft, plus Porto und Verpackung. Drei Tage später war es da – und es brachte eine andere Energie mit in die Wohnung. Seinen Humor und seine Gedanken. Seine Liebesgeschichten. Eine eigene Haushaltsorganisation. Genau dieser Roman und kein anderer.
Excellence simply delivered
lauteten die selbstbewussten roten Worte. Jetzt fuhren sie los, und schon bogen sie, groß auf die Seitenwand eines leuchtend gelben Lkws gedruckt, um die Ecke.
Hallo, Baby, sagte Helen und drehte sich frontal zum Baby in der Wippe. Ihr Gesicht tauchte groß über ihm auf.
Hey, Babe, sagte sie amüsiert. (Mein Säugling; so eine junge Person – so unfassbar jung – sie muss getragen werden.)
Hey, sagte sie, lächelte, suchte Augenkontakt.
Hey, sagte sie ein weiteres Mal. Diesmal aber sanfter, atmete dabei langsam aus (Ich grüße dich).
Tippte dann die verschiedenen Figuren des Mobiles an, eine nach der anderen, setzte jedes Element dieser Komposition in Bewegung, brachte das ganze empfindliche Gebilde dazu, sich zu drehen, bewirkte Beziehungen und Positionsänderungen und setzte Klangelemente in die Luft dazwischen:
hey
hey
hey
Das ist auch unsere Situation.
Rose
Das Baby, ganz anwesend, die Verkörperung eines Anfangs, mit eigenen Handlungen und Reaktionen, mit seiner eigenen Art, Erfahrungen zu machen, fixierte währenddessen Helens Stirn.
Das Baby hieß Rose.
Das Mobile
Über die Babywippe von Rose gewölbt
ruckte und wippte es leicht.
Es senkte sich. Es hob sich.
Rastlos blieb es niemals vollkommen still.
Für die darunter vor sich hin brabbelnde Rose war es ungefähr so: das Mobile als Ausdruck ihres Weltempfindens – nah und ruckelig, von Leerstellen durchsetzt, kantig und eckig und lebendig. Mehr oder weniger monochrom. Mit grauen Flecken, hellen Teilen und sich hervorschiebenden dunkleren und warmen Schatten.
Ungefähr so: schematisch, hängend; hielt sich immer bereit.
Präsentierte sich in einer wackeligen Formation, dann wieder in einer anderen.
Zeigte eine Figur in Nahaufnahme.
Dann wieder eine andere.
Die Formen, die es aufspannte, waren einfach, elementar. An einem langen Nachmittag, etwa eine Woche vor Roses Geburt, hatte Helen sich auf dem Boden niedergelassen, sie einem Bausatz entnommen, den sie online bestellt hatte, und zu einem Mobile zusammengefügt.
Eine runde Figur ohne Ecken oder Kanten: ein KREIS.
Eine flächige, rationale und rechtwinklige Figur: ein QUADRAT.
Zwei spitze, aufrecht stehende DREIECKE.
PUNKTE! Eine Fläche mit unregelmäßig verteilten Punkten.
WELLEN: ein Querschnitt durch Wellenbewegungen.
Die Formen mussten zueinander versetzt angebracht und ausreichend weit voneinander entfernt positioniert werden. Damit nämlich das ganze Ding schweben, sich im Raum ausgebreitet halten und ausbalancieren konnte, durfte keines der Teile schwerer sein als die anderen.
Und sie hatte es geschafft – mit Angelschnur, Einfädeln, mit kleinen kniffligen Knoten.
Das Endstück des Haltearms hatte sie schließlich am Schreibtisch festgeklemmt.
Und da, ganz von allein –
bewegte es sich.
Drehte sich. Ruckelte.
Schon die leichteste Luftbewegung – eine sich öffnende Tür, das Atmen einer Person in der Nähe oder einfach eine Temperaturveränderung – ließ es wippen, sich heben und senken und die Drehrichtung ändern.
Es rotierte.
Wahrte eine erträgliche, taktvolle Distanz.
Nur manchmal, ohne Vorwarnung, sprang es plötzlich näher. Für Rose war das, als stürzte es auf sie zu, umzingelte sie und drückte sie nieder. Die Positionierung in der Wippe unter dem Mobile: Es war bemerkenswert, wie sehr Rose sich manchmal dagegen wehrte. Wie eine Szene ruhiger Drehbewegungen – ein kontrastreicher, anregender Bereich – sie aufregen, verwirren und bedrängen konnte.
Vorerst aber studierte sie es: dieses heitere Himmelszelt aus Formen.
Ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf den Kreis: ein großes strahlendes Auge.
Sie löste sich vom Kreis.
Wanderte in Richtung der großen Lichtquelle des Fensters zurück zur Wellenform. Sie spürte diese Bewegung als Veränderung in ihrem Innern, das mit dem Raum im Austausch stand.
Denn Rose war ebenfalls zugleich Masse und Leere.
Sie war spitz und hatte Lücken, war voll und leer, drehte sich und schwebte, war ausgedehnt und geschlossen.
Sie bestand aus PUNKTEN!
Sie war ruhig, blieb innerhalb ihrer Grenzen. Dann plötzlich breitete sie sich aus. Sie war wie verebbendes Wasser, dann ein sich verzweigendes und wieder sammelndes, stetiges Fließen.
Sie strampelte.
Und ungefähr so – spektakulär, beweglich – hing auch die Welt um sie herum.
Nahm Form an. Veränderte die Form.
Sie gab ihr Zeichen mit Licht und Schatten, auf die sie mit ausgedehntem oder punktuellem Interesse reagierte.
Rose durchlief sie ruhig, gelangweilt, erregt oder munter, gestresst oder bekümmert, und ohne dass ihre sensationelle Lebenskraft dabei in irgendeiner Weise durch den Raum begrenzt wurde, den sie in einem Zimmer, einer Armbeuge oder in ihrem winzigen Baumwollstrampler einnahm, krümmte Rose die Raumzeit um sich herum.
Die krümmte zurück.
Und Rose strampelte, um der Welt zu begegnen, und versetzte sie so in Schwingung.
Neben ihr stand Helen, öffnete den Pappumschlag an der Naht und wog den Roman in ihren Händen.
Das Hintergrundsummen des Heizkörpers unter dem Fenster wechselte in eine etwas höhere Tonart: seine Art, mitzuteilen, dass Wasser durch ihn hindurchlief und er – wie all die paketsortierenden freiberuflichen Körper, die in diesem Augenblick mit ihren Lieferwagen Pakete ausfuhren, wie all die ähnlichen netzwerkartigen, Innen- mit Außenräumen verbindenden Systeme – installiert und angeschlossen war und funktionierte; jetzt sogar auf Hochtouren.
Der Vogel im Baum hatte aufgehört zu zwitschern.
Oder er zwitscherte weiter.
Nur im Bereich eines anderen Fensters, eines anderen Zimmers, das von anderen Menschen bewohnt war, etwas weiter die Straße hinunter, woanders.
Eine Umgebung mit ganz eigenen Anregungen
Ich fange später an zu lesen, sagte Helen zu sich selbst und fühlte sich auf einmal etwas entmutigt von der Auswahl, die sie da getroffen hatte. Aber sie hatte den Roman schon aufgeschlagen, und ihr Blick fiel auf einen bestimmten Absatz. Es war die Beschreibung eines Hauses. In allen Romanen werden Wohnorte, Lebensumstände, unterschiedliche Rückzugsorte für Menschen beschrieben, und das Haus auf diesen Seiten war im Jahr 1749 gerade neu gebaut worden. Ein großzügiges Haus – das Wort, das dieser Roman benutzte, war »geräumig«. Es stand auf einer Anhöhe in einer ländlichen Gegend in England. Am »Hang einer Anhöhe, aber näher ihrem Fuße als dem Gipfel, sodass es nach Nordosten von einem Hain aus alten Eichen geschützt war, der sich in einem mählichen Anstieg von nahezu einer halben Meile darüber erhob«. Weit genug unten also, um nicht übermäßig exponiert zu sein, »und dennoch lag es hoch genug, um einen ganz zauberhaften Blick über das Tal darunter zu gewähren«. Geschützt und gleichzeitig mit einer herrlichen Aussicht – Helen las aufmerksam die ganze Passage, und die Szene entfaltete sich gemäß ihrer eigenen Empfindung. Sie breitete sich aus wie eine Decke. Eine Topografie aus unterschiedlichen Zonen, jede davon mit besonderen Details bestickt. Hoch oben über dem Haus Tannen, Felsen und ein Wasserfall. Er stürzte zunächst als Lärm in ihre geistigen Sinnesorgane, dann als Bewegung, als vage Empfindung einer weißen, schäumenden Gewalt vor Blau, dann als ein Fallen »über die geborstenen und bemoosten Steine«. Wurde unten flacher und langsamer, bis er »in einem Kieselbett davonlief«, dann das Haus umfloss und in das tiefere Gewässer eines großen, glitzernden Sees mündete. Er war das Zentrum der Aussicht aus jedem der Fenster an der Vorderfront des Hauses: ein See, »der die Mitte einer schönen, mit Buchen- und Ulmengruppen geschmückten und von Schafen beweideten Ebene füllte«. Das vorherrschende Gefühl war das von Raum: sehr viel Raum, der sich sehr viel Zeit nahm, sich zu entfalten. Grasende Schafe. Alte Baumgruppen und jüngere Bäume. Und nun breitete er sich noch weiter aus. Dem See nämlich »entsprang ein Fluss«, der den Blick einige Meilen bis zur blauen Linie des Horizonts mit sich zog, »durch eine erstaunliche Vielfalt von Wiesen und Wäldern« mäanderte und schließlich »ins Meer mündete«.
Raum, Zeit: Ausdehnung in alle Richtungen – auf der rechten Seite aber bauschte sich der Stoff zusammen. Dort war ein kleineres, schmaleres Tal, »verziert mit mehreren Dörfern«. Ansammlungen von kleineren Häusern, ärmlicheren Häusern, die sich um die Türme einer alten verfallenen Abtei gruppierten. Aber schau, hier auf der linken Seite schon wieder eine Ausweitung. Noch mehr Land, das zum Haus gehörte; eine Ausweitung, bunt gewürfelt und von Abwechslungsreichtum gekennzeichnet: Es gab einen »sehr schönen Park, der sich aus sehr unebenem Gelände fügte und angenehm mit der ganzen Vielfalt variierte, die Hügel, Rasen, Hain und Wasser … aufbieten konnten«.
Die Jahreszeit: Frühling. Es war Mitte Mai.
Die Tageszeit: ganz früh am Morgen, der Anbruch eines neuen Tages.
Möglichkeiten, Potenzial: ein sich öffnendes Gebiet, groß genug, um grenzenlos zu scheinen, aber in Wirklichkeit doch durch etwas begrenzt. Im Süden durch den schmalen blauen Meeresarm. Im Osten durch eine »Kette wilder Berge, deren Gipfel über den Wolken lagen«.
Und nun eine Fokussierung, etwas trat in den Vordergrund: eine Figur, die sich bewegte. Mr. Allworthy, Besitzer und Bewohner des Hauses, ein Mann, angefüllt mit Güte, der auf der Terrasse auf und ab schritt, während die Sonne aufging.
Helen las weiter.
Sie spürte den Gang dieser älteren Person eher, als dass sie ihn sah. Ihre Lungen reagierten auf die Beschreibung des Sonnenaufgangs: das rosafarbene Licht, das zuerst nur die äußeren Ränder hier und da antippte, dann das gesamte Zentrum der Szene erhellte. Und dann eine merkwürdige Wendung. Ein Ruck: ein Kniff oder Haken innerhalb der beständigen, sich ruhig ausbreitenden Erzählung:
»Leser, sieh dich vor.«
Hier sprach der Erzähler, der ganz unerwartet von der Beschreibung in eine informelle, direkte Anrede wechselte: »Ich habe dich unbedacht auf den Gipfel eines so hohen Berges wie den Mr. Allworthys geführt.«
Nicht auf den geografischen, auf dem die Quelle des Wasserfalls zwischen dunklen Felsen hervorsprudelte, sondern auf einen metaphorischen Berg, so hoch erhaben wie Mr. Allworthys übertriebene Güte.
Das Problem aus seiner Sicht: Ich habe dich hier heraufgeführt. Aber »wie ich dich nun wieder herunterbringen soll, ohne dass du dir den Hals brichst, weiß ich eigentlich nicht«.
Wie führt man nach einer solchen Erhöhung alles – diese mögliche Person, das gesamte Erzählprojekt – wieder zurück auf den Boden? Damit sich die Dinge auf einer vertrauteren, menschlicheren Ebene abspielen können?
Der Erzähler, wie er hin und her überlegt: Ganz ehrlich? Das »weiß ich eigentlich nicht«.
Vielleicht geht es nur gemeinsam, also »wollen wir versuchen, gemeinsam hinabzurutschen«.
Leser, mein Hals ist dein Hals. Das Ziel: ausprobieren, ob es möglich ist, ob es uns gelingt (dieses Erzählprojekt), ohne dass jemand sich den Hals bricht.
Aber halt – was ist das? Eine Klingel!
Horch: Mr. Allworthy wird nach unten zum Frühstück gerufen. Vielleicht reicht das ja vorerst: Wir alle finden zusammen im gemeinsamen Bedürfnis nach Nahrung.
Die Erzählerfigur ist auf jeden Fall dabei: »Mr. Allworthy wird zum Frühstück gerufen, dem ich beiwohnen muss …«
Eine Verpflichtung (wo ich hingehe, musst du mitgehen), die er als Einladung an den Leser formuliert: »Komm mit.«
Helen nahm sie an. Sie wiederholte sie im Geiste, mit der inneren Stimme ihrer persönlichen Lektüre, fast so, als würde sie sich selbst einladen.
»… und mich dabei, wenn du magst, an deiner Gesellschaft freuen will.«
Helen sah hinüber zu Rose
Die betrachtete die Wände. Sie vermaß erneut den Raum, die Figuren auf der beschlagenen Fensterscheibe, die Entfernung zur nahen Straße.
Ihre Situation: Sie war abgesichert und stabil, weil sie Wohnraum hatten. (Danke, Nisha; danke, gute Beziehungen; danke, Nishas Ehemanns Mutter, der diese Wohnung gehörte und die in der darüber wohnte.) Und zudem ein Einkommen – ein Teil davon wurde während des Mutterschaftsurlaubs weitergezahlt –, von dem die Miete bestritten werden konnte.
Gleichzeitig war es eine Lebenssituation, die durch den Umstand ihrer intensiven und kontinuierlichen gegenseitigen Ansprache immer wieder (neu) erschaffen und grundlegend definiert wurde.
Durch das Moment des Adressiven; durch ihr gegenseitiges Reagieren aufeinander. Zwei Menschen, die sich einander zuwandten: die für einen aus Helens Sicht unabsehbar langen Zeitraum füreinander die Rolle der jeweils ersten Antwortenden (der jeweils unmittelbaren und ersten, weil immer anwesenden Adressatin) einnehmen würden.
Meinst du das?
Das war Helen, die Rose fragte.
Ich überlasse es dir: Habe ich, indem ich all das tue – dich hochhebe, dich absetze, dich warm halte, dich zeitweilig allein lasse (dich in deiner Wippe festschnalle, während ich zur Wohnungstür stürme, weil es klingelt) – verstanden, was du mir sagen willst?
Brauchst du genau das?
Ist das mit Lebendigsein gemeint, und ist es das – ist es wirklich alles –, was dazugehört?
Das war Rose, die Helen fragte, ihr etwas entgegensetzte, die mit dieser erstaunlichen Art auf das antwortete, was vorgeschlagen oder angeboten worden war – von Helen, die fragte: Bist du hungrig? Bist du müde? Bist du zufrieden? Ist alles »gut«?
(Ein »gutes« Baby – sie lernte ständig dazu, fügte täglich neue, überraschende Bedeutungen den gewohnten Wörtern ihres Vokabulars hinzu: Das also ist hier mit »gut« gemeint! Das soll damit ausgedrückt werden: vorhersehbar und leicht zu lesen. Ruhig. Hochhebbar und – sehr wichtig – ablegbar. Ein neugeborener Mensch, der von Geburt an darauf ausgerichtet ist, oder wenigstens den Willen dazu aufbringt, dem Rhythmus der Erwachsenenwelt widerstandslos zu folgen, und dessen Bedürfnisse sich innerhalb der erwartbaren Bandbreite bewegen und nicht überzogen, sondern vernünftig und erfüllbar sind.)
Rose, die noch nicht sprechen konnte, sondern sich nur mit Brabbeln und Weinen, mit weichen, luftigen Ausdrucksformen und silbenartigen Ansätzen zu möglichen Lauten ausdrücken konnte, antwortete darauf. Oder doch eher auf etwas anderes: auf ein tiefes, mächtiges inneres Stechen, das von einer uralten, unbekannten Intuition ausgelöst wurde.
Rose, für die es kein grundsätzliches Getrenntsein gab, nur eine gemeinsame Situation und Empfindung und die, weil sie so weit offen war, eine ständige Verbindung herstellte zwischen sich, Helen und ihrer Umgebung.
Ich weiß, ich weiß.
Wir wissen es nicht.
Geht es so – finden wir so heraus, wie man es macht?
Zusammen leben? In dieser Form?
Zwei mögliche Menschen: der eine daran gewöhnt, die eigenen Körpergrenzen zu schützen, der andere wie offenes Land.
Beide ständig der Gegenwart des anderen bewusst.
Die eine zuhörend und empfänglich für die andere: ihre Anregungen aufnehmend.
Hier, ein Gedanke, sagte Helen zu Rose.
Hier, ein Gedanke, bot Rose Helen an oder schien es zu tun: mit einer Geste. Dem Öffnen ihres Mundes. Mit der Art, wie sie, jedes Mal, wenn sie hungrig oder müde war, ihren Kopf abrupt wegdrehte. Ein Gedanke, den Helen manchmal als eindeutigen visuellen Auslösereiz im Gehirn, öfter aber als merkwürdiges Gefühl wahrnahm, das sie zu deuten versuchte, um es in eine Handlung übersetzen und so beantworten zu können. Dann tun wir das jetzt.
Es ist wichtig, dass wir das jetzt gleich, unbedingt in genau diesem Moment tun.
Und dann taten sie es auch, und ihre Handlung ließ weitere Gedanken entstehen, die sie wiederum in eine andere Richtung schickten, auf etwas Neues zu.
Ihre Situation hatte eine bestimmte Struktur: eine Dynamik, die zwischen zwei unterschiedlichen Standpunkten entstand – einer hier, einer dort drüben, oder auch beide ganz nah beieinander. Zwei unterschiedliche, feste Positionen, aber auch die Beziehung, die sich zwischen ihnen herstellte; jede Beteiligte übernahm eine aktive Rolle in diesem Dialog, von dem keine von beiden wusste, dass sie ihn überhaupt führten.
Helen und Rose: wie sie sich aneinander wandten, miteinander in Verbindung traten, von ihrem jeweiligen Punkt im Raum aus.
Manchmal durchaus erfolgreich.
Durch Nähe und Direktheit und mühelosen Austausch.
Auf Zack: Fragen-treffen-auf-Sofortantworten. Handlungen als Ausdruck wunderbaren wechselseitigen Verstehens, das sich jederzeit ereignen konnte, in jedem Moment, aus dem Nichts heraus: vormittags oder mitten in der Nacht.
Wie sie einander aber auch verpassten.
Sich über große Distanzen und Unterschiede hinweg in die grobe Richtung der anderen tasteten. Ich verstehe, du bist dort, und ich bin hier. Aber ich weiß nicht, was für eine Frage du gestellt hast. Und das ist sowieso nicht die passende Antwort. Unzutreffende, unangemessene Reaktionen auswerfen: panisch viel zu hohe Bälle spielen angesichts mächtiger Abwehr, Verweigerung, Angespanntheit und unerträglicher Verzögerungen.
Roses Aufmerksamkeit wurde von einer Figur des Mobiles gefangen genommen, die Helen gar nicht bemerkte. Ihr Körper zuckte. Unwillkürlich strampelte sie.
Das flexible Hohlgestell der Wippe fing die Wucht ihres Strampelns auf und ließ Rose als Reaktion darauf zurückschnellen.
Es funktioniert also.
Das sagte Helen zu sich selbst, aber auch zur Wippe unter dem Mobile; dazu noch die bequeme Position ihres eigenen Körpers neben Rose. Überraschend bequem, wo doch eine Schlafphase übersprungen worden war. Aber nun lagen sie hier: beschäftigt; ihre Aufmerksamkeiten wurden in unterschiedliche Richtungen gelenkt, sie waren beide müde, trieben aber sanft in dieser Müdigkeit; waren unerwartet zufrieden.
Im Augenblick funktioniert es.
Aber wie lange? Und wird sie weiterhin funktionieren – diese fragile Komposition, die wir geschaffen haben: Kann sie aufs Neue erschaffen werden und später oder morgen verlässlich wieder genauso funktionieren?
Es war die Szenerie eines improvisierten, alltäglichen Handlungsablaufs, dessen Mechanismen freigelegt waren.
Die Situation hatte auch etwas Sentimentales. Weil archaische und äußerst mächtige Gefühle im Spiel waren. Etwas übertriebene vielleicht auch: aufgeblasen, leicht klebrig, süßlich riechend. Doch warum »sentimental« nicht im Sinne Friedrich Schillers verstehen? Als eine von zwei verschiedenen Haltungen dem Schreiben und der Welt (dem Schreiben der Welt) gegenüber. Einerseits: das »Naive«. Die unmittelbare Mitteilung einer Erfahrung. Das Erzählen davon. Demgegenüber: das »Sentimentalische«, eine Praxis, die aus der Beziehung des Dichters oder der Dichterin zu den Materialien, zur jeweiligen Situation, zur erfahrenen Erfahrung schöpft und diese Beziehung offenlegt: »sentimentalisch« bedeutet in seiner Begrifflichkeit, verortet und sich seiner selbst bewusst zu sein; sich selbst zu beobachten, zu kommentieren. Sich Gedanken zu machen.
Einsetzende Selbstbeobachtung …
Für Helen war es eine vollkommen neue Situation, auf die sie (wie alle, die etwas ohne vorherige Anleitung zum allerersten Mal tun) rein praktisch so schlecht vorbereitet war, dass ein hoher Grad an Selbstbeobachtung unvermeidlich war.
Macht man das so?
Es war Helen, die sich das fragte. Die aber auch ihre Mutter fragte, die drei Autostunden entfernt lebte. Nisha, ihre Kollegin. Ihre Teamleiterin. Nisha, mit ihren drei großen, gesunden Kindern, die längst dem Babyalter entwachsen waren. Mit ihren großzügigen Taschen voll gebrauchter Sachen.
Und darüber hinaus, willkürlicher: die Leute, denen sie online folgte; Elternteile in Aktion, denen sie im Park begegnete, im Supermarkt. (Wer hatte sie unterwiesen?)
Es war eine Situation der provisorischen Maßnahmen und offenen Fragen, in der man gleichzeitig mit dem Gewicht von Erwartungen, bewährten Verhaltensweisen und einer Menge erhaltener Informationen zurechtkommen musste.
Bin »ich« das, die das gerade macht?
Als ob die ganze Welt zusah, wenn auch nur unverbindlich, mit einem starken Hang zum Urteilen, aber einem nur begrenzten Interesse an den Einzelheiten. Als ob die Welt sie durch eine Einzäunung beobachtete, als gäbe es so etwas wie Zäune oder Grenzen, die eine Sphäre dauerhaft von allen anderen abtrennten, damit sichergestellt war, dass nichts, was ihre Situation betraf, nach außen dringen, entweichen und Angelegenheiten jenseits der eigenen betreffen konnte.
Als ob dauernd jemand mithörte. Ständig dieses unangenehme Gefühl.
Stören wir Sie? Diese Frage richtete Helen regelmäßig an die Wohnung über ihr: Während sie versuchte, die Lautstärke von Roses Schreien, ihre eigenen Frustrationsschübe sowie die Häufigkeit und die Dauer ihrer Versuche, sie beide zu beruhigen, aber auch die Uhrzeiten, zu denen sich all dies ereignete, einzuschätzen. Sie schickte die Frage durch die Zimmerdecke, damit sie die Sohlen der Hausschuhe ihrer Vermieterin berühren konnte – ihre aus gedrehten und geflochtenen französischen Gräsern und türkisfarbenem Leinen hergestellten Espadrilles, mit denen sie auf ihren Holzdielen herumging.
Stören wir Sie, und wenn ja, könnte das – wird das – Konsequenzen haben?
Werden wir Sie auch zukünftig (für das Recht) bezahlen dürfen, hier weiterhin zu wohnen/leben?
Auch wenn es mir anders lieber wäre – das war Helen, die grübelte: Ich würde wirklich gern wissen, wie das wäre, all das mit einer etwas »naiveren« Haltung zu erleben. Also einfach tun, einfach handeln. Einfach weitermachen. Ohne allzu viel nachzudenken. Ohne sich den Kopf zu zerbrechen (ohne von dieser gespaltenen Position aus zu denken, die immer beide einschließt und immer irgendwie danebenliegt). Wenn das nur ginge, es klingt (als wäre es) wirklich richtig gut.
Es war eine alltägliche, ganz gewöhnliche Situation, die zwar gewisse Besonderheiten aufwies, in der man aber nicht isoliert war. Eine Situation, die in indirektem, manchmal in direktem, in befruchtendem oder konflikthaftem Austausch mit anderen Situationen stand, aber auch mit anderen Praktiken, Wissensbereichen sowie mit anderen Objekten und anderen Kräften, die ihre Umgebung formten und bedingten:
Mit der Lampe, die Helen abends vom Schreibtisch nahm und an die Steckdose beim Sofa anschloss. Wo sie ein angenehmeres Licht als die Deckenlampe erzeugte, einen sanften Lichtkreis, in dem sie beide sich beruhigen konnten.
Mit dem Sofa, dessen Polstermuster Helen nicht gefiel. Sie fand es abscheulich.
Mit dem Philosophiebuch auf dem Regal mit dem nach außen gewendeten Cover und der Person darauf, die ihnen den Rücken zukehrte und sich eingehend mit eigenen Dingen beschäftigte. Aber dennoch: eine Stimmung und wichtige, herausfordernde Ideen mitteilte. Sein Insistieren auf einer »Kontinuität zwischen der ästhetischen Erfahrung und den gewöhnlichen Lebensprozessen«; seine Theorien und sein Vokabular.
Das Buch gehörte eigentlich Rebba.
Sie hatte es gekauft. Vor ein paar Jahren, als sie noch Studentin war, hatte sie darin gelesen. Sie hatte damals auf die für sie typische Weise darüber gesprochen – also über die Kapitel, die sie gelesen hatte.