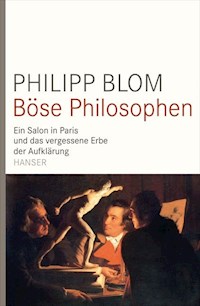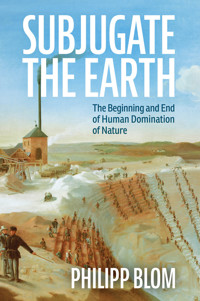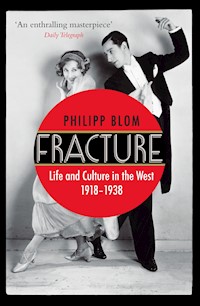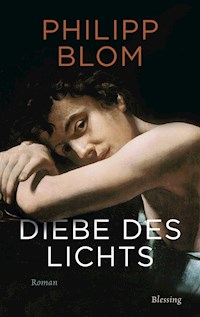Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Macht euch die Erde untertan« – Philipp Bloms Universalgeschichte der Unterwerfung der Natur »Macht euch die Erde untertan«: Vor rund 3000 Jahren legte der Autor der Genesis seinem Schöpfer diesen Satz in den Mund. Damit war die Idee geboren, dass der Mensch eine Sonderstellung auf der Erde einnimmt und deren Ressourcen rücksichtslos ausbeuten darf. Sie war so stark, dass sie sich über den ganzen Planeten verbreitete. Wer sich ihr widersetzte, bekam es mit Kolonisatoren und Geschäftemachern zu tun, die sich auf angeblich höhere Werte beriefen. In seiner Universalgeschichte der Umwelt erzählt Philipp Blom die Geschichte der Unterwerfung der Natur, deren Konsequenzen die Menschheit heute an den Rand des Abgrunds führt. Nur wenn sie sich von dem Wahn befreit, über der Natur zu stehen, bleibt ihr die Chance, zu überleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Macht euch die Erde untertan« — Philipp Bloms Universalgeschichte der Unterwerfung der Natur »Macht euch die Erde untertan«: Vor rund 3000 Jahren legte der Autor der Genesis seinem Schöpfer diesen Satz in den Mund. Damit war die Idee geboren, dass der Mensch eine Sonderstellung auf der Erde einnimmt und deren Ressourcen rücksichtslos ausbeuten darf. Sie war so stark, dass sie sich über den ganzen Planeten verbreitete. Wer sich ihr widersetzte, bekam es mit Kolonisatoren und Geschäftemachern zu tun, die sich auf angeblich höhere Werte beriefen. In seiner Universalgeschichte der Umwelt erzählt Philipp Blom die Geschichte der Unterwerfung der Natur, deren Konsequenzen die Menschheit heute an den Rand des Abgrunds führt. Nur wenn sie sich von dem Wahn befreit, über der Natur zu stehen, bleibt ihr die Chance, zu überleben.
Philipp Blom
Die Unterwerfung
Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur
Hanser
Für Lea und Benedikt
Der Schwung in die Lüfte
Ein Moment des höchsten Todesmutes, des blinden Glaubens, als er auf die Klippe zurennt und sich dann in die Luft wirft, auf die Flügel vertrauend, die fremd und starr sind, bis der Wind sie ergreift und sie mit einem Satz in die Höhe hebt, als wären es nur Federn. Da fliegt er, steigt er auf, rast er mit flatternden Fittichen in die Sommerluft, über der Insel. Er sieht die Häuser unter sich, die Bäume und die Felder und die Berge selbst immer kleiner werden, das glitzernde Meer reicht bis an den Horizont, ans Weiß überall. Er fühlt seine Kraft, hebt sich weiter in die Höhe mit jedem Flügelschlag und immer weiter. Unter sich sieht er seinen Vater fliegen. Nie würde der den Mut haben, sich so weit in den Himmel zu schwingen, einem Gott gleich, dem Beherrscher der Inseln und des Meeres. Er aber hört das Pulsieren des Blutes, das in seinen Ohren pocht und durch seine schwellenden Adern läuft, er fühlt jede Anspannung seiner Muskeln, er fühlt die warme Luft, die ihn umströmt wie eine fließende Umarmung, der Atem einer unbekannten Göttin. Ikarus schwingt sich weiter empor, weiter als die Möwen und Gänse, höher als die kühnsten Adler fliegen. Er hat es geschafft. Er ist der Welt da unten entkommen. Ihren tyrannischen Gesetzen. Von nun an wird er seine eigenen Gesetze schreiben. Von nun an wird er wie ein König leben, erhaben, frei und auf jede Herausforderung gefasst. Er wird der Herr sein von alledem, von diesen kleinen Flecken Land, die von hier oben aussehen, als hätte ein Vogel sie im Flug fallenlassen, als hätten die Götter mit den Inseln gewürfelt, um einen Preis zu gewinnen. Gleich erreicht er die Wolken, die frei und unbezähmbar im Himmel fliegen, gleich wird er sie greifen können und ihnen ihr Geheimnis entreißen.
Nur wenige Flügelschläge noch, dann ist er dort.
Prolog
Kauf eine Wolke mir
Ich habe großen Respekt vor dem Material. Als wäre es selbst ein Lebewesen. Das meiste ist ja von Menschen erdacht. Und man muss es wieder zum Erzählen bringen. Nicht der Autor erzählt, wie wir früher immer eingetrichtert bekommen haben. Alle Menschen und Ereignisse erzählen.
Alexander Kluge1
Sieh in den Himmel, auf die Unendlichkeit und davor auf den hoch gekuppelten Tumult der Wolken. Egal, was auf dem Streifen Land darunter liegt: ein Alpenpanorama, der tägliche Stau auf dem Sunset Boulevard, eine Industrieruine, sturmgepeitschte Ozeane, Getreidefelder oder glitzernde Wolkenkratzer: Dort oben weht der Wind frei, dort müssen auch die Gedanken frei sein in immer neuen Formen. Dort muss die letzte Wildheit herrschen.
Maler sind seit jeher verliebt in Wolken, in ihre stürmischen Metamorphosen, in die Sinnlichkeit der Formen, das Spiel von Licht und Schatten und die dramatischen Stimmungsumschwünge, die hereinbrechen, wenn plötzlich die Sonne verschwindet oder wie eine Offenbarung durch die aufgetürmten bleiernen Massen bricht.
Die größten Wolkenvirtuosen waren jene Holländer, die um die Mitte des 17. Jahrhunderts begannen, die eigene Stimmung in der Zerrissenheit und der Poesie der himmlischen Landschaften zu sehen, schon weil die irdische Landschaft ihnen nicht viel zu bieten hatte: kaum ein Hügel, geschweige denn dramatische Gipfel und Schluchten, majestätische Flüsse oder Panoramen. Hier war alles feucht und klein, bräunlich mit Grau, ohne große Akzente, antike Ruinen oder andere Quellen des erhabenen Schauers. Die Menschen dort waren Bauern oder Heringsfischer. Das Land war ein Strich am Horizont, nur von einigen Bäumen oder einer Reihe von Windmühlen unterbrochen. Große Teile dieser Landschaft waren von Menschenhand erschaffen; nicht nur die Felder, deren Ränder wie mit dem Lineal gezogen waren, auch die Kanäle und die Städte, überhaupt das Land selbst, das Ingenieure, Deichgrafen und die harte Arbeit anonymer Arme der Nordsee abgetrotzt hatten. »Gott hat die Erde geschaffen«, sagt eine alte Redensart, »und die Holländer ihr eigenes Land.« An Selbstbewusstsein fehlte es ihnen nicht.
1Jacob van Ruisdael, Weizenfeld, ca. 1670, Öl auf Leinwand, 100 x 130,2 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York, Nachlass Benjamin Altman, 1913, Accession Number: 14.40623
Die Maler aber suchten nach mehr als nach abgezirkelten Produktionseinheiten der Marktgärten und Kuhweiden. Ihre Auftraggeber, die Patrizier von Amsterdam und anderen Handelszentren, verlangten nach bildlichen Darstellungen ihres Lebensgefühls und ihrer Ideen. Sie waren strenge Protestanten, die glaubten, dass sie Gott direkt Rechenschaft schuldig waren. Ohne Beichte und Absolution waren sie ganz auf ihr Gewissen zurückgeworfen. Die Künstler der Zeit projizieren dieses Drama in die Natur. Leinwände, auf denen ein Bauernhaus oder ein Wäldchen zu sehen ist, bilden die Bühne für psychologische Dramen, in denen die Wolkenmassive den Sturm der Emotionen und der inneren Kämpfe darstellen.
Im Himmel erkannten Rembrandt, Ruisdael und ihre Kollegen die letzte Wildnis einer aufgeschütteten, abgezirkelten, in Streifen geschnittenen Welt. Das Meer, der ewige Ernährer und ewige Feind aller Küstenvölker, repräsentierte die Natur, die sich nicht bezwingen ließ und deren Kraft man respektieren musste, wenn einem das Leben lieb war. Das Meer war aber immer auch Quelle für Fisch und Handelsware, für Arbeit und Karrieren. Bei aller Achtung hatte man eine pragmatische Beziehung zur Nordsee. Der Himmel war der letzte Raum, in dem die Stürme der Seele sich abbilden ließen.
*
1. Juli 2021: hundertjähriges Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas. Eine Ehrengarde marschiert vor 70.000 geladenen und uniformierten Gästen und 56 geladenen Artilleriegeschützen über den Platz des Himmlischen Friedens und durch ein riesiges Tor, das mit den Jahreszahlen 1921 und 2021 sowie Hammer und Sichel in Gold gekrönt ist. Die Soldaten bewegen sich mit der Disziplin eines einzigen Körpers, jeder Winkel exakt abgezirkelt, das Metall ihrer Gewehre blitzt in der Sonne, ihr Blick ist starr nach vorne gerichtet, in eine glorreiche Zukunft. Beim Hissen der Nationalflagge schießen die Kanonen hundert Salutschüsse. Die Kommunistische Jugend und die Jungen Pioniere zollen der Partei vor einem riesigen Porträt von Mao Zedong enthusiastisch Tribut. Die jungen Menschen tragen im linken Ohr kleine Kopfhörer, damit sie die Sprechchöre und Parteihymnen perfekt synchronisiert skandieren können, nichts ist hier dem Zufall überlassen. Helikopter fliegen in der Formation der Zahl »100« über den Platz.
Abseits von dieser Zeremonie und den omnipräsenten Postern, Bannern und Leuchtreklamen für das Parteijubiläum geht das normale, chaotische Leben der Stadt weiter. Die drückende Glocke aus Smog, die sonst das Atmen erschwert, hat sich gelichtet — ein für viele Menschen in Peking willkommener Nebeneffekt der Feierlichkeiten: Der Himmel strahlt blau und obwohl die Bilder dieses Tages deutlich einen gelblich-grauen Dunst über den Häusern erkennen lassen, sind die Sichtweite und Luftqualität doch wesentlich besser als an anderen Tagen, weil in der Umgebung Pekings Fabriken mit besonders stark schmutzigen Abgasen einige Tage vor der Zeremonie ihre Produktion herunterfahren mussten.
Internationale Wissenschaftler fanden für das schöne Wetter an diesem feierlichen Tag aber noch einen anderen Grund: Die Regierung hatte sich einer Technologie bedient, in die sie in den letzten Jahren Unmengen Geld investiert hatte: Cloud Seeding. Dabei werden Silberjodid oder andere Chemikalien von Flugzeugen auf Wolken gesprüht, um dort das Entstehen von Tropfen zu stimulieren und am gewünschten Ort das Abregnen der Wolken zu provozieren. Durch den künstlichen Regen am Vortag war die Luft gereinigt und der Himmel über dem Platz des Himmlischen Friedens beinahe blau. Auch den Olympischen Spielen 2008 hatte Cloud Seeding schöne Fernsehbilder beschert.
Nach offiziellen chinesischen Angaben sind allein zwischen 2012 und 2017 mehr als zweihundert Milliarden Kubikmeter Wasser künstlich abgeregnet, Artilleriegeschosse mit Jodid haben 2019 riesige Hagelschäden verhindert. Ziel ist es, die Wetterveränderung durch Cloud Seeding weiter auszudehnen, bis es ein Gebiet abdeckt, das anderthalbmal so groß ist wie Indien, um landwirtschaftliche Produktionsquoten und propagandistische Ereignisse abzusichern.2
*
»Ich, Noa Jansma, verkaufe Wolken«, verkündet eine junge niederländische Künstlerin auf ihrer Website. In der Sprache der Wirtschaft erklärt sie ihr Projekt:
das Schürfen: Die Wolken werden zu meinem Besitz. Nach der Besetzungstheorie von Jean-Jacques Rousseau bemächtige ich mich ihrer, indem ich eine Grenze um sie ziehe, bevor jemand anders das tut. Ich habe künstliche Intelligenz trainiert, das für mich zu tun.
die UR (Unique Registration): Nach der Arbeitstheorie von John Locke müssen Menschen mit den Wolken interagieren, um sie zu ihrem Eigentum zu machen. Ich habe eine Installation gebaut, in der Menschen auf dem Gras liegen können und auf projizierte Wolken blicken, die vorbeischweben. Die Wolken werden nach ihren Eigenschaften bepreist (in €) und ein QR-Code wird hinzugefügt. Wenn die Zuschauer diesen QR-Code mit ihren Handys scannen, betreten sie die Welt der virtuellen Spekulation. Als Teil der Interaktion teilen sie ihre Daten (ein Selfie und ihren Namen) mit der Wolke und bekommen ein Zertifikat.
das US (Universal System): Nach der Bezahlung bekommen die Besitzer ein Zertifikat, das auch in einem Online-Kataster archiviert wird. Die gekauften Wolken schweben mit den Kaufpreisen im virtuellen Raum. Inspiriert durch kapitalistische Marktkräfte, können im Kataster größere Wolken kleinere fressen und auf ihre Kosten wachsen.3
2Noa-Jansma-Projekt: Buycloud. Quelle: https://www.noajansma.com/buycloud
Die Pandemie hat Jansmas Projekt notgedrungen zu einem Online-Ereignis mutieren lassen. Trotzdem sieht sie gerade für Buycloud eine eindeutige Chance mitten in der Katastrophe: »Neue Studien sagen vorher, dass bei steigenden Emissionen bald keine Kumulus-Wolken mehr existieren werden. Das wird zu einem Temperaturanstieg von 8° Celsius führen — katastrophal für den Planeten, aber hervorragend für den Wolkenmarkt. Der Kauf einer Wolke wird zu einer poetischen, aber stabilen Investition.«
Das Lachen bleibt den Investoren gelegentlich im Halse stecken, aber die Künstlerin will ihre Gedanken noch einen Schritt weiterführen. Ihre Inspiration kam aus der Geschichte der europäischen Unterwerfung anderer Kontinente, erläutert sie: »Als im 15. Jahrhundert westliche ›Entdecker‹ das Land besuchten, das wir heute Amerika nennen, sagten sie den Ureinwohnern, dass sie ihr Land kaufen wollten. Die Ureinwohner waren verwirrt. Ihr Land? Kaufen? Ihr Wortschatz hatte kein Wort oder Verständnis für Eigentum an Naturphänomenen.«4 Die Wolken als letztes noch nicht kolonisiertes Phänomen warten nur darauf, endlich global vermarktet zu werden.
*
Wolken — der letzte ungezähmte Teil der Natur? Das sind sie, die ewig Veränderlichen, nur in unserer Vorstellung. Längst wird ihre Entstehung durch die Erderhitzung beschleunigt, werden sie beobachtet, klassifiziert, verfolgt, analysiert, chemisch manipuliert und nicht nur in einem Kunstprojekt mit Preisen versehen und zu Spekulationsobjekten gemacht: denn Zukunftsoptionen auf die Erntemengen einzelner landwirtschaftlicher Commodities und damit auch Wetten auf das Wetter im Zeitraum der Ernte gehören längst zur Normalität. Mit Wolken lässt sich eine Menge Geld verdienen.
Wer lange genug eine Landschaft (im Englischen schöner: skyscape oder sogar: cloudscape) von Kumuluswolken beobachtet, ein Feld von feinstem Cirrus im Licht der untergehenden Sonne, oder eine bleiern drohende Gewitterfront, kann nicht umhin, von ihren unerschöpflich einfallsreichen Variationen über ein Thema hypnotisch aufgesogen zu werden. Gesichter und Gestalten erscheinen, Drachen kämpfen mit anderen, wunderbaren Kreaturen, bedrohliche Felswände türmen sich auf, Sonnenstrahlen schneiden durch dunkle Mauern oder illuminieren eine Szene wie in einer barocken Oper. Keine Landschaft kann grandioser sein als die Berge und Schluchten dieser hoch aufgetürmten Chimären. Wie beim Blick auf fließendes Wasser, auf die Brandung oder auf ein Feuer, kann das Bewusstsein von diesem Strom ganz mitgerissen werden, sich am Ende in ihm auflösen.
Die anarchische, ungreifbare, dauernd in Veränderung begriffene Natur der Wolken hat es ihnen erlaubt, sich so lange der Herrschaft der Menschen zu entziehen. Sie gehörten schon immer den Göttern, die sie nach ihrem Willen zusammenballen oder vom Himmel verbannen konnten, in denen sie sich verbergen konnten und aus denen sie ihre Blitze schleuderten.
Jetzt aber, wo smarte Unternehmer und selbsternannte Visionäre längst planen, den Planeten, auf dem sich die Menschheit in jüngster Zeit aufgeführt hat wie eine Rockband in einer Hotelsuite, einfach zurückzulassen und mit einer kosmischen Arche Noah die eigenen zerstörerischen Instinkte und Besitzansprüche in andere Teile der Galaxie zu tragen, ist auch der Raum der Wolken längst kolonisiert. Nur in jenen Winkeln der Vorstellungskraft, die noch nicht von kommerziellen Interessen usurpiert oder betäubt sind, können die Wolken ihre Zauberei noch schwellend und verwehend in den Himmel malen, eine Erinnerung daran, dass alles, was Teil der Natur ist, im dauernden Fluss begriffen ist, unmöglich festgehalten werden kann.
Das gezähmte Land unter den Wolken und der Griff nach immer neuen Eroberungen in der Stratosphäre sind Ausdruck eines kollektiven Wahns, der vollkommen entfesselten Idee nämlich, der Mensch (das Maskulinum ist bewusst gewählt) stehe außerhalb und über der Natur und könne, ja müsse sie unterwerfen. Dieses Menschenbild begreift sich als erhaben über Tiere und andere Lebewesen, sieht die Natur als Kulisse seiner eigenen Ambitionen und als Rohstofflager. Von dieser privilegierten Position aus macht er sich daran, die Welt ganz seinem Willen zu unterwerfen.
Dieser Ehrgeiz ist von einem faustischen Irrsinn umflattert. Gleichzeitig aber ist dieser Wahn der Naturbeherrschung so allgegenwärtig und alldurchdringend, dass es schwerfällt, den nötigen Abstand zu gewinnen, um ihn mit all seinen grotesken und faszinierenden Gesichtern, Masken und Fratzen zu sehen, die auch Wolken schließlich nur zeigen, wenn man nicht mitten in ihnen steckt, sondern sie aus der Ferne betrachtet.
Die Unterwerfung der Natur ist längst zu einer globalen Praxis geworden. In Gesellschaften, die sich gerne als aufgeklärt verstehen und die auch häufig auf eine christliche Tradition zurückblicken, ist dieser Wahn in Naturverständnis und Menschenbild besonders tief verwurzelt. Er wird in Familien und Schulen weitergegeben, findet sich als Muster in Geschichten, Filmen und Video-Games, auch in Gesetzen, Bemerkungen und sogar Witzen, aus denen heraus die soziale Welt sich den Einzelnen als Träger der gleichen Bezüge darbietet.
Diese Unterwerfung prägt den Weltzugang und das Selbstbild vieler Gesellschaften, die sich auf ein gemeinsames Erbe berufen. Aus ihrer Perspektive heraus stellt sich die Geschichte als eine Ausbreitung der Zivilisation und der Entfaltung des Fortschritts dar, der durch Zufall oder Vorsehung in der eigenen Lebensweise oder einer sehr ähnlichen seinen höchsten Ausdruck findet. Der Aufstieg vom Nomadentum zu Ackerbau, Stadtkulturen, Schrift und Geld, Rad und Eisenbahn, Menschenrechten, liberalen Demokratien und globalen Märkten scheint mit unaufhaltsamem Momentum voranzuschreiten.
So zumindest beschrieben es Beobachter im sogenannten Westen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aber die Geschichte hat gleich mehrere andere Wendungen genommen. Die Eschatologie der liberalen Demokratien und der liberalen Märkte ist einerseits von der Techno-Zukunft des Silicon Valley abgelöst worden, das dieselbe alte Sehnsucht in neue Bilder kleidet und als Transhumanismus, Besiedlung ferner Planeten oder Herrschaft der Künstlichen Intelligenz inszeniert.
Auf anderen Gebieten ist dieses Narrativ an der Wirklichkeit zerbrochen, von der Klimakatastrophe bis hin zum Aufbrechen postimperialer Wunden und Demütigungen vom Mittleren Osten bis in die Ukraine. Jenseits dieser offensichtlichen Konflikte rasen die Missachtung natürlicher Systeme und der damit verbundene Kollaps der Biodiversität einer vorhersehbaren Katastrophe zu. Anstatt eines himmlischen Jerusalem erscheinen in der mittleren Distanz ein Sodom und Gomorrha.
Das gezähmte und beherrschte Land, der unterworfene Planet zeigt sich überfordert von so viel willkürlicher und plötzlicher Manipulation. Organische Verbindungen, über Jahrmillionen entstanden und in der Erde gespeichert, wurden innerhalb von wenigen Jahrzehnten wieder in die Atmosphäre geblasen: Ihre Energie befeuerte den rapiden Aufstieg einer Spezies zu ungeahnter Macht.
Aus der Perspektive ökologischer Systeme aber hat dieser Aufstieg einen Preis: Fein aufeinander eingespielte Lebenszyklen kollabieren, chemische Zusammensetzungen und Temperaturen von Ozeanen und Atmosphäre ändern sich, Ozeanströmungen und Höhenwinde ändern die Richtung, Polareis schmilzt ab, Regenwälder verschwinden, Meeresspiegel steigen, die Biodiversität kollabiert. Das himmlische Jerusalem ist noch unbewohnt und schon längst kellerfeucht.
Diese natürlichen Prozesse spulen sich ab wie von Wissenschaftlerinnen vorhergesagt, nur wesentlich schneller als in vielen Modellen errechnet. So müssen wir uns darauf gefasst machen, dass auch die nächsten Stadien der Erderhitzung ähnlich ablaufen wie berechnet, aber das Potenzial für Verdrängung, Leugnung und politische Instrumentalisierung ist so enorm, dass sich die bloße, nachvollziehbare und beobachtbare Wahrheit nicht durchsetzen kann.
So vollzieht sich die Katastrophe vor aller Augen. Jedoch ist Homo sapiens kein besonders wichtiger Organismus und wird das Schicksal seines Heimatplaneten nur vorübergehend beeinflussen, davor und danach regieren die Mikroben, für die Säugetiere wenig mehr sind als Trägerorganismen. Homo sapiens freilich — dieser Gedanke entbehrt auf der Bühne der Evolution nicht der Komik — sieht sich als Mittelpunkt, als Maß, als Herrscher der Natur. Er glaubt tatsächlich, dass alle lebenden Kreaturen vor seiner unvergleichlichen Majestät in den Staub fallen.
Ein nüchterner Blick erkennt Homo sapiens als einen Primaten, der sich selbst hoffnungslos überschätzt, einen unwesentlichen Teil in einem System von Systemen, das in der westlichen Tradition als »Natur« bezeichnet wird, einen biologischen Neuankömmling, der im Moment den Zyklus aller innovativen Spezies zu durchlaufen scheint: maximale Ausdehnung, Degradierung der Ressourcen, gefolgt von Zusammenbruch. Diesen Weg ist auch das römische Reich gegangen.
Die Unterwerfung der Natur spielt eine Schlüsselrolle in diesem sich entfaltenden Drama, wenn auch vielleicht eine andere als erwartet. Sie ist längst Teil des Gewebes geworden, in dem unsere Gesellschaften denken und handeln. Sie scheint ein selbstverständlicher Teil des menschlichen Lebens zu sein, dabei war ihr Erfolg nie sicher; ihre Karriere verläuft abenteuerlicher als die vieler Romanhelden. In einer sehr begrenzten geografischen und kulturellen Umgebung hat sich die Idee der Unterwerfung über Jahrhunderte etabliert, um dann zu einem neuen, unendlich viel mächtigeren Leben aufzubrechen. Mit den Schiffen, den Büchern und den Kanonen der Europäer wurde sie in die Welt getragen, die Aufklärer erklärten die absolute Beherrschung der Natur zur vornehmsten Aufgabe des Menschen, Wissenschaftler und Ingenieure machten scheinbar riesige Schritte einer glorreichen Zukunft entgegen, Kapitalisten und Kommunisten gleichermaßen erhoben sie zur Staatsraison und erklärten der Natur buchstäblich den Krieg.
In diesem Buch versuche ich der erstaunlichen Geschichte dieser Wahnidee nachzugehen, von ihrer Geburt im Morgengrauen der dokumentierten Zivilisation bis hin zu ihrem Sterben im Zuge der Klimakatastrophe.
*
Außerhalb der »westlichen« Tradition bietet sich ein ganz anderes Bild. Es gibt kaum andere Gesellschaften, deren Mythen und Geschichten bis heute überliefert und erschlossen sind, die den Menschen als Herrscher über die Natur verstehen, erhaben über das Gekreuch und Gefleuch zu seinen Füßen, dazu ausersehen, sie zu unterwerfen und die Geschichte zu vollenden.
In chinesischen Denktraditionen beispielsweise gibt der Weg, das Dao, vor, wie und wohin die Natur fließt und dass Menschen diesen Weg erkennen und das Gleichgewicht respektieren lernen müssen (wie wir später sehen werden, geschieht das allerdings auch nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint). Die Azteken sahen sich selbst als Sklaven tyrannischer und inkompetenter Götter, die ihnen in allen Naturerscheinungen begegneten und die nur mit exaltiert blutrünstigen Menschenopfern bei Laune gehalten werden konnten.
Die Aborigines in Australien begreifen sich als Wanderer entlang der Traumpfade ihrer Ahnen, die sie intim mit ihrem Land verbinden und eine spirituelle Geografie formen. Das Volk der Jívaro in Ecuador weiß, dass es ein Volk von Räubern ist, das im Krieg gegen die Natur lebt und sich gewaltsam oder durch List nimmt, was es vom allgegenwärtigen Feind erbeuten kann. Für die neuseeländischen Maori und ihre polynesischen Vorfahren ist die natürliche Welt voller Dinge und Orte, die für alle oder nur für bestimmte Menschen tāpuu sind, tabu, die nicht angerührt, gegessen oder betreten werden dürfen.
In der Shinto-Tradition Japans liegt die höchste ästhetische Perfektion und die größte Weisheit in der meditativen Identifikation mit natürlichen und vergänglichen Formen und Prozessen. Menschen vom Volk der San in Botswana und Namibia wissen, dass sie Verwandte von Tieren und Bäumen sind, und dass ihre Ahnen in Steinen und sogar im Wind wohnen können. Es ist leicht, solche Entwürfe als poetische Naivität zu belächeln, aber Kulturen wie die San haben es über mehrere Jahrzehntausende geschafft, in einer relativ stabilen Beziehung mit ihrer natürlichen Mitwelt zu leben. Das westliche Modell ist innerhalb von wenigen Jahrhunderten, wenn nicht von Jahrzehnten an seine Grenzen geraten.
Diese Weltentwürfe (und dies sind nur wenige, willkürlich gewählte Beispiele) unterscheiden sich stark voneinander und transportieren sehr unterschiedliche Menschenbilder und Handlungsmuster. Sie entstanden in Kulturen mit sehr unterschiedlichen Graden der technologischen Entwicklung und sozialer Komplexität, unter sehr verschiedenen klimatischen Bedingungen und als Reaktion auf verschiedenartige Herausforderungen. Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie Menschen als Teil eines geschlossenen Systems wahrnehmen.
Viele Traditionen räumen dem Menschen eine gewisse Sonderstellung ein, wie auch Dipesh Chakrabarty beschreibt5, aber in keinem dieser vielen Weltbilder erscheint die wahnsinnige und atemberaubend narzisstische Idee, dass der Mensch über der Natur stehe und nicht nur andere Menschen und Territorien, sondern die Natur selbst unter sein Knie zwingen könne, sei es durch Gebete oder technologische Arsenale und wissenschaftliche Penetration der letzten Geheimnisse des Kosmos.
Lange war diese Idee lediglich eine unter vielen, der Wahn der Unterwerfung der Natur konzentrierte sich auf die ehrgeizigen Fantasien einiger Mönche und Gelehrter in Europa, einem Teil der Welt, der nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches in Anarchie verfallen war. Andere Kulturen mit anderen Ideen über die Welt und zweifellos auch anderen kollektiven Wahnideen entwickelten sich auf anderen Erdteilen. Manche Gesellschaften und ihre Geschichten lebten weitgehend isoliert voneinander, andere waren im ständigen Austausch durch Migration, Handel und Krieg. Keiner der kulturellen Weltzugänge aber schaffte es, sich auf dem ganzen Globus zu etablieren.
Im 15. Jahrhundert entsteht eine rasante historische Dynamik, die dieses Gleichgewicht zerstört. Innerhalb von wenigen Generationen wird das Narrativ der Naturbeherrschung und der Unterwerfung globalisiert, durch die Kolonialmächte eingeschleppt und verbreitet, adaptiert und oft intensiviert von Rebellen und Befreiungskämpfern, von Kirchen, Kommunisten und Kapitalisten gefördert, besungen und exekutiert. In diesem Prozess wurden andere Weltzugänge als rückständig gebrandmarkt und bekämpft, während das Evangelium der wissenschaftlichen Beherrschung der Natur im Dienst des Menschen, der Wirtschaft, des Fortschritts, in Abermillionen von Köpfen gedrillt und zur Not mit Panzerbrigaden durchgesetzt wurde.
Heute ist dieser Wahn so endemisch und mit feinsten Haarwurzeln so tief in die letzten Winkel unseres Bewusstseins und unseres Menschenbildes eingedrungen, dass es vielen Menschen buchstäblich unmöglich ist, sich die Welt aus einer anderen Perspektive vorzustellen. Die Geschichte dieses einzigartigen Wahns ist eine Möglichkeit, kritische Distanz zu dieser Idee zu gewinnen, die in vielerlei Hinsicht die Matrix des westlichen Zugangs zur Natur darstellt.
Deswegen scheint es der beste Weg, die Idee der Unterwerfung der Natur nicht wie ein Insektenforscher aufzuspießen und zu klassifizieren, sondern den gesamten Prozess ihrer Entstehung darzustellen und zu beobachten, wie sie sich entfaltet, neue Köpfe und Kollektive ansteckt, ums Überleben kämpft, sich verändert und triumphiert, von ihren Anfängen in Mesopotamien bis zur globalen Herrschaft und ihrem langsamen Sterben. Aus diesem Zusammenbruch entsteht eine philosophische Revolution, die größer ist als die kopernikanische: die radikale Wiederentdeckung des Menschen als Teil der Natur. Dieses intellektuelle Abenteuer wird in Teil III in diese Geschichte zurückkehren.
Der Mensch als Teil der Natur entsteht, wenn die Geschichte der Naturbeherrschung auf den Kopf (Marx würde sagen: vom Kopf auf die Füße) gestellt wird. Anstatt Homo sapiens als Herrn der Schöpfung zu begreifen, ist es auch möglich, ihn als in alle möglichen Zusammenhänge verstricktes Tier zu verstehen, als Knotenpunkt in einem unendlich komplexen Geflecht auch changierender Zustände, als ein Wesen mit weniger Macht und Willensfreiheit, als es sich schmeichelnd zuspricht.
Wer also handelt eigentlich von dieser Perspektive aus gesehen? Wie wichtig sind in diesem komplexen Bild die Geschichten, die Gesellschaften in ihren kollektiven und individuellen inneren Theatern auf die Bühne schicken und die ihr Handeln lenken sollen? Können kollektive Ideen und Geschichten eine aktive Rolle spielen in der Geschichte, oder sind sie nur passive Hirngespinste? Handeln, mit anderen Worten, Menschen mehr als freie Individuen oder mehr als Teil einer kollektiven Gestimmtheit, eines gemeinsamen kulturellen Horizonts, aus dem Drama ihres inneren Theaters heraus?
Vielleicht ist es interessant, auch den Wahn der Unterwerfung der Natur und mit ihm jeden kollektiven Wahn, jede Geschichte, die sich eine Gemeinschaft erzählt, als einen zwar nicht biologischen, aber doch lebensähnlichen Akteur zu begreifen, der sich mit einer gewissen Intentionalität und Kreativität seinen Weg bahnt, der sich anpasst und ändert und Strategien findet, um sich weiter auszubreiten und mehr Köpfe zu infizieren, so wie ein Virus es tut und damit die Evolution selbst. So stellt sich die Unterwerfung als evolutionäre Dynamik dar, die Menschen benutzt, wie es auch Pilze und zahllose Mikroben tun in dem großen Tanz der Verstrickungen und Abhängigkeiten, den wir »das Leben« nennen. Der Wahn als Handelnder: Diese gewissermaßen evolutionäre Perspektive schafft den nötigen analytischen Abstand, um seine Geschichte überhaupt erzählen zu können.
*
Den passiven Part bei all diesem Nachdenken über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur spielt Letztere, die ich weiterhin so bezeichnen möchte, obwohl sich beide Begriffe im Laufe dieser Überlegungen auflösen werden. Die Schwierigkeit des Nachdenkens liegt schon in diesem einen Wort »Natur« beschlossen, von dem man meinen sollte, dass sofort klar ist, was gemeint ist; aber schon beim ersten Nachfragen stellen sich Zweifel ein und niemand weiß, wie sein Gegenüber den Begriff versteht.
Nur um den Bedeutungshorizont ein wenig zu öffnen und dieses Wort in seiner Komplexität aufblitzen zu lassen, sei daran erinnert, dass das Wort »Natur« immer schon einen Unterschied transportiert. Die Natur ist der Kultur entgegengesetzt, die eine definiert das Gegenteil der anderen, aber gleichzeitig hängen sie voneinander ab; Bruno Latour beschreibt sie als die »Siamesischen Zwillinge, die zärtlich zueinander sind oder sich mit den Fäusten prügeln, ohne aufzuhören, denselben Rumpf zu teilen«.6
Je nach ideologischer Disposition gestaltet sich die Hierarchie zwischen Kultur und Natur unterschiedlich. Die Natur ist unberührt und kommt aus sich selbst (oder durch göttliche Intervention), die Kultur ist von Menschen gemacht und dessen eigentliche Bestimmung. Der Mensch steht zwischen Natur und Kultur. Seine historische Mission liegt in der Emanzipation von der Natur und der Schaffung einer höheren Kultur, der Grundlage seiner Freiheit und seiner Erlösung von seinen irdischen Banden.
Dieses etwas überspitzte Narrativ spiegelt sich in einem künstlerischen Genre, das in einer Epoche zum Leben erwachte, als sich die Beziehung zwischen Menschen und der Natur radikal änderte: Stillleben, die besonders in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts populär wurden. Ein klassisches Stillleben — ein Gemälde mit einem Blumenstrauß oder einem Teller mit Früchten, oder Küchenzutaten inklusive Wild und Fischen — ist nie die Darstellung einer natürlich aufgetretenen, vorgefundenen Szene, sondern ein sorgfältiges Arrangement verschiedener Elemente nach einer moralischen Ordnung. Und ein Stillleben ist nie lebendig. Das französische Wort dafür ist nature morte, tote Natur.
Ein Stillleben ordnete die Natur nicht nur — es versah sie mit einem moralischen Inhalt, verwandelte natürliche Dinge wie Blumen und Früchte in bloße Chiffren einer göttlichen Ordnung. Jeder Blumenstrauß zeigte abgeschnittene Blumen, deren Sterben in ihre Schönheit eingeschrieben war, eine Frucht auf dem Höhepunkt ihrer Reife und im Begriff, in Fäulnis überzugehen, schon umschwirrt von den ersten Fliegen. Eine Kerze würde bald niederbrennen, ein Blütenblatt ist rasch vertrocknet, ein Glas geht bald zur Neige, eine Flöte wird nur durch den vergänglichen Atem zu kurzem, melodischem Leben erweckt — und was die häufigen Totenschädel, Rechnungsbücher (dies war eine Nation von Kaufleuten) und religiösen Traktate angeht, so erübrigt sich jede Interpretation. Die Natur wurde zum moralischen Spektakel, zum Raum der Inszenierung der menschlichen Sterblichkeit und eines Verlangens nach Transzendenz.
Diese Denkbewegung, konstatiert Bruno Latour, führt zu einer strukturellen Schizophrenie: »Gerade diese unzulässige Verallgemeinerung jedoch führte zu dem seltsamen Verfahren, einem als objektiv und träge deklarierten Sektor der Welt das Leben abzusprechen und einen als subjektiv, bewußt und frei deklarierten Sektor mit Leben zu überfrachten.«7 Das Erfahrungskontinuum von Natur/Kultur, in dem das menschliche Bewusstsein existiert, wird aufgespalten in eine individuelle, subjektive, »überanimierte« Kultur und seinen Schatten, eine entseelte, objektivierte Natur. Das eine bedingt das andere.
Die entfernte »Natur« wird einerseits zur stummen Ressource und ökonomischen Externalität, zum anderen aber zum Stillleben, zur Landschaft, zum touristischen Dekor, zu Kitsch. Der Rest ist die historische Rache des Jean-Jacques Rousseau: In einer Gesellschaft, die sich von allen natürlichen Rhythmen, Nahrungsmitteln und Reizen emanzipiert hat und zunehmend auch ihre Erfahrungen in eine Sphäre digitaler Simulacren verlegt, wird eine authentische, unberührte Natur endgültig zum Sehnsuchtsort, auch wenn so eine Natur spätestens seit der Proklamation des Anthropozäns nirgendwo auf diesem Planeten existiert.
Die kulturelle Gegenbewegung zur Künstlichkeit der Kultur ist spätestens seit Rousseau der Rückzug ins Paradies, in die kindliche Unschuld und die Harmonie mit der Natur, ins Idyll. Das ist im besten Falle gefährlich anarchische Romantik, meistens aber schlicht Gedankenkitsch. Es gibt keine Rückkehr und keinen Stillstand in der Natur oder in der Geschichte, keinen ruhenden und neutralen Ort des Denkens, von dem aus die Welt objektiv beschrieben werden kann. Allein die Tatsache, dass alles Denken in und durch alternde, lüsterne, kranke, ängstliche, sich dauernd verändernde Körper und Erfahrungshorizonte geschieht, macht eine solche historische Abstraktion unmöglich.
Zwischen der hyperanimierten Kultur und der passiven Natur, zwischen extremer Trennung von der Natur und der Sehnsucht nach der Rückkehr in ihren Schoß bietet die Geschichte des Westens ein ganzes Panorama an Spannungen und Positionen. Gleichzeitig aber ist die Art, auf die der moderne Okzident die Natur darstellt, so der Anthropologe Philippe Descola, etwas, »was in der Welt am wenigsten geteilt wird«.8 In vielen Regionen des Planeten werden Menschen und Nicht-Menschen nicht als fundamental voneinander getrennt angesehen, erklärt er. Sie leben in derselben »ontologischen Nische«, haben dieselben Bedürfnisse, sind miteinander verwandt, sind durch dieselben Geschichten miteinander verwoben und sind vollinhaltliche Individuen mit ihrer eigenen Vernunft, Moral und Gesellschaft.
Diese Trennung der ontologischen Nischen zwischen westlichen Menschen und ihrer Kultur und dem, was sie »Natur« nennen, ist nie vollkommen — in der Tat, ein Teil dieses Buches ist der Archäologie des gedanklichen Widerstands dagegen gewidmet —, aber sie hat die Kultur der Unterwerfung ermöglicht und geprägt, indem sie aus den Organismen, mit denen Menschen diesen Planeten teilen, eine nature morte gemacht hat.
Wo auch immer auf dem Kontinuum zwischen ekstatischer Auflösung und totaler Objektivierung die verschiedenen Stimmen und Positionen sich finden mögen, sie alle teilen die komplizierte, widersprüchliche Geschichte des Begriffs, von dem sie ausgehen. Es ist wichtig, die schwierige Biografie dieses Begriffs mitzulesen und mitzudenken, wenn im Folgenden scheinbar arglos das Wort »Natur« in verschiedenen Kontexten und Bedeutungen auftaucht und sich jeder klaren Definition immer wieder entzieht.
In einer Bedeutung aber ist die Natur gerade massiv in das Leben von vielen Millionen von Menschen zurückgekehrt. Die Corona-Pandemie hat drastisch verdeutlicht, wie willkürlich und wie aufwändig diese Trennung geworden ist, wie verwundbar Menschen sind, wie unmittelbar Teil der Natur, vernetzt und verstrickt in biologische, ökonomische, politische und soziale Zusammenhänge jenseits ihrer Kontrolle und sogar ihrer Kenntnis. Es ist eine Pandemie, die vermutlich durch menschliche Eingriffe in die Natur verursacht wurde und durch menschlichen Erfindungsgeist beendet werden wird.
Schon jetzt aber hat das Virus Wahrnehmungen und Instinkte verändert, Körpergefühle modifiziert, Arbeitspraktiken geändert, Familiendynamiken und soziale Rituale. Es hat soziale Unterschiede vergrößert und Regierungen bloßgestellt, hat das Vertrauen in die Wissenschaft in manchen Ländern gestärkt und in anderen weiter erodiert, hat Gesellschaften gespalten, zahllose Menschen psychisch und finanziell belastet, Karrieren befördert und gebrochen, zu neuen medizinischen Durchbrüchen geführt, ungekannte staatliche Interventionen verursacht und alten Debatten ein neues Vokabular gegeben. Gleichgültig, wie lange es die Welt in Ausnahmezustand versetzt: Es wird eine andere Welt zurücklassen.
Wenn eine biologische Pandemie innerhalb von wenigen Monaten so tiefe Spuren in Denken und Verhalten von Millionen von Menschen hinterlassen kann, gleichgültig, ob sie körperlich infiziert wurden oder nicht, wie ist es mit einer Wahnidee, deren infektiöse Macht schon seit Jahrtausenden wieder und wieder Gesellschaften heimsucht? Und was kommt nach der Pandemie? Irgendetwas kommt immer danach.
I
Mythos
Die Welt auf einer Vase
Dies ist die Welt und ihre Ordnung. Ein mächtiger Zylinder aus blassem, gelblich-grauen Alabaster, so groß wie ein zehnjähriges Kind, mit horizontalen Bändern von Figuren, die sich um das Gefäß winden.
3Reliefierte Steinvase, Mesopotamien, Uruk-Zeit, etwa 3200—2900 v. u. Z. Museum Bagdad, Iraq Museum
Ganz unten, direkt über dem Fuß, kräuseln sich die Wellen, die Wasser von Euphrat und Tigris, die aus der dürren Ebene fruchtbare Felder machen, die Wasser an der Küste, wo sich die süßen und salzigen Wasser einer Göttin und eines Gottes in einem Akt der kosmischen Zeugung vermischt hatten, um die bekannte Welt zu erschaffen, die funkelnden Kanäle, die sich in einem dichten Netz zwischen den Feldern und Gärten erstrecken. Alles ruht auf dem Wasser, das wie im Gilgamesch-Epos die Welt erschafft, ernährt und umgibt.
Das nächste Band zeigt Kornähren und Schilf, kultivierte und wilde Pflanzen dieser Küstenlandschaft, direkt darüber folgt ein Band mit Schafen und stolz gehörnten Widdern, die einander in scheinbar ewiger Prozession folgen.
Auf der nächsten Ebene schreitet eine lange Reihe von Männern, die Krüge mit Öl oder Bier und Schalen voller Früchte tragen, um ihre Ernte im Tempel darzubringen. Sie sind alle in derselben Geste gefroren, im Profil mit mandelförmigen Augen, markanten Nasen und kahlen Köpfen, die Arme mit ihrer Bürde angewinkelt vor sich gehalten, die Körper weich und stark gebaut, als wollten sie zeigen, dass ihr Herr reich ist und sie genug zu essen haben, die Beine im Schritt geöffnet, die Genitalien klar sichtbar.
Ein breites Band trennt diese unermüdlichen Träger von der obersten Darstellung, die für Betrachter fast auf Augenhöhe ist. Ein nackter Mann bietet der Göttin betend einen Korb mit Früchten dar. Die beiden Schilfbündel mit den ringförmig eingerollten Spitzen identifizieren sie als eine mächtige Göttin.
Dieses Feld zeigt ein ganz besonderes Ritual: Opfer und heilige Hochzeit. Der Herrscher ehelicht Inanna, die Schutzgöttin der Stadt und Herrin des Himmels, Göttin der fleischlichen Liebe und des Krieges, der Gerechtigkeit und der Macht. Wir wissen nicht genau, wie dieses Ritual vollzogen wurde. Vielleicht hat der König stellvertretend mit der Hohepriesterin die Ehe vollzogen, aber so wie die Priesterin bei diesem Koitus nicht mehr nur eine irdische Frau ist, so ist der König gleichzeitig der Leib und Stellvertreter von Dumuzi, dem göttlichen Gefährten von Inanna. Die Herrscher vollzogen so ein alljährliches Ritual, das die Fruchtbarkeit des Landes sicherstellen sollte.
Die Natur — unbelebt, pflanzlich und tierisch — belegt die niedrigsten Ränge der Pyramide, deren Spitze das Opfer im Tempel bildet, die mystische Hochzeit, wie spätere, christliche Autoren den Moment nennen würden, an dem sich das irdische Leben mit dem überirdischen verbindet, um die Ordnung der Welt zu garantieren.
Über den Rängen der natürlichen Welt finden sich die Sklaven und Menschen von niedrigem Status (auch wenn die hier Dargestellten symbolisch entkleidete Priester sein dürften). Erst auf dem höchsten Rang tragen die meisten Menschen (außer dem Priester) rituelle Kleidung. Der König wird als Bräutigam (leider ist dieses Fragment verloren gegangen) an einer breiten Schärpe zu seiner Braut geführt. Der Priester übergibt eine Brautgabe. Die Braut steht vor dem Eingang zu ihrem Tempel und Vorratshaus, einem Teil der Tempelkomplexe, so wie die Priester und Verwalter zur selben, schreibenden, mathematisch gebildeten Klasse gehörten. Die Lagerung des Getreides für schlechte Jahre, die Besteuerung der Felder und die Fixierung der Preise bildeten die Machtbasis der Tempelelite.
Im Tempel stehen zwei Götterstatuen, mehrere Opfergaben — und ein Paar Vasen, die der Uruk-Vase erstaunlich ähnlich sehen. Archäologen gehen davon aus, dass zu diesem Meisterwerk im Tempel der Inanna noch eine zweite, korrespondierende Vase gehörte und dass beide im Tempel der Inanna standen, sodass die beiden Gefäße auf dieser Darstellung Teil der Geschichte werden, die sie erzählen — eine ewige, selbstreferenzielle Bespiegelung.
Dieses Spiel mit Referenzen ist nicht zufällig, denn das Objekt selbst wird zum Spiel. Das Ritual der Hochzeit zwischen dem Herrscher/Dumuzi und der Göttin (vertreten durch eine Priesterin oder Tempelprostituierte) wurde alljährlich gefeiert. Die heilige Hochzeit erinnerte auch an das Schicksal des Gottes Dumuzi, der die Hälfte des Jahres in der Unterwelt verbringen musste und jedes Jahr wiedergeboren wurde, genau wie die Pflanzen. Es garantierte die Kontinuität dieses Zyklus und gleichzeitig erklärt es die simple, konische Form des Gefäßes, denn die Vase kann auch wie ein riesiges Rollsiegel gedacht werden, das, in die Unendlichkeit ausgerollt, einen immer wiederkehrenden Kreislauf aus Hochzeit und Ernte symbolisiert, gestützt von der ewigen Hierarchie der göttlichen Ordnung.
Die Uruk-Vase kann nicht nur betrachtet werden, sie birgt ihre Botschaft auch in ihrer Form und in der Weise, in der sie sich selbst zum Teil ihrer eigenen Geschichte macht. Sie stellt eine Welt dar, in der sich die Menschen die Erde untertan gemacht haben und selbst Untertanen der Götter sind, in der alles einer göttlichen Ordnung folgt. In dieser Ordnung aber gibt es ein ambivalentes Element: Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das auf zwei verschiedenen Ebenen der Vase auftaucht; halb tierisch und halb göttlich, bewohnt er ein Zwischenreich.
Diese Doppelnatur verursachte offensichtlich schon für die Mesopotamier eine schwer zu ertragende Spannung. Wie über alle großen Spannungen, Risse und Ängste, erzählten sich die Menschen auch hierüber Geschichten. Eine dieser Geschichten, von einem großen König, der zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch war und der auszog, um die Natur und den Tod selbst zu unterwerfen, wurde zu einer zentralen Erzählung von Uruk und am Beginn des 2. Jahrtausends v. u. Z. von einem Schreiber und Priester namens Sîn-leqe-unnīnī nach alten Überlieferungen auf zwölf Tontafeln aufgezeichnet, in einem Zeichensystem, das etwa 1800 Jahre früher entwickelt worden war, um die Vorratshaltung zu erleichtern: die Schrift.
Gilgamesch, der Held
»Der, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes, der die Wege kannte, der, dem alles bewußt — Gilgamesch, der die Tiefe sah, die Grundfeste des Landes, der die Wege kannte … Er sah das Geheime und deckte auf das Verhüllte, er brachte Kunde von der Zeit vor der Flut.«9 Mit diesen Versen beginnt die älteste schriftlich überlieferte Geschichte, die archäologischen Funden zufolge in wesentlichen Zügen bis ins 6. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurückreicht. Und diese Geschichte liefert das erste Zeugnis für die Idee der Unterwerfung der Natur. Deshalb muss sie hier einigermaßen ausführlich nacherzählt werden. Gilgamesch, der König des mesopotamischen Uruk, will sich durch Heldentaten einen Namen machen und scheitert schließlich beim Versuch, das ewige Leben zu erlangen. Trotz seiner Weisheit und seiner Kraft erleidet er Schiffbruch. Dieser Held ist weise und doch töricht, ein herausragender Herrscher und doch ein Tyrann, grausam und doch manchmal sanft, ein widersprüchlicher und ambivalenter Protagonist, wie alle großen Figuren der Weltliteratur.
Im Prolog des Epos tritt Gilgamesch als Städtebauer auf, der Uruk mit einer großen, imposant aus der Ebene aufragenden Mauer umgeben hat, einem Bauwerk, wie es die Welt noch nie gesehen hat — »sieh an dessen Mauer, die wie Kupfer glänzt! Besieh ihre Brustwehr, die niemand nachzubilden weiß!«10
Nicht alles aber ist so schön hier wie die glänzenden Mauern. Der König unterdrückt sein Volk. Er zwingt die jungen Männer, sich Tag und Nacht bereitzuhalten, um ihn zu amüsieren, und er beansprucht das Recht der ersten Nacht mit allen Jungfrauen der Stadt. Niemand kann ihm Einhalt gebieten, und so wenden sich seine verzweifelten Untertanen an die Götter, sie mögen seinen übergroßen Appetit zügeln und sie von der Bürde seiner Willkür befreien.
Die Götter erhören diese Klage und beschließen, den übermächtigen König abzulenken. Sie erschaffen Enkidu, einen Mann, der ihm an Kraft und Körperbau ebenbürtig ist, einen haarigen Gesellen, der in der Wildnis lebt, weitab von der umwallten Stadt, und zwischen den Gazellen grast. Als die Städter von diesem seltsamen Wesen hören, schicken sie die Hure Schamchat, um ihn zu überlisten. Sie trifft ihn an einer Wasserstelle, an der er mit anderen Tieren trinkt, und schreitet zur Tat: »Da löste Schamchat ihr Untergewand. Sechs Tage und sieben Nächte stand Enkidu aufrecht und paarte sich mit Schamchat.«
Als Enkidu endlich genug hat, muss er feststellen, dass die Tiere, unter denen er gelebt hat, jetzt vor ihm fliehen. Sein ehemals unschuldiger Körper ist »beschmutzt« von seinem neuen Wissen, von seinem Kontakt mit der Kultur, aber seine Nächte mit Schamchat haben den Verstand in ihm wachsen lassen und er bleibt bei ihr. Durch sie wird er ein Bewohner der Stadt und entfernt sich von der Wildnis. Auf einem Marktplatz in Uruk trifft er Gilgamesch, der sich gerade daranmacht, eine weitere junge Frau zu entjungfern. Enkidu verstellt ihm den Weg und die beiden ringen miteinander, bis die Wände wanken, ohne dass einer den anderen besiegen kann. So werden aus den Gegnern Freunde.
Gilgameschs Verlangen nach Bestätigung und Ruhm ist durch seine neue Freundschaft und seine neue Beliebtheit bei seinen Untertanen und den Göttern noch längst nicht gestillt. Er beschließt, gemeinsam mit Enkidu in den Zedernwald zu ziehen, um dort den Waldgeist Chuwawa, den Wächter der Zedern, zu erschlagen. Die Ratgeber des Königs und Enkidu versuchen, ihn davon abzubringen, denn Chuwawa steht unter dem Schutz des Gottes Enlil und ist ein schreckliches Ungeheuer. Aber Gilgamesch lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen und schließlich willigt Enkidu ein, ihn zu begleiten. Nach schweren Kämpfen gelingt es den beiden Helden, den schrecklichen Waldgeist zu töten. Gilgamesch fällt die riesigen Zedern, um aus ihnen Tore für den Tempel von Nippur anzufertigen. Auch den abgeschlagenen Kopf von Chuwawa nehmen sie mit sich.
Der Mut und die Kraft der beiden Freunde beeindrucken sogar die Götter. Die mächtige Göttin Ischtar hat beschlossen, den schönen König zu heiraten. Ischtar ist niemand anders als Inanna, die »Herrin des Himmels« und Göttin der Liebe und des Krieges. Man sagt von ihr, dass sie mit ihren Liebhabern grausam umgeht, wenn sie ihrer müde wird. Gilgamesch weiß das und gibt seiner himmlischen Verehrerin einen Korb. Wutentbrannt und tief gedemütigt veranlasst die Göttin, dass der Himmelsstier losgelassen wird, um Gilgamesch und Enkidu zu vernichten. Die beiden Helden aber sind auch dieser Bedrohung gewachsen und töten den Stier.
Gilgamesch veranstaltet ein ausschweifendes Freudenfest in Uruk, die Götter aber sind aufgebracht über seinen Frevel und seine Arroganz. Sie beschließen, dass einer der beiden Freunde sterben muss, und schicken Enkidu ein Fieber. Gilgamesch ist außer sich vor Schmerz und Trauer um seinen engen Gefährten, sein zweites Selbst. Er will dessen Tod nicht wahrhaben und bleibt bei seinem Leichnam, bis eine Made aus dessen Nase fällt. Erst dann überfällt ihn eine schreckliche Erkenntnis: »Auch ich werde sterben, und werde nicht auch ich dann so wie Enkidu sein? — Trübsal ist eingekehrt in meinen Leib. Ich begann, den Tod zu fürchten …«
Durch den Verlust des Freundes wird der große König sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst, und er beschließt, sich auf den Weg zu machen, um Utnapischtin zu finden, den alten Mann, dem die Götter die Unsterblichkeit geschenkt haben. Vielleicht kann der ihm helfen, unsterblich zu werden? Nach langer und gefährlicher Reise erreicht er eine Bierschenke am Ufer des Meeres am Rande der Welt, der erste Last Chance Saloon der Weltliteratur.
Er berichtet der Wirtin von seinen Heldentaten, aber sie ist nicht beeindruckt. Als er ihr von seiner Todesangst und seiner Trauer berichtet, gibt sie ihm einen Rat, der auch nach Jahrtausenden nichts von seiner Weisheit verloren hat: »Gilgamesch, wohin läufst du? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden! Als die Götter die Menschen schufen, Bestimmten sie für die Menschen den Tod, Das Leben behielten sie in ihrer Hand! Drum Gilgamesch, fülle deinen Leib, Freue dich bei Tag und Nacht, Feire jeden Tag ein Freudenfest! Tag und Nacht spring und vergnüge dich! Zieh reine Kleider an, Wasche dein Haupt und bade dich im Wasser, Schau froh auf das Kind, das dich an der Hand hält, Und dein Weib freue sich in deinen Armen!«11
Der wandernde Held aber ist fest entschlossen, das Wasser zu überqueren, um Utnapischtin zu finden, und schlägt den weisen Rat in den Wind. Er findet den Fährmann, fällt siebzig Bäume, um sie als Stocherstangen für die Überfahrt mit dem Kahn zu nutzen, und macht schließlich den Alten ausfindig.
Auch der unsterbliche Utnapischtin versucht, Gilgamesch den Wunsch nach Unsterblichkeit auszutreiben. Wie eine Eintagsfliege ist der Mensch für kurze Zeit von den Reichtümern der Welt umgeben, nur um plötzlich zu verschwinden: »Die Menschheit, deren Spross stets abgemäht ist, einem Schilfrohr aus dem Sumpfe gleich, den schönen jungen Mann, das schöne Mädchen, geschwinde raubt in ihrer vollen Blüte sie der Tod!«
Der Alte erzählt ihm seine eigene Geschichte. Vor langer Zeit beschlossen die Götter, die Stadt Schuruppak und alle ihre Bewohner, die ihnen lästig geworden waren, durch eine Flut auszulöschen. Nur der Gott Ea wollte nicht mitmachen. Er beauftragte Utnapischtin, ein Schiff zu bauen und alle Tiere auf das Schiff zu laden, damit sie die Flut überlebten. Der Alte baute das Schiff und belud es mit seiner Familie, allen Tieren, die er finden konnte, den Vertretern aller Künste, seinem gesamten Besitz und »jeglichem Samen von dem, was atmet«. Dann beginnen die Götter ihr imposantes Zerstörungswerk: »Einen ersten Tag walzte der Sturm das Land nieder. Rasend brauste er einher. Dann aber brachte der Ostwind die Sintflut. Wie ein Schlachtengemetzel ging die Wucht der Flut über die Menschen hinweg.« Sogar die Götter packte die Angst, als sie ihr Werk sahen. Sie schrien auf, stimmten laute Klagen an und bereuten ihre Grausamkeit, weil sie erst jetzt begriffen, dass ihnen von jetzt ab auch niemand mehr opfern würde.
Sechs Tage und sieben Nächte lang tobte die Flut, dann zog sich das Wasser zurück und das Schiff kam auf einer Bergspitze zu ruhen, von wo aus Utnapischtin eine Taube, eine Schwalbe und einen Raben ausschickte, um nach Land zu suchen. Endlich brachte er »oben auf dem Stufenturm aus Fels« ein Opfer dar und die Götter »rochen den süßen Duft, die Götter kamen alsbald wie die Fliegen«, um ihren Hunger zu stillen.
Nach dieser Erzählung beschließen Utnapischtin und seine Frau, ihren unnachgiebigen Besucher auf die Probe zu stellen. Wenn Gilgamesch sieben Tage und Nächte wach bleiben kann, wird der Alte den Rat der Götter zusammenrufen, um über seine Unsterblichkeit zu entscheiden. Der Held willigt ein, ist aber so erschöpft, dass er sofort einschläft. Obwohl er die Probe nicht bestanden hat, erbarmt sich Utnapischtins Frau seiner und erzählt ihm von einer Pflanze, die ewige Jugend verleiht. Gilgamesch findet die Pflanze auf einem abenteuerlichen Tauchgang an den Boden des Meeres.
Während der Held auf seinem Weg zurück zu den Menschen in einem kühlen Teich badet, frisst eine Schlange die Pflanze und häutet sich, denn jetzt hat sie ein neues Leben gewonnen. Gilgamesch hat alles gewagt und alles verloren und muss mit leeren Händen nach Uruk zurückkehren. Seine letzten Worte wiederholen den Anfang des Epos. Sie preisen die Schönheit der Stadt und ihrer Mauer, ein Wunderwerk sondergleichen.
Es ist erstaunlich, dass schon der erste Held der Literaturgeschichte ein unvollkommener und suchender Mensch ist, der — obwohl zu zwei Dritteln göttlich — einen Fehler nach dem anderen macht und dafür leiden muss, weil er zu arrogant ist, taub für guten Rat, zu stolz und zu unwissend, weil er seinen Ort in der Welt nicht kennt.
Obwohl er der älteste Held der Literatur ist, kommt er uns gar nicht fremd vor, ein Mensch mit Ambitionen und Fehlern, die uns sehr vertraut erscheinen. Und hier begegnen wir ihm zum ersten Mal, dem Wahn der Unterwerfung. Gilgamesch, der alle im Kampf besiegen muss, der den Wächter des Waldes erschlägt und die Zedern der Götter zu Bauholz macht, der Herrscher über eine Stadt und ihre Gärten, der den Tod selbst überwinden will, dieser fehlerbehaftete Held ist der erste Träger dieses Wahns, gegen den der Mythos eine Warnung ausspricht: Du kannst nicht die Natur beherrschen, entheiligen, unterwerfen, außer Kraft setzen. Wie weit du auch wanderst, was für heroische Taten du auch auf deinem Weg vollbringst, es ist verlorene Mühe gegen den Willen der Götter und die Gesetze des Schicksals. Am Ende bleibt nur die Einsicht.
Schon die ersten Zeilen erwähnen seinen größten Verdienst, der mit seinem größten Fehler zusammenhängt. Gilgamesch »brachte Kunde von der Zeit vor der Flut« von seinem Zusammentreffen mit Utnapischtin mit, Wissen über das harmonische Zusammenleben mit den Göttern, das ihn der unsterbliche Alte lehrte, ein Wissen also, das er selbst davor nicht besessen hatte.
Das Epos erklärt auch die Ignoranz seines Helden, denn das alte Wissen wurde durch einen göttlichen Fehler vernichtet. Als die Götter beschlossen, die Menschheit durch eine Flut auszurotten, gab der Gott Ea dem alten Utnapischtin den Auftrag, ein Schiff für sich und die Seinen und für ausreichend viele Tiere aller Arten zu bauen. Utnapischtin war weise, wusste um das Verhältnis zwischen Menschen und Göttern, wurde aber, unerreichbar für die Menschen, an einen Ort jenseits der Wasser des Todes verbannt. Von diesem Wissen, das Gilgamesch wieder zurückbrachte, sprechen die ersten Zeilen des Epos.
Das Gilgamesch-Epos ist eine Geschichte eines Unwissenden, der alle möglichen Fehler macht, weil niemand sich erinnert, wie man den Göttern dienen und im Einklang mit der von ihnen geschaffenen Erde leben kann. Auch Enkidu, das Kind des Waldes, wird durch die Berührung mit der Kultur, mit Prostituierten und dann mit Brot und Bier, zu einem Kulturwesen, vor dem die Tiere weglaufen.
Der Blick von der Zinne
Die Stadt mit ihren hohen Mauern war Gilgameschs eigentliches Vermächtnis, sein Anteil an der Ewigkeit. Was dachte ein Zeitgenosse Gilgameschs, wenn er auf den Zinnen der hohen Mauern von Uruk stand und die Umgebung bis zum Horizont betrachtete? Was dachte er über das satte Grün der Gärten unter ihm und über die Felder mit ihren funkelnden Kanälen in der Ferne? Über die staubverwehte Landschaft jenseits der Zivilisation, die Steppe und den Sumpf und die Berge? Was dachte er über den Fluss, der sie alle ernährte, und was dachte er über Steppengräser und über Wolken, über die Fliegen, die ihn am Ohr kitzelten, und die Sonnenhitze zu Mittag?
Jenseits der Zinnen schweifte das Auge über Plantagen von Dattelpalmen gefolgt von Feldern mit Gerste, Flachs und Sesam, und von Gärten mit Kichererbsen, Linsen, Bohnen, Zwiebeln und Obstbäumen wie Tamarinden und Granatapfel, eine blühende Landschaft. Dahinter, so weit das Auge reichte, kam Weideland in einer Ebene mit kleinen Bauernhöfen und Dörfern, ein grüner Schimmer über der graubraunen Ewigkeit, die sich bis zum Horizont erstreckte, bis zur Steppe, wo früher Eden lag.
Hier entstand eine Denkfigur, die bis in die Gegenwart wirkt. Die Steppe als Ort der Wildheit und der Unbestimmtheit, ein feindlicher Ort, der darauf wartete, kolonisiert und zivilisiert zu werden, der aber auch als Wildnis der Kultur feindlich entgegenstehen konnte, zeigt sich im schönen Sprachbild des biblischen Gartens Eden, in der Bibel der Gan-ba-Eden, in der awestischen Sprache des Nordirans, seinem linguistischen und vielleicht auch kulturellen Ursprung, ein pairi daēza, ein eingezäunter Garten in der Steppe, ein geschützter und schattiger Obstgarten inmitten der feindlichen Natur.
Die Philosophie der Gärten füllt Bibliotheken zwischen Japan und England und stellt von Anfang an die Frage, ob es neben der Unterwerfung nicht auch ein kollaboratives Formen und Weiterdenken von Möglichkeiten natürlicher Gestaltung geben könne. Im Garten war immer schon die Spannung zwischen Wildnis und Zähmung präsent. Im europäischen Mittelalter wurde daraus der Hortus conclusus, der umhegte Ort, an dem die Jungfrau und das Einhorn in mystischer Eintracht leben, ein organisierter Raum, der allegorisch alle Ordnungen der Schöpfung abbilden soll und dessen Pflanzen ihre eigene symbolische Sprache sprechen. Der Gegensatz von Natur und Kultur fand seinen Ausdruck in dieser Praxis, gelegentlich auch die meditative und vegetative Überwindung oder die Negation dieser Gegensätze.
Das Bild des Gartens Eden begleitet nicht nur die Kultur des Westens, war hier aber stark ausgeprägt und von Anfang an von gewissen Motiven charakterisiert, die sich über Jahrtausende erhalten haben. Uruk, die erste Kultur, die von sich glauben konnte, die Natur vielleicht nicht unterworfen, aber doch durch den eigenen Fleiß und die Gunst der Götter gezähmt und geordnet zu haben, wurde von den akkadischen Königen verdrängt. Sie verwendeten die sumerische Sprache Uruks weiterhin bei Ritualen, brachten sonst aber neben der eigenen Sprache auch eine stärker hierarchisierte Kultur mit.
Die soziale Struktur des sumerischen Uruk ist schwer zu erkennen, weil es zwar Tempel, aber keine eindeutig identifizierbaren Palastbezirke gibt. Das änderte sich unter den Akkadern, die von ca. 2300 v. u. Z. im südlichen Mesopotamien den ersten Flächenstaat der Geschichte aufbauten. Nicht nur ihre Architektur zeigt eine stärkere soziale Abgrenzung zwischen Herrschern und Beherrschten, auch ihr Denken war eher vertikal strukturiert.
Ein Höhepunkt der königlichen Selbstdarstellung waren die zeremoniellen Löwenjagden, bei denen sich der Monarch als Unterwerfer der Natur und Beschützer der Kultur inszenieren konnte. Eine weitere Neuerung der akkadischen Palaststadt ist der von mehreren Herrschern unterhaltene königliche Zoo, der einem staunenden Publikum exotische Tiere wie Elefanten, Löwen und Affen präsentierte: nicht nur domestizierte Tiere, auch ihre Cousins aus der Wildnis waren unter menschlicher Herrschaft.
Zwischen den Anfängen der sumerischen Zivilisation etwa 5000 v. u. Z. bis zur Akkadischen Periode um 2300 v. u. Z. war bereits mehr Zeit vergangen, als unsere Gegenwart vom antiken Griechenland trennt, aber es gab starke kulturelle Kontinuitäten, die sich über Sprachen und geografische Verlagerungen hinweg durchsetzten. Eine dieser stabilen Ideen war der Blick von der Zinne, über die kultivierte Landschaft inmitten der Wildnis, die Gärten in der Wüste. Wer hier stand, konnte wirklich wie Gilgamesch von sich glauben, die Natur unterwerfen zu können.
Klima und Geografie begünstigten diese Perspektive. Die mesopotamischen Stadtkulturen bilden den Anfang eines historischen Phänomens, das der Historiker Karl Wittfogel als »hydraulische Gesellschaften« bezeichnete: Gemeinwesen, die durch die geplante und organisierte Bewässerung ihrer Felder intensive Landwirtschaft betreiben konnten und sich gemeinsam mit urbanen Zentren und rigiden Hierarchien und militärischen Elitekulturen entwickelten.
Wittfogels vielleicht allzu schematische Theorie der hydraulischen Gesellschaften ist inzwischen vielfach kritisiert und in Teilen widerlegt worden, aber seine Beobachtung von gewissen morphologischen Ähnlichkeiten dieser Stadtkulturen war trotzdem wertvoll, zumal solche Kulturen unabhängig voneinander, zu unterschiedlichen historischen Momenten und auf verschiedenen Kontinenten immer wieder entstanden sind, von China und dem Industal bis nach Mesopotamien und Mittelamerika. In Angkor-Wat und in den Niederlanden erwiesen sich Kanalisierung, Bewässerung und Trockenlegung ganzer Landschaften als immens wirkungsvolle Werkzeuge im Kampf um die Beherrschung der als passiv oder feindlich erlebten Natur und für die Schaffung einer intensiven, wie Latour sagen würde, »hyperanimierten« Kultur.
Die Bewässerung der Felder ermöglichte größere und häufigere Ernten (oder, im Falle von Mesopotamien, dass überhaupt geerntet werden konnte). Viele Menschen konnten an einem Ort leben, sodass die Produktion von Nahrung einen Überschuss erwirtschaftete und einer gewissen Klasse der Gesellschaft anvertraut wurde. So entstanden differenzierte Gesellschaften, in denen Händler, Handwerker, Beamte, Priester und Krieger ihren je eigenen Aufgaben nachgehen konnten.
Die Besteuerung der Bauern machte die Herrscher der einzelnen Städte mächtig und erlaubte ihnen, Armeen auszurüsten und ihre Felder nicht nur zu schützen, sondern auch zu Eroberungsfeldzügen aufzubrechen, denn wie schon Gilgamesch waren auch die akkadischen Herrscher nur ruhmreich, wenn sie Reichtümer und Beute in die Stadt brachten. Gleichzeitig verlangte eine effiziente Besteuerung eine funktionierende Buchhaltung und Verwaltung.
Diese Stadtkulturen brachten ein ganz neues Modell von Macht und sozialem Zusammenhalt hervor. Der große Schritt zur Landwirtschaft war schon um 12.000 v. u. Z. vollzogen worden, wenn auch häufig als Teil einer nomadischen oder halbnomadischen Lebensweise. Lange diskutierten Prähistoriker über die sozialen Folgen der landwirtschaftlichen Revolution und behaupteten, dass sie einen abrupten Wechsel von einem Leben in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern zu einer Existenz als höriger Landarbeiter bedeutet hat. Jüngere Ausgrabungen aber zeigen, dass es häufig und über Jahrtausende hinweg eine Koexistenz von Feldern und kleinen, flexiblen Siedlungen gegeben hat (auch die Akkader und die Sumerer scheinen lange neben- und miteinander gelebt zu haben), ohne Befestigungen und offensichtliche soziale Hierarchien, ohne ein starkes Innen und Außen, ohne einen markanten Gegensatz also zwischen Natur und Kultur, denn die Gemeinschaften lebten zumindest einen Teil des Jahres auf eine Weise, die sich seit dem Paläolithikum nur wenig geändert hatte und durch dieselben Geschichten und Legenden beschrieben werden konnte. Gemauerte Strukturen wie Çatalhöyük in der heutigen Türkei und Knossos auf Kreta scheinen dabei als Versammlungsorte für die verschiedenen Gemeinschaften und ihre Rituale fungiert zu haben, obwohl neuere Forschungen nahelegen, dass Çatalhöyük auch phasenweise intensiv bewohnt wurde.
Im Mesopotamien des 4. Jahrtausends v. u. Z. hatte sich das Bild einer dicht besiedelten Stadt radikal geändert. Wer Uruk zum ersten Mal besuchte, das geschäftige Treiben in den Straßen sah, die großen Rituale im Tempel, den Reichtum, die Gerüche und Klänge einer Stadt in einer Welt ohne Städte, und um sie herum die Gärten und Felder und Dörfer, konnte leicht zu der Überzeugung gelangen, dass die Sumerer es vermochten, die natürliche Welt selbst zu unterwerfen.
Die bewässerten Felder des Zweistromlandes sind beredte Zeugnisse einer Verwaltung und einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in der es Baumeister, Bürokraten und Arbeiter gab, eines Systems, das aus einfachen Anfängen zu ungeheurer Komplexität anwuchs und das die Landschaft in dem Maße veränderte, in der sich auch die Gesellschaft neu erfinden konnte, denn sie führen zu einer noch größeren Konzentration der Bevölkerung, zu mehr Handel, mehr Kriegen, mehr Sklaven und einer noch stärker arbeitsteiligen Gesellschaft mit einer herrschenden Elite aus Priestern und Aristokraten.
So entstanden inselhaft Stadtkulturen, die ihre Macht auf Wassermanagement aufbauten und die sich über kulturelle Differenzen hinweg in einigen Aspekten erstaunlich ähnlich waren. Eine Landschaft von bewässerten Feldern und Gärten mit kleinen Bauernhöfen und Dörfern, Transportkanälen und relativ guten Straßen umgibt eine Stadt, die meist konzentrisch angelegt ist und ihre soziale Geografie in der Topografie der Wohnstätten und öffentlichen Plätze spiegelt, mit Adelspalästen und Tempelbezirken, Plätzen für Märkte, öffentliche Rituale, aber auch für Hinrichtungen, häufig Quartieren für Ausländer, aber auch Straßengeschäften, Bordellen, Kasernen und einer Stadtmauer.
Diese Organisation beschreibt das Tenochtitlan des 15. Jahrhunderts ebenso wie drei Jahrhunderte zuvor Angkor-Wat in Kambodscha, das mittelamerikanische Tikal wie auch die Stadtkulturen in Mesopotamien.
Landschaft und Erinnerung
Bei aller Vorsicht gegenüber verlockenden Spekulationen ist der klimatische und geografische Einfluss auf landwirtschaftliche Praktiken und Produkte, auf Nutztiere und Rohmaterialien und damit auch auf gesellschaftliche Strukturen und ihre Geschichten kaum zu bestreiten. Ein Beispiel: Mittelamerikanische Kulturen durchliefen eine vergleichsweise schwache wirtschaftliche und machtpolitische Entwicklung — auch weil ihnen vor der Ankunft der Europäer keine Lasttiere und Reittiere zur Verfügung standen: Lamas und Alpakas eignen sich nicht für solche Arbeiten. Transporte über lange Distanzen mussten von Menschen bewerkstelligt werden, nur auf wenigen Routen konnten sie auf Kanälen abgewickelt werden. Ein Träger aber konnte Nahrung höchstens dreißig Kilometer weit befördern, dann benötigte er selbst mehr zu essen, als er tragen konnte.
Wie viel Einfluss eine Gesellschaft auf ihre natürliche Umgebung hatte, hing aber auch von klimatischen Gegebenheiten ab. Die Khmer in Angkor-Wat im 12. Jahrhundert oder die Azteken in Tenochtitlan im 15. Jahrhundert lebten in tropischen Gebieten, in denen die organische Welt ständig in alles von Menschen Gemachte eindringt und es unbeirrbar zurückzugewinnen sucht. Von Schimmelpilz über Ameisen und unendlich erfindungsreiche Pflanzenschösslinge ist die Natur unentwegt aktiv, in der Regenzeit werden die Straßen unpassierbar und das Leben zieht sich so weit wie möglich in die Häuser zurück. In einem solchen Klima kommt man eher nicht auf die Idee, die Natur unters Knie zwingen zu können.
Die Zivilisationen in Ägypten und im Industal lebten unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen, waren aber beide davon abhängig, dass der Fluss als ihre Lebensader einmal im Jahr über seine Ufer trat und die Felder nicht nur bewässerte, sondern auch mit Nährstoffen versorgte. Wie in Kambodscha und im subtropischen Mittelamerika wirkte die Natur hier als dominanter Akteur und Rhythmusgeber, wenn auch in einer nährenden Rolle. Ein Ägypter wäre wohl kaum auf die Idee gekommen, die Natur zu beherrschen, denn seine Existenz hing vom Rhythmus des Flusses ab, dessen Gottheiten er deshalb Opfer darbrachte. Einen Stausee konnte man öffnen, wenn der Regen einmal ausblieb, aber die alljährliche Überflutung des Nil oder des Indus konnte kein Mensch kontrollieren.
Wir wissen nicht, wie egalitär und gemeinschaftlich organisiert Harappa im Industal wirklich war, aber die ägyptische Kultur ist doch hinreichend bekannt, um einen Vergleich mit Mesopotamien zu wagen. In ihrer Aggressivität, ihrer systematischen Sklaverei und Unterwerfung anderer Völker, ihrer Vorliebe für monumentale Architektur, ihrer hierarchischen Organisation und ihrem Hunger nach Macht und Ruhm standen die Pharaonen den Herrschern des Zweistromlandes um nichts nach, was sie auch im 2. Jahrtausend v. u. Z. zu geopolitischen Rivalen machte.
Trotzdem gibt es keinen ägyptischen Gilgamesch, keinen ägyptischen Gott-Menschen, der alles unterwerfen will. Ein Pharao konnte von sich behaupten, von den Göttern abzustammen, und sich als Gott verehren lassen, er konnte Tempel bauen und ruhmreiche Kriege führen, aber die Mythen gehörten allein den Göttern und beschrieben den Kreislauf von Leben und Tod, die Herrscher der verschiedenen Bereiche. Osiris, der leidende Gott, der jedes Jahr aufs Neue sterben und wiedererstehen musste, gab so auch den Takt für den landwirtschaftlichen Jahreszyklus von Empfängnis, Geburt, Reife und Tod, den scheinbar ewigen Atem der alljährlichen Überschwemmungen und der Fruchtbarkeit, die sie brachten.