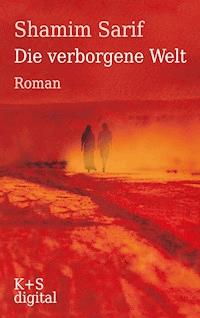
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Krug & Schadenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pretoria, Südafrika, in den fünfziger Jahren. Die junge Inderin Amina eröffnet mit einem Farbigen ein Café. Das ist unerhört. Und zur Zeit der Apartheid offiziell verboten. Die Eltern lassen ihre eigensinnige Tochter gewähren, doch die Großmutter setzt alles daran, ihre Enkelin zu verheiraten. Aber Amina hat ihren eigenen Kopf ... Miriam hingegen ist eine fügsame indische Ehefrau. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern auf einer abgelegenen alten Farm. Die Stille ist endlos, die Einsamkeit unerträglich, die Zukunft scheint trostlos. Bis Miriam eines Tages Amina begegnet - dem ersten Menschen, der ihr nach vielen Tagen ein Lächeln schenkt. Und sie behutsam zu umwerben beginnt ... "Grüne Tomaten" - angerichtet auf indische Art …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRAUEN IM SINN
Verlag Krug & Schadenberg
Literatur deutschsprachiger und internationaler
Autorinnen (zeitgenössische Romane, Kriminalromane,
historische Romane, Erzählungen)
Sachbücher und Ratgeber zu allen Themen
rund um das lesbische Leben
Bitte besuchen Sie uns: www.krugschadenberg.de.
Shamim Sarif
Die verborgene Welt
Roman
Aus dem Englischenvon Andrea Krug
Für Hanan, die meinem Leben Leidenschaft verliehen hat, meinen Gedanken Klarheit und meinen Worten eine Stimme.
In unermesslicher Dankbarkeit und unendlicher Liebe.
KAPITEL 1
Pretoria, April 1952
Sie lag bäuchlings auf dem Dach, im Blickfeld nur die billigen Ziegel, und wusste dennoch, dass es sich um einen Streifenwagen handelte. Es lag etwas Unbekümmertes im Schlittern der Reifen über die sandige Straße und in der Art, wie die Handbremse angezogen wurde, noch während die Räder sich drehten, was ein leises Kreischen in der drückenden Luft verharren ließ. Sie hielt mit dem Hämmern inne und lugte über den Dachvorsprung. Sie waren so dicht an der Eingangstür des Cafés zum Stehen gekommen, dass sie einen der Blumentöpfe, die Jacob erst am Vortag bepflanzt hatte, beschädigt hatten.
»Mistkerle!«, murmelte sie leise.
Sie ließ das Schild halb angenagelt hängen und kletterte die Leiter hinunter. Ihre Bewegungen waren bedächtig und ließen ihr Zeit zum Überlegen. Ein Jahr zuvor noch wäre sie binnen Sekunden im Café gewesen – sie wäre voller Eifer herbeigelaufen, um sich jedem neuen Hindernis, das ihr in den Weg geräumt wurde, zu stellen und es zu beseitigen. Doch die vielen Monate des Kampfes gegen Regeln und Vorschriften, die für sie keinerlei Sinn ergaben, hatten ihr die Lust auf Auseinandersetzungen genommen und so handelte sie nun gemächlicher, zügelte ihre Impulsivität, und als sie zu dem Streifenwagen hinübersah, erschienen winzige Falten der Konzentration auf ihrer Stirn.
Einer der beiden, der Fahrer, saß noch im Wagen. Sie kannte viele der einheimischen Polizisten, doch dieser war ihr fremd, und einen Augenblick lang war sie von seinem Äußeren eingenommen – ein ebenmäßiges, attraktives Gesicht, umrahmt von weichem blondem Haar –, bis sie seinen kühlen blauen Blick sah, der von purer Arroganz kündete. Er musterte sie von oben bis unten, und sie hielt seinem Blick stand.
»Noch nie eine Frau in Hosen gesehen?«, fragte sie – zu leise, als dass er es hätte hören können, doch zu ihrem Bedauern kurbelte er das Fenster herunter.
»Was?«
Sie hatte keine andere Wahl, als es zu wiederholen. Sie sprach klar und deutlich, und sein Mund verzog sich ein wenig.
»Jedenfalls keine Inderin, das steht fest«, erwiderte er.
Sie wandte sich um und betrat das Haus, blieb jedoch gleich an der Tür stehen. Das Café war mehr als halb voll, dennoch konnte sie die boerewors in der Küche brutzeln hören. Niemand sprach und niemand blickte zu ihr hinüber – alle Augen waren verstohlen auf den Polizisten gerichtet, der da am Tresen stand. Sie wusste, dass Jacob sie im Blick hatte, aber er ließ sich nichts anmerken. Er polierte weiter das Glas in seiner Hand und nickte ab und an. Officer Stewart stützte sich mit dem einen Arm friedlich auf die polierte Theke und zupfte mit der anderen Hand gedankenvoll an seinem gestutzten Bart.
»Hör mal, Jacob. Ich will euch beiden ja nichts Böses, aber diese Gesetze machen uns Polizisten das Leben verdammt schwer.«
»Uns machen sie auch nicht gerade Vergnügen«, sagte Amina hinter ihm. Sie sah, wie Jacob leicht den angegrauten Kopf schüttelte.
Stewart drehte sich um und tippte sich an die Mütze. »Amina. Lange nicht gesehen.«
»Ja.«
»Hast wohl zugesehen, dass du dir keinen Ärger aufhalst, wie?«
Sie quittierte seinen Versuch zu plaudern mit einem gezwungenen Lächeln. Dann trat sie hinter die Theke, öffnete den unförmigen Eisschrank, nahm eine Flasche Cola heraus und hielt sie ihm ihn. Um Jacobs willen gab sie sich alle Mühe.
»Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten, Officer Stewart?«
Der Polizist schüttelte den Kopf und sah zu, wie sie die halbe Flasche in einem Zug leerte. Dann hielt sie inne, holte schleunigst Luft und lächelte.
»Was ist mit Ihrem Kollegen? Will er nicht reinkommen?«, fragte sie.
»Nein, danke. Mir ist es lieber, wenn er draußen im Wagen bleibt. Er ist ein bisschen übereifrig. Ein wenig hitzköpfig. Er hat ein Problem mit euren Gepflogenheiten.«
Er wies auf den hinteren Teil des Cafés, und als hätte sie keine Ahnung, was er meinte, drehte sie sich um und blickte zu der Sitzecke hinüber, wo ihre afrikanischen Arbeiter tagsüber abwechselnd saßen und aßen. Doris und Jim waren im Augenblick da, und sie sah, wie Doris trotzig das Kinn hob, auch wenn ihre Finger, die um die Kaffeetasse lagen, leicht zitterten. Amina lächelte sie ermutigend an und wandte sich wieder dem Polizisten zu.
»Welche Gepflogenheiten genau sollen das sein, Officer?«
»Nun hör mir mal zu, Amina. Du weißt, wovon ich spreche, und dich mit mir anzulegen, macht die Sache nicht besser, klar? Du und ich – wir wissen beide, dass es ein Vergehen ist, wenn Schwarze da essen, wo Weiße essen.«
Sie stellte die Cola auf die Theke und sah sich um.
»Hier gibt’s keine Weißen. Sie natürlich ausgenommen.«
»Wie Nicht-Weiße dann eben. Dies ist ein Lokal für Asiaten. Und Farbige«, fügte er mit einem Nicken in Richtung Jacob hinzu. »Das heißt: keine Schwarzen.«
»Sie arbeiten für mich.«
»Dagegen ist nichts einzuwenden«, erwiderte der Polizist und schlug bekräftigend auf die Theke. »Aber sie dürfen nicht mit dir zusammen essen. Das ist verboten.«
»Wo sollen sie denn sonst essen?«, fragte Amina.
»Das ist mir doch egal! Sie können draußen essen. Oder in der Küche, verdammt noch mal. Oder wenn sie nach Hause kommen.«
»Kommen Sie zwölf Stunden am Stück ohne Essen aus, Officer?«
Jacob fuhr sich nervös über den geschorenen Schädel und sah zu, wie Amina zu ihrem Grammophon hinüberging. Er wünschte verzweifelt, er könnte eingreifen und für Frieden sorgen, irgendeinen Kompromiss vorschlagen. Doch das würde die Grenzen, die ihm als angeblicher Geschäftsführer des Cafés gesetzt waren, überschreiten – Officer Stewart wusste nicht, dass Jacob in Wahrheit Aminas Geschäftspartner war. Es war Farbigen und Indern verboten, gemeinsam ein Unternehmen zu betreiben, doch ein hilfsbereiter Anwalt hatte ihnen geholfen, insgeheim eine Generalvollmacht für Jacob aufzusetzen, und inzwischen war ihre Partnerschaft von den entscheidenden Menschen weithin anerkannt, und ihr Geheimnis wurde gut gehütet.
Amina kniete sich nieder, den Rücken dem Polizisten zugewandt, und ging ihren kleinen Stapel Schallplatten durch. Stewart setzte entschlossen seine spitz zulaufende Mütze auf und schlenderte zu der hintersten Nische hinüber, wo er stehen blieb und auf die Sitzenden herabsah.
»Papiere!«, sagte er und streckte die Hand aus. Doris und Jim sahen instinktiv zu Amina hinüber.
»Sie wissen doch, dass die beiden Papiere haben«, sagte sie.
»Ich will sie sehen. Und zwar sofort.«
Jim zog seine Papiere hinten aus der Hosentasche. Der Einband war knittrig und abgetragen, und selbst wenn es aufgeschlagen wurde, wies das Dokument eine bleibende Krümmung auf, weil so oft auf ihm gesessen wurde. Stewart drehte es in der Hand und blickte auf den Koch hinunter.
»Das ist bloß eine Reisegenehmigung.«
»Ja, Sir!«
»Wo ist dein Pass?«
»Ich habe keinen Pass, Sir. Ich bin ein Farbiger.«
Stewart begutachtete das Dokument, um sich dieser Tatsache zu vergewissern.
»Du bist ein Farbiger?«
»Ja, Sir!«
»Für mich siehst du aus wie ein Kaffer«, bemerkte Stewart.
»Sie sagen, ich bin ein Farbiger. Die Kommission. Sie haben mich klassifiziert.«
Jacob war neben dem Polizisten erschienen, ohne dass jemand wahrgenommen hätte, dass er sich bewegt, geschweige denn beeilt hatte.
»Sein Großvater war weiß, Officer. Holländer – wie mein Vater.«
»Okay.« Stewart warf das Dokument auf den Tisch, wandte sich um und ließ den Blick über das Café schweifen.
»Du verstehst, was ich euch sagen will, oder, Jacob? Ich will euch nichts am Zeug flicken. Ich tue bloß meine Arbeit.«
Der Knall eines Schusses elektrisierte den Raum – die schiere Lautstärke ließ alle Anwesenden für einen Sekundenbruchteil erstarren, bevor sie sich allesamt duckten.
Amina kniete noch immer vor dem Grammophon und sah, wie Officer Stewart hinter der Theke kauerte und Jacob neben ihm hockte. Die Fenster klirrten noch leicht, als wäre gerade ein Zug durch das Café gerauscht. Stewart zog vorsichtig seine Pistole und brachte sie auf dem Tresen in Anschlag, während er sich langsam erhob. Amina stand gleichzeitig auf. Sein Partner stand in der Tür und ließ die Pistole um seinen Mittelfinger kreisen.
»Was zum Teufel machst du da?«, fragte Stewart.
Der blonde Mann grinste. »Meine Arbeit«, sagte er. »Warum redest du überhaupt mit diesen Leuten hier?«
Er hielt die Pistole fest und feuerte einen weiteren Schuss in die Decke. Putz rieselte herab, und ein hohes Echo sang im Raum.
»Das hier verstehen sie«, meinte er. Er grinste wieder und sah Amina an.
»Wenn du weiterhin Kaffern bedienst, murksen wir sie alle ab. Dann wirst du neue Leute finden müssen.« Er lachte.
»Wenn Sie so weitermachen«, erwiderte Amina, »dann brauchen wir keine neuen Leute. Sie sind nicht gerade gut fürs Geschäft.«
Seine Miene verdunkelte sich, doch noch bevor er den ersten Fluch über die Lippen brachte, schob Stewart ihn zur Tür hinaus und in Richtung Wagen.
Amina sah sich nach Doris um, aber die Sitzecke war leer – ihre gesamte Belegschaft hatte sich in die Küche verzogen oder auf den festgetretenen Flecken Erde draußen vor der Hintertür. Die Gäste, die auf ihr Essen zum Mitnehmen gewartet hatten, waren bereits fort. Andere legten Geld auf den Tisch. Selbst das Gebrutzel aus der Küche war verklungen. Als sie wieder zur Tür blickte, um sich zu vergewissern, dass die Polizisten wirklich fort waren, sah sie, dass das Glas des gerahmten Bildes ihrer verstorbenen Großmutter, das darüber hing, zerbrochen war – der vertraute, herausfordernde Blick ihrer Großmutter wurde von einem Sprung verzerrt. Das schmerzte sie am meisten.
»Lass dich nie von jemandem zur Sklavin machen. Ich war eine Sklavin, mein Leben lang, und das hat mich ruiniert.« Das waren Begums letzte Worte an Amina Harjan gewesen. Sie hatte sie an einem sonnigen Samstagmorgen in Bombay geäußert, röchelnd, aber mit dringlicher Überzeugung, als ihre Enkelin bei ihr am Krankenbett saß und den Duft von zerstoßenen Kardamomschoten einatmete, der von dem Süßwarenhersteller im Stock unter ihnen heraufstieg. Bei Einbruch der Nacht war ihre Großmutter tot gewesen. Ihr Hinscheiden ließ ihre Enkelin in einem seltsamen Schockzustand dahintreiben, der ihren fohlenhaften Gliedern jegliche Energie raubte, und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Amina die Wochen verstreichen gespürt, ohne den Versuch zu machen, sie zu ergreifen und zu nutzen. Als ihr Vater dann wieder einmal seinen langgehegten Wunsch zum Ausdruck brachte, fern von Indien ein neues Leben zu beginnen, merkte sie kaum, dass die Vorbereitungen bereits im Gange waren. Mr.Harjan hatte sich an eine stillschweigende Übereinkunft mit seiner Schwiegermutter gehalten, nicht nach Südafrika auszuwandern, denn sie war vierzig Jahre zuvor aus jenem Land vertrieben worden, doch dieses Versprechen verlor seine Bedeutung, nachdem sie gestorben war.
Bei der Bestattung waren nicht genug Männer zugegen, um den kleinen, aber unhandlichen Leichnam von Aminas Großmutter sorgsam zu halten, und so glitt er in unschicklicher Hast in das Grab und landete mit einem Aufprall, der die versammelten Trauergäste zusammenzucken ließ. Rasch wurde Erde darüber geschaufelt, und Amina erinnerte sich an ihr Staunen, wie schnell Begum von der Erdoberfläche verschwunden gewesen war. Sie war die einzige anwesende Frau gewesen; die anderen waren nach der Trauerzeremonie nach Hause zurückgekehrt, wie es dem Brauch entsprach. Gegen den Wunsch ihrer Mutter hatte sie darauf bestanden, die Männer zu begleiten, und ihr Vater hatte weder die Energie gehabt, sich mit seiner temperamentvollen Tochter zu streiten, noch den Wunsch, ihr den letzten Abschied von seiner Schwiegermutter zu verwehren.
Amina registrierte den Sprung im Glas des Bilderrahmens und betrachtete forschend Begums Gesicht. Sie brauchte einen Moment, bevor sie Jacobs Blick begegnen konnte, und als sie sich schließlich mit einem Lächeln zu ihm umdrehte, hätte er nicht zu sagen vermocht, ob das Leuchten in ihren Augen von unterdrückten Tränen herrührte oder von Zorn.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte sie ihn.
»Aber ja«, antwortete er. »Ich mag zwar alt werden, aber ich kann immer noch hinter den Tresen abtauchen, wenn’s sein muss.«
Sie lachte, wie er es vorausgesehen hatte, und ohne ein weiteres Wort begannen sie die Tische abzuräumen.
Delhof, bei Pretoria
Miriam stand reglos da, ein gutes Stück von ihrem neuen Zuhause entfernt, die Hand an der Stirn, um ihre Augen zu beschatten. Das Haus war einst ein Farmhaus gewesen, es war niedrig und langgestreckt. Alles schien niedrig zu sein an diesem Ort – die Bäume, die Hügel, selbst die wenigen Gebäude –, niedrig und flach und ohne Farbe, als würde alles vom Gewicht des Himmels und seinem sich ausdehnenden Blau erdrückt. Die Sonne traf ihre Hand mit rotgleißender Intensität, drang ungemildert durch die durchscheinende, geäderte Haut ihres Handgelenks, und als sie die Augen einen Moment fest schloss, spürte sie die Hitze unter ihren Lidern noch immer wie Kohlenglut.
Als sie die Stimme ihres Sohnes vernahm, öffnete sie die Augen rasch wieder. Sie wandte sich um, und der Junge und seine Schwester gerieten ins Zentrum ihres Blickes, klein und knochig standen sie auf der stoep des Hauses, und die sie umgebenden Stapel von Kisten und Möbeln ließen sie beinahe zwergengleich erscheinen. Sie betrachtete die Kinder stirnrunzelnd, als versuche sie sich zu erinnern, wer sie waren, und der Junge rief wieder nach ihr und wieder, seine hohe, schrille Stimme kam auf den schimmernden Wellen der Hitze, die zwischen ihnen flirrten, zu ihr herübergehüpft.
»Was ist? Was willst du?«, rief sie zurück. Sie sprach Gujerati, obwohl ihr Mann sie angewiesen hatte, ausschließlich Englisch mit den Kindern zu sprechen oder, sobald sie der Sprache mächtig genug war, Afrikaans. Doch sie war in Gedanken, und Gujerati war die Sprache, mit der sie aufgewachsen war, die Sprache, in der auch ihre Mutter sie erzogen hatte.
Der Junge verstummte beim Ton seiner Mutter.
»Geht rein, ich komme!«, rief sie, und gehorsam rannten sie ins Haus. Sie stand vollkommen reglos da, wie ein bedrohtes Tier, das auf das kleinste Geräusch lauschte. Als sie die heiße, trockene Luft einatmete, erhaschte sie den Geruch von verbranntem Staub, und sie wusste, dass er fortan Teil eines jeden Atemzugs sein würde; sie spürte ihn bereits leicht auf der Haut liegen. Allein die weichen Falten ihres Baumwollkleides bewegten sich ein wenig in der Hitze, und langsam, aber stetig rannen ihr Schweißperlen von den Schläfen über die hohen Wangenknochen. Sie hob die Hand und wischte sie ungeduldig fort. Sie verstand diesen Ort nicht, an den ihr Mann sie gebracht hatte. Sie wusste, dass Springs nicht mehr als eine halbe Stunde entfernt war, wenn das Wetter und die Straßen gut waren, und dass es ein hübsches Städtchen war, aber hier war nichts, gar nichts. Vielleicht eine halbe Meile entfernt gab es ein paar baufällige Häuser, aber sie sahen aus, als wären sie schon seit Jahren unbewohnt. Am fernen Horizont waren einige Gehöfte auszumachen – wahrscheinlich gehörten sie den Farmern, die künftig zur Kundschaft im Laden ihres Mannes zählen sollten –, doch ansonsten gab es nur noch die Eisenbahnschienen; hier vor ihrem neuen Zuhause lagen sie blank und unverrückbar auf der rostfarbenen Erde, vollkommen allein auf weiter Flur.
So viel Land – noch nie zuvor hatte sie so viel Land gesehen, das einfach dalag, leer. Was sollten sie hier anfangen? Wie sollten sie derart einsam leben? Nach dem beengten Zusammenleben in ihrer Großfamilie in Pretoria, den papierdünnen Wänden zwischen erstickenden Räumen, die ständig vor Nachbarinnen und Verwandten barsten? Es war Miriam nicht unrecht gewesen, das Haus ihres Schwagers zu verlassen, denn ihre Schwägerin hatte sie kaum besser behandelt als ein Dienstmädchen. Und Omars Laden hier draußen bedeutete einen Neuanfang: ein Laden, der alles anbieten würde, was die ansässigen Farmer brauchten. Doch sie fürchtete die stille Einsamkeit des Landstrichs und wusste nicht, wie sie damit zurechtkommen würde, einzig ihren wortkargen Gatten zur Gesellschaft zu haben.
Wieder hob sie die Hand, und diesmal fuhr sie sich mit dem Arm über Wangen und Augen. Dann schlang sie die Arme schützend um ihren Leib und kehrte zu ihrer Familie zurück.
KAPITEL 2
Springs, November 1952
Als die Mutter ihres Vaters Amina wiedersah, fiel sie beinahe in Ohnmacht. Die Ankunft der älteren Dame in Südafrika verursachte einen Wirbel im Haushalt der Harjans, der alle erfasste – bis auf ihre einzige Enkelin. Auch Amina hätte die Auswirkungen vermutlich zu spüren bekommen, doch sie war schlicht und einfach nicht da und konnte auch nicht gefunden werden. Sie sei fort, sie müsse ein paar Tage arbeiten, hieß es auf dem hingekritzelten, kaum lesbaren Zettel, den sie ihren Eltern auf dem Küchentisch hinterlassen hatte, und da ihre Familie selten genau wusste, wo und welcher Art ihre Gelegenheitsjobs waren, war sie auch nicht aufzutreiben. Für gewöhnlich bereitete das ihrem Vater keine großen Sorgen; anders als andere Männer seines Alters und seiner Herkunft ließ er seine Tochter weitgehend tun, was sie wollte, seit sie einige Jahre zuvor nach Springs gekommen waren. Aminas Mutter war eine unterwürfige, gehemmte Frau, deren Sorge stumm blieb und nur aus den Falten zwischen den Brauen auf ihrer schmalen Stirn sprach. Sie verstand am besten, welche Auswirkungen die bevorstehende Ankunft ihrer Schwiegermutter auf ihrer aller Alltagsroutine haben würde, und sie machte sich die ungewöhnliche Mühe, ihre Küche zu verlassen, um im Café in Pretoria, mit dem Auto etwa eine Stunde vom Heim ihrer Familie in Springs entfernt, nach ihrer Tochter zu fragen. Jacob Williams bot Mrs.Harjan Tee an und hörte sie höflich an, erklärte jedoch, von Amina seit drei Tagen nichts gehört zu haben, da sie einen Taxijob angenommen habe und zwei Leute den langen Weg von Johannesburg nach Kapstadt fahre.
»Sie ist bald wieder da, Lady«, sagte er, benutzte dabei die ehrerbietige Anrede, die in der farbigen Gemeinschaft am Kap üblich war, und schenkte der besorgten Mutter ein aufmunterndes Lächeln. »Sie bleibt nie lange weg. Nie.«
Obwohl Amina in der Tat bald wieder da war, so doch nicht rechtzeitig genug, und so wurde die alte Dame allein von ihrem Sohn abgeholt. Das entsprach nicht dem überschwänglichen großen Bahnhof, den sie sich auf ihrer langen und von Übelkeit erschwerten Reise ausgemalt hatte. Mr.Harjan war ein erschöpfter, durchscheinend wirkender Mann, dessen hagere Gestalt in seinen ausgebeulten Arbeitskleidern fast ausgemergelt wirkte. Er kam ein wenig zu spät und fand seine Mutter am Ende des Bahnsteigs, wo sie wie angewurzelt stand und den staubigen Bahnhof und die herumwuselnden Schwarzen voller Widerwillen betrachtete. Er begrüßte sie ohne große Begeisterung, als hätte er sie am Tag zuvor erst gesehen, und verfrachtete sie in sein klappriges Auto. Wortlos fuhr er nach Hause zurück, ohne dem Unbehagen seiner beleibten Mutter groß Beachtung zu schenken – als hätte er bloß ein Paket abgeholt, das nicht weiter wichtig war. Die wiederholte Aufzählung all ihrer Zipperlein zog über ihn hinweg wie eine Wolke von Stechmücken, irritierend, aber letztlich nicht weiter von Bedeutung.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























