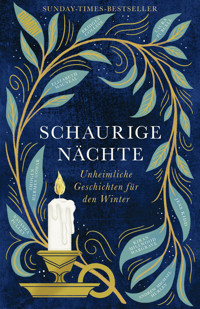9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder braucht eine Geschichte – auch wenn es schmerzhaft ist.
Emmett Farmer arbeitet auf dem Hof seiner Eltern, als ein Brief ihn erreicht. Er soll bei einer Buchbinderin in die Lehre gehen. Seine Eltern, die wie alle anderen Menschen Bücher aus ihrer Welt verbannt haben, lassen ihn ziehen – auch weil sie glauben, dass er nach einer schweren Krankheit die Arbeit auf dem Hof nicht leisten kann. Die Begegnung mit der alten Buchbinderin beeindruckt den Jungen, dabei lässt Seredith ihn nicht in das Gewölbe mit den kostbaren Büchern. Menschen von nah und fern suchen sie heimlich auf. Emmett kommt ein dunkler Verdacht: Liegt ihre Gabe darin, den Menschen ihre Seele zu nehmen? Nach dem plötzlichen Tod der Buchbinderin erkennt der Junge, welch Wohltäterin sie war – und in welche Gefahr er selbst geraten ist ...
Ein unvergleichliches Buch über die Macht der Erinnerung, verbotene Liebe und darüber, was das Menschsein bedeutet: Geschichten zu erzählen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Bridget Collins
Bridget Collins hat an der London Academy of Music and Dramatic Art studiert. Sie hat bisher mehrere Romane geschrieben sowie zwei Stücke, die beim Edinburgh Festival uraufgeführt wurden. »Die verborgenen Stimmen der Bücher« wurde in mehrere Länder verkauft.
Ulrike Seeberger, geboren 1952, Studium der Physik, lebte zehn Jahre in Schottland, arbeitete dort u.a. am Goethe-Institut. Seit 1987 freie Übersetzerin und Dolmetscherin in Nürnberg. Sie übertrug u.a. Autoren wie Philippa Gregory, Vikram Chandra, Alec Guiness, Oscar Wilde, Charles Dickens, Yaël Guiladi und Jean G. Goodhind ins Deutsche.
Informationen zum Buch
Jeder braucht eine Geschichte – auch wenn es schmerzhaft ist.
Emmett Farmer arbeitet auf dem Hof seiner Eltern, als ein Brief ihn erreicht. Er soll bei einer Buchbinderin in die Lehre gehen. Seine Eltern, die wie alle anderen Menschen Bücher aus ihrer Welt verbannt haben, lassen ihn ziehen – auch weil sie glauben, dass er nach einer schweren Krankheit die Arbeit auf dem Hof nicht leisten kann. Die Begegnung mit der alten Buchbinderin beeindruckt den Jungen, dabei lässt Seredith ihn nicht in das Gewölbe mit den kostbaren Büchern. Menschen von nah und fern suchen sie heimlich auf. Emmett kommt ein dunkler Verdacht: Liegt ihre Gabe darin, den Menschen ihre Seele zu nehmen? Nach dem plötzlichen Tod der Buchbinderin erkennt der Junge, welch Wohltäterin sie war – und in welche Gefahr er selbst geraten ist.
Ein unvergleichliches Buch über die Macht der Erinnerung, verbotene Liebe und darüber, was das Menschsein bedeutet: Geschichten zu erzählen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Bridget Collins
Die verborgenen Stimmen der Bücher
Roman
Aus dem Englischenvon Ulrike Seeberger
Inhaltsübersicht
Über Bridget Collins
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil Eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Teil Zwei
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Teil Drei
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Impressum
Teil Eins
1
Als der Brief kam, band ich draußen auf dem Feld die letzte Weizengarbe mit Händen, die so sehr zitterten, dass ich den Knoten kaum fertig brachte. Ich war schuld daran, dass wir auf die altmodische Weise arbeiten mussten, und ich würde, verdammt, nicht aufgeben. Ich hatte mich durch die Nachmittagshitze gekämpft, die dunklen Flecken weggeblinzelt, die am Rand meines Gesichtsfelds aufflackerten. Die Nacht zog herein, und ich war fast fertig. Die anderen waren aufgebrochen, als die Sonne unterging, hatten mir über die Schulter hinweg zum Abschied zugerufen, und ich war froh darüber. Zumindest war ich nun allein und musste nicht so tun, als könne ich mit ihnen mithalten. Ich machte weiter, versuchte nicht daran zu denken, wie leicht alles mit der Erntemaschine gewesen wäre. Ich war zu krank gewesen, um die Maschinen zu überprüfen – nicht dass ich mich an viel erinnerte, was zwischen den immer wieder kurz aufblitzenden Augenblicken von Klarsichtigkeit lag. Für mich bestand der Sommer nur aus Echos und Geistern und dunklen, schmerzenden Lücken. Es hatte auch niemand sonst daran gedacht, nach der Maschine zu sehen. Jeden Tag stolperte ich über eine andere Aufgabe, die nicht erledigt war; mein Vater hatte sein Bestes gegeben, aber er konnte ja nicht alles schaffen. Meinetwegen würden wir das ganze Jahr in allem hinterherhinken.
Ich zog die Stängel fest um die Mitte der Garbe und lehnte sie gegen die anderen. Fertig. Nun konnte ich nach Hause gehen … Doch rings um mich pulsten und wirbelten Schatten, tiefer als das blaue Violett der Abenddämmerung, und mir zitterten die Knie. Ich ließ mich in die Hocke sinken, keuchte vor Schmerzen in allen Knochen. Es war schon besser als sonst – besser als die schwindelerregenden Krämpfe, die mich monatelang immer wieder ohne Vorwarnung überfallen hatten –, doch ich fühlte mich noch so spröde und zerbrechlich wie ein alter Mann. Ich biss die Zähne zusammen. Ich war so schwach, dass ich hätte heulen mögen; aber das würde ich nicht, eher würde ich sterben, obwohl das einzige Auge, das mich beobachtete, der volle, runde Herbstmond war.
»Emmett? Emmett!«
Es war nur Alta, die sich zwischen den Korngarben hindurch auf mich zuschlängelte; ich rappelte mich auf und versuchte, das Schwindelgefühl zu unterdrücken. Über mir wankten die wenigen Sterne erst hierhin, dann dorthin. Ich räusperte mich. »Ich bin hier.«
»Warum hast du nicht einen von den anderen gebeten, das fertig zu machen? Ma hat sich solche Sorgen gemacht, als die anderen die Gasse entlangkamen und du nicht dabei …«
»Sie hat keinen Grund zur Sorge. Ich bin doch kein Kind mehr.« Mein Daumen blutete, wo ein scharfer Halm in die Haut eingedrungen war. Das Blut schmeckte nach Staub und Fieber.
Alta zögerte. Vor einem Jahr war ich so stark gewesen wie all die anderen. Jetzt schaute sie mich mit schief gelegtem Kopf an, als wäre ich jünger als sie. »Nein, aber …«
»Ich wollte den Mond aufgehen sehen.«
»Ja, sicher.« Im Zwielicht wirkten ihre Züge weicher, aber ich sah trotzdem, wie überlegt sie mich anschaute. »Wir können dich nicht dazu zwingen, dich auszuruhen. Wenn dir nichts daran liegt, gesund zu werden …«
»Jetzt redest du schon wie sie. Wie Ma.«
»Weil sie recht hat. Du kannst nicht erwarten, dass du mit einem Schlag wieder so bist, als wäre nichts geschehen. Nachdem du so krank warst.«
Krank. Als hätte ich mit einem Husten oder mit Erbrechen oder von Pusteln übersät das Bett gehütet. Selbst durch den Nebel meiner Alpträume hindurch konnte ich mich an mehr erinnern, als ihnen bewusst war; ich wusste um das Schreien und die Halluzinationen, um die Tage, an denen ich nicht zu weinen aufhören konnte oder niemanden erkannte; um die Nacht, als ich mit bloßen Händen das Fenster eingeschlagen hatte. Ich wünschte, ich hätte mir wirklich tagelang hilflos die Eingeweide aus dem Leib und in den Nachttopf geschissen; das wäre besser gewesen, als immer noch die Striemen an den Handgelenken zu sehen, wo sie mich festbinden mussten. Ich wandte mich von Alta ab und konzentrierte mich nur noch darauf, an der Wunde unten an meinem Daumen zu saugen, mit der Zunge daran zu lecken, bis ich kein Blut mehr schmecken konnte.
»Bitte, Emmett«, sagte Alta und strich mit den Fingern über den Kragen meines Hemdes. »Du hast ein ebenso gutes Tagwerk verrichtet wie alle anderen. Kommst du jetzt nach Hause?«
»Na gut.« Eine Brise hob mir die Nackenhaare in die Höhe. Alta bemerkte, dass ich zitterte, und senkte die Augen. »Was gibt’s denn zum Abendessen?«
Sie warf mir ihr Grinsen zu, das eine Zahnlücke entblößte. »Gar nichts, wenn du dich nicht beeilst.«
»Na schön. Wer zuerst da ist.«
»Du kannst noch mal mit mir um die Wette laufen, wenn ich kein Mieder trage.« Sie wirbelte herum, dass ihr der staubige Rock um die Fußgelenke flog. Wenn sie lachte, sah sie noch immer wie ein Kind aus, aber die Knechte schnüffelten bereits um sie herum. In manchem Licht wirkte sie schon wie eine junge Frau.
Ich trottete neben ihr her, war so erschöpft, dass ich mich wie betrunken fühlte. Die Dunkelheit verdichtete sich, sammelte sich unter den Bäumen und in den Hecken, während das Mondlicht die Sterne am Himmel ausbleichte. Ich dachte an kaltes Brunnenwasser, glasklar, mit winzigen grünen Pünktchen unten am Boden – oder nein, an Bier, grasig und bitter, bernsteinfarben, mit Vaters Spezialmischung von Kräutern angesetzt. Davon würde ich gleich einschlafen, aber das war gut. Ich wollte nur eines: erlöschen wie eine Kerze, in eine traumlose Bewusstlosigkeit sinken. Keine Alpträume, keine nächtlichen Angstattacken, und am Morgen im sauberen neuen Sonnenlicht aufwachen.
Die Turmuhr im Dorf schlug neun, als wir durch das Tor in den Hof traten. »Ich habe einen Bärenhunger«, sagte Alta. »Die haben mich nach dir losgeschickt, ehe ich …«
Plötzlich unterbrach sie die Stimme meiner Mutter. Sie schrie.
Alta hielt inne, während das Tor hinter uns zuschwang. Unsere Blicke trafen sich. Ein paar Wortfetzen schwebten über den Hof: Wie kannst du nur sagen … wir können das nicht, wir können es einfach nicht machen!
Meine Beinmuskeln zitterten, weil ich mich zwang, stockstill zu stehen. Ich streckte die Hand aus, stützte mich an der Mauer ab und wünschte, mein Herz schlüge langsamer. Schimmernd drang ein Keil aus Lampenlicht durch einen Spalt in den Küchenvorhängen. Dahinter bewegte sich ein Schatten hin und her: Mein Vater ging auf und ab.
»Wir können nicht die ganze Nacht hier draußen bleiben«, flüsterte Alta.
»Es ist wahrscheinlich nichts.« Die beiden stritten sich schon die ganze Woche darüber, warum niemand die Erntemaschine überprüft hatte. Keiner erwähnte, dass es eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre.
Ein dumpfer Schlag: Fäuste hieben auf den Küchentisch. Mein Vater erhob die Stimme. »Was erwartest du denn von mir? Dass ich nein sage? Die verdammte Hexe wird uns so schnell verfluchen wie …«
»Das hat sie doch schon! Sieh ihn dir doch an, Robert – was ist, wenn er nie wieder gesund wird? Das ist alles ihre Schuld …«
»Seine Schuld, meinst du wohl – wenn er …« Eine Sekunde lang schrillte ein hoher Ton in meinen Ohren und übertönte Vaters Stimme. Die Welt kippte und richtete sich wieder auf, als hätte sie kurz auf ihrer Achse geruckelt. Als ich mich wieder konzentrieren konnte, herrschte Schweigen.
»Das wissen wir nicht«, sagte mein Vater endlich, laut genug, dass wir es hören konnten. »Sie hilft ihm vielleicht. All die Wochen hat sie geschrieben und sich erkundigt, wie es ihm geht.«
»Weil sie ihn für sich haben wollte. Nein, Robert, nein, ich lasse das nicht zu. Er gehört hierher, zu uns, was immer er auch getan hat, er ist immer noch unser Sohn – und die, die jagt mir Angst ein.«
»Du hast sie doch noch nie gesehen. Du musstest doch nie dahin gehen und …«
»Das ist mir gleichgültig! Sie hat genug angerichtet. Sie kriegt ihn nicht.«
Alta schaute mich an. Irgendwas veränderte sich in ihrem Gesicht, und sie packte mich beim Handgelenk und zerrte mich vorwärts. »Wir gehen jetzt da rein«, sagte sie mit der hohen, aufgeregten Stimme, mit der sie auch die Hühner rief. »Es war ein langer Tag, du hast bestimmt einen Bärenhunger. Ich habe den jedenfalls. Wenn jetzt keine Pastete mehr übrig ist, bringe ich jemanden um. Steche ihm die Gabel direkt ins Herz.« Sie hielt vor der Tür inne. Dann riss sie die Tür auf.
Meine Eltern standen an entgegengesetzten Enden der Küche: mein Vater beim Fenster, mit dem Rücken zu uns, meine Mutter am Kamin, sie hatte rote Flecken auf den Wangen wie Rouge. Zwischen ihnen auf dem Tisch lagen ein Blatt dickes, weißes Papier und ein offener Umschlag. Mutter blickte rasch von Alta zu mir und machte einen halben Schritt auf den Tisch zu.
»Abendessen«, verkündete Alta. »Emmett, setz dich, du siehst aus, als würdest du jeden Augenblick umkippen. Ich hoffe, die Pastete ist im Ofen.« Sie stellte einen Stapel Teller neben mir ab. »Brot? Bier? Ehrlich, ich könnte genauso gut Küchenmagd sein …« Sie verschwand in der Speisekammer.
»Emmett«, sagte mein Vater, ohne sich zu mir herumzudrehen. »Auf dem Tisch liegt ein Brief. Den solltest du lesen.«
Ich zog das Blatt zu mir her. Die Schrift auf dem Papier verschwamm zu einem formlosen Klecks. »Meine Augen sind zu staubig. Sag mir, was drinsteht.«
Mein Vater neigte den Kopf, seine Nackenmuskeln spannten sich an, als müsse er etwas Schweres hinter sich herschleppen. »Die Binderin will einen Lehrling.«
Meine Mutter gab ein Geräusch von sich, das klang, als verschluckte sie ein Wort.
Ich fragte: »Einen Lehrling?«
Es herrschte Stille. Eine Scheibe Mond leuchte durch die Lücke in den Vorhängen, tauchte auf ihrem Pfad alles in Silberglanz. Vaters Haar sah darin fettig und grau aus. »Dich«, antwortete er.
Alta stand in der Tür zur Speisekammer, ein Glas mit Essiggemüse an sich gedrückt. Eine Sekunde lang fürchtete ich, sie würde es fallen lassen, aber sie setzte es sorgfältig auf der Anrichte ab. Der Aufprall von Glas auf Holz war lauter, als das Klirren gewesen wäre.
»Ich bin zu alt, um ein Lehrling zu sein.«
»Sie sieht das nicht so.«
»Ich dachte …« Meine Hand lag flach auf dem Tisch: eine dünne weiße Hand, die ich kaum wiedererkannte. Eine Hand, die kein ehrliches Tagwerk verrichten konnte. »Es geht mir immer besser. Schon bald …« Ich hielt inne, weil mir meine Stimme so fremd vorkam wie meine Finger.
»Darum geht es nicht, mein Sohn.«
»Ich weiß, ich bin jetzt zu nichts nutze …«
»Oh, mein Liebling«, sagte meine Mutter. »Das ist doch nicht deine Schuld … es hat nichts damit zu tun, dass du krank warst. Du bist sicher schon bald wieder der Alte. Wenn das alles wäre … Du weißt doch, wir haben immer gedacht, du würdest einmal mit deinem Vater den Hof führen. Und das hättest du tun können, du könntest es noch immer … aber …« Ihr Blick wanderte zu meinem Vater. »Wir schicken dich nicht weg. Sie fragt nach dir.«
»Ich weiß nicht, wer sie ist.«
»Das Buchbinden … ist ein gutes Handwerk. Ein ehrliches Handwerk. Das ist nichts, vor dem man sich fürchten muss.« Alta rumpelte gegen die Anrichte, und Mutter schaute ihr über die Schulter hinweg zu, wie sie mit einer raschen Armbewegung verhinderte, dass ein Teller auf den Boden fiel. »Alta, pass doch auf.«
Mein Herz hüpfte und pochte. »Aber … ihr hasst doch Bücher. Sie sind böse. Das habt ihr mir gesagt … damals, als ich das Buch vom Lenzmarkt mitgebracht habe …«
Sie warfen einander einen Blick zu, so rasch, dass ich ihn nicht deuten konnte. Mein Vater meinte: »Das ist jetzt nicht wichtig.«
»Aber …« Ich wandte mich wieder meiner Mutter zu. Ich konnte das alles nicht in Worte fassen: den raschen Themenwechsel, sobald jemand ein Buch erwähnte, das Schaudern des Abscheus bei diesem Wort, ihre Mienen … Wie sie mich einmal, als ich noch klein war und wir uns in Castleford verlaufen hatten, wütend an einem schmuddeligen Laden vorbeigezerrt hatten – A. Fogatini, Pfandleiher und lizenzierter Buchhändler. »Was meinst du damit, dass das ein gutes Handwerk ist?«
»Es ist nicht …« Mutter holte tief Luft. »Nun, vielleicht ist es nicht das, was ich mir für dich gewünscht hätte, ehe …«
»Hilda.« Mein Vater griff sich mit den Fingern an den Hals, massierte sich die Muskeln, als schmerzten sie. »Du hast keine andere Wahl, mein Junge. Du wirst ein geregeltes Leben führen. Sicher, es ist weit weg, aber das ist ja nicht schlimm. Dort ist es ruhig. Die Arbeit ist nicht schwer, und es bringt dich niemand vom rechten Weg ab …« Er räusperte sich. »Und nicht alle sind wie sie. Du richtest dich dort bequem ein, erlernst das Handwerk, und dann … Na ja. In der Stadt gibt es Buchbinder, die eigene Kutschen haben.«
Ein winziges Schweigen. Alta klopfte mit dem Fingernagel an den Rand des Glases und schaute mich an.
»Aber ich habe doch nicht – ich habe noch nie – wie kommt sie denn darauf, dass ich …?« Keiner wollte mir in die Augen sehen. »Was meinst du damit, dass ich keine andere Wahl habe?«
Niemand antwortete. Schließlich schritt Alta durch das Zimmer und nahm den Brief in die Hand. »›Sobald er reisen kann‹«, las sie laut vor. »›Die Binderei kann im Winter sehr kalt werden. Bitte sorgt dafür, dass er warme Kleidung mitbringt.‹ Warum hat sie an dich und nicht an Emmett geschrieben? Weiß sie nicht, dass er lesen kann?«
»So machen es alle«, erwiderte mein Vater. »Man bittet die Eltern um einen Lehrling, so geht das eben.«
Es war gleichgültig. Meine Hände auf dem Tisch waren nichts als Knochen und Sehnen. Vor einem Jahr waren sie noch braun und muskulös gewesen, beinahe Männerhände; jetzt gehörten sie niemandem. Sie taugten zu nichts, außer zu einem Handwerk, das meine Eltern verachteten. Aber warum hatte sich die Binderin ausgerechnet mich ausgesucht? Hatten meine Eltern sie vielleicht doch darum gebeten? Ich breitete die Finger aus und presste sie fest auf den Tisch, als könnte ich so die Stärke des Holzes durch die Haut meiner Handflächen aufnehmen.
»Was ist, wenn ich nein sage?«
Mein Vater tappte zum Schrank, beugte sich hinunter und nahm eine Flasche Brombeergin heraus. Es war ein starkes, süßes Gesöff, das meine Mutter nur an Festtagen oder zu medizinischen Zwecken ausschenkte, aber jetzt schüttete er sich einen halben Becher voll, und sie sagte kein Wort. »Wir haben hier für dich keinen Platz. Vielleicht solltest du dankbar sein. Das ist etwas, das du tun kannst.« Er kippte die Hälfte des Gins hinunter und hustete.
Ich holte tief Luft. Auf gar keinen Fall sollte mir die Stimme versagen. »Wenn es mir erst besser geht, bin ich wieder genauso stark wie …«
»Mach das Beste draus«, erwiderte mein Vater.
»Aber ich will nicht …«
»Emmett«, sagte Ma, »bitte … es ist das Richtige für dich. Sie weiß, was sie mit dir machen muss.«
»Was sie mit mir machen muss?«
»Ich meine doch nur … wenn du wieder krank wirst, dann kann sie …«
»Wie in einem Irrenhaus? Ist es das? Ihr schickt mich irgendwohin, meilenweit weg von allem, nur weil ich jeden Augenblick wieder den Verstand verlieren könnte?«
»Sie will dich haben«, erwiderte Ma und krallte die Hände in ihren Rock, als wolle sie Wasser herauswringen. »Ich wünschte, du müsstest nicht gehen.«
»Dann gehe ich nicht!«
»O doch, du gehst, mein Junge«, sagte mein Vater. »Gott weiß, du hast uns schon genug Schwierigkeiten ins Haus gebracht.«
»Robert, nicht doch …«
»Du gehst. Und wenn ich dich wie ein Paket zusammenschnüren und vor ihrer Tür ablegen muss, du gehst. Mach dich bereit für morgen.«
»Morgen?« Alta wirbelte so schnell herum, dass ihr Zopf wie ein Seil nach vorne schwang. »Er kann morgen noch nicht gehen. Er braucht Zeit zum Packen … und dann ist da auch noch die Ernte und das Erntemahl … Bitte, Pa.«
»Halt den Mund!«
Stille.
»Morgen?« Die roten Punkte auf Mas Wangen hatten sich zu großen scharlachroten Flächen ausgeweitet, die wie Blutflecken leuchteten. »Wir haben nie gesagt, dass …« Ihre Stimme erstarb. Mein Vater hatte seinen Gin ausgetrunken, hatte ihn mit einer Grimasse heruntergeschluckt, als hätte er den Mund voller Steine.
Ich wollte Ma versichern, es wäre in Ordnung, ich würde gehen, sie müssten sich meinetwegen keine Sorgen mehr machen, doch mein Hals war von der Erntearbeit zu trocken.
»Noch ein paar Tage. Robert, die anderen Lehrlinge gehen doch erst nach der Ernte – und er ist immer noch nicht gesund, nur ein paar Tage …«
»Die sind jünger als er. Wenn er einen Tag auf dem Feld arbeiten kann, ist er auch gesund genug zum Reisen.«
»Ja, aber …« Sie bewegte sich auf ihn zu und packte ihn beim Arm, so dass er sich nicht wegdrehen konnte. »Nur noch ein bisschen Zeit.«
»Herrgott, Hilda!« Er gab ein ersticktes Geräusch von sich und versuchte, sich von ihr loszureißen. »Mach doch nicht alles noch schwerer. Meinst du, ich lasse ihn gern ziehen? Meinst du, nachdem wir uns so bemüht haben – darum gekämpft haben, dieses Haus reinzuhalten. Meinst du, dass es mich mit Stolz erfüllt, wo doch mein eigener Vater mit dem Kreuzzug marschiert ist und dabei ein Auge verloren hat?«
Meine Mutter schaute zu Alta und mir. »Nicht vor den …«
»Was hat das jetzt schon noch zu sagen?« Er wischte sich mit dem Unterarm über die Augen und schleuderte mit einer hilflosen Geste den Becher auf den Boden. Er zerbrach nicht. Alta beobachtete, wie er auf sie zurollte und liegenblieb. Mein Vater wandte uns den Rücken zu, beugte sich über die Anrichte, als müsse er wieder zu Atem kommen. Dann herrschte Schweigen.
»Ich gehe«, sagte ich. »Ich gehe morgen.« Ich konnte keinen ansehen. Ich stand auf, schlug mir, als ich meinen Stuhl zurückschob, das Knie an der Tischkante an. Mühsam schleppte ich mich zur Tür. Es schien mir, als wäre der Griff kleiner und schwerer zu bewegen als sonst. Als die Tür aufging, hallte das Klacken laut von den Wänden wider.
Draußen teilte der Mond die Welt in tiefes Blau und Silber. Die Luft war warm und sahneweich, erfüllt von Heuduft und Sommerstaub. Eine Eule gluckste in einem Feld in der Nähe.
Ich schwankte zur anderen Seite des Hofes und lehnte mich dort an eine Mauer. Ich konnte kaum atmen. Mas Stimme hallte in meinen Ohren wider: Die verdammte Hexe wird uns verfluchen. Und die Antwort meines Vaters: Das hat sie doch schon!
Sie hatten recht; ich war zu nichts nutze. Elend stieg in mir hoch, so stark wie der stechende Schmerz in meinen Beinen. Vor all dem hier war ich nie krank gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass mein Körper mich im Stich lassen, dass mein Verstand erlöschen könnte wie eine Lampe und nur Dunkelheit zurückbleiben würde. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich krank geworden war. Jedes Mal, wenn ich es doch versuchte, sah ich nur ein Wirrwarr aus alptraumhaften Bruchstücken. Selbst meine Erinnerungen an das Leben davor – an den letzten Frühling, den letzten Winter – waren von demselben Schatten beschmutzt, als wäre gar nichts mehr gesund. Ich wusste, dass ich nach dem Mittsommer zusammengebrochen war, denn Mutter hatte es mir erzählt. Ich war auf dem Heimweg von Castleford gewesen; aber niemand hatte mir je erklärt, wo genau ich gewesen oder was geschehen war. Ich musste den Wagen gelenkt haben – ohne Hut unter der heißen Sonne wahrscheinlich –, aber wenn ich versuchte, es mir ins Gedächtnis zu rufen, war da nichts, nur eine Luftspiegelung, ein letzter schwindelerregender Blick auf das Sonnenlicht, ehe mich die Schwärze verschluckte. Wochenlang war ich nur aus dieser Finsternis aufgetaucht, um zu schreien und mich zu wehren und sie anzubetteln, mich loszubinden. Kein Wunder, dass sie mich loswerden wollten.
Ich schloss die Augen. Ich konnte die drei immer noch sehen, wie sie da standen, die Arme umeinandergelegt. Hinter mir flüsterte etwas, kratzte etwas wie mit trockenen Krallen an der Wand. Es war keine Wirklichkeit, doch es übertönte die Eule und das Rascheln der Bäume. Ich barg den Kopf in den Armen und tat so, als könnte ich es nicht hören.
Ich hatte mich wohl instinktiv in die tiefste Ecke der Dunkelheit zurückgezogen, denn als ich die Augen wieder aufschlug, rief Alta mitten auf dem Hof meinen Namen, ohne in meine Richtung zu schauen. Der Mond war weitergewandert und stand nun über dem Giebel des Hauses. Alle Schatten waren kurz und gedrungen.
»Emmett?«
»Ja«, antwortete ich. Alta schrak zusammen und machte einen Schritt vorwärts, um in die Schatten zu schauen.
»Was machst du da? Hast du geschlafen?«
»Nein.«
Sie zögerte. Hinter ihr bewegte sich das Licht einer Lampe hinter dem oberen Fenster, während dort jemand zu Bett ging. Ich rappelte mich langsam auf die Füße, hielt inne und fuhr zusammen, als der Schmerz mir in die Gelenke schnitt.
Alta schaute zu, wie ich aufstand, ohne mir Hilfe anzubieten. »Hast du das ernst gemeint? Dass du gehst? Morgen?«
»Pa hat es auch ernst gemeint, als er gesagt hat, dass ich keine andere Wahl habe.«
Ich wartete darauf, dass sie mir widersprach. Alta war schlau, fand immer neue Wege oder irgendeine andere Art und Weise, die Dinge zu erledigen, Schlösser aufzubekommen. Doch nun legte sie nur den Kopf in den Nacken, als wolle sie ihre Haut vom Mondlicht bleichen lassen. Ich schluckte. Dieses blöde Schwindelgefühl war wieder zurück – ganz plötzlich zog es mich hierhin und dorthin –, und ich schwankte gegen die Wand und rang nach Luft.
»Emmett? Geht’s dir gut?« Sie biss sich auf die Lippe. »Nein, natürlich nicht. Setz dich.«
Ich wollte ihr nicht gehorchen, aber meine Beine sackten unter mir zusammen. Ich schloss die Augen und atmete tief den Duft des Heus und der abkühlenden Erde ein, die überreife Süße der zerdrückten Kräuter und einen stinkenden Hauch von Dung.
Altas Rock bauschte sich auf und raschelte, als sie neben mir in die Hocke ging.
»Ich wünschte, du müsstest nicht gehen.«
Ich hob eine Schulter, ohne sie anzuschauen, und ließ sie wieder sacken.
»Aber … vielleicht ist es am besten so …«
»Wie kann das sein?« Ich schluckte, versuchte, das Krächzen in meiner Stimme aufzufüllen. »Na gut, ich verstehe schon. Ich bin hier zu nichts nutze. Es ist besser für euch alle, wenn ich … wo immer sie ist, diese Binderin.«
»Draußen im Sumpf, an der Straße nach Castleford.«
»Richtig.« Wie würde der Sumpf riechen? Nach stehendem Wasser, verrottendem Schilf. Schlamm. Schlamm, der einen bei lebendigem Leib verschlang, wenn man sich zu weit von der Straße entfernte, und der einen nie wieder ausspucken würde … »Wieso weißt du so viel darüber?«
»Ma und Pa denken nur an dich. Nach allem, was geschehen ist … Dort bist du in Sicherheit.«
»Das hat Ma auch gesagt.«
Eine Pause. Alta begann, an ihrem Daumennagel zu kauen.
Im Obsthain unterhalb der Ställe flötete eine Nachtigall und gab dann auf.
»Du weißt ja nicht, wie es für sie war, Emmett. Immer diese Angst. Du bist ihnen ein bisschen Ruhe und Frieden schuldig.«
»Ich kann doch nichts dafür, dass ich krank war!«
»Du kannst aber dafür, dass du …« Sie schnaufte. »Nein, ich weiß. Ich habe das nicht so gemeint … nur brauchen wir alle … bitte sei nicht böse. Es ist gut so. Du erlernst ein Handwerk.«
»Ja. Bücher binden.«
Sie zuckte zusammen. »Sie hat dich ausgewählt. Das muss doch bedeuten …«
»Was bedeutet das? Wie kann sie mich ausgewählt haben, wenn sie mich noch nie gesehen hat?« Ich meinte, Alta hätte zum Sprechen angesetzt, aber als ich ihr den Kopf zuwandte, starrte sie nur mit ausdrucksloser Miene den Mond an. Ihre Wangen waren schmaler als vor meiner Krankheit, und die Haut unter ihren Augen sah aus, als wäre sie mit Asche verschmiert. Sie war eine Fremde, unerreichbar.
Als wäre es eine Antwort, sagte sie: »Ich komme dich besuchen, wann immer ich kann …«
Ich ließ den Kopf nach hinten sinken, bis ich die Steinmauer an meinem Schädel spürte. »Die haben dich rumgekriegt, nicht?«
»Ich habe Vater noch nie so gesehen«, antwortete sie. »So wütend.«
»Ich schon«, erwiderte ich. »Er hat mich einmal geschlagen.«
»Ja«, sagte sie, »na ja – ich denke, du …« Sie unterbrach sich.
»Als ich klein war«, fügte ich hinzu. »Du warst nicht alt genug, um dich daran zu erinnern. Es war am Tage des Frühlingmarkts.«
»Oh.« Als ich aufschaute, huschten ihre Augen fort. »Nein. Daran erinnere ich mich nicht.«
»Ich habe … da war ein Mann, der Bücher verkauft hat.« Ich konnte mich noch genau daran erinnern, wie an jenem Tag das Jahrmarktsgeld in meiner Hosentasche geklimpert hatte – Sixpence in Farthings, so viele Farthings, dass sie die Tasche ausbeulten –, genauso an das berauschende, sorglose Gefühl, wie ich zum Frühlingsmarkt ging, mich von den anderen wegschlich und mir überlegte, was ich kaufen würde. Ich war an den Ständen mit Fleisch und Hühnern vorbeigegangen, am Fisch aus Coldwater und den gemusterten Baumwollstoffen aus Castleford, war kurz am Stand mit den Süßigkeiten stehengeblieben und hatte mich dann einem anderen, kleineren zugewandt, der ein wenig abseits war und wo ich einen Blick auf Gold und satte Farben erhascht hatte. Man konnte ihn kaum Stand nennen; es war nur ein Tisch auf Böcken, den ein Mann mit ruhelosen Augen bewachte. Doch darauf waren hoch Bücher aufgetürmt. »Ich habe da zum ersten Mal welche gesehen. Ich wusste nicht, was das war.«
Unvermittelt erschien wieder dieser seltsame, lauernde Ausdruck auf Altas Gesicht. »Du meinst …?«
»Vergiss es.« Ich wusste nicht, warum ich ihr das erzählte. Ich wollte mich nicht erinnern. Aber jetzt konnte ich den Gedanken daran nicht mehr loswerden. Ich hatte die Bücher für Schachteln gehalten, kleine Kästchen aus vergoldetem Leder, in denen man Dinge aufbewahrte, zum Beispiel Mutters bestes Silber oder Vaters Schachfiguren. Ich war hingeschlendert, hatte mit meinem Geld geklimpert, und der Mann hatte rechts und links über die Schulter geschaut, ehe er mich angrinste. »Ah, was für ein goldlockiger kleiner Prinz! Seid Ihr für eine Geschichte hergekommen, junger Herr? Für eine Erzählung über Mord oder Inzest, über Schande oder Ruhm, über eine Liebe, die das Herz so sehr durchbohrte, dass man sie besser vergisst, oder eine finstere Übeltat? Ihr seid zum richtigen Händler gekommen, junger Mann, diese Bücher hier sind das Beste vom Besten, sie erzählen Euch wahre und schreckliche Geschichten voller Gewalt und Leidenschaft und Gemütserregung. Oder wenn Euch der Sinn nach Komödien steht, davon habe ich auch einige, die allerseltensten. Von was sich die Leute so trennen! Schaut nur her, junger Herr, lasst Euer Auge über all das schweifen … Gebunden von einem Meister in Castleford, vor vielen Jahren.«
Es gefiel mir nicht, wie er mich immer junger Herr nannte, aber als er mir das Buch reichte, fiel es auf, und ich vermochte es einfach nicht zurückzugeben. Sobald ich die Buchstaben auf den Seiten sah, begriff ich es: Das waren viele Seiten, die man alle zusammengequetscht hatte – wie Briefe, viele Briefe, nur in einem besseren Kästchen. Eine Geschichte, die immer weiterging. »Wie viel kostet es?«
»Ah, das hier, junger Herr. Für einen so jungen Mann habt Ihr einen hervorragenden Geschmack. Das ist ein ganz besonderes Buch, eine echte Abenteuergeschichte, die reißt Euch mit wie ein Reiterangriff. Ninepence dafür. Oder zwei für einen Shilling.«
Ich wollte das Buch. Ich wusste nicht, warum, nur dass es mir in den Fingerspitzen juckte. »Ich habe nur Sixpence.«
»Die nehme ich«, sagte er und schnipste mir mit den Fingern zu. Sein breites Lächeln war verschwunden. Als ich seinem hastigen Blick folgte, sah ich, dass sich unweit von uns ein Haufen Männer murmelnd zusammengerottet hatte.
»Hier.« Ich kippte ihm meine Handvoll Farthings in die ausgestreckte Hand. Er ließ einen fallen, starrte jedoch unverwandt auf die Männer und beugte sich nicht herunter, um ihn aufzuheben. »Danke.«
Ich nahm das Buch und eilte davon, triumphierend, aber unruhig. Als ich das geschäftige Treiben des Marktes wieder erreicht hatte, blieb ich stehen und drehte mich um. Die Männer bewegten sich auf den Stand des Mannes zu, während er verzweifelt seine Bücher in den staubigen kleinen Karren warf, der hinter ihm stand.
Irgendetwas warnte mich, dort lieber nicht hinzustarren. Ich rannte nach Hause, fasste das Buch nur mit der Manschette meines Hemds an, um den Umschlag nicht mit meinen verschwitzten Fingern zu beflecken. Auf der Treppe zur Scheune setzte ich mich in die Sonne – hier würde mich keiner sehen, die anderen waren noch auf dem Jahrmarkt – und untersuchte das Buch genauer. Es war anders als alles, was ich je gesehen hatte. Es war von einem tiefen, schweren Rot mit einem Goldmuster, und es fühlte sich so weich an wie Haut. Als ich es aufschlug, stieg mir der Duft von Moder und Holz in die Nase, als hätte man es jahrelang nicht angefasst.
Es zog mich in seinen Bann.
Die Geschichte spielte in einem Heerlager in einem fremden Land und war zunächst verwirrend: voller Hauptmänner, Majore und Oberste, voller Streitgespräche über militärische Taktik und die Androhung eines Kriegsgerichts. Aber irgendwas brachte mich dazu, immer weiterzulesen: Ich konnte alles vor mir sehen, in allen Einzelheiten, ich konnte die Pferde hören und das Klatschen der Zeltleinwand im Wind, ich spürte, wie mein Herz beim Geruch des Schießpulvers schneller zu schlagen begann … Ich stolperte weiter durch das Buch, wurde widerwillig hineingezogen. Allmählich begriff ich, dass diese Männer am Vorabend einer Schlacht standen und dass der Mann in dem Buch ein Held war. Bei Sonnenaufgang würde er seine Leute zu einem glorreichen Sieg führen – ich spürte seine Erregung, seine Erwartung, ich spürte sie selbst …
»Was zum Teufel machst du da?«
Diese Worte zerstörten den Zauber. Ich rappelte mich instinktiv auf die Beine, blinzelte durch den Dunst. Mein Vater – und die anderen hinter ihm, meine Mutter mit Alta auf dem Arm, alle vom Jahrmarkt zurück. Jetzt schon … doch es wurde bereits dunkel.
»Emmett, ich habe gefragt, was du da machst!« Er wartete meine Antwort nicht ab, riss mir nur das Buch weg. Als er sah, was es war, erstarrte sein Gesicht. »Wo hast du das her?«
Von einem Mann, wollte ich sagen, von einem Mann auf dem Jahrmarkt, er hatte Dutzende davon, und sie sahen aus wie Kästchen für Juwelen, aus Leder und Gold … Aber als ich Vaters Miene wahrnahm, zog sich irgendwas in meinem Kehlkopf zusammen, und ich konnte nicht reden.
»Robert? Was …?« Mutter streckte die Hand danach aus und zuckte dann zurück, als hätte es sie gebissen.
»Ich verbrenne es.«
»Nein!« Meine Mutter ließ Alta taumelnd auf den Boden rutschen und kam auf uns zugestolpert, um meinen Vater beim Arm zu packen. »Nein, wie kannst du das tun? Vergrabe es.«
»Es ist alt, Hilda. Die sind schon alle tot, schon jahrelang.«
»Du darfst es nicht tun. Nur für alle Fälle. Schaff es weg. Wirf es weg.«
»Damit jemand anderer es findet?«
»Du weißt, dass du es nicht verbrennen darfst.« Einen Augenblick lang starrten sie einander mit angespannter Miene an. »Vergrab es. An einem sicheren Ort.«
Endlich nickte mein Vater kurz und knapp. Alta bekam Schluckauf und begann zu wimmern. Vater stieß das Buch zu einem der Knechte hin. »Hier! Pack das gut ein. Ich gebe es dem Totengräber.« Dann wandte er sich wieder mir zu. »Emmett«, sagte er, »ich will dich nie wieder mit einem Buch sehen. Hast du mich verstanden?«
Nichts verstand ich. Was war geschehen? Ich hatte das Buch gekauft, ich hatte es nicht gestohlen, aber irgendwie hatte ich anscheinend etwas Unverzeihliches getan. Ich nickte, noch ganz benommen von den Bildern, die sich vor meinen Augen geformt hatten. Ich war an einem anderen Ort gewesen, in einer anderen Welt.
»Gut. Daran wirst du dich erinnern«, sagte mein Vater.
Und dann schlug er mich.
Ich will dich nie wieder mit einem Buch sehen.
Und nun schickten sie mich zu einer Buchbinderin, als wäre etwas viel Schlimmeres an die Stelle der Gefahr getreten, vor der mich mein Vater gewarnt hatte. Als wäre jetzt ich die Gefahr.
Ich blickte zur Seite. Alta starrte auf ihre Füße hinunter. Nein, sie erinnerte sich nicht an jenen Tag. Niemand hatte je wieder darüber ein Wort verlauten lassen. Niemand hatte je erklärt, warum Bücher schändlich waren. Einmal hatte in der Schule jemand gemurmelt, der alte Lord Kent hätte eine Bibliothek; doch als alle kicherten und die Augen verdrehten, fragte ich nicht, warum das denn so schlimm war. Ich hatte ein Buch gelesen: Was immer mit Lord Kent nicht stimmte, ich war genauso. Tief in mir war die Schande noch da.
Und ich hatte Angst. Es war eine schleichende, formlose Angst, wie der Nebel, der vom Fluss hereinzog. Ihre kühlen Ranken wucherten um mich und in meine Lungen hinein. Ich wollte nicht einmal in die Nähe der Binderin gehen. Aber ich musste.
»Alta …«
»Ich gehe rein«, sagte sie und sprang auf. »Du schaust besser auch, dass du nach oben kommst, Em. Du musst noch packen, und die Reise ist morgen sehr weit, nicht? Gute Nacht.« Dann lief sie über den Hof, nestelte die ganze Zeit an ihrem Zopf herum, so dass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. An der Tür rief sie noch »Bis morgen«, ohne sich noch einmal umzudrehen. Vielleicht lag es am Echo, das von der Stallmauer zurückkam, dass die Worte so unaufrichtig klangen.
Morgen.
Ich schaute auf den Mond, bis meine Angst zu groß wurde. Schließlich ging ich in mein Zimmer und packte meine Sachen.
2
Von der Straße her sah es so aus, als würde die Binderei brennen. Hinter uns ging die Sonne unter, das rotgoldene Feuer des letzten Sonnenlichtes spiegelte sich in den Fenstern. Unter dem dunklen Strohdach erschien jede Scheibe wie ein Rechteck aus Flammen, zu gleichmäßig, um ein Feuer zu sein, aber doch so hell, dass ich zu spüren meinte, wie meine Handflächen vor Hitze prickelten. Mir lief ein Schauder durch alle Gliedmaßen, als hätte ich das alles schon einmal im Traum gesehen.
Ich umklammerte den schäbigen Sack auf meinem Schoß und wandte den Blick ab. Hinter uns lag der Sumpf unter der versinkenden Sonne, flach und endlos; grün mit bronzeroten und braunen Flecken, glitzernd vor Wasser. Ich roch nasses Gras und die Wärme des Tages. Unter all der Feuchtigkeit lag ein widerlicher Modergeruch, und der riesige, sterbende Himmel über uns war blasser, als er hätte sein dürfen. Mir schmerzten die Augen, mein Körper war von der Feldarbeit gestern mit einer Landkarte stechender Kratzer überzogen. Ich hätte auch heute dort bei der Ernte helfen sollen, doch stattdessen rumpelten mein Vater und ich schweigend über die raue, matschige Straße. Wir hatten nicht miteinander geredet, seit wir uns vor der Morgendämmerung auf den Weg gemacht hatten, und es gab immer noch nichts zu sagen. Die Worte stiegen in mir auf, aber dann zerplatzten sie wie Gasblasen im Sumpf und hinterließen auf meiner Zunge einen schwachen Geschmack der Verwesung.
Als wir den letzten Abschnitt des Weges entlangholperten, wo er im hohen Gras vor dem Haus auslief, warf ich von der Seite einen verstohlenen Blick auf Vaters Gesicht. Die Bartstoppeln an seinem Kinn waren weiß gesprenkelt, und seine Augen saßen tiefer in ihren Höhlen als im letzten Frühjahr. Alle waren älter geworden, während ich krank war; als wäre ich aufgewacht und hätte festgestellt, dass ich jahrelang geschlafen hatte.
Wir hielten an. »Wir sind da.«
Ein Schauder durchfuhr mich: Entweder würde ich mich übergeben oder meinen Vater anflehen, mich wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich nahm den Sack auf meinem Schoß und sprang herunter. Die Knie gaben beinahe unter mir nach, als ich mit den Füßen auf dem Boden landete. Ein ausgetretener Pfad führte zwischen den Grasbüscheln hindurch zur Haustür. Ich war noch nie hier gewesen, aber das Scheppern der Glocke war mir so vertraut wie ein Traum. Ich wartete, war so entschlossen, nicht zu meinem Vater zurückzublicken, dass die Tür vor mir schimmerte und schwankte.
»Emmett.« Plötzlich war die Tür offen. Einen Augenblick lang sah ich nur zwei blassbraune Augen, so blass, dass die Pupillen erschreckend schwarz schienen. »Willkommen.«
Sie war alt – schmerzlich, skelettartig alt – und weißhaarig, ihr Gesicht war zerknittert wie Papier, ihre Lippen waren beinahe von der gleichen Farbe wie ihre Wangen; aber sie war so groß wie ich, und ihre Augen waren so klar wie Altas. Sie trug eine lederne Schürze und Hemd und Hose wie ein Mann. Die Hand, die mich hineinwinkte, war dünn, aber muskulös, die Venen schlängelten sich wie blaue Schnüre über die Sehnen.
»Seredith«, sagte sie. »Komm rein.«
Ich zögerte. Zwei Herzschläge, dann begriff ich, dass sie mir ihren Namen genannt hatte.
»Komm rein.« Während sie an mir vorbeischaute, sagte sie: »Danke, Robert.«
Ich hatte nicht gehört, wie mein Vater vom Wagen gestiegen war, aber als ich mich umdrehte, stand er neben mir. Er hustete und murmelte: »Wir kommen dich bald besuchen, Emmett, in Ordnung?«
»Pa …«
Er schaute nicht einmal in meine Richtung. Er warf der Binderin einen langen, hilflosen Blick zu; dann tippte er sich zum Gruß an die Stirn, als wüsste er nicht, was er sonst tun sollte, und ging mit großen Schritten zum Karren zurück. Ich wollte ihm etwas hinterherrufen, aber ein Windstoß nahm mir die Worte, und Vater drehte sich nicht um. Ich schaute ihm zu, wie er zu seinem Sitz hochkletterte und die Stute schnalzend antrieb.
»Emmett.« Die Stimme der Buchbinderin riss mich zu ihr zurück. »Komm rein.« Ich merkte, dass sie es nicht gewöhnt war, irgendwas dreimal sagen zu müssen.
»Ja.« Ich hielt den Sack mit meinen Habseligkeiten so fest umklammert, dass meine Finger schmerzten. Sie hatte meinen Vater Robert genannt, als würde sie ihn kennen. Ich machte einen Schritt und dann noch einen. Dann trat ich über die Schwelle und in einen dunkel getäfelten Flur, wo vor mir eine Treppe nach oben führte. Eine Standuhr tickte. Links befand sich eine halb geöffnete Tür, ich konnte einen Blick in die Küche dahinter werfen. Rechts führte eine weitere Tür in …
Die Knie gaben unter mir nach. Übelkeit breitete sich in mir aus. Ich fühlte mich fiebrig und fröstelte doch, kämpfte um mein Gleichgewicht, während die Welt sich um mich drehte. Ich war schon einmal hier gewesen – nur hatte ich nicht …
»Oh, verdammt«, sagte die Binderin und streckte die Hand aus, um mich festzuhalten. »Alles gut, mein Junge, atmen.«
»Es geht mir gut«, beteuerte ich.
Dann wurde alles schwarz um mich.
Als ich aufwachte, tanzte Sonnenlicht wie ein wogendes Netz an der Zimmerdecke, wie Wasserkräusel, die sich über das schmale Rechteck von Helligkeit breiteten, das zwischen den Vorhängen hereinsickerte. Die weißgetünchten Wände wirkten leicht grünlich wie das Fleisch eines Apfels. Draußen pfiff ein Vogel immer und immer wieder, als rufe er einen Namen.
Das Haus der Binderin. Ich setzte mich auf. Plötzlich pochte mein Herz erregt. Aber hier gab es nichts, vor dem man sich fürchten musste; hier war nichts außer mir, dem Zimmer und dem gespiegelten Sonnenschein. Ich merkte, dass ich auf Tierlaute lauschte, auf die ständige Rastlosigkeit eines Bauernhofs, aber ich hörte nur den Vogel und das leise Rascheln des Windes im Strohdach. Die verblassten Vorhänge bauschten sich auf, und ein breiteres Lichtband blitzte über die Decke. Die Kissen dufteten nach Lavendel.
Gestern Abend …
Ich ließ meine Augen auf der gegenüberliegenden Wand ruhen, folgte den Buckeln und Windungen eines Risses im Putz. Nachdem ich ohnmächtig geworden war, konnte ich mich an nichts außer Schatten und Angst erinnern. Alpträume. Im klaren Licht des Tages schienen sie längst vergangen; aber sie waren schlimm gewesen, hatten mich im Schlaf immer wieder in die Tiefe hinuntergerissen. Ein, zwei Mal hatte ich mich beinahe von ihnen losgekämpft, aber dann hatte mich das Gewicht meiner eigenen Gliedmaßen wieder nach unten gezogen, in eine erstickende tiefschwarze Blindheit. Ein schwacher Nachgeschmack von verbranntem Öl war mir im Rachen verblieben. So schlimm waren sie viele Tage lang nicht gewesen. Ein Windstoß verursachte mir Gänsehaut auf den Armen, und ich versuchte, meine Haut glattzustreichen. So in Ohnmacht zu fallen, in Serediths Arme … Es war wohl die Müdigkeit nach der Reise gewesen, der Kopfschmerz, die Sonne in den Augen und der Anblick meines Vaters, wie er ohne einen Blick zurückfuhr.
Meine Hose und mein Hemd hingen über der Rückenlehne des einzigen Stuhls. Ich stand auf und zerrte sie mir mit ungeschickten Fingern über, versuchte, mir nicht vorzustellen, wie Seredith mich ausgekleidet hatte. Zumindest hatte ich noch meine Unterhose an. Außer dem Stuhl und dem Bett war der Raum beinahe leer: eine Truhe am Fußende des Bettes, ein Tisch beim Fenster und die blassen, sich bauschenden Vorhänge. Es gab keine Bilder und keinen Spiegel. Das machte mir nichts aus. Zu Hause hatte ich weggeschaut, wenn ich im Flur an meinem Spiegelbild vorüberging. Hier war ich unsichtbar; hier konnte ich Teil der Leere sein.
Das ganze Haus war still. Als ich auf den Treppenabsatz hinaustrat, hörte ich die Vögel über den Sumpf hinweg singen, das Ticken der Uhr im Flur unten und ein dumpfes Hämmern von irgendwo; aber unter all dem lag eine Stille, die so abgrundtief war, dass alle Geräusche darüber hinwegschlitterten wie Kiesel über Eis. Die Brise strich mir über den Nacken, und ich ertappte mich dabei, wie ich über die Schulter schaute, als wäre da jemand. Das kahle Zimmer versank einen Augenblick lang in Düsternis, als eine Wolke über die Sonne wanderte; dann leuchtete es heller als zuvor, und die Ecke eines Vorhangs klatschte in der Brise wie eine Fahne.
Ich hätte mich beinahe umgedreht und wäre wieder ins Bett gegangen wie ein Kind. Aber ich lebte nun in diesem Haus. Ich konnte nicht den Rest meines Lebens in meinem Zimmer verbringen.
Die Treppe knarzte unter meinen Füßen. Jahrelanger Gebrauch hatte das Geländer glänzend poliert, aber im Sonnenlicht flirrte dicht der Staub, und der weißgetünchte Putz löste sich blasig von der Wand. Das Haus war älter als unser Bauernhaus, älter als unser Dorf. Wie viele Buchbinder hatten hier schon gelebt? Und wenn diese Binderin – Seredith – starb … würde dieses Haus dann eines Tages mir gehören? Ich ging langsam die Treppe hinunter, als hätte ich Angst, dass sie unter mir nachgeben würde.
Das Klopfen hörte auf, und ich hörte Schritte. Seredith öffnete eine der Türen zum Flur. »Ah, Emmett.« Sie fragte mich nicht, ob ich gut geschlafen hatte. »Komm in die Werkstatt.«
Ich folgte ihr. Irgendetwas daran, wie sie meinen Namen sagte, ließ mich die Zähne zusammenbeißen, aber sie war nun mein Lehrmeister – nein, meine Lehrmeisterin, nein, mein Lehrmeister –, und ich hatte ihr zu gehorchen.
An der Tür zur Werkstatt hielt sie inne. Einen Augenblick lang dachte ich, sie wolle mir den Vortritt lassen, aber dann ging sie mit großen Schritten quer durch das Zimmer und wickelte rasch etwas in ein Tuch, ehe ich sehen konnte, was es war. »Komm rein, mein Junge.«
Ich trat über die Türschwelle. Es war ein langer, niedriger Raum, erfüllt vom Morgenlicht, das durch eine Reihe hoher Fenster hereinströmte. Werkbänke verliefen auf beiden Seiten des Raumes, und dazwischen befanden sich andere Dinge, die ich noch nicht benennen konnte. Ich nahm den ermatteten Glanz alten Holzes wahr, das scharfe Schimmern einer Klinge, Metallgriffe, die dunkel vom Schmierfett waren … aber es gab zu viel zu sehen, und meine Augen konnten nicht lange auf einzelnen Dingen verweilen. Am hinteren Ende des Raumes stand ein Ofen, der mit Kacheln in Rostrot, Ocker und Grün umgeben war. Über meinem Kopf hingen Papiere über einen Draht gebreitet, in satten Farben, dazwischen immer wieder Blätter, die wie Stein, Federn oder Laub gemustert waren. Ich ertappte mich dabei, wie ich die Hand nach dem ausstreckte, das am nächsten hing: Irgendwas war an diesen strahlend eisvogelblauen Flügen, die da über mir hingen …
Die Binderin legte ihr Bündel ab und kam auf mich zu, deutete dabei auf verschiedene Dinge. »Blockpresse. Beschneidepresse. Veredelungspresse. Planschrank – hinter dir, Junge –, Werkzeuge in dem Schrank da drüben und in dem daneben, Leder und Tuch im nächsten. Makulatur kommt in diesen Korb, fertig zur Wiederverwertung. Pinsel gehören auf dieses Brett, Leim da hinein.«
Ich konnte gar nicht alles aufnehmen. Nach dem ersten Versuch, mir alles zu merken, gab ich auf und wartete nur darauf, dass sie aufhörte. Schließlich sah sie mich mit zusammengekniffenen Augen an und sagte: »Setz dich.«
Ich fühlte mich seltsam. Mir war nicht eigentlich übel, und Angst hatte ich auch nicht. Es war, als wachte etwas in mir auf und bewegte sich. Die Wirbel der Maserung im Holz der Werkbank vor mir kamen mir vor wie die Landkarte eines Ortes, den ich einmal gekannt habe.
»Es ist ein komisches Gefühl, nicht wahr, mein Junge?«
»Was?«
Sie blinzelte mich an, die Sonne hatte auf dieser Seite ihres Gesichts eines ihrer braunen Augen beinahe weiß gebleicht. »Es packt einen, all das hier. Wenn du der geborene Buchbinder bist – und das bist du, mein Junge.«
Ich wusste nicht, was sie meinte. Zumindest … Irgendwas an diesem Raum war einfach richtig, ließ mein Herz – völlig unerwartet – höherschlagen. Als könnte ich nach einer Hitzewelle den kommenden Regen fühlen – oder als könnte ich einen Blick auf mein früheres Ich, das Ich vor meiner Krankheit, erhaschen. Ich hatte so lange nirgendwo mehr hingehört, und nun hieß mich dieser Raum mit seinem Duft nach Leder und Leim willkommen.
»Du weißt nicht viel über Bücher, oder?«, fragte Seredith.
»Nein.«
»Glaubst du, dass ich eine Hexe bin?«
Ich stammelte: »Was? Natürlich … nein …« Aber sie brachte mich mit einer Handbewegung zum Schweigen, während ihr ein Lächeln um die Mundwinkel spielte.
»Schon in Ordnung. Meinst du, ich bin so alt geworden, ohne zu wissen, wie die Leute über mich reden? Über uns.« Ich wandte den Blick ab, aber sie fuhr fort, als hätte sie es nicht bemerkt. »Deine Eltern haben Bücher von dir ferngehalten, nicht wahr? Und jetzt weißt du nicht, was du hier sollst.«
»Du hast nach mir gefragt. Das stimmt doch?«
Sie schien mich nicht zu hören. »Mach dir keine Sorgen, Junge. Es ist ein Handwerk wie jedes andere. Und dazu noch ein gutes. Das Binden ist so alt wie das Alphabet – älter sogar. Die Leute verstehen es nicht, aber wieso sollten sie auch?« Sie verzog das Gesicht. »Zumindest ist der Kreuzzug vorbei. Du bist zu jung, um dich daran zu erinnern. Dein Glück.«
Es herrschte Schweigen. Ich verstand nicht, wie das Binden älter sein konnte als die Bücher, aber sie starrte in die Ferne, als wäre ich nicht da. Eine Brise brachte den Draht über mir zum Schwingen, und die bunten Papiere flatterten. Seredith zwinkerte, kratzte sich am Kinn, ihre Augen kehrten zu mir zurück. »Morgen fängst du mit ein paar Arbeiten an. Aufräumen, Pinsel auswaschen, solche Sachen. Vielleicht kannst du auch schon Leder schärfen.«
Ich nickte. Ich wollte hier allein sein. Ich wollte Zeit haben, die Farben richtig anzuschauen, die Schränke durchzusehen und das Gewicht der Werkzeuge in meiner Hand zu prüfen. Der ganze Raum sang für mich, lud mich ein.
»Schau dich um, wenn du möchtest.« Aber als ich aufstehen wollte, machte sie eine unwillige Geste, als hätte ich ihr nicht gehorcht. »Nicht jetzt. Später.« Sie nahm ihr Bündel auf und wandte sich zu einer kleinen Tür in der Ecke, die ich bisher nicht bemerkt hatte. Es waren drei Schlüssel in drei Schlössern nötig, um sie zu öffnen. Ich erhaschte einen Blick auf eine Treppe, die nach unten ins Dunkel führte, ehe Seredith das Bündel auf ein Brett gleich bei der Tür legte, sich wieder zur Werkstatt wandte und die Tür hinter sich zuzog. Sie schloss ab, ohne mich anzuschauen, schirmte die Schlüssel mit ihrem Körper vor mir ab. »Da hinunter gehst du noch lange nicht, mein Junge.« Ich wusste nicht, ob sie mich damit warnen oder beruhigen wollte. »Rühre nichts an, was abgeschlossen ist, dann wird alles gut.«
Ich holte tief Luft. Der Raum sang immer noch für mich, aber in die süße Melodie hatte sich eine schrille Note gemischt. Unter dieser ordentlichen, sonnendurchfluteten Werkstatt führte eine steile Treppe in die Dunkelheit. Ich konnte die hohle Leere unter meinen Füßen spüren, als begänne der Boden unter mir nachzugeben. Vor einer Sekunde hatte ich mich noch sicher gefühlt. Nein. Ich hatte mich … verzaubert gefühlt. All das war durch diesen kurzen Blick auf die Dunkelheit verdorben; wie in dem Augenblick, wenn ein Traum sich in einen Alptraum verwandelt.
»Kämpfe nicht dagegen an, Junge.«
Sie wusste es also. Es war wirklich, ich bildete mir das nicht nur ein. Ich hob die Augen, halb fürchtete ich mich, ihren Blick zu erwidern; aber sie starrte über den Sumpf, hatte die Augen gegen das blendende Licht zusammengekniffen. Sie sah älter aus als irgendwer, den ich je gesehen hatte.
Ich stand auf. Die Sonne stand immer noch am Himmel, aber nun schien das Licht im Raum beschmutzt. Ich wollte nicht mehr in die Schränke schauen oder die Stoffballen ans Licht ziehen. Aber ich zwang mich, an den Schränken vorbeizugehen, die Schilder wahrzunehmen, die matten Messingknäufe und das Leder, das um die Kante einer Tür eine grüne Zunge herausstreckte. Ich machte kehrt und ging durch den Gang zwischen den Werkbänken, wo der Boden glattgetreten war von den Schritten vieler Jahre, von Menschen, die kamen und gingen.
Ich gelangte zu einer weiteren Tür. Auch sie hatte drei Schlösser. Aber hier gingen Menschen ein und aus – das konnte ich an den Bodendielen erkennen, an dem gut ausgetretenen Pfad, auf dem eine leichtere Staubschicht lag. Warum kamen die Leute her? Was tat die Buchbinderin hinter dieser Tür?
Schwärze glitzerte in meinen Augenwinkeln. Jemand flüsterte mir wortlos etwas zu.
»Gut«, sagte sie. Irgendwie war sie neben mir aufgetaucht, zog mich auf einen Schemel. »Nimm den Kopf zwischen die Knie.«
»Ich … kann nicht …«
»Ruhig, Junge. Es ist die Krankheit. Das geht vorüber.«
Es war Wirklichkeit. Da war ich mir sicher. Etwas Wildes, Unersättliches, Falsches, das mich aussaugen, mich zu etwas anderem machen wollte. Sie zwang mich jedoch, den Kopf zwischen die Knie zu nehmen, und hielt mich fest, und die Gewissheit schwand. Ich war krank. Es war dieselbe Furcht, die mich dazu gebracht hatte, meinen Vater und meine Mutter anzugreifen … Ich biss die Zähne zusammen. Ich durfte dem nicht nachgeben. Wenn ich mich gehenließ …
»So ist’s gut. Braver Junge.«
Bedeutungslose beschwichtigende Worte, als wäre ich ein Tier. Endlich richtete ich mich auf und verzog das Gesicht, als mir das Blut durch den Kopf wirbelte.
»Besser?«
Ich nickte und kämpfte gegen die Übelkeit an. Meine Hände zuckten, als hätte ich eine Schüttellähmung. Ich ballte sie zu Fäusten und stellte mir vor, wie ich mit Fingern, denen ich nicht vertrauen konnte, ein Messer benutzen sollte. Ich würde mir den Daumen abschneiden. Ich war zu krank, um hier zu sein – und doch …
»Warum?«, fragte ich; das Wort klang wie ein Jaulen. »Warum hast du mich ausgewählt? Warum mich?«
Die Buchbinderin wandte ihr Gesicht wieder zum Fenster und starrte ins Sonnenlicht.
»War es, weil ich dir leidgetan habe? Der arme, verrückte Emmett, der nicht mehr auf dem Feld arbeiten kann? Zumindest ist er hier in Sicherheit und allein und verstört seine Familie nicht …«
»Glaubst du das?«
»Was sonst könnte es sein? Du kennst mich nicht. Warum sonst würdest du dir jemanden aussuchen, der krank ist?«
»Was sonst, allerdings.« Ihre Stimme hatte einen scharfen Ton, aber dann seufzte sie und schaute mich an. »Erinnerst du dich, wann es angefangen hat? Das Fieber?«
»Ich glaube, ich war …« Ich holte tief Luft, versuchte, meine Gedanken zu beruhigen. »Ich war in Castleford gewesen und auf dem Heimweg – und als ich aufwachte, war ich zu Hause …« Ich unterbrach mich. Ich wollte nicht über die Lücken und Alpträume nachdenken, die Ängste bei Tag, die plötzlichen, entsetzten Augenblicke der Klarheit, in denen ich wusste, wo ich war … Der ganze Sommer war zerfetzt, vom Fieber zerrissen, bestand aus mehr Lücken als Erinnerungen.
»Du warst hier, mein Junge. Hier bist du krank geworden. Dein Vater ist dich holen gekommen. Erinnerst du dich daran?«
»Was? Nein. Was habe ich hier gemacht?«
»Das Haus liegt an der Straße nach Castleford«, sagte sie mit einem leisen Lächeln. »Aber mit dem Fieber … du erinnerst dich daran und dann wieder nicht. Das ist teilweise das, was dich krank macht.«
»Ich kann nicht hierbleiben. Dieses Haus – diese verschlossenen Türen. Hier wird es mir nur schlechter gehen.«
»Das vergeht. Vertraue mir. Und es wird hier schneller vergehen als an jedem anderen Ort.« Es lag ein seltsamer Ton in ihrer Stimme, als schämte sie sich beinahe.
Eine neue Angst zerrte an mir. Ich müsste hier bleiben und mich fürchten, bis es mir besser ging; ich wollte das nicht, ich wollte weglaufen …
Sie schaute auf die verschlossene Tür. »In gewisser Weise«, fuhr sie fort, »denke ich, dass ich dich ausgewählt habe, weil du krank bist. Aber nicht so, wie du denkst. Nicht aus Mitleid, Emmett.«
Unvermittelt drehte sie sich um, drängte sich an mir vorbei, und ich stand da und starrte auf den Staub, der in der leeren Türöffnung wirbelte.
Sie log. Das hatte ich an ihrer Stimme gehört.
Sie bemitleidete mich doch.
Vielleicht jedoch hatte sie recht. Irgendetwas an der Stille des alten Hauses, an den niedrigen Räumen, die vom beständigen Herbstsonnenlicht erfüllt waren, an der ruhigen Ordnung der Werkstatt begann, die Ängste in mir aufzulösen. Tag für Tag verging, bis das Haus mir nicht mehr neu oder seltsam vorkam; dann Woche um Woche … Ich lernte einiges auswendig: die gekräuselten Spiegelungen an meiner Zimmerdecke, die aufklaffenden Säume an der Decke auf meinem Bett, die unterschiedlichen Knarzer jeder Stufe unter meinen Füßen, wenn ich nach unten ging. Dann waren da die Werkstatt, das Schimmern der Kacheln am Ofen, der erdige Safranduft des Tees, der milchige Schimmer einer gut gemischten Paste in einem Glastopf … Die Stunden vergingen langsam, voller kleiner, verlässlicher Einzelheiten; zu Hause hatte ich in der Geschäftigkeit des Lebens auf dem Bauernhof nie Zeit gehabt, einfach dazusitzen und vor mich hinzustarren oder meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie ein Werkzeug aussah oder wie gut es gemacht war, ehe ich es benutzte.
Die Arbeiten, die mir Seredith in der Werkstatt übertrug, waren einfach. Sie war eine gute Lehrerin, klar und geduldig. Ich lernte Vorsatzpapiere machen, Leder schärfen, mit Blindprägung oder Goldprägung veredeln. Sie muss enttäuscht gewesen sein, wie ungeschickt ich mich anstellte – wie ich eine Seite an die eigenen Finger leimte oder mit einem scharfen Prägestempel eine tiefe Scharte in ein makelloses Stück Kalbsleder machte –, aber sie sagte nichts, nur gelegentlich: »Wirf es weg und fang neu an.« Während ich übte, ging sie spazieren oder schrieb Briefe oder Listen von Vorräten, die wir mit der nächsten Post bestellen sollten, während sie hinter mir an der Werkbank saß; oder sie kochte, und das Haus wurde erfüllt vom Duft nach Fleisch und Teig. Wir teilten uns alle anderen Aufgaben, aber nach einem Morgen, den ich mit tüfteligen Arbeiten verbracht hatte, war ich froh, Holz zu hacken oder den großen Waschzuber zu füllen. Wenn ich mich schwach fühlte, erinnerte ich mich daran, dass Seredith das alles, ehe ich kam, allein bewerkstelligt hatte.
Doch alles, was ich tat – alles, wobei ich ihr zusah –, hatte mit der Vorbereitung von Material oder mit dem Üben für die letzte Veredelung der Bücher zu tun. Nie bekam ich einen Buchblock oder gar ein fertiges Buch zu Gesicht. Eines Abends, als wir in der Küche aßen, fragte ich: »Seredith, wo sind die Bücher?«
»Im Gewölbe«, antwortete sie. »Sobald sie fertig sind, müssen sie an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.«
»Aber …« Ich hielt inne, dachte an den Bauernhof und daran, wie schwer wir dort alle schufteten und wie es doch nie reichte; ständig hatte ich mit Vater gestritten und ihn gebeten, all die neuen Erfindungen anzuschaffen, die unseren Hof so ertragreich wie möglich machen sollten. »Warum machen wir nicht mehr Bücher? Sicher können wir doch umso mehr verkaufen, je mehr wir machen?«
Sie hob den Kopf, als wollte sie darauf mit Schärfe erwidern; dann schüttelte sie den Kopf. »Wir machen die Bücher nicht, um sie zu verkaufen, mein Junge. Bücher verkaufen, das ist falsch. Zumindest darin hatten deine Eltern recht.«
»Dann … verstehe ich nicht …«
»Auf das Binden kommt es an. Das Handwerk, die Würde. Wenn zum Beispiel eine Frau zu mir kommt und ein Buch möchte. Dann mache ich ein Buch für sie. Für sie, verstehst du? Nicht, damit Wildfremde es anglotzen.« Sie schlürfte Suppe von ihrem Löffel. »Es gibt Buchbinder, die nur an ihren Gewinn denken, denen außer ihrem Konto bei der Bank alles gleichgültig ist, die, ja, die Bücher verkaufen – aber einer von denen wirst du nie sein.«
»Aber – bisher ist niemand zu dir gekommen …« Ich starrte sie an, gründlich verwirrt. »Wann setze ich endlich all das um, was du mir beibringst? Ich lerne so viel, aber ich habe noch nicht einmal …«
»Du lernst schon bald mehr«, antwortete sie und stand auf, um noch Brot zu holen. »Wir wollen die Sache langsam angehen, Emmett. Du bist krank gewesen. Alles zu seiner Zeit.«
Alles zu seiner Zeit. Hätte das meine Mutter gesagt, so hätte ich unwillig geschnaubt; aber ich schwieg, denn irgendwie hatte mir die Zeit hier gutgetan. Allmählich ließen die Alpträume nach, und die Schatten, die tagsüber lauerten, zogen sich zurück. Manchmal konnte ich lange stehen, ohne dass mir schwindelig wurde; manchmal waren meine Augen so klar wie früher. Nach ein paar Wochen wanderte mein Blick nicht einmal mehr zu den verschlossenen Türen am anderen Ende der Werkstatt. Die Werkbänke, Werkzeuge und Pressen murmelten mir tröstende Worte zu: Alles war nützlich, alles am rechten Platz. Es war gleichgültig, wozu alles diente, außer dass ein Leimpinsel für Leim war, das Schärfmesser fürs Schärfen. Manchmal, wenn ich innehielt, um die Dicke eines Lederstücks zu überprüfen – an manchen Stellen musste es dünner sein als ein Fingernagel, sonst würde es sich nicht gut falten lassen –, schaute ich vom dunklen Lederstaub auf und spürte, dass ich am rechten Ort war. Ich wusste, was ich zu tun hatte, und ich tat es – auch wenn ich vorerst nur übte. Ich konnte es schaffen. Das war seit meiner Krankheit nicht mehr vorgekommen.
Natürlich vermisste ich mein Zuhause. Ich schrieb Briefe und