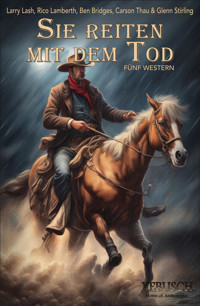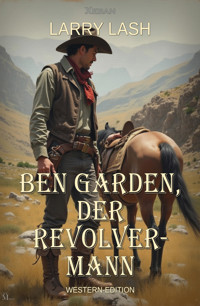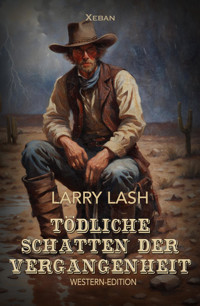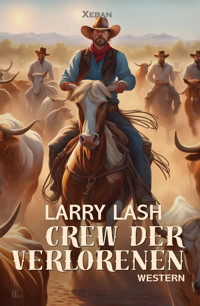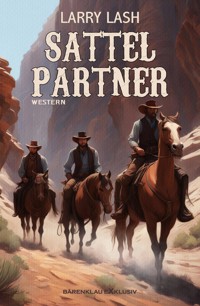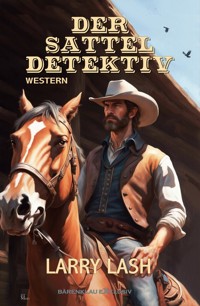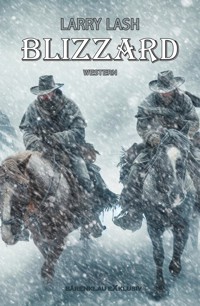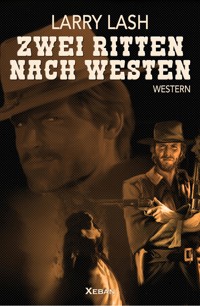3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt erstarrt in Angst, während Rancher einen hoffnungslosen Kampf führen. Männer fallen durch heimtückische Kugeln, und Rinder werden von den Weiden getrieben.
Maskierte Reiter terrorisieren das Land!
Da taucht Steve Shore auf, der Revolvermann aus Texas. Der Mann, der für harte Dollars seinen Colt vermietet; der Mann, der plötzlich weiß, auf wessen Seite er stehen muss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Larry Lash
Die
Verschwörer
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang;
[email protected] / www.xebanverlag.de
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by XEBAN-Verlag mit einem Motiv von Steve Mayer und eedebee (KI), 2025
Korrektorat: Peter Friedel
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Verschwörer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Eine Stadt erstarrt in Angst, während Rancher einen hoffnungslosen Kampf führen. Männer fallen durch heimtückische Kugeln, und Rinder werden von den Weiden getrieben.
Maskierte Reiter terrorisieren das Land!
Da taucht Steve Shore auf, der Revolvermann aus Texas. Der Mann, der für harte Dollars seinen Colt vermietet; der Mann, der plötzlich weiß, auf wessen Seite er stehen muss …
***
Die Verschwörer
Western von Larry Lash
1. Kapitel
»Steh auf, Red!«
Der Mann bückte sich und blickte in das Gesicht des Schläfers, aber er wagte es nicht, ihn wachzurütteln.
»Dein Freund ist da, dein Freund aus Texas!« Red Como ließ ein unwilliges Knurren hören, dann schlug er, noch immer schlaftrunken, nach dem Sprecher, sodass dieser zur Seite sprang.
»Red ist betrunken«, sagte eine tiefe Stimme von der Tür des Sheriff-Office her. »Und so bekommen Sie ihn nie wach.«
»Wem sagen Sie das, Stranger«, erwiderte Percy Skelton, der Hilfssheriff, böse. »Wer den Sheriff wecken will, begibt sich in Lebensgefahr. By Gosh, es wird immer schlimmer mit ihm, und wenn er getrunken hat, kann nicht einmal der Teufel mit ihm auskommen. – He, Stranger, was haben Sie vor?«
Die Augen des Hilfssheriffs richteten sich auf den Texaner. Er musterte den Fremden genauer, der etwa dreißig Jahre alt war, schlank und athletisch gebaut, mit schmalem, braungebranntem Gesicht, in dem dunkelblaue Augen leuchteten. Der Stoppelbart und die staubige Kleidung verrieten, dass der Mann lange unterwegs gewesen sein musste. Trotzdem machte er nicht den Eindruck eines Satteltramps und Langreiters.
Steve Shore, der Texaner, hatte wie ein Cowboy Lasso-Narben an den Händen. Er hob sich vorteilhaft von seinem Freund, dem Sheriff Red Como, ab, der im Alkoholrausch laut schnarchte. Como lag auf einem Lager, das schmuddelig war wie er selbst. Red Como war nicht mehr der Mann, der er früher gewesen war. Er musste irgendeinen Kummer mit sich herumschleppen und war wohl aus diesem Grand dem Alkohol verfallen. Die Stadt lachte bereits über ihn, und Red Como wusste es. In wenigen Monaten war er ein Schatten seiner selbst geworden, ein menschliches Wrack. Das war umso erstaunlicher bei einem Mann, der noch jung war und als tapferer und unerschrockener Kämpfer galt. In der Stadt Denable hatte er hohes Ansehen genossen.
Red Como war breitschultrig und von großer Gestalt, ein Mann, der über enorme Kräfte verfügen musste. Beherrschung jedoch war etwas, was Hilfssheriff Percy Skelton bei seinem Vorgesetzten noch nicht gesehen hatte. Der Umgang mit Como war sehr schwierig, vor allem dann, wenn Como getrunken hatte. Er war dann unausstehlich, und man wusste nie, wie er reagieren würde. Zu der Zeit, als er sich nur gelegentlich betrank, hatte er sich hinterher immer zu entschuldigen gewusst, doch das war jetzt vorbei. Como war zum Tyrannen geworden, und das konnte niemand besser beurteilen als Skelton.
Percy Skelton hatte oft das Verlangen, seine Stellung als Hilfssheriff aufzugeben und sich einen ruhigeren Job zu suchen, doch dann dachte er an seine Frau und seine vielen Kinder. Seine Frau predigte ihm immer wieder, auszuhalten und es durchzustehen. In seinem Alter würde ein Leben als Weidereiter nicht mehr angenehm sein. Oft hatte sich Skelton schon gesagt, dass er viel versäumt hatte, weil er in der Jugend nichts Ordentliches lernte. Er war Cowboy geworden und hatte hart gearbeitet. Doch eines Tages hatte er feststellen müssen, dass er zum alten Eisen gehörte. Er hatte auch zu spät geheiratet und musste für eine Familie sorgen, als gleichaltrige Männer bereits erwachsene Söhne besaßen. Das Leben hatte ihn eine Menge gelehrt. Er wusste, dass es in der Welt nicht immer richtig zuging und dass selbst feste Gesetze dehnbar waren. Er hatte sich auf seine Art angepasst, hatte ein ausgeprägtes Gefühl für Schwierigkeiten und wusste, wann es Zeit zum Aufgeben war. Percy Skelton hatte auch eingesehen, dass er nicht der Mann war, um Red Como beeinflussen oder gar ändern zu können.
»Tun Sie es nicht!«, flehte Skelton jetzt den Texaner Shore an, als er sah, dass dieser mit einem Kübel voll Wasser herbeikam. Im gleichen Augenblick, als er seine Warnung aussprach, erkannte er jedoch, dass Steve Shore sich nicht von seinem Vorhaben würde abbringen lassen. Es verschlug Skelton den Atem, und er versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Er hatte seine Erfahrungen mit Red Como und machte, dass er ins Freie kam. Als das Wasser auf Red Como platschte, war Skelton bereits an der Tür und kurz darauf draußen auf der Veranda.
Der Rappwallach des Texaners war draußen angebunden. Es war ein Vollblut, ein herrliches Tier, das jeden Pferdekenner begeistern musste.
Percy Skelton kam nicht dazu, das Pferd zu bewundern. Ein wilder, wütender Schrei wurde im Office laut. Unwillkürlich schloss Skelton die Augen. Seine Lippen pressten sich zusammen, und seine Hände krallten sich um das Geländer der Veranda.
»Jetzt geht der Tanz los!«, murmelte er.
Poltern, Stöhnen und Schreie, Keuchen und Stampfen verrieten, dass es im Büro zum Kampf gekommen war. Porzellan zerschellte, und dann klirrte eine Fensterscheibe. Passanten kamen neugierig heran. In den Gesichtern der Leute sah Skelton die Schadenfreude und Gefallen daran, Sensationen aus sicherer Entfernung mitzuerleben. Jede Abwechslung war den Leuten in ihrem langweiligen Dasein recht. Aber keiner war gewillt, sich einzumischen.
»Sie halten mich für einen alten, verbrauchten Mann«, murmelte Skelton vor sich hin. »Sie haben nicht einmal unrecht. Für kein Geld der Welt würde ich mich in den Kampf im Office einmischen. Gleich wer auf der Strecke bleibt. – Dabei sind die beiden Freunde!«
Skelton sah auf die Zuschauermenge, die sich schnell vergrößerte. Die halbe Stadt schien sich versammelt zu haben. Nicht nur Männer waren gekommen, auch Frauen und Kinder waren dabei. Vor allem fielen dem Hilfssheriff die Leute von Tom Coony auf, die sich im Hintergrund hielten, aber die meiste Freude an dem Geschehen zu haben schienen. Sieben Kerle waren es, raue Burschen, die ihre Colts tief geschnallt trugen.
»Es hat sich also doch jemand gefunden, der den Sheriff einmal verprügelt!«, rief einer der Kerle Percy Skelton zu. »Schade, dass wir nur den Krach hören und wenig zu sehen bekommen. Schieb den Sheriff auf die Straße, Percy, wir wollen ihn sehen!«
Er verstummte, denn in diesem Augenblick; krachte im Office ein Schuss, und danach wurde es still.
Red Como ist ein Teufel, dachte Percy Skelton. In seinem trunkenen Zustand schreckt er nicht einmal vor einem Mord an seinem Freund zurück. Jetzt muss ich doch nachsehen. Mir scheint, dass Como zu weit ging.
Skelton gab sich einen Ruck. Er warf noch einen Blick auf die sieben Kerle, die jetzt noch stärker grinsten, und wandte sich dann um. Die Stille nach dem Schuss schien auch die übrigen Gaffer erschreckt zu haben.
Voller Gram dachte Skelton daran, dass er jetzt einen Toten im Office finden würde. Er malte sich aus, den Texaner tot am Boden zu sehen und davor seinen Sheriff, der jetzt ernüchtert war.
Ungewollt weitete sich Skeltons Brust. Ja, das war seine Stunde, auf die er lange gewartet hatte. Endlich würde er Como sagen können, was er wirklich von ihm hielt. Endlich würde sich sein lang aufgestauter Zorn entladen können. Widerstandslos würde sich Como fesseln lassen. Er würde Como den Stern vom Westenaufschlag reißen. Skelton würde die Freude haben, einem völlig gebrochenen Mann gegenüberzustehen, der alles widerstandslos über sich ergehen lassen würde. By Gosh, davon hatte Percy Skelton immer geträumt, einmal über Como triumphieren zu können und aller Welt zu zeigen, was er selbst für ein Kerl war. Alle sollten staunen und zu der Erkenntnis kommen, dass sie ihn falsch eingeschätzt hatten, dass er nicht der Versager war, für den sie ihn hielten. Er genoss es, dass sich alle Augen an ihm festsaugten, als er seine Hand auf die Klinke legte und sie niederdrückte. Er riss die Tür auf und erstarrte. Seine Augen weiteten sich. Hölle und Teufel, es gab keinen Toten. Und schon gar nicht einen Sheriff, der völlig gebrochen war.
»Komm herein und mach die Tür hinter dir zu!«, forderte Red Como ihn auf. »Es zieht!«
»Wohin hast du den Fremden geschafft?« Die eigene Stimme klang Skelton fremd in den Ohren. Sein Herz klopfte, und er war erstaunt darüber, dass es ihm gelang, diese Worte überhaupt herauszubringen.
»Es war kein Fremder hier«, sagte Como und betrachtete Skelton wie einen, der um den Verstand gekommen war. »Du hast doch nicht etwa getrunken, Percy? Deine Frau würde dir das übelnehmen. Von dem bisschen Geld, das du für deinen Dienst bekommst, kannst du keinen Brandy kaufen.«
Offener Hohn war aus Red Comos Stimme zu hören.
»Mach keine faulen Witze, Red! Wo hast du die Leiche hingeschafft?«
Skelton sah sich suchend im zerschlagenen Office um. Es gab kein Möbelstück, das heil geblieben war oder noch an seinem alten Platz stand.
»Freund«, hörte er in diesem Augenblick die Stimme des Texaners aus der kleinen Küche, »ich braue dem Sheriff gerade einen guten Kaffee. Fangen Sie nicht an aufzuräumen, sondern gehen Sie gleich zu Dinah Right und bitten Sie sie, sofort hierherzukommen.«
Percy Skelton schluckte schwer. Er glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen und einer Sinnestäuschung zu erliegen, doch der Texaner trat in diesem Augenblick in die Verbindungstür zur Küche. Er zeigte so wenig Kampfspuren wie Como, nur seine Kleidung war in Unordnung geraten.
Der Texaner lächelte. Red Como betastete seinen Kopf und klagte: »Habe ich Kopfschmerzen, Steve! Damned, dieser schlechte Brandy hat mich eine Woche lang betrunken gehalten! Hab Erbarmen und lass Dinah später kommen!«
»Tut mir leid, Red«, widersprach der Texaner. »Ich will wissen, warum sie sich nicht mehr um dich kümmert. Du musst ihr sehr zugesetzt haben, Red. Sie soll kommen und dich so sehen.«
»Du bist ein Teufel, Steve! Ich sage dir aber jetzt schon, dass sie ablehnt und nicht kommen wird. Wollen wir wetten?«
»Nicht wenn Percy Skelton ihr sagt, dass ich hier bin. Also los, gehen Sie, Skelton, holen Sie Dinah Right!«
»Ja, ich mache mich auf den Weg«, stammelte Skelton verwirrt. Mit einem nervösen Augenzwinkern ging er nach draußen.
»Trink!«, forderte Steve Shore seinen Freund auf und schob ihm die Tasse zu. »Es wird dir guttun und den Brandyteufel verjagen.«
Red Comos rotgeränderte Augen richteten sich auf den Freund. Schwerfällig griff er nach der Tasse. Seine Hand zitterte dabei. Steve tat so, als sehe er es nicht.
»Ich weiß, was du jetzt denkst«, knurrte Red. »Du stellst fest, dass das nicht mehr der alte Red ist, dass ich ein Säufer geworden bin, dem die Hand zittert. Du denkst, dass ich kein Recht mehr habe, den Sheriffposten auszuüben. Ist es so?«
Steve gab keine Antwort. Er füllte seine Tasse mit der gelassenen Ruhe eines Mannes, den nichts erschüttern kann.
»Du nimmst an, dass ich nur noch eine halbe Portion bin, nicht wahr?«, fuhr Red Como fort, als er keine Antwort bekam. »Es ist wahr, Steve, mit mir ist nichts mehr los. Steh auf und schau aus dem Fenster. Die neugierigen Gesichter draußen werden es dir bestätigen. Ich bin ein Versager. Du hättest nicht nach hier kommen sollen. Was ließ dich nur in dieses schmutzige Rindernest reiten? Sag nur nicht, dass eine Ahnung dich trieb. Ich würde es dir nicht abnehmen.«
»So ist es wahrhaftig nicht, Red.«
»Du gibst also zu, dass du nicht die Absicht hast, mir etwas vorzulügen. Das erinnert mich an die alten Tage und daran, dass noch etwas zwischen uns steht. Du willst nicht einmal aus dem Fenster schauen?«
»Ich habe kein Verlangen danach, Red.«
»Mein Hilfssheriff hätte es ausgekostet, Steve. Für ihn ist es eine große Freude zu sehen, dass ich unfähig bin. – Damned, ich hätte alles hinwerfen sollen, aber ich konnte es nicht.«
Er ergriff die Tasse und trank sie leer. Dann setzte er sie auf den Tisch zurück und tastete über den Sheriffstern. »Es ist nur ein Blechstern«, fuhr er fort, »aber dennoch zentnerschwer. – Wenn ich nur nicht diese verteufelten Kopfschmerzen hätte!« Er rieb sich die Stirn, doch das schien ihm keine Erleichterung zu bringen. »Ich rede immer nur von mir, Steve. Was trieb dich hierher?«
»Man hat mich hergebeten, Red. Den Brief trage ich in der Tasche.«
»Also das ist es! Ich habe mir schon so etwas gedacht. Dinah hat dir geschrieben. Sie war es also. Wie kommt sie nur dazu?«
»Es war nicht Dinah, Red!«
»Nicht?«, stieß Red Como verwundert aus. Er rieb sich die Augen und starrte Steve Shore an, als könne er überhaupt nichts mehr begreifen. »Dinah war es nicht? Ich nahm an, dass sie dich hergebeten hat, damit du einen besseren Menschen aus mir machen sollst. Im Vertrauen, schon seit Monaten weicht sie mir aus, Steve. Ich weiß nicht einmal, wie es ihr geht.«
»Das ist ziemlich übel, Red.«
»Gib dir keine Mühe, Steve. Manchmal denke ich, dass sie dich nicht vergessen kann und dass sie in diesem dreckigen Rindernest nur blieb, weil sie hoffte, dass du dich einmal hierher verirren könntest. – Sie hat dir wirklich nicht geschrieben, Steve?«
»Nein!«, kam es hart über Steve Shores Lippen. »Warum sollte sie auch einem Satteltramp schreiben? Warum sollte sie sich an einen Mann wenden, von dem sie weiß, dass er nie zur Ruhe kommen wird? In ihren Augen bin ich ein schäbiger Revolvermann, das wissen wir beide. Wir wissen auch, was sie von Revolverleuten hält. Nein, nicht Dinah schrieb mir. Das tat ein Mann namens Godfrey.«
»Fred Godfrey?«
»Genau der.«
»Der Großrancher und Geschäftsmann?«
Steve Shore zog einen Brief aus dem Innenfutter seiner Jacke und warf ihn auf den Tisch. »Lies selbst.«
»Nein«, lehnte Red Como ab. »Ich kenne Fred Godfrey, das genügt für mich. Der Mann glaubt, der Herrgott selbst zu sein.«
»Wirkt er auf dich wie ein rotes Tuch?«
»Und wenn es so ist?«
»Wir haben nicht immer die gleichen Ansichten, Red. Ich werde zu Godfrey reiten, ihn mir ansehen und mit ihm sprechen. Ich beabsichtige, in der Abenddämmerung zu reiten, und bis dahin hoffe ich, dein Gast sein zu können. Ich werde dafür sorgen, dass du dich wieder mit Dinah aussöhnst. – Was hast du gegen Fred Godfrey vorzubringen?«
»Nichts, noch nichts«, erwiderte Red und griff sich an die Stirn. »Ich kann den Kerl nicht ausstehen. Ich konnte ihn vom ersten Augenblick an nicht leiden. Außerdem versteht er sich zu gut mit einem gewissen Tom Coony.«
»Wer ist Tom Coony?«
»Ein Mann, der fast ganz Denable beherrscht und mir Vorschriften machen will«, antwortete Red. »Jetzt versucht er es allerdings nicht mehr. Ich habe ihm nachdrücklich zu verstehen gegeben, dass er sich in mein Amt nicht einzumischen hat.«
»Du hast dich mit ihm verfeindet?«
»So kann man es nennen«, gab Red ohne Zögern zu. »Es gehören ihm hier fast alle Saloons und Whiskybuden. Er hat eine Garde von sieben Kerlen um sich, die ihn ständig bewacht. Er glaubt sich verfolgt und ständig bedroht. Ich weiß auch warum. Seine dunklen Geschäfte lassen diese Möglichkeit zu. Ich habe ihm noch nichts nachweisen können, so sehr ich auch darauf aus war. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die ganze Stadt gegen mich verschworen hat. Ich nehme an, dass er immer wieder Hinweise über mein Tun bekommt, sodass er sich rechtzeitig vorsehen kann. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass ich zu trinken anfing. Meine Erfolglosigkeit raubt mir die Nerven. Ich bin nicht mehr der alte Red, ich bin ein Versager. Ich konnte diesen Coony nicht stellen und ihm nicht das geringste beweisen.«
Red Como erhob sich und ging in die Küche. Steve hörte Wasser platschen, und als Red zurückkam, troff sein Gesicht vor Nässe. Er nahm ein Handtuch und trocknete sich ab. Danach ergriff er einen Besen und begann zu fegen. Einer halbvollen Brandyflasche gab er einen Tritt. Sie rollte Steve Shore vor die Stiefelspitzen. Der hob sie auf, entkorkte sie und ließ den Inhalt einfach auf den Boden laufen.
»Ein gutes Desinfektionsmittel«, sagte er dabei.
»Was will Godfrey von dir, Steve?«, wollte Red wissen.
»Ist das so schwer herauszufinden?«
»Einen Revolvermann? Hölle, er hat doch eine harte Crew! Will er sie noch verstärken? Wenn das so ist, hat der Schuft irgendwelche dunklen Pläne. Er stellt eine unbesiegbare Crew zusammen, aber zu welchem Zweck? Das gefällt mir nicht, Steve. Willst du dich in dieses dunkle Spiel einlassen?«
»Ich will leben und mit dem Colt Geld verdienen.«
»Ich weiß«, erwiderte Red Como trocken.
»Bisher hast du dich immer so verhalten, dass du auf der Seite des Gesetzes geblieben bist. Man konnte dir nie etwas Ungesetzliches nachweisen. Wo aber stehst du wirklich? Bei einem Revolvermann ist die Trennungslinie zum Gesetz nur hauchdünn. Er kann in den Abgrund stürzen, bevor er richtig begriffen hat, wie es kommen konnte. Er wird dann zum Gejagten, und ein Steckbrief macht ihn zum Freiwild. Wie lange willst du dieses Leben noch führen, Steve?«
»Bis ich das Geld für eine eigene Ranch zusammen habe«, erwiderte Steve Shore. Er half Red Como, die Möbel wieder an ihren alten Platz zu stellen. »Godfrey erwartet mich.«
»Dann gib nur auf dich acht, Steve«, warnte Como. »Wenn er dich in der Zange hat, bist du gefangen. Du weißt doch: Mitgefangen, mitgehangen! Vielleicht stehen wir uns bald als Feinde gegenüber. Es würde mir leidtun, dich auf der anderen Seite zu sehen, Steve.«
»Wir standen schon einmal auf verschiedenen Seiten, ich auf der Seite des Südens und du …«
»Ich weiß«, winkte Red Como ab. »Wir hätten uns gegenseitig aus der Welt bringen können, doch wir taten es nicht. Im Gegenteil, schwerverwundet wie wir waren, haben wir den letzten Proviant und die letzte Zigarette miteinander geteilt.«
»Ich habe zudem noch einem toten Südstaatler die Uniform ausgezogen und sie dir angezogen, damit du in ein ordentliches Lazarett kamst und nicht in Gefangenschaft. Als dann später der Krieg für uns Südstaatler verlorenging, hast du mir geholfen. Ohne Dinah Right wären wir wohl zusammengeblieben und lebten irgendwo auf einer kleinen Ranch als Partner.«
»Wir haben uns beide etwas vorgemacht, Steve«, erwiderte Red Como grollend. »Jeder von uns hat geglaubt, dass er geliebt wird. Heute glaube ich, dass wir uns beide täuschten und dass Dinah in uns nur Freunde und Kameraden sah. Sie ist sehr selbstsicher und braucht keine Hilfe. Hier in Denable hat sie inzwischen einen gutgehenden Store und verdient weitaus mehr als ich.«
»Das ist wohl auch der Grund, warum du ihr keinen Heiratsantrag gemacht hast?«
»Was redest du da, Steve? Natürlich würde ich mich nicht von einer Frau ernähren lassen, das ginge gegen meine Einstellung. Nein, das ist es nicht. Dinah Right ist mir zu hellsichtig und zu intelligent. Als ich das wusste, bekam ich es einfach mit der Angst. Kannst du das begreifen, Steve? Es muss doch schrecklich sein, wenn man mit einer Frau verheiratet ist, der man nichts vormachen kann.«
»Ist das der zweite Grund, warum du zur Brandyflasche gegriffen hast, Red?«
Red Como starrte den Freund wütend an. »Denk, was du willst!«, fauchte er. »Du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit Dinah. Warum hast du ihr damals nicht einen Heiratsantrag gemacht und bist stattdessen davongeritten? Sie war sehr traurig, und es war nichts mit ihr anzufangen. Du Narr hast nichts mehr von dir hören lassen.«
»Jetzt bin ich da.«
»Ja, um für Godfrey zu reiten, für einen Sklavenhalter und Teufelskerl, der sich die ganze Welt erobern möchte. Du sollst auch wissen, dass Fred Godfrey hinter Dinah her ist. Es wäre besser für dich, wenn du nie hierhergekommen wärst.«
»Als ich den Brief bekam, Red, dachte ich an Dinah und dich, und da wusste ich plötzlich, dass ich euch Wiedersehen musste. Die Jahre vergehen sehr schnell, und man wird nicht jünger. Ich gebe zu, dass ich plötzlich Angst davor hatte, dass es kein Wiedersehen mehr geben könnte.«
»Wäre das so schlimm?«, fragte Red Como rau. »Man soll die Vergangenheit nicht heraufbeschwören. Was vorbei ist, das ist vorbei. Du und ich, wir sind nicht die alten geblieben. Schau mich nur an und sag mir die Wahrheit. Von dir will ich sie hören, und ich glaube, dass ich sie ertragen kann.«
»Glaubst du das wirklich?«, fragte Steve Shore mit einem leichten Unterton in der Stimme.
Red Comos Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Sein Blick wurde stechend, doch Steve hielt diesem Blick stand.
»Ich habe immer geglaubt, in dich hineinsehen zu können«, murmelte Red Como. »Jetzt weiß ich, dass ich das nicht kann. Hör zu, Steve, verschwinde, bevor Dinah kommt.«
»Ein schlechter Rat, den ich nicht befolgen werde, Red«, erwiderte Steve. »Sehen wir zu, dass wir unsere Arbeit beenden.«
Red Como antwortete nicht. Er warf Steve einen eigenartigen Blick zu und machte sich wieder an die Arbeit. Wenig später hatte der Raum ein wohnlicheres Aussehen.
Red Como zog ein frisches Hemd an, und als er gerade fertig war, betrat Hilfssheriff Percy Skelton das Office.
»Dinah Right kommt«, wandte er sich an Steve Shore. »Sie kann jeden Augenblick hier eintreffen.«
»Das ist gut so, Steve«, wandte sich Red an den Texaner. »Endlich wird dir jemand sagen, dass du mit deinem Kommen nicht gerade Freude bereitest.«
Red Como ging zum Schrank, öffnete ihn und langte nach einer vollen Whiskyflasche. Steve Shore war jedoch lautlos hinter ihn getreten, nahm ihm die Flasche aus der Hand und trat schnell einen Schritt zurück.
Red Como knurrte wütend: »Ich habe mächtigen Durst!«
»In der Küche ist noch Kaffee, Red!«
»Ich bin kein Kind mehr. Gib die Flasche her!«, forderte Red Como.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und Dinah Right trat ein. Mit ihrem Eintritt schien der Sonnenschein ins Office gekommen zu sein.
»Gib Red die Flasche nicht, Steve«, sagte sie mit einer melodischen Stimme. »Für ihn ist Alkohol Gift. Der Inhalt jeder Brandyflasche sollte sich in Wasser verwandeln, wenn Red ihn trinken will.«
By Gosh, es war nicht zu fassen! Das Mädchen war noch schöner geworden. Steve blickte ihr in die Augen, und sie erwiderte seinen Blick. Dinah schien über das Wiedersehen erregt zu sein, doch sie beherrschte sich meisterhaft. Das Lachen, das sie so reizend aussehen ließ, wich nicht von ihren Lippen.
Dinah Right war eine Schönheit. Sie war hochgewachsen und schlank. Ihr Haar war so dunkel, dass es bläulich schimmerte.
»Es war Zeit, dass du dich an uns erinnert hast, Steve«, sagte sie und trat auf ihn zu. »Jemand musste deinem Freund endlich die Flasche wegnehmen. Er war dabei, sich totzutrinken. Schau ihn dir richtig an, was hat er nur aus sich gemacht?«