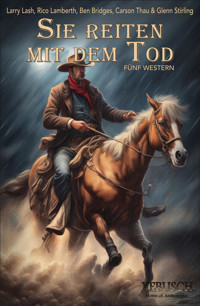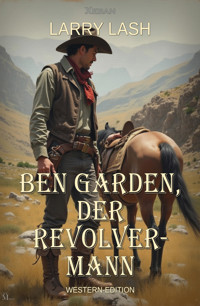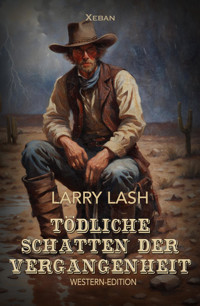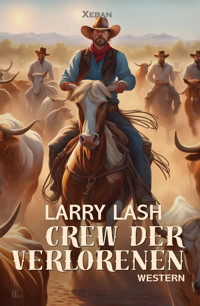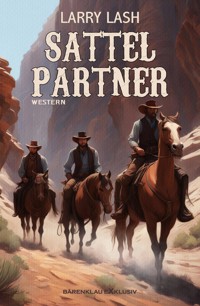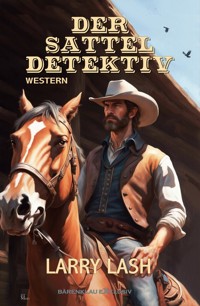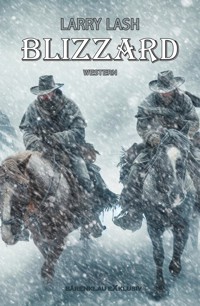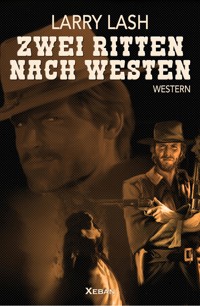3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: XEBAN-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am Ufer des Missouri River, der auch Big Muddy genannt wird, entscheiden sich nicht nur die Schicksale der Soldaten des Krieges zwischen Süd- und Nordstaaten und das des Major Malbourn, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Fort für die Südstaaten zu erobern.
Zur gleichen Zeit sind die Missouri-Männer auf dem Raddampfer Sturmvogel mit ihrem Captain McDuid, der von Marshall Murphy wegen des Mordes an dessen Sohn verfolgt wird, auf dem Fluss. An dessen Ufer wartet auch Leutnant Perry. Er war mit einem Vermessungstrupp der US-Armee weit im Indianerland unterwegs. Als er vom Ausbruch des Krieges hört, muss Perry als einziger Yankee unter lauter Südstaatler fliehen. Er überlebt nur knapp einen Indianerüberfall, aber er erreicht das Ufer des Missouri. Beim Anblick des ›Sturmvogels‹, der in weiter Ferne zu sehen war, glaubt Perry an seine Rettung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Larry Lash
Missouri-Männer
Western-Edition
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors
© Copyright dieser Lizenzausgabe by XEBAN-Verlag.
Verlag: Xeban-Verlag: Kerstin Peschel, Am Wald 67, 14656 Brieselang;
[email protected] / www.xebanverlag.de
Lizenzgeber: Edition Bärenklau / Jörg Martin Munsonius
www.editionbaerenklau.de
Cover: © Copyright by XEBAN-Verlag mit einem Motiv von Steve Mayer und eedebee (KI), 2025
Korrektorat: Ines Bauer
Alle Rechte vorbehalten!
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt beim XEBAN-Verlag. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Missouri-Männer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Am Ufer des Missouri River, der auch Big Muddy genannt wird, entscheiden sich nicht nur die Schicksale der Soldaten des Krieges zwischen Süd- und Nordstaaten und das des Major Malbourn, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Fort für die Südstaaten zu erobern.
Zur gleichen Zeit sind die Missouri-Männer auf dem Raddampfer Sturmvogel mit ihrem Captain McDuid, der von Marshall Murphy wegen des Mordes an dessen Sohn verfolgt wird, auf dem Fluss. An dessen Ufer wartet auch Leutnant Perry.
Er war mit einem Vermessungstrupp der US-Armee weit im Indianerland unterwegs. Als er vom Ausbruch des Krieges hört, muss Perry als einziger Yankee unter lauter Südstaatler fliehen. Er überlebt nur knapp einen Indianerüberfall, aber er erreicht das Ufer des Missouri. Beim Anblick des ›Sturmvogels‹, der in weiter Ferne zu sehen war, glaubt Perry an seine Rettung …
***
Missouri-Männer
Western von Larry Lash
1. Kapitel
Seit Stunden hockte Dan Perry im Schilf. Der sumpfige, leicht gefrorene Boden schwankte unter seinem Gewicht wie die tückische Grasnarbe eines Moores, die sich jederzeit öffnen konnte, um Dan langsam herunterzuzerren. Das Feuer, das er mit Schilf nur mühsam am Lehen erhielt, qualmte stark und drohte immer wieder zu verlöschen. Der beißende Qualm setzte Dan kaum stärker zu als die nagende Ungeduld.
Auf Meilen hin gab es an diesem Ufer nur Schilf und sumpfigen Boden. Außerdem war die Uferböschung von der Strömung des Missouris so niedrig, zernarbt und ausgewaschen, dass der Anblick nicht gerade reizvoll zu nennen war. Dazu kam, dass kein Baum, kein Strauch in der Nähe standen und dem wandernden Blick einen Halt gaben, denn gleich hart am Schilf und Riedgrasgürtel begann schon das wogende, abgestorbene Meer des Präriegrases. Man hatte den Eindruck, als wenn Big Muddys gelbe, schlammige Fluten mitten durch das braune Grasmeer der Prärie kröchen.
Durch die fahle Dämmerung trieb der wallende Rauch des Schilffeuers über den Fluss, der manchmal entwurzelte Bäume mit entlaubten Kronen und sperrigem Astwerk an Dan vorbeitrug. Der Rauch wehte auch über die flachen Sandbänke hin, die weiter rechts von Dans Standort als trügerische gelbbraune Erhöhungen aus dem Wasser ragten.
Der Qualm hatte die Raben von den Sandbänken verscheucht, und weit und breit schien es nun kein lebendiges Wesen mehr zu geben, das mit Dan Perry die Einsamkeit teilte.
Dans dunkle braunen Augen beobachteten unentwegt die Flusskrümmung. Dort schoben sich die Ausläufer der Hügelkette so weit vor, dass man nur noch einen Teil der Krümmung überblicken konnte. Doch dahinter, für Dan Perry bereits erkennbar, wurde eine blaue Rauchfahne sichtbar. Holzrauch war es, der sich mit der klaren Dämmerung vermählte und unentwegt näher rückte, doch so langsam, dass Dan Perrys Geduld auf eine harte Probe gestellt wurde.
Flussaufwärts fahrende Schiffe kamen nur langsam vorwärts. Jeder Reiter hätte ohne Mühe am Ufersaum mit ihnen Schritt halten können, und Dan wusste das. Er konnte sich ausrechnen, dass die Dunkelheit der Nacht bereits niedersinken würde, bevor der Schaufelraddampfer für ihn sichtbar hinter der Krümmung hervorkam.
Dans Lippen pressten sich fester zusammen, und sein Blick wanderte in die Runde. Das Land ringsum kam ihm vor wie ein dunkles, riesiges Loch. Nach Westen zu hob es sich zu kleinen Hügeln und Kuppen an. Die nächtlichen Schatten berührten diese Erhebungen bereits. Sie würden bald nicht nur das Land hinter den Hügeln zudecken, sondern auch das Pferd, das dort tot unter Dan zusammengebrochen war. Sattel und Zaumzeug hatte er unter einem Gebüsch verborgen. Die Winchester, seine Schlafdecke und die wenigen Habseligkeiten, die in den Satteltaschen gesteckt hatten, waren zu einem Bündel verschnürt worden, das sich Dan aufgeladen hatte. Jetzt lag das Bündel neben ihm im Schilf. Es sog bereits die Nässe auf, und Dan fröstelte, als er dies sah.
Tiefbraun war sein hageres Gesicht, gezeichnet von harten Strapazen. Tiefe Schatten standen in seinen Augen und Bartstoppeln bedeckten Kinn und Wangen.
In seinem grauen Stetson sah man deutlich ein kleines Kugelloch. Dornen hatten sein Flanellhemd eingerissen. Grau und unansehnlich waren seine hochhackigen Reitstiefel geworden.
Unansehnlich aber waren auch die beiden Halfter, die er tief geschnallt trug. Sie standen in krassem Gegensatz zu den blau schimmernden, gepflegten Revolvern, deren Mündungen aus den offenen Halftern drohend herausragten und deren Kolben mit geschnitzten Elfenbeinschalen ausgestattet waren.
Die beiden 45er schienen aber gar nicht so recht zu Dan Perry zu passen. Sie sahen aus, als hätte er sie gerade aus einem Store gekauft und als wäre noch nie eine Kugel aus ihren Läufen gerast. Aber das täuschte. Dan fand irgendwie immer mal Zeit, um seine Eisen zu pflegen, ja auf Hochglanz zu bringen.
Im steinernen, ruhigen Gesicht zuckte kein Muskel. Erstaunlich selbstbeherrscht schien er die Tugend des Wartens erlernt zu haben. Kein Wunder, nach allem, was er hinter sich hatte. Vor fünf Jahren hatte es begonnen, als er die Gefangenschaft bei den Sioux hinter sich brachte und gegen jeden Hohn unempfindlich geworden war. Hier hatte er gelernt, dass ein Mann niemals seine Geduld verlieren durfte, wenn er ein bestimmtes Ziel verfolgte.
Sein jetziges Ziel war, erst einmal auf einen Flussdampfer zu kommen. Sein Rauchsignal musste bald bemerkt werden, und dann würde man auch ihn sehen, ein Beiboot aussetzen und ihn überholen. Von diesem Augenblick an hätte er weniger Sorgen. Keine umherstreifende Sioux Horde würde ihn mehr jagen können.
»Waste!«
Das war gut so, und unwillkürlich sprach er dieses Sioux Wort aus, wobei ein dunkles Lächeln über sein ernstes Gesicht huschte. Für Augenblicke war es danach so, als verschleierte sich sein Blick und als dächte er über irgendetwas scharf nach.
In diesem Augenblick tauchte an der Krümmung der Schatten eines schwarzen, kleinen Raddampfers auf. Das grelle Pfeifen der Signalpfeife zerriss plötzlich die Stille der Einsamkeit und war weithin hörbar.
Unwillkürlich atmete Dan Perry schneller. Es war, als hätte ihn der Anblick des Bootes bereits von einer drückenden Last befreit. Er legte mehr Schilf aufs Feuer. Er blies in die Glut, bis er meinte, keine Luft mehr zu bekommen. Danach schob sich die Dunkelheit wie ein Vorhang nieder, und das kleine Schiff kam außer Sicht.
Als es für Dan wieder auf dem Strom sichtbar wurde, war es ein dunkler Fleck, an dem die Schaufelräder weiße Gischt aufwirbelten. Das flache Boot kam mit abgeblendeten Lichtern immer näher, so nahe, bis es fast mit Dan parallel war und er schon befürchten musste, dass es weiterfahren und ihn zurücklassen würde.
Als seine Geduld fast zu zerreißen drohte, hörte er eine dunkle Stimme, die durch ein Sprachrohr verstärkt, zu ihm herüberschallte:
»Wir kommen!«
Drüben erwartete man keine Antwort. Sicherlich konnte man sich denken, dass dem Fremden dort in der Wildnis kein Sprachrohr zur Verfügung stand und schon aus diesem Grunde eine gegenseitige Verständigung unmöglich war.
Die Schaufelräder rauschten auf. Das Boot drehte bei. Mit einigem Poltern wurde ein Beiboot ausgeschwungen und zu Wasser gelassen. Von kräftigen Ruderschlägen getrieben, löste es sich vom dunklen Rumpf des großen Bootes. Das leichte Boot lag ganz flach im Wasser und kam rasch näher. Bald war die drei Mann starke Besatzung gut zu erkennen. Aber das Boot kam nur bis auf Rufweite heran.
»Heh, Kid!«, gelte eine raue Stimme zu Dan herüber.
»Kid, bist du es?«
Für Dan war das nicht die erste Überraschung. Die Tatsache, dass das Schiff mit abgeblendeten Lichtern fuhr, hatte ihm bereits zu denken gegeben. Es war nicht schwer zu erraten, dass man ihn offenbar mit jemandem verwechselte und er es nur dieser Tatsache zu verdanken hatte, dass man überhaupt ein Boot zu Wasser gelassen hatte. Deshalb wagte er nicht, diese Frage direkt zu beantworten, sondern rief zurück:
»Was ist denn los? Warum fahrt ihr mit verdunkeltem Licht?«
Die nächsten Sekunden mussten entscheiden. Wenn Kid ein intimer Bekannter dieser Männer war, mussten sie an Dans Stämme heraushören, dass sie sich geirrt hatten.
»Du bist vielleicht gut, Kid! Ed sagte bereits, dass man bei dir immer mit Überraschungen rechnen müsste. Ist gut, wir kommen!«
Das Boot kam näher heran. Es glitt langsam in die Schilfwand hinein und lag endlich still.
Jetzt erst zeigte sich Dan. Aber er zeigte sich so, dass die drei Fremden plötzlich in die dunklen Mündungen seiner Revolver blickten. Sie schienen nicht einmal überrascht. Nicht einer griff zu den im Boot liegenden Waffen.
»Tatsächlich, du bist genauso, wie Ed es uns sagte, ein Mann voller Überraschungen, Kid«, sagte der Kerl, der das Ruder führte ruhig. »Du brauchst uns deine Künste nicht erst vorzumachen. Wir wissen darüber Bescheid. Komm, steig ein! Ed erwartet dich!«
»Ich weiß nicht, ob es Ed recht sein wird!«
»Das ist gut«, unterbrach ihn der andere ärgerlich. »Halte uns lieber nicht so lange auf! Es ist eine ungemütliche Nacht, und wir müssen sehen, dass wir bald in einem stillen Nebenarm verschwinden. Es gibt einige stark bewaffnete Boote, die auf uns Jagd machen. Deinetwegen lassen wir uns nicht die Planken unter den Füßen zusammenschießen!«
Dan zögerte nicht länger. Er wunderte sich nicht einmal darüber, dass man ihn nicht sogleich ausfragte. Die Männer verließen sich auf diesen Ed; denn wer immer der Fremde am Ufer sein mochte, Ed musste ihn persönlich kennen. Für Dan aber war das schlimmer, denn bei der ersten Gegenüberstellung mit diesem Mann musste sein Schwindel auffallen. Dan zögerte keine Sekunde mehr.
Sicher, er hätte die drei wieder zu ihrem Schiff zurückschicken oder aber sich ihres Bootes bemächtigen können. Aber was wäre damit für ihn erreicht gewesen? Mit einem kleinen, offenen Boot war er genauso hilflos wie ohne Pferd. In diesem wilden Land musste man beweglich sein. Außerdem war sein Proviant zur Neige gegangen. Der Hunger brannte in ihm. Auf dem Flussdampfer aber gab es gewiss ein reichliches Essen für ihn. Die Wahl konnte also nicht schwerfallen, auch wenn das Flussboot nicht gerade vertrauenerweckend aussah und die Männer im Beiboot noch weniger.
Dan betrachtete die Männer genauer. Sie alle drei waren ungestüme, raue Gesellen, Flusspiraten und vielleicht noch Schlimmeres. Dem einen fehlte ein Auge. Bei dem anderen sah man die Schneidezähne nicht mehr. Wer konnte sagen, wo er sie verloren hatte? Bei allen war es aber so, als hätte sie der Teufel selbst aus der Hölle gejagt.
Dan hatte bereits in manche Gesichter gesehen. Er hatte den rohen Frachtwagenfahrern gegenübergestanden, den halbwilden Büffeljägern, Rinderleuten, Indianern und Goldsuchern, doch zum ersten Mal blickte er in die verwegenen und rohen Gesichter von Flusspiraten. Nur solche konnten es sein, die der Teufel ihm hier über den Weg geführt hatte.
Dan senkte die Waffen, die er bis jetzt immer noch auf die drei Kerle gerichtet hatte, und steckte sie langsam in die Halfter zurück. Er hob sein feuchtes Bündel auf, watete durch das knietiefe Wasser zum Boot und stieg ein.
»Freund«, sagte der Kerl, dem die Zähne fehlten, »Ed hat uns schon manches von dir erzählt. Sei willkommen in unserer Gemeinschaft! Das Leben bei uns wird dir gefallen. Männer, die wie du mit ihren Eisen umzugehen wissen, werden auch bald gelernt haben, eine Kanone abzufeuern und mit größeren Geschossen zu treffen!«
Bei diesen Worten bewegte er sein Ruder gleichmäßig mit dem Einäugigen, der Dan auch freundlich angrinste.
Näher kam das Rauschen der großen Schaufelräder, die im Rhythmus der klopfenden Kolben versuchten, das Flussboot auf der Stelle zu halten.
Schärfer schärften sich allmählich die Konturen des Bootes aus der Dunkelheit. Mit Erstaunen sah Dan, dass das dunkel daliegende Boot wenig Ähnlichkeit mit den üblichen Schaufelradampfern hatte, die sonst den Strom bevölkerten. Es hatte nur ein Zwischendeck, und das war mit zollstarken Eichenbohlen verkleidet. Auch das Ruderhaus lag nicht so hoch wie bei anderen Booten. Es erhob sich nur wenig über den allgemeinen Schiffsrumpf und schien ebenfalls stark verkleidet zu sein.
»Der Sturmvogel hat schon so manchen Siouxangriff überstanden«, sagte der Bärtige, der den prüfenden Blick Dans richtig gedeutet hatte.
»Dabei liegt unser Boot so flach, dass es Gewässer befahren kann, die von den Routenschiffen gemieden werden müssen. Sturmvogel gleitet fast über die Sandbänke, legt an seichten Stellen an und löst sich ebenso leicht, ohne mit seinem Rumpf im Schlick steckenzubleiben.«
»Wie stark ist die Besatzung?«, wollte Dan wissen.
Der Bärtige lachte ein glucksendes Lachen. Er wischte sich über die zernarbte Stirn und sagte rau: »Jeder von uns zählt für zehn. Demnach ist unsere Besatzung so stark wie eine Hundertschaft.«
»Und für Passagiere bleibt wenig Platz?«
»Ed verzichtet im Allgemeinen auf Mitfahrer. Nur bisweilen macht er eine Ausnahme. Eine solche wirst du gleich kennenlernen. – Heb, ahoi!«
Sein Ruf galt den Männern auf dem Flussboot. Wurfleinen wurden herabgeworfen. Wenig später wurde das Beiboot hochgehievt und eingeschwungen. Jetzt erst sah Dan weitere Männer der Besatzung des Sturmvogels.
Als er seine krumm getretenen Cowboystiefel auf die Schiffsplanken setzte und die fremde Atmosphäre spürte, glitten seine Hände an den tief geschnallten Eisen entlang. Die stählernen Läufe gaben ihm wieder die nötige Ruhe zurück.
Man betrachtete ihn neugierig. Niemand stellte ihn vor. Alle hielten ihn wohl für einen Mann namens Kid und seine Ankunft für durchaus in Ordnung.
Wer immer auch Kid sein mochte, seine Existenz hatte Dan aus einer argen Klemme befreit. Er war gewillt, seine Situation so schnell wie möglich zu klären.
»Ich möchte erst einmal Ed sprechen!«, sagte Dan deshalb zu dem Bärtigen.
»Der Captain erwartet dich bereits, Kid, komm nur!«
Damit schob der bärtige Kerl Dan vor sich her durch eine Kajütentür und ging danach vor ihm her durch einen Gang, an dessen Ende eine neue Tür Halt gebot.
Drinnen musste man sie schon kommen gehört haben, denn eine tiefe Bassstimme rief:
»Komm nur herein, Kid!«
Dan Perry befolgte die Aufforderung sofort. Er öffnete die schwere Eichentür und wollte sie gleich wieder hinter sich ins Schloss werfen. Aber der Bärtige war ihm so dicht gefolgt, dass er mit Dan in den Raum hineinglitt.
Dan konnte sich nicht länger um den Kerl kümmern, denn er sah sich einem Mann gegenüber, der bei seinem Anblick nicht gleich aufsprang, sondern ruhig hinter seinem prächtigen Schreibtisch sitzenblieb, nur die Augen eng zog und seine Zigarette fester zwischen die Lippen nahm.
Nein, der Mann hinter dem Schreibtisch zeigte keine Überraschung. Er hatte sich bewundernswert in der Gewalt und ließ sich und seinem Besucher genügend Zeit zur gegenseitigen Betrachtung. Er war von beachtlicher Größe, hatte ein frisches, kühn geschnittenes Gesicht mit verwegenen, hellblauen Augen und einer Hakennase daran. Über der breiten, gewölbten Stirn stand dichtes, weißblondes Haar wie bei einer Bürste. Seine ganze Erscheinung war für einige bestimmt angsteinflößend.
Er fixierte Dan Perry scharf und genau. Beider Blicke kreuzten sich wie die Klingen zweier Schwerter.
Der Bärtige hinter Dan bewegte sich unruhig.
»Captain, was ist nun? Er ist doch der richtige?«
»Ob er der richtige ist, wird sich jetzt herausstellen, Sam«, erwiderte der Kommandant mit einem spöttischen Unterton in der Stimme. »Drücke ihm deinen Revolver nicht zu fest in den Rücken. Schaff ein wenig Abstand und lass ihn erst seinen Packen ablegen!«
2. Kapitel
Der leichte Druck in Dan Perrys Rücken ließ nach. Die Befehle und Wünsche des Kommandanten schienen augenblicklich in die Tat umgesetzt zu werden. Der Bärtige wich ganz bis zur Tür zurück, doch seine Waffe blieb weiterhin auf Dans Rücken gerichtet. Dan legte sein Bündel ab.
»Ein wenig freundlicher Empfang für einen weißen Mann, der in Not ist, Sir!«
»Schiffbruch in der Prärie? – Hm, das kann gestellt sein, um an mich heranzukommen und sich meiner Mannschaft zu entledigen. Spielen wir lieber mit offenen Karten! Wer sind Sie? Wer hat Sie geschickt, und wo liegen die drei Schaufelradboote von Murphy?«
»Tut mir leid, Sir, ich kenne keinen Murphy und auch nicht seine Boote!«
»Wenn Sie glauben, dass mich Ihre Cowboytracht täuschen kann, so irren Sie sich. Sie sind ein Mann vom Fluss!«
»Auch darin müssen Sie sich täuschen, Kommandant«, erwiderte Dan ruhig. »Aber ich will zugeben, dass ich tatsächlich kein Cowboy bin, sondern nur ein einfacher Leutnant der Armee.«
»In Zivil?«
Der Captain erhob und beugte sich weit über den Schreibtisch vor. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, und der höhnische Klang in seiner Stimme wurde noch stärker, als er sagte:
»Leutnant in Zivil, wohl in einem Sonderauftrag, wie? – Nun, auch das ist Murphy zuzutrauen, dass er selbst die Armee für sich gewinnt, um sie danach auf mich zu hetzen. Heraus mit der Sprache, Leutnant!«
»Nun, ich glaube, die Armee hat zurzeit genug allein zu tun, Captain, es ist Krieg!«
»Krieg?«
Für einen Augenblick veränderte sich das Gesicht des Captains und schien seine wahre Überraschung zu offenbaren.
»Ja, Sir, es ist Krieg. Ein Scout brachte die Nachricht zum Fort. Auf seinem Wege dorthin kam er an dem Camp meines Vermessungstrupps vorbei, und so erhielt ich die Nachricht, dass am 20. Dezember 1860 das versammelte Volk von Südcarolina die Verordnung im Konvent über die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahre 1788 widerrufen hat. Damit wird der bisher bestehende Bund zwischen Südcarolina und den anderen Staaten aufgelöst. Für mich aber, Sir, bedurfte es einer sofortigen Entscheidung, denn ich war der einzige Yankee unter lauter Südstaatlern, die die Armee weit ins Indianerland geschickt hatte. Nun, ich konnte nicht bleiben. Ich machte mich also davon, nachdem ich einen Sergeanten niedergeschlagen und drei Soldaten mit der Waffe, in der Hand in Schach gehalten hatte. Ich konnte mir ein gutes Pferd, Zivilkleidung und Proviant besorgen. Die Uniform warf ich bald fort. Ich ritt nur in der Nacht, und als ich bereits glaubte, die Verfolger abgeschüttelt zu haben, hingen mir drei Sioux-Krieger auf der Fährte. Einer der Kerle schoss mir das Pferd unter dem Sattel weg. Drei Tage belauerten wir uns und kämpften, anschließend war die Sache für mich entschieden. Doch einer der Sioux konnte verwundet mit den Pferden seiner Partner entkommen, und mir blieb nur noch der Marsch zu Fuß hierher zum Fluss in der Hoffnung, ein Boot zu erwischen, das mich nach Fort Deadle bringen kann oder mich in der Nähe des Forts absetzt.«
»Warum, Leutnant?«
»Weil der Scout niemals das Fort erreichen wird. Major Jube Malbourn von der Vermessungsabteilung unserer Truppe ließ den Armee-Scout rücksichtslos niederschießen, als er sich seinem Befehl widersetzte, seinen Weiterritt zum Fort Deadle zu unterbrechen. Major Malbourn hat sich mit seinen Männern gleich zur Sache des Südens bekannt. Jetzt ist er bereits auf dem Marsch zum Fort, um der Armee mitten im Indianerland eine Niederlage zu bereiten. Jetzt werden Weiße gegen Weiße kämpfen. Die Stämme der Sioux und ihre Verbündeten werden es bald heraushaben und sich auf ihre eigene Art einmischen. Captain, jeder Weiße im Indianerland wird bald zu spüren bekommen, was der Krieg bedeutet. Und deshalb sollte jeder Weiße daran denken, dass ihm seine Hautfarbe Verpflichtungen auferlegt!«
»Aber das alles ist für mich noch lange kein Grund, Leutnant, meine Route zu ändern und Sie nach Fort Deadle zu bringen«, gab ihm der Kommandant knurrig zur Antwort.
»Ich habe andere Sorgen, wenn es mir auch nicht gleichgültig ist, dass ein Krieg ausbrach. Ich stehe auf keiner Seite. Wer will, kann sich für den Norden oder den Süden begeistern und sich dafür erschießen lassen. Die Sklavenhalter sind mir genauso unsympathisch wie die Yankees. Mit anderen Worten, Leutnant, ich habe mir meine eigenen Gesetze auferlegt. Mir ist es auch verteufelt gleich, wem die Oglala-Sioux den Skalp nehmen, ob es der Haarschopf eines Süd- oder eines Nordstaatlers ist. Mich kümmert es wenig, auf wen die roten Gents Jagd machen werden. Solange der Fluss befahrbar ist und mein Schiff sich nicht in Eisschollen festsetzt oder Murphy hinter mir her ist, soll es mir gleich sein, ob einsam reitende Sioux oder weiße Siedler, Jäger und Rancher gehetzt und gejagt werden. Aber sie alle werden dann am eigenen Leibe erfahren, wie es einem Mann zumute ist, der wie ein Tier gehetzt wird!«
Er lachte bitter vor sich hin. Mit rauer Stimme wandte er sich dann an den Bärtigen: »Sam, sage diesem Leutnant jetzt, aus welchen Männern unsere Mannschaft besteht!«
»Aus Missouri-Männern, Sir«, antwortete der Bärtige stolz.
»Ja, aus ganz gewöhnlichen Missouri-Männer, die alle etwas auf dem Kerbholz haben und deshalb vom Gesetz und Marshall Murphy gesucht werden. Der Marshall hat einen mächtigen Geldgeber und ein übles Gesetz hinter sich. Er möchte uns alle, jedes Mitglied der Besatzung, vom Kommandanten bis zum letzten Mann, an eine Planke nageln und an der tiefsten Stelle des guten Big Muddy auf den Grund gehen lassen. Und weil dies so ist, Leutnant, wird Ihr Wunsch, bald nach Fort Deadle zu kommen, wohl kaum in Erfüllung gehen. Im Gegenteil! Wir dampfen weiter flussaufwärts und in Gewässer, in die uns Murphy mit seinen gecharterten Booten nicht mehr folgen kann. Wir wollen in Ruhe überwintern, Leutnant. Wenn Ihnen das nicht passt, bitte, so steigen Sie aus!«
Er lachte vor sich hin, und durch das Lachen hindurch hörte man das Rauschen des Wassers, das an den Planken des Bootes vorbeifloss. Im nächsten Augenblick aber klang die helle Stimme einer Frau auf:
»Captain McDuid, aber das widerspricht doch dem, was Sie mir noch vor einer Stunde sagten! Sie sagten doch, dass Sie Fort Deadle anlaufen würden. Aber nun
muss ich nach Ihren jetzigen Worten annehmen, dass wir bereits an Fort Deadle vorbeigefahren sind!«
Lautlos war die Frau gekommen, und ebenso lautlos trat sie ein. Sie glitt schnell an Sam, dem Bärtigen, vorbei, der ihr den Eintritt versperren wollte. Sie kam an Dan Perry vorbei und stand im Anschluss im Lichtschein der Schreibtischlampe vor dem Kommandanten.
Viele böse Überraschungen hatte Leutnant Dan Perry erwartet, aber der Anblick dieser Frau war eine so große Überraschung, wie er sie nie auf einem solchen Boot und in einer derartigen Situation für möglich gehalten hätte. Auf den ersten Blick sah er, dass sie eine Lady war, von der nicht nur Offiziere im Feindesland und in der Wildnis träumten, sondern mit deren Existenz man kaum rechnen konnte.
Sie trug ein Spitzenkleid, das alle Formen ihres schlanken Körpers ahnen ließ. Sie war eine Frau, die das Herz eines jeden Mannes höher und schneller schlagen lassen musste, besonders eines Mannes, der monatelang hart geschuftet und außer einigen alten Sioux-Squaws, mit lederartigen Gesichtern schier vergessen haben mochte, wie schön eine weiße Frau sein konnte.
Für Dan Perry war es günstig, dass sie ihn nicht beachtete, sondern ihre vor Erregung pechschwarzen Augen nur auf Ed McDuid, den Schiffskommandanten, gerichtet hielt. So hatte er die Gelegenheit, ihr Gesicht im Profil zu sehen. Es war ein hübsches Gesicht, das eine kleine Stupsnase keck emporrichtete. Dunkle Wimpern waren wie Schmetterlingsfühler fein nach oben gebogen. Es zeigte einen roten, weich geschwungenen Mund. Im Nacken war das leuchtend rote Haar zu einem schweren Knoten gebunden. Das Temperament dieser Frau kam zum Ausdruck, als sie wütend mit ihrem hochhackigen Schuh auf den Boden stampfte, was den Captain und Kommandanten sogleich antworten ließ:
»Vor drei Tagen fuhren wir in der Nacht sozusagen unter den Geschützen des Forts an diesem vorbei, Madame. Aber Sie waren einfach nicht zu wecken. Sie schliefen fest und hatten die Kajütentür verschlossen. Dreimal habe ich versucht, Ihren Schlaf zu unterbrechen um Sie danach mit dem Beiboot in der Nähe des Forts außer Reichweite der Kanonen an Land zu setzen, doch Sie, Madame, taten mir den Gefallen nicht, Sie wurden nicht wach. Ja, es tut mir wirklich leid für Sie, Madame!«
»Aber Sie hatten es mir doch fest zugesagt, Mister McDuid!«
»Und ich sagte Ihnen bereits vor Beginn unserer Reise, dass es Passagiere nicht leicht auf meinem Boot hätten. Ich schenkte Ihnen auch reinen Wein über Murphy ein und sagte, dass es kaum möglich wäre, am hellen Tag unter den Geschützen am Landungs-Steg des Forts festzumachen. Sie wussten auch durch mich, dass sich niemand im Fort über unser Kommen freuen würde und dass Marshall Murphy die große Flussschleife ausgenutzt und die Fortbesatzung gegen uns aufgebracht haben könnte. So war es wirklich! Man war im Fort auf unser Kommen vorbereitet, und wenn es nicht eine für uns so günstige stürmische und regnerische Nacht gewesen wäre, hätte uns Murphy endlich in der Falle gehabt, und unsere Freiheit wäre beendet.«
»Woher wissen Sie das alles, Mister McDuid?«
»Ich ließ mich in der Nähe des Forts an Land setzen und nahm dort Verbindung auf. Ich war sogar im Fort, Madame. Doch leider war es mir nicht möglich, mit Ihrem Bruder zu sprechen. Er war bei den Soldaten, die links und rechts des Forts die Ufer überwachten. Ich war wirklich neugierig, Madame, was Murphy über mein Schiff und die Mannschaft durch seinen Boten an den Fort-Kommandanten ausrichten ließ. Nun, es war der alte Song. Er hat mitteilen lassen, welche Summe für meine Ergreifung ausgesetzt ist. Daraufhin hielt der Fort-Kommandant es für lobenswert, seine Soldaten zu beschäftigen, um sich damit eine kleine Nebeneinnahme zu sichern. Außerdem stellte er das Ganze als eine nötige militärische Übung hin. Ich nehme an, dass der Kommandant aber nicht erst danach gefragt hat, wer hinter Marshall Murphy steht.
Ihm genügte mein Name und einiger aus meiner Besatzung, um sein Tun zu rechtfertigen. Er unterscheidet sich demnach nicht von anderen Narren, die uns der Marshall schon auf den Pelz hetzte. Ich sah ein, dass es wenig Zweck gehabt hätte, dem Kommandanten die Wahrheit über meine Männer und mich mitzuteilen, weil er nicht überdurchschnittlich begabt ist und er sich kaum von all den anderen unterscheidet, denen die Jagd auf uns zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich habe mit solchen Männern bereits bittere Erfahrungen gemacht, Madame. Es ist in der Zwischenzeit so, dass jeder dem Marshall glauben muss. Der Schein trügt, aber er ist gegen meine Leute und mich. Nur der Mann, den ich erschossen haben soll, nur dieser eine Mann aus St. Louis, würde den wirklichen Mörder nennen können. Doch der kann nicht mehr darüber reden, leider! Das, Madame, trifft meine Besatzung und mich sehr schwer, und vor allem, weil der Tote ein sehr einflussreicher Mann gewesen ist.«
Captain McDuid hatte ohne Erregung gesprochen und sicherlich deshalb so ausführlich, mit der Absicht, Leutnant Perry einige Informationen zu geben. Und seltsam, je länger er sprach, umso sympathischer wurde er Dan.
»Einen gewissen Kid Malligan lernte ich im Fort kennen«, begann McDuid wieder. »Er versprach, mit Ihrem Bruder Verbindung aufzunehmen und dass er sich dann durch Rauchzeichen am Ufer melden würde, Constance Lee.