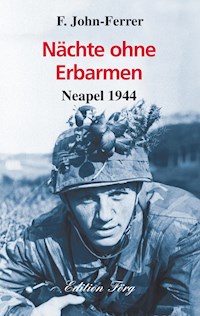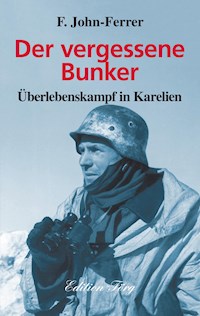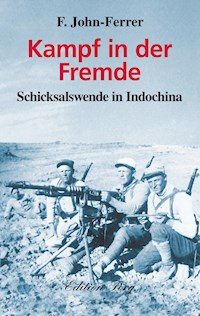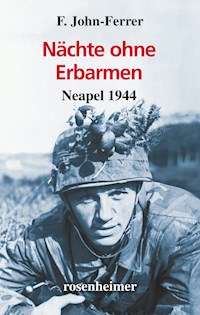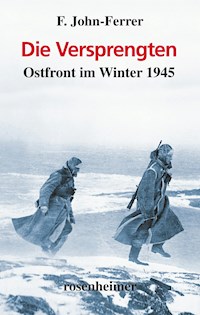
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als im Januar 1945 die deutschen Truppen im Raum Warschau dem Druck der Roten Armee nicht mehr standhalten können und zurückweichen, verlieren die beiden Obergefreiten Röttger und Sailer den Anschluss an ihre Einheit. Durch das russisch besetzte Hinterland ziehen sie westwärts, um die deutsche Front einzuholen. Ihr Weg inmitten einer feindlichen Welt und eines sibirisch kalten Winters führt sie von Rawa über Litzmannstedt in Richtung Breslau. Das Schicksal der beiden zeigt symbolhaft den Wahnsinn dieses Krieges, aber auch, wie viel Kameradschaft in solchen Situationen bedeutet. F. John-Ferrer schrieb dieses Buch nach dem Bericht eines Soldaten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Erzählt nach dem Bericht eines Teilnehmers. Die militärischen Geschehnisse entsprechen den Tatsachen. Die Namen sind erfunden; eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig und unbeabsichtigt.
LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2000
© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: © Bundesarchiv Bild 101I-099-0744-11 / Fotograf: Fraß Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
eISBN 978-3-475-54491-0 (epub)
Worum geht es im Buch?
F. John-Ferrer
Die Versprengten Ostfront im Winter 1945
Als im Januar 1945 die deutschen Truppen im Raum Warschau dem Druck der Roten Armee nicht mehr standhalten können und zurückweichen, verlieren die beiden Obergefreiten Röttger und Sailer den Anschluss an ihre Einheit. Durch das russisch besetzte Hinterland ziehen sie westwärts, um die deutsche Front einzuholen. Ihr Weg inmitten einer feindlichen Welt und eines sibirisch kalten Winters führt sie von Rawa über Litzmannstedt in Richtung Breslau. Das Schicksal der beiden zeigt symbolhaft den Wahnsinn dieses Krieges, aber auch, wie viel Kameradschaft in solchen Situationen bedeutet. F. John-Ferrer schrieb dieses Buch nach dem Bericht eines Soldaten.
1
1945.
Über dem polnischen Land liegt die starre Melancholie eines sibirisch kalten Januartages. Die Luft steht still, die Kälte hängt wie eine unsichtbare Glocke über dem Raum. Wohl scheint die Sonne, doch sie ist ohne wärmende Kraft und wandert, einer abgegriffenen Silbermünze gleichend, im farblosen Dunst des Winterhimmels.
Auf der schneeglatten Straße von Warschau nach Rawa summt ein planenüberspannter Wehrmachtsdiesel. Die Schneeketten klirren gegen die vereisten Kotflügel und wirbeln Schneestaub auf, der das ganze Hinterteil des Fahrzeuges überpudert hat. Im Fahrerhaus sitzen drei in dicke Wintermäntel eingepackte Soldaten. Der Fahrer schielt manchmal zur Seite, wo die Kameraden sitzen und schlafen. Der eine schnarcht mit offenem Mund. Der andere hat den Kopf auf die Schulter des Kameraden gelegt.
Jetzt fährt der Lkw in eine Kurve und gerät leicht ins Rutschen.
„Verdammter Mist!“, schimpft der Fahrer und weckt damit die beiden Mitfahrer auf.
„Was’n los?“, fragte der eine.
„Glatt ist’s! Miststraße, elende.“
Jetzt ist auch der andere Soldaten wach geworden und gähnt; dann wischt er an der gefrorenen Türscheibe und murmelt:
„Schätze, dass es mindestens dreißig Grad unter Null sind.“
Sie schweigen wieder.
Der Lkw summt eine Steigung hinan und rollt dann auf wieder ebener Strecke weiter.
„Los, ’ne Zigarette brauch ich“, brummt der Fahrer.
Der ganz rechts sitzende Mitfahrer wühlt in den Manteltaschen nach den Zigaretten, gibt dem Nebenmann eine und brennt sich zwei Stück an. Eine davon für den Fahrer.
„Merci“, grunzt der und steckt sich die Zigarette in den Mund.
Der enge Raum nebelt sich mit blauem Dunst ein.
„Wo kommst du her?“, fragt der in der Mitte sitzende Soldat seinen rechten Nebenmann.
„Nowe Miasto. Ich habe dort an einem Lehrgang der Armee-Pionierschule teilgenommen.“
Der Fahrer, mit der Zigarette im Mundwinkel, grinst:
„Wozu soll dat denn gut sein?“, fragt er.
Das Gespräch kommt in Gang und verscheucht Fahrmüdigkeit und Langeweile.
Willi Röttger heißt der Obergefreite, der mit Wäschebeutel, Karabiner und blaugefrorener Nase auf der Straße stand und dem aus Warschau kommenden Wagen zuwinkte, um ein Stück mitgenommen zu werden. Nach Rawa.
Dort liegt das 662. SMG-Bataillon, dessen Offiziere zum größten Teil schon den Ersten Weltkrieg mitgemacht haben. Willi gehört zum Pionierzug der fünften Kompanie. Seit einigen Monaten baut man Bunker und Panzergräben, die das Städtchen Rawa in weitem Halbkreis nach Osten hin abschirmen und der sowjetischen Dampfwalze ein energisches Halt entgegensetzen sollen.
Willi Röttger, 23 Jahre alt, von Beruf Schlosser, aus dem Sauerland stammend, gehört zu jener Sorte Soldaten, die sich auf fast allen Kriegsschauplätzen herumgetrieben haben und das Rückgrat der Armee bilden. Er gilt als stur und hat sich während seiner fünfjährigen Dienstzeit mit der sprichwörtlichen Ruhe seiner Heimat gewappnet, mit der er militärischen Schikanen und Unsinnigkeiten zu widerstehen vermag. Seine Meinung über den Krieg ist grundsätzlich negativ, aber er hütet sich, sie laut werden zu lassen.
Der dreiwöchige Lehrgang auf der Armee-Pionierschule in Nowe Miasto hat ihn mit neuen Infanteriewaffen bekannt gemacht, wobei es passierte, dass er auch zwei Mal strafexerzieren musste, weil er einem Ausbilder „pampig“ gekommen war.
Jetzt befindet sich Obergefreiter Röttger auf dem Weg zum Bataillon und freut sich auf das Wiedersehen mit Emmerich Sailer, dem alten Weg- und Streitgenossen.
„Was macht ihr denn in Rawa?“, fragt er die beiden Lkw-Fahrer.
„Marketenderwaren bringen wir euch“, sagt der Nebenmann.
„Na prima!“, freut sich Willi. „Was gibt’s diesmal?“
„Den gleichen Kram wie immer“, erwidert der Mitfahrer. „Haarwasser, Zahnpasta, Schreibste-ihr-Papier.“ Er feixt.
„Für so was haben wir in Rawa keine Verwendung“, lacht Willi.
Der Fahrer beugt sich vor und fragt grinsend:
„Wieso nich? Gibt’s keene Weiber bei euch?“
„Schon“, sagt Willi, „aber die pfeifen uns was, die sind stur.“
Jetzt sind die drei Soldaten beim unerschöpflichen Thema angelangt. Willi hört nur halb zu; er denkt an Emmes, den Freund. Seit einem Jahr sind sie zusammen und unzertrennlich geworden. Mit ein bisschen Glück und Drängelei konnte man bisher beisammenbleiben.
Ein Dorf taucht auf.
Mit klirrenden Schneeketten fährt der Lkw hindurch, und dann kommen Wehrmachtsfahrzeuge entgegen, weichen vorsichtig aus und fahren in Richtung Warschau weiter. Auch ein paar Panjeschlitten zockeln neben der Straße her im Schnee. Die kleinen, zottigen Pferde atmen Dunstfahnen aus den Nüstern, und auf den Schlitten hocken dick vermummt Zivilisten.
„Noch acht Kilometer bis Rawa“, sagt Willi. „Ich bin wirklich froh, dass ihr mich mitgenommen habt, Kumpels.“
„Ist doch ’n klarer Fall“, sagt der Fahrer. Dann fragt er wie beiläufig: „Wird Rawa auch zur Verteidigung ausgebaut?“
„Feste, mein Lieber“, sagt Willi. „Bevor ich zum Lehrgang abkommandiert worden bin, haben wir ’ne Menge Bunker gebaut.“
„Wie überall“, bemerkt jetzt der Mitfahrer. „Sogar in Warschau wird gebuddelt.“
„Wo du hinspuckst, Militär“, lässt sich der Fahrer vernehmen. „Manchmal sind sogar die Straßen verstopft. Es sieht wirklich aus, als käme bald ’s dicke Ende von dem Mist. Es heißt ja, der Iwan greife bald an … Na, dann gute Nacht, Marie. Haste noch ’n Stäbchen für mich, Kumpel?“
Willi brennt dem Fahrer eine neue Zigarette an.
„Bei Baranow steht der Iwan“, sagt Willi, als er die Zigarette hinüberreicht, „Pulawy und Magaszewa sollen schon wieder von den Unsern geräumt worden sein.“
„Das stimmt“, nickt der Fahrer. „Vor vier Tagen sollten wir Verpflegung nach Pulawy fahren. Wir sind gar nicht bis dorthin gekommen. Der Iwan war schon da. Mann, was wir auf der Rückfahrt erlebten, vergess’ ich mein Lebtag nicht. Nur so gerannt sind die Unsern … eine Affenschande!“
„Dabei hat man doch Jahre lang Bunker gebaut und alles befestigt“, sagt der Mitfahrer ärgerlich, „und trotzdem geht’s zurück, nirgendwo wird mehr gehalten. Es ist zum Kotzen. Wenn das so weitergeht, haben wir den Iwan bald vor unserer Haustür.“
„Das kommt noch so weit“, murmelt der Fahrer und gibt mehr Gas, da die Straße ansteigt.
Die drei schweigen. Ihre Gesichter drücken Besorgnis aus. Jeder weiß, dass die Rückzüge in Russland an der ganzen Front stattfinden; man sieht es ja: Die Straßen sind von zurückflutenden Fahrzeugen verstopft, in den Dörfern östlich von Warschau wimmelt es von Militär, und selbst der größte Optimist hat aufgehört, an den versprochenen Sieg zu glauben.
Eine Straßenkreuzung kommt näher. Die Wegschilder stehen schief im Schnee.
„So, Kumpels“, sagt Willi und deutet mit dem Kinn nach vorn. „Das dort ist Rawa. Nimm langsam ’s Gas weg, Onkel.“
„Wie spät hab’n wir’s denn?“, fragt der Fahrer.
Der Mitfahrer schiebt den Mantelärmel hoch und schaut auf die Uhr.
„Halber viere, Jupp.“
„Da wird’s wieder Nacht, bevor wir …“ Er bricht ab und beugt sich vor, schaut durch die leicht vereiste Windschutzscheibe und bremst plötzlich so jäh, dass der Wagen ins Rutschen kommt und sich quer zu stellen droht.
„Mensch, biste jeck!“, ruft der Mitfahrer.
„Raus!“, brüllt der Fahrer. „Flieger!“
Der Lkw neigt sich nach rechts und bleibt schief im schneeverwehten Straßengraben hängen. Willi reißt die Tür auf und lässt sich hinausfallen. Zugleich hört er das Dröhnen näher kommender Flugzeuge. Es schwillt an, es füllt den Raum.
Aus südöstlicher Richtung fliegen sie an. Russenbomber. Hundert, zweihundert oder noch mehr. Auf Rawa zu, das nur noch zwei Kilometer weit vom schief im Straßengraben hängenden Lkw liegt. In dem Dröhnen ihrer Motoren hört man die um Rawa stehende Flak schießen.
Willi liegt in der Schneewehe und spürt die bissige Kälte nicht. Mit weit aufgerissenen Augen starrt er dem Pulk entgegen, zwischen dem kleine, schwärzliche Sprengwolken wachsen.
Dann ertönt ein Rauschen und gleich darauf ein ohrenbetäubendes Krachen.
Der erste Bombenteppich rast über Rawa hinweg. Qualm kocht empor und baut sich zu einer dunklen Wand auf, in der unzählige grelle Blitze zucken. Der Luftdruck presst Willi in den Schnee.
Dort vorne muss die Hölle los sein. Die Rauchwand wächst noch immer. Bombenteppich auf Bombenteppich rauscht nieder. Die Einschläge tanzen jetzt in rasendem Rhythmus auf dem freien Feld und hinterlassen dunkle Flecke, über denen die Sprengwolken wie Pilze stehen.
Endlich verstummt das Bersten und geht in ein hohles Dröhnen über. Die Bomber fliegen ab. Das Geräusch verliert sich in nordwestlicher Richtung.
Willi Röttger bleibt noch eine Weile liegen. Emmes, denkt er, hoffentlich bist du nicht in der Stadt gewesen … Das muss ja entsetzlich gewesen sein … grauenhaft …
Hinter Willi erhebt sich der Mitfahrer und sucht seine Mütze. Er ist blass und klopft sich den pulverigen Schnee vom Mantel.
„Mensch“, sagt er heiser, „was haben wir für einen Massel gehabt, dass wir noch nicht drin waren.“
Jetzt taucht der Fahrer auf; er lag auf der anderen Straßenseite und bleibt kopfschüttelnd stehen, starrt in Richtung Rawa, wo der Rauch brodelt und kocht und langsam abzieht.
„He, Jupp!“, ruft der Mitfahrer. „Jetzt sind wir dran mit dem Bedanken … unser Kumpel da … nee sowas … Mensch, wie heißte eigentlich?“
Willi murmelt seinen Namen; er ist noch ganz benommen von dem Schreck.
„Du bist unser Glücksschweinchen jewese“, sagt der Fahrer und schlägt Willi auf die Schulter. „Um Minuten ist es jegang’n, Mann … um Minuten!“
Pulvergestank und Brandgeruch wehen heran. Auf der Straße kommen ein paar Fahrzeuge und stauen sich hinter dem schief im Straßengraben hängenden Lkw. Rufe werden laut. Stimmen wirbeln durcheinander.
Willi hat seinen Wäschebeutel und den Karabiner aus dem Lkw geholt, verabschiedet sich von den beiden Fahrern und geht rasch davon – auf Rawa zu, in dem ihn ein heilloses Durcheinander und Schlimmes erwarten wird.
Rawa mit seinen ungefähr fünftausend Einwohnern gilt als strategisch wichtiger Punkt, weil fünf Straßen sich in der kleinen Stadt kreuzen. Sie liegt siebzig Kilometer südlich von Warschau und fünfundsiebzig Kilometer östlich von Litzmannstadt. Pioniere und Angehörige des 662. SMG-Bataillons haben in monatelanger Arbeit einen starken Befestigungsgürtel um den Ort und entlang den von Süden nach Norden verlaufenden Hügeln gezogen, wobei man mehr oder weniger rigoros auf die Mithilfe der polnischen Bevölkerung zurückgegriffen hat.
Mit dem Bombenangriff auf Rawa scheint die lang erwartete Offensive der Sowjets ins Rollen gekommen zu sein. Sie haben Brückenköpfe bei Baranow, Pulawy und Magnuszew gebildet und, wie man allgemein weiß, starke Kräfte herangezogen.
Willi Röttger hat die brennende Stadt schnell erreicht. Sie hüllt sich in Rauch. Ganze Straßenzüge stehen in Flammen. Auf dem Marktplatz brennen abgestellte Wehrmachtsfahrzeuge bis aufs Gerippe aus. Menschen laufen in kopfloser Angst herum. Geschrei und das unheimliche Prasseln des Brandes bilden eine unwirkliche Geräuschkulisse. Soldaten und Zivilisten rennen durcheinander. Was an Fahrzeugen noch intakt geblieben ist, startet, um in rücksichtsloser Eile aus der Stadt zu kommen.
Ein Offizier versucht, Ordnung in das Durcheinander zu bringen, aber niemand hört auf ihn, und schließlich verschwindet er.
Willi schwitzt vor Aufregung und Angst. Über Rawa fliegen jetzt sowjetische Schlachtflieger. Das schmetternde Krachen ihrer Bomben mischt sich in das Dröhnen der erneut schießenden Flak. Da prallt Willi auf eine Frau, die aus einem brennenden Haus stürzt.
„Pan … pan …“, kreischt sie und ringt verzweifelt die Hände, „meine Kind … meine kleine Kind …“
Noch ehe Willi begreift, ertönt ein mahlendes Schieben. Er packt die Frau am Handgelenk und zieht sie fort; sie stürzt, sie schreit schrill, sie reißt sich los, und Willi rennt allein weiter.
Hinter ihm kracht das Haus zusammen und schleudert brennende Dachbalken durch die Luft.
Es ist eine Hölle, durch die Willi rennt. Es gilt, das bisschen Leben in Sicherheit zu bringen und aus diesem Irrsinn herauszukommen.
Der Obergefreite kommt durch. Jetzt hat er den Stadtrand erreicht, an dem entlang ein tiefer Bach fließt. Auf der anderen Seite liegt der neue Panzergraben. Dort drinnen hocken Soldaten und pressen sich an die Betonwände.
Willi muss verschnaufen. Er lehnt sich außer Atem an die Grabenwand und wischt sich über das schwitzende Gesicht.
„Wo … wo liegt die fünfte Kompanie, Kumpel?“, fragt er einen Soldaten, der sich mit zitternden und frostklammen Händen eine Zigarette zu drehen versucht.
„Kann ich dir nicht sagen – irgendwo drüben bei den Bunkern.“
Willi nimmt sein Gewehr und steigt aus dem Panzergraben.
„Mann – pass auf!“, schreit ihm jemand nach. „Tiefflieger!“
Sie sind schon da. In geringer Höhe rasen sie über das von Bomben zerfressene Gelände. Die Bordwaffen rattern.
Willi hat sich hingeworfen und hält den Atem an. Er spürt den Fahrtwind des Schlachtfliegers, er hört das Prasseln der Geschosse.
Auf! Weiter!
Willi stolpert und rennt auf einen der Hügel zu, auf den eine Trampelspur hinaufführt. Höhe 114. Dort muss der Gefechtsstand der fünften liegen.
Die Schlachtflieger sind verschwunden. Irgendwo hinter dem rauchenden Rawa rummeln sie herum: Die Flak in ihren Schneeburgen stellt das Feuer ein. So etwas wie Ruhe breitet sich über den Raum.
Noch während Willi den Schneepfad hinaufstolpert, hört er in östlicher Richtung Kanonendonner.
Der Eingang des großen, mit Schnee getarnten Bunkers liegt auf der Westseite des Hügels. Eine mit Asche bestreute Treppe führt hinab.
Willi atmet erst ein paar Mal durch. Schwein gehabt, denkt er und schaut den Weg zurück, den er gekommen ist.
Das monotone Weiß der Landschaft zwischen Bunker und Stadtrand ist mit vielen runden Flecken beschmutzt: frische Bombentrichter. Über Rawa schwebt eine mächtige Rauchwolke und schiebt langsam gegen Norden ab.
Da kommt jemand die Bunkertreppe herauf.
Willi sieht zunächst nur einen weiß gestrichenen Stahlhelm und breite Schultern.
„Hallo – ja, das ist ja der Röttger!“
„Jawohl, Herr Unteroffizier – vom Lehrgang zurück. Bin grad noch so durchgekommen.“
Willi und der Unteroffizier Kurt Lehmann, Gruppenführer im Pionierzug, begrüßen sich herzlich. Lehmann ist einer der wenigen Aktiven der Kompanie und hat das Deutsche Kreuz in Gold und etliche Auszeichnungen mehr am Rock.
„Röttger, Sie Pechvogel, was haben Sie sich bloß für ’nen miserablen Anreisetag ausgesucht! Warum sind Sie nicht noch ein paar Tage in Nowe Miasto geblieben?“
„Nee – danke, Herr Unteroffizier –, mir hat’s gereicht. Da ist mir unser Gammelverein schon lieber.“
„Der Iwan ist zum Angriff angetreten.“
„Wo?“
„Überall. In Baranow geht’s rund. Nicht mehr lange, dann werden auch wir was zu tun kriegen.“
In der Ferne rumpelt starker Kanonendonner. Bei Baranow muss es sein. Rechts des Bunkers geht Infanterie vor.
„Ob wir wieder ’nen Rückzieher machen werden?“, fragt Willi misstrauisch.
Lehmann zuckt die breiten Schultern. „Wenn wir noch die alte Garnitur wären, Röttger … aber Sie wissen ja, was hier alles rumgurkt in der Gegend. Lauter ältere Herren, von den jungen Dachsen und den halben Krüppeln erst gar nicht zu reden, mit denen wir den Krieg gewinnen sollen. Es ist ein Jammer.“
„Ist beim Pionierzug noch alles da?“, fragt Willi.
„Ja – noch alles da. Auch Ihr Freund Sailer. Der wird sich freuen, wenn er hört, dass Sie wieder da sind. Ich gehe jetzt zu unserem Bunker rüber, Röttger. ,Haus Sonnenblick‘ wohnen wir.“ Lehmann grinst.
„Wie sinnig“, grinst auch Willi und lehnt das Gewehr an die Schneemauer.
„Los“, sagt Lehmann, „melden Sie sich jetzt beim Alten zurück, und warten Sie dann hier, bis der Sailer kommt. Ich schick ihn her. Wir liegen ’n Ende von hier weg … auf dem zweiten Hügel links drüben.“
„Dammich“, murmelt Willi, sich umschauend. „Nu ist doch mein Wäschebeutel weg – so ein Mist … so ein verfluchter Mist.“
„Sie Heini! Wie kann Ihnen so was passieren!“, schimpft Lehmann.
„Hab ihn bei der Rennerei verloren“, murmelt Willi. „In der Stadt irgendwo … oder schon vorher. Nein, so ein Mist! Ich könnte mir vor Wut in den Hintern beißen!“
„War was Wichtiges im Wäschebeutel?“, fragt Lehmann.
„Na klar“, grient Willi. „Schnaps und Zigaretten. Aufgespartes.“
„Sie gehören mit Katzendreck erschossen, Röttger“, stellt Lehmann fest und schüttelt den Kopf. „Wie kann man Schnaps und Zigaretten … nee so was, nee so was …“
Lehmann schiebt ab und verschwindet auf dem Trampelpfad. Willi würgt den Ärger hinunter und ordnet Mantel und Koppelsitz; dann stolpert er die Bunkertreppe hinab.
Eine Tür ist nicht vorhanden. Eine steif gefrorene Zeltbahn verdeckt den Eingang. Dahinter hört man hohl klingende Stimmen. Ein Fernsprech-Apparat klingelt.
Der Obergefreite Willi Röttger betritt den Gefechtsstand der fünften Kompanie.
Der Raum ist niedrig und riecht nach frischem Mörtel und Tabakrauch. Von der Decke herab baumelt eine Karbidlampe. Ein Tisch steht in der Mitte, auf dem eine Landkarte liegt. Vor den beiden breiten Schießscharten stehen niedrige Plattformen aus Brettern, auf denen je ein MG 42 postiert ist. Daneben liegt ein Haufen gegurtete Munition.
„Obergefreiter Röttger meldet sich vom Sonderlehrgang aus Nowe Miasto zurück!“ Willi steht so ähnlich wie stramm und blinzelt in das grelle Licht.
„Aaah – der Röttger ist wieder da!“, ertönt eine sanfte Männerstimme, und Oberleutnant Drechsler kommt um den Kartentisch herum: ein gepflegt aussehender älterer Herr im fußlangen Mantel, gelbem Wollschal, Hornbrille und mit rosigem Gesicht. Die fünfte Kompanie führt er seit Oktober vorigen Jahres. Von Kriegsführung hat er wenig Ahnung, da er erst vor acht Monaten vom Ladentisch seines in Mühlhausen befindlichen Textilgeschäftes weg zur Wehrdienstleistung einberufen wurde.
Oberleutnant Drechsler ist schon Großvater, ein gütiger. Mit derselben Güte behandelt er auch seine Kompanie. Man nennt ihn – wenn er es nicht hört – deswegen auch Opa. Das EK eins an seiner Brust stammt aus dem Ersten Weltkrieg.
„Na, wie war’s, Röttger?“, fragt Drechsler den Obergefreiten und reicht ihm freundlich die Hand.
Willi bekommt einen laschen Händedruck zu spüren und sagt: „Prima, Herr Oberleutnant.“
Auch der Leutnant kommt heran: ein blutjunges Kerlchen, blass und schmal wie ein Handtuch.
„Sie kommen zur rechten Zeit, Röttger!“ Es klingt fröhlich. „Nun ist es bald so weit, und Sie müssen sich in die Heldenbrust werfen.“
Wie albern! Ob es auch dieser Junge tun wird?
„Viel Neues hinzugelernt, mein Sohn?“, erkundigt sich der gemütliche Herr in Uniform.
„Jede Menge, Herr Oberleutnant. Leider muss ich Ihnen aber den Verlust meines Wäschebeutels melden.“
„Das ist nicht so wichtig, Röttger. Hauptsache, Sie sind wieder da.“
Da ertönt aus dem Hintergrund des Bunkerraumes ein Bierbass. „Ja mei, der Röttger Willi is aa wieder da vom Lehrgang in Nowe Miasto.“
Der Bierbass gehört Unteroffizier Emil Huber, der als Hauptfeldwebel Dienst tut und am Rockärmel die Kolbenringe trägt. Huber ist von Beruf Pferdemetzger, wiegt über zwei Zentner, hat ein wohl genährtes Gesicht und trägt einen grauen Schnauzer unter der Kartoffelnase. Er ist Münchner, und ihm gehen Weißwurst und Bier genauso ab wie seine geliebte Vaterstadt. Lauter gemütliche Leute sind das, mit denen man bestens auskommen kann und die sich redliche Mühe geben, eine aus Magenkranken, Rheumatikern und sonstigen Genesenden bestehende Kompanie zu führen. Wie sie sich bewähren werden, wenn der Russe anrennt, ist für Willi ungewiss.
Er muss berichten, wie es in Nowe Miasto war. Dann spricht er von dem Bombenangriff und dem Chaos in Rawa.
Die Mienen werden ernst. Oberleutnant Drechsler nickt nur.
„Na, die Russen sollen bloß kommen“, sagt Leutnant von Zinnenberg, „denen werden wir schon einheizen.“
Das Telefon rasselt.
Drechsler nimmt den Hörer auf, meldet sich mit dem Decknamen der Kompanie, horcht und nickt ein paar Mal.
„Jawohl“, sagt er dann und klappt leicht die Hacken seiner dicken Filzstiefel zusammen, was einen dumpfen Ton erzeugt. „Ende.“
Der Hörer klappert auf den Apparat zurück.
Oberleutnant Drechsler reibt sich mit Daumen und Zeigefinger die Nase; dann sagt er mit dramatischer Schwere:
„Meine Herren, der Feind ist aus allen Brückenköpfen heraus zum Angriff angetreten.“
Schweigen.
Huber zwirbelt nervös an seinem Schnauzbart. Leutnant von Zinnenberg tritt an den Tisch und beugt sich über die Karte; dann legt er die gepflegte Hand darauf und sagt:
„Wir werden unsere Stellungen halten … wir haben die Besten. Er soll nur kommen!“
O du lieber Augustin, denkt Willi und verlässt grüßend den Bunker.
Als er die schmale Treppe hinaufsteigt, taucht oben eine Gestalt auf und breitet die Arme aus.
„Willi! Alter Kumpel! Servus!“
„Mensch, Emmes – Hundling! Knallkopp!“
Die beiden Freunde umarmen sich.
Emmerich, von Willi „Emmes“ genannt, ist ein hübscher Kerl. Seine schlanke Gestalt verschwindet in einem langen Mantel, und deshalb wirkt auch der Kopf etwas zu klein, zu schmal. Er hat leicht vorstehende Backenknochen und hellblaue, gescheite Augen, die meist kritisch die Geschehnisse beobachten und betrachten.
Emmerich Sailer stammt aus der Gegend von Klagenfurt. Dort hat seine Mutter ein kleines Häuschen und lebt von einer Pension, die ihr der durch einen Werksunfall ums Leben gekommene Mann hinterlassen hat. Davon hat Frau Sailer ihren Sohn in Wien Chemie studieren lassen. Er ist mit dem Studium nicht fertig geworden, weil er 1943 zum Militär einberufen wurde, ist aber fest entschlossen, es nach Kriegsende fortzusetzen.
Emmes ist Willi, was Bildung anbelangt, turmhoch überlegen, aber das stört die guten Beziehungen zueinander nicht im Geringsten. Sie haben sich vor einem Jahr in Teisendorf bei Klagenfurt in einem Ersatz-Bataillon kennen gelernt und sind seither immer beisammengeblieben.
„Erst ’ne Zigarette“, sagt Emmes und hält Willi die zerdrückte Juno-Schachtel hin.
„Mensch, ich bin froh, dass ich wieder da bin“, brummt Willi, als er von Emmes Feuer gereicht bekommt. „Und was ist hier los?“
„Hörst es ja, Spezl“, lächelt Emmes. „Krieg hab’n ma schon die ganze Zeit.“
„Das hab ich auch schon bemerkt“, grinst Willi. „Ob beim Pionierzug noch alles beisammen ist, wollte ich wissen.“
„Noch allweil alles da“, sagt Emmes, und Willi lauscht entzückt dem steiermärkischen Dialekt, den er so lange entbehrt hat und der ihm jetzt ein Gefühl heimatlicher Geborgenheit verursacht.
„Der Sepp Lechner ist noch immer unser Zugführer“, setzt Emmes lächelnd fort, „und der Lehmann, der Müller … der ganze Haufen is noch beisammen. Mit dir san wir jetzt wieder komplett, Willi. Übrigens – der Lehmann hat mir gesagt, dass du deinen Wäschebeutel verloren hast, du Depp, du damischer! Wie kann man Schnaps und Zigaretten verlieren?“
„Das hat der Lehmann mich auch schon gefragt. Aber es ist nicht mehr zu ändern, Emmes.“
„Macht nix, Spezl. Die Wiedersehensfeier wird trotzdem abgehalten. Meine Mutter hat mir vor ein paar Tagen ein zünftiges Packerl g’schickt, und da war, unter anderm, auch ein Flascherl Sliwowitz drin.“
Willi drischt dem Freund auf die Schulter. „Mensch, da ist ja alles dran!“
Emmes wird ernst. „Bist grad in den Schlamassel reingekommen, gell?“
„Nicht ganz. Kurz vor Rawa haben wir bemerkt, was los ist. Ich bin mit einem Lkw gekommen. Zwei oder drei Kilometer vor Rawa haben wir den Bombenangriff miterlebt. Scheußlich, sag ich dir. In der Stadt schaut es schlimm aus … ich möchte jetzt nicht mehr dran denken, Emmes. Reden wir lieber von was anderm.“
„Unkraut vergeht nicht“, sagt Emmes, und dann gehen sie langsam davon, zwei unterschiedliche Gestalten, aber doch ein Herz und eine Seele.
Der Kanonendonner östlich Rawa nimmt an Stärke zu und scheint näher zu kommen.
2
Die Front ist in Bewegung geraten. Auf den Straßen und Nebenwegen fluten ununterbrochen deutsche Kampfgruppen zurück. Es heißt, der Russe sei nicht mehr aufzuhalten und rücke mit Panzern und motorisierten Schützenbrigaden heran.
Die Rauchwolke über Rawa ist abgezogen. Eine Nacht lang herrscht bedrückende Ruhe. Die polnische Bevölkerung, die unter der Kriegsfurie am meisten leidet, hat aus den Häusern noch gerettet, was zu retten war. Obdachlos gewordene Familien fliehen auf Panjeschlitten oder mit einem Handkarren zu Bekannten oder Freunden irgendwo westlich der gemarterten Stadt, andere ziehen es vor, daheim zu bleiben und den Russen zu erwarten.
Der zeigt sich seit dem Bombenangriff immer häufiger. Kaum dass die Rauchwolke über Rawa verschwunden ist, tauchen die gefürchteten IL 2-Schlachtflieger auf und jagen im Tiefflug heran, alles unter Beschuss nehmend, was sich im freien Feld, in der Stadt, auf den Straßen zeigt.
Der Kanonendonner rückt immer näher. Auf den Straßen herrschen wirre Zustände. Kopfloses Durcheinander, wohin man schaut. Es scheint, als ob es keine Führung mehr gäbe, und jeder tut das, was ihm das Richtige zu sein dünkt. Niemand ist da, der die zurückgehenden Infanterie- und sonstigen Kampfeinheiten aufhält und neu ordnet.
Mit den zurückflutenden Soldaten kommen auch Nachrichten.
„Da ist kein Halten mehr“, sagen sie. „Da gibt’s nur eins: zurück, sonst wirste in die Pfanne gehauen. Alles ist hin.“
Die sowjetischen Marschälle sind mit ihren Armeen in einem unaufhaltbaren Vormarsch. Sie haben die Offensive gut vorbereitet und mit einer nur sieben- bis achtstündigen Kanonade aller Kaliber den Feind aus seinen Stellungen vertrieben und zum unweigerlichen Rückzug gebracht.
Bunkerlinien, an denen Jahre lang gebaut wurde, werden im Handumdrehen genommen, Stellungen, die man für uneinnehmbar hielt, nach kurzem Trommelfeuer verlassen.
Millionen Zentner Baustoffe sind umsonst vertan worden und werden von den Sowjets bestaunt und freudig begrüßt. Der deutsche Widerstand scheint so gut wie endgültig gebrochen zu sein. Das Drama erfüllt sich. Stärkste Sowjetverbände, ausgerüstet mit den neuesten, von den USA gelieferten Waffen, ausgeruht und siegesgewiss, umschließen den Raum von Warschau und schlagen unbarmherzig jeden Widerstand nieder. Der Sowjetmarschall Schaposchnikow hat die große Zange gut durchdacht, mit der er die Deutschen fassen will.
Auf den Hügeln vor Rawa liegt das 662. SMG-Bataillon und erwartet die erste Feindberührung.
Pak ist in Stellung gegangen, frierend stehen die Soldaten in den knochenhart gefrorenen Gräben und beobachten das vor ihnen liegende Gelände.
Noch zeigt der Feind sich nicht, aber dass er näher und näher kommt, hört man aus dem Geschützlärm hinter den verschneiten Hügeln und Wäldern. Über die schmalen Wege keuchen Panjefahrzeuge, auf denen zurückgehende Infanteristen ihre Waffen und Munition gepackt haben. In Einzelgruppen tauchen die Fliehenden auf und verschmelzen auf den Straßen mit dem kunterbunten Wirrwarr einer auseinander fallenden Armee.
Der Pionierzug der 5. Kompanie liegt in zwei Bunkern auf dem Hügel.
Willi Röttger und Emmerich Sailer haben den Umtrunk mit den Kameraden abgehalten und harren der Ereignisse, die da kommen sollen.
„’s wird schon schief gehen, Willi“, seufzt Emmes, als er mit dem Freund auf dem Hügel steht und durch das Glas den Rauch am östlichen Horizont beobachtet.
„Das wird auch nirgendwo mehr halten“, brummt Willi. „Die ganze Bunkerbauerei ist Blödsinn gewesen.“
Emmes lässt das Glas sinken und schaut den Freund an.
„Irgendwie ist der Wurm drin, Willi. Schon lange. In der obersten Führung stimmt’s nimmer so wie früher. Wir schaun da noch net dahinter, aber wir werden’s bald wissen.“
„Du meinst also, dass der Krieg verloren ist?“
„Glaubst du noch an den Sieg, Willi? Sei ehrlich!“ Willi schüttelt den Kopf so heftig, dass der Stahlhelm hin und her rutscht.
„Wir müssen jetzt nur sehen“, sagt Emmes halblaut und wie zu sich selbst, „dass wir heil rauskommen. Mein Mutterl hat niemanden mehr als mich. Wenn ich ihr auch noch verloren geh, dann …“ Er bricht ab.
„Wir haben bisher immer Glück gehabt, Emmes“, sagt Willi leise, „wir werden es auch diesmal haben. Ich hab das so im Gefühl, weißt du.“
Der Steiermärker schaut den Freund lächelnd an. „Gefühle, Willi – im Krieg nützen dir die Gefühle nix … Aufs Glück kommt’s an, merk dir das.“
„Sag mir, Emmes, wozu das alles noch gut sein soll?“
„Willst es wirklich hören, Willi?“
„Na?“
„Ganz drunt liegen müssen wir erst am Boden, Willi“, sagt Emmes ruhig, wie es seine Art ist. „Das, was uns jetzt regiert, muss restlos ausgemerzt werden. Erst dann werden wir wieder hochkommen, erst dann wird Deutschland ein neues Gesicht bekommen.“
„Vielleicht erleben wir’s nicht mehr, Emmes.“
„Kann sein, ja“, murmelt der Steiermärker, „aber die anderen werden es erleben, Willi.“
„Davon haben wir zwei nischt.“
Emmes schaut den Freund lächelnd an. „Hast Angst, Willi?“
„Du nicht?“
Emmes zuckt die Achseln. „Ich will net hier verrecken, Willi, ich will woanders sterben – daheim oder in meinen Bergen. Bloß net hier! Dös Land ist mir zu unheimlich, zu fremd. Und deshalb werd ich, wenn’s hart auf hart geht, genau aufpassen, was besser ist: Heldentod oder Weiterleben.“
Willi schaut den anderen verwundert an. So hat Emmerich Sailer noch nie geredet. Er ist doch ein gescheiter Kerl, denkt Willi, er hat auch Recht. Keiner will hier sterben. Man muss sich dagegen wehren.
Die Nacht weht heran. Es ist nicht mehr so kalt wie am Vortag. In den Bunkern herrscht bedrückte Stimmung.
„Pionierzug – antreten!“, heißt es mitten in der Nacht.
Fluchend rappeln die Soldaten sich aus den Decken, suchen ihre Klamotten zusammen und treten hinter dem Bunker an.
Der dunkle Himmel zuckt und blitzt im Widerschein der feindlichen Mündungsfeuer.
„Pionierzug – stillgestanden!“, ertönt die scharfe Stimme Sepp Lechners.
„Danke“, antwortet das hohe Organ des jungen Leutnants . „Lassen Sie rühren, Lechner.“
Die Soldaten ahnen, dass es mit der Nachtruhe vorbei ist. Und da sagt auch schon Leutnant von Zinnenberg:
„Der ganze Zug rückt zum Bunkerbau aus. Melden Sie sich auf Höhe einhundertdreiundzwanzig, Feldwebel Lechner. Dort müssen noch schnell zwei Bunker fertig gestellt werden. Ist das klar?“
Feldwebel Sepp Lechner stößt den Atem durch die Nase. Jetzt noch schnell zwei Bunker zu bauen, wo der Feind schon in Reichweite ist, mutet ein bisschen sinnlos an.
„Hat denn das noch einen Zweck, Herr Leutnant?“
„Ob Zweck oder nicht – das ist ein Befehl, Lechner“, erwidert der junge Leutnant nervös. „Der Major wünscht, dass auf der Höhe einhundertdreiundzwanzig noch zwei Bunker gebaut werden. So schnell wie möglich. Damit wird die linke Flanke unserer Kompanie noch zusätzlich verstärkt.“
„Herr Leutnant“, sagt Lechner ruhig, „ich möchte darauf hinweisen, dass …“
„Ich brauche Ihre Meinung nicht“, lautet die scharfe Erwiderung. „Rücken Sie jetzt ab.“
„So ’n Blödsinn“, murmelt Lechner.
„Was haben Sie gesagt?“, schreit von Zinnenberg; seine Jungenstimme überschlägt sich vor Erregung. „Wiederholen Sie das noch einmal, Feldwebel Lechner.“
„Blödsinn, hab ich gesagt.“
„Sie sind wohl verrückt geworden, Lechner!“
„Es wäre kein Wunder, Herr Leutnant.“
Die Soldaten feixen.
Da schreit Zinnenberg: „Ich werde Sie zur Meldung bringen! Ich werde einen Tatbericht gegen Sie einreichen!“
Lechner überhört die Drohung und wendet sich seinen Leuten zu: „Los, Jungs, holt die Klamotten her.“
„Ich habe mit Ihnen gesprochen, Feldwebel Lechner!“
„Ja, ja, schon gut, Herr Leutnant. Tun Sie, was Sie nicht lassen können.“
„Morgen früh melden Sie sich beim Chef zum Rapport“, zischt Zinnenberg und geht davon.
„So ’n Spinner“, sagt Willi ganz laut.
Zehn Minuten später trabt der Pionierzug querfeldein. Vornweg stampft der hünenhafte Lechner. Unteroffizier Lehmann holt ihn ein und sagt:
„Du, Sepp, wenn der Zinnenberg dir einen Tatbericht anhängt, dann werd ich sauer, dann …“
„Ach Quatsch“, brummt der Feldwebel. „Mach dir keine Sorgen, Kurt. Wer weiß, was morgen ist.“
„Ja, wer weiß“, murmelt auch Lehmann.
Die im Gänsemarsch gehenden Gestalten verschwinden zwischen weißen Hügeln.
Der Himmel bewölkt sich, die Nacht ist finster und voller dumpfer Geräusche.
Trotz Dunkelheit und Frost werden halb links drüben auf dem lang gestreckten Hügelrücken in aller Eile noch zwei Erdbunker mit Decken und Stirnwänden aus Beton gebaut. Raupenfahrzeuge und organisierte Panjeschlitten haben das notwendige Baumaterial und Wasser in Fässern für die Betonmischung herangeschafft. Etwa ein Dutzend schweigsamer Polen arbeitet mit den Pionieren.
Es ist eine harte Arbeit, in der man keinen rechten Sinn mehr sehen kann. Aber Befehl ist Befehl. Irgendjemand beim Bataillonsstab hat die Bauarbeit befohlen, um die von Süden nach Norden verlaufenden Hügel noch stärker zu befestigen. Keiner drückt sich vor der Arbeit, denn es ist bitterkalt, und müßiges Herumstehen duldet der Frost nicht.
Die Zivilisten mischen Zement und Sand. Die Mischung muss sofort aufgeschüttet werden, da sie sonst zu Klumpen zusammenfriert.
Willi und Emmes arbeiten nebeneinander.
„Den Wievielten haben wir denn heute?“, fragt Emmes.
Willi muss erst nachdenken.
„Den Dreizehnten“, sagt er dann.
„Na pfüati“, murmelt Emmes, „ausgerechnet der Dreizehnte.“
„Abergläubisch?“
„Dahoam wär ich’s net, aber hier schon.“ Emmes legt die Schaufel beiseite und steigt auf den Bunker. Von dort aus schaut er nach Osten.
Das Land ist weiß und verflacht sich vom Fuße des Hügels weg. Eine schmale Straße läuft rechts des Hügels vorbei; sie kommt weit drüben aus einem Wald, hinter dem die Mündungsfeuer sowjetischer Artillerie zucken. Die Einschläge liegen aber weit links – irgendwo auf einer anderen Straße und in der Nähe eines polnischen Dorfes.
„Na, Sailer“, sagt jemand zu Emmes; es ist Lechners Stimme, „was gibt’s? Sehen Sie was?“
„Nein, Herr Feldwebel – noch nichts. Ich schätze nur die Entfernung bis zur russischen Ari ab.“
„An die zwanzig bis fünfundzwanzig Kilometer werden es sein“, sagt Lechner.
„Dann ist der Iwan bald da. Morgen vielleicht schon.“
„Da ist der Zement noch nicht einmal hart“, murmelt Lechner. „Wir vertun nur noch Kraft und Geld. Und wofür, Sailer … sage mir, wofür? Sie sind doch Student, Sie können denken, und Sie haben auch zwei Augen im Kopf.“
„Auf meine Meinung kommt’s net mehr an, Herr Feldwebel.“
Lechner, elf Jahre Soldat, von Anfang an schon dabei, ist in Erregung geraten.
„Sailer“, sagt er, „mir tut jeder Sack Zement Leid, den wir noch verbuttern. Und was ist nicht schon alles verbuttert worden in diesem Mistkrieg in Bunker und Befestigungen, Millionen und Millionen Säcke Zement von Kurland bis in die Karpaten! Und wo sind die Bunker heute? Hin sind sie. Der Russe hat sie. Weg für immer. Wir kriegen sie nie wieder zurück, Sailer – nie wieder! Und was hätten wir nicht alles von diesem Zement bauen können! Unsere zertepperten Städte daheim, unsere Häuser, die der Tommy und der Ami zu Klumpen gehauen haben! – Sehen Sie, Sailer, deshalb ist mir heute die Galle hochgekommen, als man uns zum Bunkerbau abkommandiert hat. Nicht der Zinnenberg mit seiner Eunuchenstimme hat mich aufgeregt, sondern der Befehl, Sailer – alle diese Befehle!“
„Sie haben Recht, Herr Feldwebel“, erwidert Sailer, der die Erregung des verdienten Soldaten spürt und versteht. „Aber wir können’s net mehr ändern – wir müssen mitmachen, bis alles auseinander bröselt.“
Lechner hat Sailers Arm gepackt und drückt ihn heftig.
„Sailer, wissen Sie, was diese Hornviecher machen müssten? – Dort befestigen, wo wir am ersten September neununddreißig angefangen haben! Dort müssten wir allen Zement verbauen, den wir in Deutschland noch haben. Von Danzig runter bis Wien. Einen Ostwall! Das hätte noch einen Zweck, Sailer – aber hier? Hier ist der Bart ab. Das ist so sicher wie ’s Amen im Vaterunser, Sailer.“
„Und wie wird’s weitergehen, Feldwebel?“, fragt Emmes.
Lechner schweigt. Er atmet schwer. Dann sagt er:
„Wir werden es bald wissen, Sailer. Gehen Sie jetzt wieder an Ihre Arbeit.“
Der Bunkerbau geht weiter. Als der Morgen aufsteigt, sind die beiden Hügelbefestigungen fast fertig. Die Soldaten und Zivilisten sehen übernächtigt und erschöpft aus. Lechner befiehlt gerade, Schnee über die ausgehobene Erde zu werfen, als weit drüben Fahrzeuge aus dem Wald kommen und eilig die Straße entlangrollen. Vier Lkw sind es mit aufgesessenen Soldaten.
Kaum dass sie vorbei sind, kommen drei Sturmgeschütze nach. Auch auf ihnen hängen Trauben von Soldaten, die schrecklich frieren müssen; aber sie ziehen das der Gefangenschaft vor.
Lechner ist rechts des Hügels hinabgesprungen und stellt sich winkend auf die Straße.
Die drei Sturmgeschütze halten. Lechner tritt an das erste heran und spricht mit den Soldaten. Dann brüllen die Motoren wieder, und die drei mit Schneestaub überpuderten Sturmgeschütze rollen weiter. Nach Rawa. Weiß Gott, wie es dort aussehen muss, denn die ganze Nacht hindurch sind zurückflutende Kampfverbände eingetroffen und versuchen, in westlicher Richtung weiterzukommen.
Lechner ist wieder auf dem Hügel bei den Bunkern. Die Leute schauen ihm fragend entgegen.
„Was ist vorn los?“, fragt Lehmann.
„Nicht mehr zu halten“, sagt Lechner. „Alles rennt zurück. Der Iwan stößt mit Panzern und starken Infanteriekräften nach.“
„Na also“, murmelt jemand, „da wär’s ja wieder mal so weit: Vorwärts, Kameraden – wir müssen zurück!“
„Es wird weitergebaut, Leute!“, ruft Lechner. „Los, an die Arbeit! Macht euch warm!“
Der Morgen ist diesig kalt. Die Sonne verbirgt sich hinter einer dichten Dunstwand. Auf der Straße tauchen immer wieder aufgelöste Kampfgruppen auf, die nach Rawa hasten.
Das Grollen der sowjetischen Artillerie ist merklich näher gerückt.
Gegen sieben Uhr morgens kriecht ein Raupenfahrzeug heran und bringt die Verpflegung für die Bunkerbauer: heißen Kaffee, Brot und Margarine.
Der Fahrer des kleinen Raupenfahrzeugs erzählt, dass es in Rawa drunter und drüber gehe. „Du kommst kaum mehr durch, alles verrammelt und verstopft.“
Stehend nehmen die Pioniere und die polnischen Zivilisten ihr Frühstück ein. Ihre Hände halten den dampfenden Trinkbecher. Die Margarine ist gefroren und muss auf dem Brotkanten zum Munde balanciert werden.
Die polnischen Arbeiter schauen oft zum Wald hinüber und reden leise miteinander.
„Du“, sagt Willi zu Emmes, „hoffentlich werden die drei Sturmgeschütze aufgehalten und bleiben bei uns. Dann hätten wir doch wenigstens was, wenn’s los geht.“
Noch ist man beim kargen Frühstück, als plötzlich über dem Wald dunkle, tief fliegende Punkte auftauchen und rasend schnell näher kommen.
Lechner, der wie ein Schäferhund auf seine Herde aufpasst, hat das Unheil sofort erkannt.
„Volle Deckung!“, brüllt er seinen Leuten zu.
Ein Dutzend der gefürchteten IL 2-Bomber rast im Tiefflug heran. Zwei von ihnen halten direkt auf den Hügel zu.
Wie die Wiesel sind die Bunkerbauer verschwunden und suchen in den Bunkern Schutz. Dann kracht es auch schon.
Brandbomben sind es, mit denen die Rotarmisten angreifen. Im spitzen Flugwinkel sausen die Bomben heran, schmettern nieder, entfachen brandrote, kochende Qualmwolken und prallen ab, sausen über die Hügelkuppe hinweg und verbrennen auf dem flachen Gelände.
Ohrenbetäubend, reißend ist das Brüllen dieser scheußlichen Bomben.
Die Soldaten liegen flach in den beiden frisch gebauten Bunkern. Sie hören das Dröhnen der abfliegenden Maschinen und das sich entfernende Krachen weiterer Einschläge.
„Na, prost Mahlzeit“, lässt sich jemand vernehmen, „das war’n ganz schöne Dinger, wenn die uns uff ’n Kopp gefallen wären …“
Die lähmende Angst weicht. Die Gestalten im Halbdunkel erheben sich wieder.
„Herr Feldwebel“, ertönt die heisere Stimme eines Berliners, „könn’ ma nu wieder uff’s Jässchen, oder soll’n ma lieba noch ’n Augenblick wart’n?“
„Ich schau mal nach“, sagt Lechner und geht hinaus.
„Du“, flüstert Emmes dem Willi zu, „der Lechner hat die Nase gestrichen voll.“
„Wer hat das nicht“, flüstert Willi zurück. „Was hat er denn gesagt?“
Emmes erzählt Willi von dem Gespräch mit Lechner, worauf Willi antwortet:
„Da siehst du’s, Emmes – jetzt auch der Lechner. Das wundert mich eigentlich. Der war doch sonst immer auf Zack.“
„So geht jedem von uns a Lichtl auf, Willi“, murmelt Emmes.
„Dem einen früher, dem anderen später.“
„Raus!“, ertönt das Kommando vom Bunkereingang her. „Weitermachen, Kameraden!“
Über Rawa kreisen noch die russischen Schlachtflieger, als die Pioniere und polnischen Zivilisten zu ihrer Arbeit zurückkehren.
3
Seit einer Stunde liegt Rawa unter starkem Artilleriebeschuss des Feindes. Heulend fliegen die Granaten heran und schlagen zwischen den Bunkern und in der Stadt ein. Es ist ein systematisches Feuer, mit dem der Russe seinen Angriff vorbereitet.
Auf allen Straßen, die aus östlicher Richtung heranführen, hasten deutsche Panzer und Artillerie zurück, dazwischen Trossfahrzeuge, Panjeschlitten und Soldaten, denen Mut und Hoffnung genommen worden sind.
Im Gefechtsstand der 5. Kompanie herrscht bedrückte Stimmung. Man steht Gewehr bei Fuß: ein schwaches Bataillon, zusammengestellt aus Magenkranken und kaum Genesenen, aus jungen, unerfahrenen Männern und alten Herren, denen vor ihrer eigenen Courage bangt. Nur der Pionierzug, 38 Mann stark, stellt so etwas wie eine verlässliche Kampfgruppe dar.
Die beiden in der Nacht gebauten und noch nicht ganz fertigen Bunker auf der Höhe 123 sind – wie konnt’s anders sein – befehlsgemäß im Stich gelassen worden. Oberleutnant Drechsler ist es lieber, wenn der Pionierzug in unmittelbarer Nähe verbleibt.
Der Zug verteilt sich auf zwei größere und zwei kleinere Bunker, von denen aus man das Vorgelände weit übersehen und unter MG- und Pakbeschuss halten kann.
Vier Pakgeschütze sind zwischen den Bunkern in Schneeburgen in Stellung gegangen. Weiter hinten, am Stadtrand von Rawa, soll eine IG-Batterie in Stellung sein.
Oberleutnant Drechsler hat seine großväterliche Ruhe verloren. Er geht im Gefechtsbunker auf und ab. Sobald einer der Fernsprecher rasselt, zuckt er unmerklich zusammen.
Jetzt wieder.
„Das Bataillon“, sagt der junge Nachrichtenmann mit dem flaumbärtigen Gesicht und reicht Drechsler den Hörer.
„Hier ,Nordstern‘“, meldet er sich. „Drechsler am Apparat.“
Der Adjutant ist an der Strippe.
„Feind geht mit starken Kräften in Richtung Rawa vor.“ Die Stimme klingt nervös. „Es ist damit zu rechnen, dass er in der nächsten Stunde auftaucht. Stellungen müssen in jedem Falle gehalten werden, Nordstern.“
„Wir werden unser Bestes tun“, murmelt Drechsler. „Kann ich auf Artillerie-Unterstützung rechnen?“
„Ja. Die VB sind bereits unterwegs. Weisen Sie sie bitte ein. Sonst noch eine Frage?“
„N … nein“, sagt Drechsler.
„Gut. Geben Sie Alarm, Nordstern. Meldungen über den Feind sofort durchgeben. – Ende.“
„Ende“, murmelt Drechsler.
In diesem Augenblick hört man das wimmernde Heulen einer Granate. Dann erfolgt ein dumpfer Schlag.
Drechsler hat den Hörer auf den Apparat fallen lassen und sich schnell an die Bunkerwand gedrückt. Leutnant von Zinnenberg, der gerade dabei war, sich ein Paar neue Socken anzuziehen, liegt platt auf dem Betonboden.
Als die Detonation vorbei ist, bleibt es für Sekunden still, und aus dieser beklemmenden Stille heraus ertönt Drechslers bebende Stimme:
„Wir müssen mit dem Auftauchen des Feindes in der nächsten Stunde rechnen, meine Herren.“
„Und was ist mit der Artillerieunterstützung, Herr Oberleutnant?“, fragt der Leutnant.
„VB sind bereits zu uns unterwegs.“
„Na wunderbar“, murmelt von Zinnenberg und setzt sich wieder auf die Munitionskiste, um den zweiten Socken anzuziehen.
„Stellen Sie eine Verbindung mit Sonnblick her, Schmidt“, sagt Drechsler zu dem jungen Nachrichtenmann.
Sepp Lechner und acht Mann seines Zuges befinden sich im Bunker Sonnblick. Drei schussbereite MG 42 stehen auf den MG-Tischen. Die Munition liegt griffbereit.
Im Augenblick schlafen die acht Mann. In die dünnen Decken gewickelt liegen sie am nackten Boden und ruhen von der Schinderei der vergangenen Nacht aus. Das Krachen der Einschläge stört sie nicht.
Sepp Lechner hockt, mit dem Rücken an die kalte Bunkerwand gelehnt, vor einem kleinen Benzinofen, der vergebens etwas Wärme auszuhauchen versucht.
Als das Telefon rasselt, fahren ein paar der Schläfer aus den Decken hoch.
„Was ’n los?“, fragt jemand.
Lechner nimmt den Hörer vom Apparat und meldet sich. Der Chef spricht.
Sepp nickt ein paar Mal, murmelt zwischendurch „jawohl“ und legt dann wieder auf.
„Alarm, Herr Feldwebel?“, fragt einer der Pioniere.
„Ja, meine Herren. Raus aus den Decken, ran an die Spritzen. Der böse Feind naht!“
„Det Jeschäft is richtig“, lässt sich der Berliner vernehmen. „Dann man auf, Sportfreunde! Jetzt müss’n ma unsern Wehrsold abarbeiten.“
Ein paar Lacher werden laut, dann begibt sich jeder auf seinen Posten.
Im Bunker Berta ist ebenfalls alles an den Waffen. Unteroffizier Kurt Lehmann geht noch einmal hinaus und schaut nach, ob die Kameraden von der Pak gefechtsbereit sind.
Emmes und Willi haben den linken MG-Tisch besetzt. Durch die breite Schießscharte kann man das Gelände in einem begrenzten Ausschnitt übersehen.
Alfons Brandl, der MG-Schütze Nr. 2, klirrt mit den MG-Gurten. Emmes probiert die Gleitfähigkeit des Schlosses und legt dann den ersten Munitionsgurt ein.
Am linken MG-Tisch wird ebenfalls an der Waffe herumgemurkst.
Schweigen herrscht.
Draußen wummern die Einschläge. Mal nah, mal weiter weg steigen die Explosionspilze auf und beschmutzen den Schnee mit hässlichen, dunklen Flecken.
„Wenn sie kommen, dann schicken sie erst Panzer vor“, sagt Willi.
Die Worte zerreißen das Schweigen, klingen hohl wie in einer Gruft.
„Wir haben ja Pak da“, antwortet Emmes und schaut probeweise über die Zieleinrichtung des Maschinengewehres, schwenkt es hin und her, setzt es wieder ab und wendet sich an Willi: „Rück’ a Zigarettl raus, Spezi.“
Willi sucht in den Manteltaschen nach der Packung und verteilt zwei Stäbchen. Emmes gibt das Feuer dazu.
Als Willi seine Zigarette anbrennt, sieht er, dass Emmes’ Hand zittert.
„Bammel?“, fragt er grinsend.
„Net direkt“, murmelt Emmes, „nur ums Krawattl ist mir ’n bissl eng.“
Auch Brandl raucht an und stößt den Rauch zischend durch die Zähne.
„Das wird ’n ganz schönen Rabatz geben“, sagt er. „Bin neugierig, wann er losgeht.“
„Wir können’s erwarten“, sagt Emmes.
Drüben, am zweiten MG-Tisch, unterhält man sich halblaut über Warschau.
„’s ist nimmer so kalt wie heut früh“, sagt Emmes. Er redet nur, um etwas zu reden und sich von dem abzulenken, was man alle Augenblicke erwartet.
„Vielleicht kriegen wir wieder Schnee“, sagt Willi und späht durch die Schießscharte.
Das Gelände ist leer. Die Sonne ist verschwunden, der Himmel ist grau. Weit drüben steht der verschneite Wald.
„Ja“, murmelt Willi, „ich riech’s direkt, dass es Schnee gibt.“
„Das wär mies“, sagt Emmes, „dann sehn wir nix, und der Russ’ hat’s leicht mit dem Rankommen.“
„Der kommt auch so ran“, sagt Brandl, an der Zigarette saugend. „Oder denkt ihr, dass wir ihn aufhalten und bis Moskau zurückjagen können?“
„Der Traum ist wohl aus“, erwidert Emmes und geht in die Bunkerecke, kramt im Tornister und holt eine kleine, bauchige Flasche hervor.
„Mensch! Du hast noch was?“, schmunzelt Willi. „Du bist ja wie eine Eichkatz, die hat auch immer was versteckt.“
„Mein letztes Flascherl“, sagt Emmes traurig und schraubt den kleinen Aluminiumbecher ab. „Danziger Goldwasser“ – aus der Steiermark. „Trinken wir’s aus, denn wer weiß, ob wir noch dazu kommen. – Prost, Muatterl!“, murmelt er und trinkt einen kleinen Schluck.
Willi und Brandl bekommen auch einen Schluck ab.
„Mensch – nu guckt mal!“, ruft einer vom 2. MG herüber, „die saufen Schnaps! – Los, her mit dem Zeug … her damit!“
Das kleine Fläschchen Danziger Goldwasser von Mutter Sailer macht die Runde und ist schnell leer. Mit dem süßen Geschmack des Getränkes auf der Zunge lässt es sich besser reden.
„’n paar Witze!“, ruft jemand. „Los, wer weiß ’n Witz?“
Als Unteroffizier Lehmann hereinkommt, werden Witze erzählt.
„Warum kann ’n Schwein nicht Rad fahr’n, Kameraden?“
„Wie doof! – Weil’s ’n Schwein ist, Knallkopp!“
„Nee – weil’s keinen Daumen hat zum Klingeln!“
„Hahahaaaa …“
Aus dem Bunker Berta ertönt Gelächter.
Dann wird gesungen. „Es ist so schön Soldat zu sein, Roosemarie …“
Der Wald drüben entlässt noch immer nicht den Feind. Die schmale Straße bleibt leer.
„Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein …“, singen sie jetzt.
Der Uhrzeiger macht seine Runden, ohne dass etwas geschieht. Nur das feindliche Artilleriefeuer orgelt weiter.
Huuiiiii … wumm … rrrreng …
„Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt ich auf sein …“
„Aus! So’n Trauermarsch wird jetzt nicht gesungen! Was anderes!“
„Dann ,Heimat deine Sterne‘!“
„Ooooch traurig.“
„Ich weiß eins! – ,Kennen Sie Lamberts Nachtlokal, dort ist’s wirklich kolossal …‘“
Emmes hat seine Mundharmonika hervorgeholt und spielt darauf. Er spielt gut. Sein Zungenschlag ist virtuos.
Im Bunker Berta singt man auch noch, als es dunkel wird und leiser Schneefall einsetzt. Die Essenholer gehen davon und kommen lachend wieder.
„Menschenskinder – Sondermeldung!“, rufen sie schon von weitem.
„Was denn? Ist der Krieg aus?“
„Nee! Schnaps-Sonderzuteilung! Pro Gruppe ’ne Flasche Dreistern!“
Gejohle bricht an. Der Krieg und der anrückende Russe sind vergessen. Der Bataillonskommandeur hat Schnaps verteilen lassen. Schnaps stärkt das Durchhaltevermögen.
„Opa soll leben!“, grölen die Soldaten und schwenken die Trinkbecher. „Hoch soll er leben, hoch soll er leben …“
In den Bunkern wird es immer lustiger. Derweil schneit es draußen so dicht, dass man kaum die Hand vor den Augen sehen kann. Und langsam läuft die Schicksalsuhr ab.
Die Zug- und Gruppenführer haben Posten aufgestellt, die horchen sollen. Aber es passiert nichts.
„Krieg fällt aus wegen Schneegestöber“, lachen die Soldaten. „Krieg findet im Saale statt! Prost!“
Der Feind greift ganz anders an als erwartet. Er nimmt sich gar nicht die Mühe, die Bunker auf den Hügeln vor Rawa frontal anzugehen – er schlägt einen Bogen und packt Rawa im Zangengriff. Beim Bataillonsstab taucht plötzlich ein fremder Offizier auf und überbringt einen Divisions-Befehl: „Feind ist bereits durchgebrochen. Kompanien zurückziehen!“
Noch ehe man an den fremden Offizier Fragen richten kann, ist er weg. War es ein als Offizier getarnter Russe? Ein Agent? Eine Rückfrage beim Regiment bleibt unbeantwortet. Die Verbindung ist plötzlich unterbrochen.
„Ja, Panzergeräusche südlich und nördlich von Rawa!“, heißt es jetzt.
„Panzer!“, gellt es von Mund zu Mund. „Panzer!“
Der Bataillonskommandeur räumt seinen Gefechtsstand. „Kompanien zurückziehen!“, befiehlt er noch.
In Rawa rattern Maschinengewehre, krachen Handgranaten, klirren Panzerketten. Und es schneit noch immer, es schneit, als bräche der Himmel ein. Der Kampflärm erstickt in dem niedersinkenden weißen Vorhang.
Der Pionierzug hat sich müde gesungen. Weil kein Feind zu hören und zu sehen, legt man sich schlafen. Der Krieg findet eben erst morgen statt.
Lechner kann nicht schlafen. Er muss an viele Dinge denken – an die elf Jahre Dienstzeit, an die siegreichen Feldzüge und an den spinnenden Zinnenberg. Tatbericht! So ’n Quatsch! Warum bloß alles so still ist? Nicht einmal das Telefon rasselt. Ob man mal bei der Kompanie anfragen soll?
Lechner nimmt den Hörer vom Apparat und kurbelt. Lange meldet sich niemand. Dann eine lallende Stimme:
„Huber … Metzgerei Huber.“
Lechner stutzt. „Wer ist dort?“
Der Teilnehmer schnauft hörbar, und dann lallt er kaum verständlich und wie aus dem Schlaf geweckt: „Emil Huber … Metzgermeister … München … Fachingerstraß’n.“ Dann bleibt es still. Der besoffene Sprecher hat wohl aufgelegt.
So sehr Lechner auch am Apparat kurbelt, es meldet sich niemand mehr.
Wie betäubt hockt Lechner vor dem Fernsprechgerät. Die Gedanken überschlagen sich. Was ist passiert? Was ist bei der Kompanie los? Sind denn alle besoffen? Haben alle den Verstand verloren?
„Alarm!“, schreit Lechner, und die Schläfer sausen aus den Decken. „Pionierzug antreten. Alles mitnehmen! Los, Riebl, Unteroffizier Lehmann und die anderen verständigen: alles mit Waffen und Klamotten antreten!“
„Was’n los?“, fragen die Soldaten. „Ist der Iwan schon da?“
Der Zug tritt an.
Es schneit noch immer, aber nicht mehr so dicht. Das feindliche Artilleriefeuer ist verstummt. Aus Richtung Rawa hört man MG-Stöße. Sie klingen fern und stotternd.
„Etwas stimmt nicht, Kameraden“, sagt Lechner, als der Zug mit sämtlichen Waffen angetreten ist. „Der Kompaniegefechtsstand meldet sich nicht mehr, aber es ist trotzdem jemand dort. Der Huber … ich weiß nicht … Na ja, wir werden ja sehen. – Rechtsum – ohne Tritt marsch!“
Schweigend verschwindet der Zug über den Hang und trabt im Gänsemarsch durch die Nacht.
„Was da wieder los ist“, sagt Willi zu Emmes.
„Wir werden ja sehen, hat der Sepp Lechner gesagt“, erwidert Emmes.
Als der Pionierzug beim Kompaniegefechtsstand ankommt, schneit es nur noch dünn. In Rawa flackert Schützenfeuer, zwischendurch kleckert ein MG.
„Wartet hier“, sagt Lechner zu seinen Leuten und verschwindet auf der in den Bunker führenden Treppe.
„Mensch“, sagt jemand, „da kennt sich ja kein Aas mehr aus.“
Eine andere Stimme erwidert: „Vielleicht pennen sie alle.“
Lechner reißt die Zeltbahn vom Eingang. Der Bunker ist leer. Auf dem Tisch flackert ein Hindenburglicht. Die Karte liegt noch da, darauf die mit bunten Nadeln abgesteckte Frontlinie. Die beiden MG-Tische vor den Schießscharten sind leer. Am Boden liegt ein einsamer Stahlhelm.
Als Lechner einen Schritt tut, kollert etwas vor der Fußspitze: eine leere Schnapsflasche. Und der Raum riecht nach Alkohol, nach kaltem Zigarrenrauch.
Lechner wischt mit dem Fäustling unter der Nase weg und schüttelt benommen den Kopf.
„He!“, ruft er dann. „Hallo!“
Da ertönt aus dem Hintergrund ein Grunzton. Unter einem Deckenhaufen liegt Emil Huber, der Spieß, betrunken. Total betrunken. Ohne Stiefel. Halb angezogen. Der Fernsprechapparat steht neben dem Lager; der Hörer liegt am Boden, wie er aus der Hand gefallen ist.
Mit drei langen Schritten ist Lechner heran, packt Huber grob am Kragen und zerrt ihn hoch.
„Huber, du besoffenes Schwein! Los, auf! Mach’s Maul auf! Was ist hier vorgegangen?“ Er beutelt den schweren Mann.
Huber reißt mühsam die kleinen Äuglein auf, guckt sich verwirrt um, lallt etwas und schmatzt mit den Lippen. Dann will er sich wieder hinlegen, aber Lechner stellt ihn mit einem Fluch auf die wackeligen Beine.
„Mach’s Maul endlich auf, du Nachtwächter, du besoffener!“, schreit er so laut, dass es die draußen stehenden Soldaten hören.
Schritte poltern die Treppe herunter. Lehmann und noch ein paar vom Zug kommen herein und gucken verdutzt auf das seltsame Bild.
„Was ist denn los, Sepp?“, fragt Lehmann und kommt rasch heran.
„Du siehst es ja“, schnaubt Lechner. „Fort sind sie alle. Bloß den da haben sie hier gelassen. – Huber, Mensch, nun rede doch schon!“
Huber ist jetzt einigermaßen wach. Er rülpst und blinzelt verwirrt um sich. Sein grauer Schnauzer hängt traurig herab, das struppige Haar stachelt um den runden Kopf.
„Seppei …“, lallt er jetzt, „ach … du bist’s …“
„Wo sind die andern?“, fragt Lechner ungeduldig. „Wo ist der Chef … der Zinnenberg … wo sind sie hin?“
Huber guckt sich verwundert um, fährt sich mit der fleischigen Hand über Gesicht und Haare.
„Marandjosef“, stammelt er, „i bin ja alloan da!“
„Was war los?“
„I … i woass nix, Seppei …“, grient Huber und torkelt auf den Tisch zu. „Herrschaftsseiten … wenn ich nur wüsst’ … mein Kopf brummt wie a Bienenstock …“
„Du musst doch wissen, was hier los war!“, schnaubt Lechner zornig und versetzt dem dicken Münchner einen Stoß.
„G’soffa hab’n ma“, lallt Huber. „Ich woaß nur noch, dass wir g’soffa hab’n …“ Er sinkt auf den Klappstuhl und reibt sich mit den dicken Händen das Gesicht, um nüchtern zu werden.
„Das ist vielleicht eine Sauerei“, sagt Lehmann zu Lechner. „Die sind alle abgehauen – und den haben sie einfach dagelassen.“ Lehmann zeigt auf Huber, der sich langsam umdreht und blöd die beiden anstarrt.
„Jessas“, lallt er, „jetzt … jetzt merk ich endlich, was g’scheh’n is … Z’ruckg’lassen haben mich die Bazi, die dreckerten! Einfach davon san’s, die staubigen Brüder die!“ Er stemmt sich hoch und torkelt auf Lechner zu. „Mensch, Seppei – i dank’ dir, dass du gekommen bist!“
„Ist irgendein Befehl eingetroffen?“, fragt Lechner hastig.
„I woass von nix. Ich hab bloß g’soffa … dann hab i mi hing’legt und bin eing’schlafa.“
„Menschenskinder“, murmelt Lehmann, „man sollt es nicht für möglich halten.“
„Also abgehauen“, murmelt Lechner kopfschüttelnd. „Einfach abgehauen, ohne uns etwas zu sagen … wie die Schweine vom Trog.“ Er wendet sich Huber zu. „Los, zieh dich an, du Nachtwächter! Stahlhelm auf! Knarre mitnehmen! Du kommst jetzt mit uns.“
Huber nickt eifrig; er scheint plötzlich nüchtern geworden zu sein. „Bin glei fertig, Seppei … glei … Marandjosef, Marandjosef“, murmelt er, als er sich anzieht. „Fort san’s alle, die Bazi … zurückg’lassen habn’s mi …“
Wenn die Situation nicht so ernst wäre, man könnte lachen. Der Krieg spielt mit den Menschen wie mit Puppen.
Zehn Minuten nach dem Geschehnis im Bunker Nordstern trabt der Pionierzug im Gänsemarsch nach Rawa. Das Lachen ist verstummt, keiner spricht. Man denkt an die Herren, die sich leise aus dem Staub gemacht oder sich sonst wie in Sicherheit gebracht haben; man weiß nichts von der Lage; man ist sich nur über eins klar: Es wird auf Biegen oder Brechen gehen; man will leben.
Der Pionierzug ist genau 38 Mann stark und in drei Gruppen aufgegliedert. Die Männer sind schwer bewaffnet. Die fünf MG stellen eine beachtliche Feuerkraft dar, ganz abgesehen davon, dass jeder noch zwei Panzerfäuste neuester Ausführung und eine Menge Handgranaten mit sich führt.
Huber trabt mit und bildet den Schluss. Der Münchener ist jetzt nüchtern und fragt sich noch immer, wie alles kam. Ein unerhörtes Glück hat der Metzger gehabt! Darüber sind sich alle einig.
Seit Lechner vor dem ungelösten Rätsel über das spurlose Verschwinden der 5. Kompanie steht, ist er fest entschlossen, keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen und den Anschluss an die abgerückten Einheiten zu finden.
Wieder einmal hat man alles zurückgelassen, wofür man Kraft, Schlaf und monatelange Arbeit hergegeben hat. Wieder einmal geht es um die zwei großen Probleme dieser Zeit: Freiheit oder Tod.
Sie wollen in die Freiheit zurück, die weit von ihnen abgerückt zu sein scheint.
In der Stadt ist es still. Der feindliche Artilleriebeschuss hat sich nördlich Rawa konzentriert und erweckt die Meinung, dass der Feind die Stadt in seinem Besitz wähnt.
Sie ist es anscheinend noch nicht ganz.
Trrrrr … trr … ertönt es in schnellem Rhythmus.
„Das sind die Unseren“, sagt Lechner leise zu Lehmann, der dicht hinter ihm geht, „aber sie sind schon aus der Stadt.“
„Wir müssen schau’n, dass wir durchkommen, Sepp.“
„Na klar – irgendwo wird schon ’ne Lücke sein.“
Sie nähern sich dem Panzergraben, der um die Stadt herumführt.
Starkes Motorengeräusch und gedämpftes Kettengeklirr verraten, dass russische Panzer durch die Straßen fahren. Dann und wann kracht es, kurze Feuerstöße aus russischen Maschinengewehren lassen darauf schließen, dass noch nicht alle Deutschen auf und davon sind.
Sepp Lechner lässt den in Gruppen dahinschleichenden Zug aufschließen.
„Hört her, Kameraden. Wir versuchen, im Panzergraben um die Stadt herumzukommen. Russische Infanterie scheint nicht da zu sein. Mit den Panzern werden wir zur Not fertig. – Los jetzt. Mir nach! Seid leise!“
Lechner springt in den etwa fünf Meter tiefen Panzergraben, der um die ganze Stadt läuft und an verschiedenen Stellen überbrückt ist.
Schnee liegt im Graben und dämpft die Schritte. Die Dunkelheit ist günstig.
Im Gänsemarsch bewegt sich der Pionierzug vorwärts. Als eine Brücke auftaucht, bleibt der vorausgehende Feldwebel stehen und horcht. Dann winkt er zum Weitergehen.
Die erste Brücke liegt hinter ihnen.
Rechts brummt etwas. Ketten klirren.
„Panzer!“, flüstert Lechner seinem Hintermann zu.
„Panzer …“, geht es leise von Mund zu Mund.
Der russische Panzer brummt heran, kommt an den Rand des Grabens.
„Hinlegen …“, zischt Lechner.
Der Pionierzug sinkt in den knietiefen Schnee und presst sich an die vereiste, grifflose und schräg aufsteigende Grabenwand. Sie halten den Atem an.
Der russische Panzer steht irgendwo in der Nähe. Man hört das Leerlaufen des Motors. Dann ertönen Stimmen. Die Besatzung unterhält sich.
Plötzlich grellt ein Scheinwerfer auf und leuchtet in den eine sanfte Biegung vollführenden Panzergraben.
Die Pioniere rühren sich nicht. Sie pressen sich in den Schnee, an die linke Grabenseite, um dem Lichtarm zu entgehen.
Es geschieht nichts. Der Schweinwerfer verlöscht wieder, die Russen fahren weiter.
„Junge, Junge“, flüstert Emmes, der dicht vor Willi das MG 42 schleppt, „wenn die uns g’spannt hätt’n!“
„Hör auf, Emmes – der Dreizehnte ist ja schon um.“
„Erst wenn wir von hier weg sind“, flüstert Emmes. Der Zug bleibt noch ein paar Augenblicke liegen.
„Wir müssen uns beeilen“, sagt Lechner zu Lehmann. „Sobald es hell wird, müssen wir von hier weg sein, sonst fangen sie uns.“
„Meinst du nicht, dass es besser wäre, wir lösten uns auf, Sepp?“
„Wie meinst du das?“, fragt Lechner.
„Gruppenweise weitergehen. So ein großer Haufen fällt leichter auf als ein paar Mann. Fünf MG, fünf Gruppen.“
„Nee, Kurt – gefällt mir nicht. Wir verlieren, wenn wir irgendwo mit dem Russen zusammenrasseln, an Feuerkraft.“
„… Und marschieren womöglich alle achtunddreißig in Gefangenschaft … wenn nicht Schlimmeres.“
Lechner überlegt.
„Gut“, sagt er schließlich, „dann also getrennt weiter. Ich nehme mir zehn Mann mit und gehe voraus. An jeder Brücke halte ich und peile die Lage; dann schicke ich dir einen Mann zurück, der euch nachholt … und so weiter, bis wir drüben sind.“
Damit ist auch Lehmann einverstanden. Er teilt den Entschluss dem Zug mit. Die Soldaten nicken, ein paar murmeln: „Nicht schlecht.“
Zehn Mann melden sich freiwillig und wollen mit Sepp Lechner die Vorhut bilden, den Rest teilt Lechner in kleine Gruppen ein.
Emmerich Sailer und Willi Röttger gehören zur letzten Gruppe; sie zählt acht Mann und verfügt über ein MG. Emmerich Sailer übernimmt die Führung des Haufens.
Noch ein paar Instruktionen, dann löst sich Feldwebel Lechner mit seinen Leuten vom Zug und schleicht sich im Panzergraben weiter. Die anderen warten.
Es klappt alles. Man kommt gut voran. Schon hat man den Südteil Rawas erreicht, als Lechners Gruppe plötzlich einen Russenpanzer auf der Südbrücke stehen sieht.
Es ist bereits dämmerig geworden. Die Russen auf dem Panzer unterhalten sich laut und lassen eine Flasche kreisen, als plötzlich einer schreit und aufgeregt in den Panzergraben zeigt.
In den nächsten Sekunden ist die scheinbare Ruhe dieses frühen Morgens dahin. Der Panzer schwenkt seine Kanone und feuert ein paar Mal rasch hintereinander in den Graben. Die Granaten krachen. Splitter zischen durch die Luft, schlagen in die schrägen Wände und heulen als Querschläger davon.
Lechner hat noch so viel Geistesgegenwart, zurückzuspringen. Die Leute prallen aufeinander. Ein Knäuel entsteht, das sich nicht schnell genug zur Flucht wenden kann.
Da fetzt eine Granate in den Haufen Soldaten. Todesschreie gellen durch den Graben. Wer noch laufen kann, lässt alles fallen und stolpert zurück. Einige versuchen, an den vereisten, schrägen Betonwänden des Grabens hochzukommen, doch es gelingt ihnen nicht. Sie sind in einer Falle. Sie müssen den Weg zurück, den sie gekommen sind.
Und der Panzer schießt weiter, feuert mit MG in den Graben und alarmiert die anderen Panzer.
Deutsche im Panzergraben!
Von allen Seiten rollen die Sowjetpanzer heran, während sich in der Todesfalle ein Drama entwickelt.
Von den zehn Mann aus Lechners Gruppe sind vier tot, zwei leicht und zwei schwer verwundet. Der Rest stürzt im Graben zurück und stößt auf Lehmanns Gruppe, die den Lärm gehört hat und nun ihrerseits versucht, zurückzulaufen oder rechts weg aus dem verfluchten Graben zu kommen.
„Da vorn ist was passiert“, sagt Emmes zu seinen Leuten. Er ist mit seiner Gruppe noch am weitesten zurück.
„Nichts wie raus hier!“, keucht Willi und wetzt bis zum nächsten Ausstieg, der hundert Meter weiter zurückliegt.
Emmes, mit dem MG auf der Schulter, rennt hinter ihm her, die anderen ebenfalls.