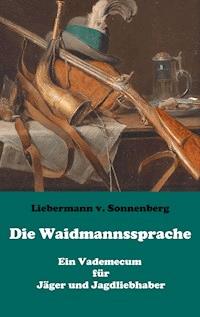
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
"Für den Jagdliebhaber muss es von Wichtigkeit sein, wenn er im Umgange mit gebildeten Waidmännern und als Teilnehmer an ihren Jagden deren Kunstsprache verstehen und sich verständlich machen kann; daher sollen in diesem Handbuch bei jeder Wildgattung die technischen Ausdrücke angegeben werden, wie man sie in verschiedenen fachwissenschaftlichen Werken über die edle Waidmannskunst aufgeführt findet." Überarbeitete Neuausgabe nach der Ausgabe Köln, 1868.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort.
Für den Jagdliebhaber muß es von Wichtigkeit sein, wenn er im Umgange mit gebildeten Waidmännern und als Teilnehmer an ihren Jagden deren Kunstsprache verstehen und sich verständlich machen kann; daher sollen in diesem Handbuch bei jeder Wildgattung die technischen Ausdrücke angegeben werden, wie man sie in verschiedenen fachwissenschaftlichen Werken über die edle Waidmannskunst aufgeführt findet.
Übersicht und Einteilung
des
in unsern Gegenden vorkommenden Wildes.
Es gehören:
I. Zur Hohen Jagd.
a. Haarwild.
Hoch-Rotwild:
Edelhirsche.
Edeltiere.
Hirschkälber.
Wildkälber.
Das Elennwild.
Damwild:
Damhirsche.
Damtiere.
Damhirschkälber.
Damwildkälber.
b. Federwild.
Der Schwan.
Der Trappe.
Der Kranich.
Das Auerhuhn.
Der Fasan.
Der Focke.
c. Raubtiere.
Der Bär.
Der Luchs.
II. Zur Mitteljagd.
a. Haarwild.
Nieder-Rotwild:
Rehböcke.
Rehe (Ricken).
Rehkälber.
Schwarzwild:
Hauende Schweine.
Angehende Schweine.
Keiler.
Bachen.
Frischlinge.
b. Federwild.
Das Birkhuhn.
Das Haselhuhn.
Der lerchengraue Regenpfeifer.
Der große Brachvogel.
c. Raubtiere.
Der Wolf.
III. Zur Niederjagd.
a. Haarwild.
Der Hase.
Das Kaninchen.
Der Biber.
Das Eichhorn
b. Federwild.
Das Schneehuhn.
Das Moorschneehuhn.
Die Waldschnepfe
Das Rebhuhn.
Die Wachtel.
Die Drosseln.
Seidenschwanz.
Der Gimpel.
Die wilden Tauben.
Die Raake.
Der Pirol.
Der Kuckuck.
Die Lerche
Küsten- und Uferlaufvögel, das sind:
Regenpfeifer
Sanderling
Strandreiter
Austernfischer.
Die Kibitze.
Reiher.
Die Knellen.
Die Wasserläufer.
Die Pfuhlschnepfen.
Die Sumpfschnepfen oder Becassinen.
Wasserralle.
Die Rohrhühner.
Die Hurbel.
Steißfuß.
Die Meerschwalben.
Die Möwen.
Die wilden Gänse.
Die wilden Enten.
Die Säger.
Seetaucher.
c. Raubtiere.
Der Dachs.
Die Fischotter.
Die Sumpfotter.
Fuchs.
Die wilde Katze.
Die Marder:
Der Steinmarder
der Baummarder.
Der Iltis.
Die Wiesel
IV. Raubvögel.
Die Geier.
Die Aasgeier.
Der Bartgeier.
Die Adler
Die Milanen.
Die Bussarde.
Die Weihen.
Habicht.
Die Edelfalken.
Die Eulen.
Die rabenartigen und krähenartigen Vögel.
Erstes Kapitel.
Die Hohe Jagd.
—
Erster Abschnitt.
Das Haarwild.
I. Das Hoch-Rotwild.
Waidmännische Ausdrücke: Beim Edelwild heißt das männliche Geschlecht Hirsch, Edelhirsch oder Rothirsch; das weibliche Tier, Rottier, Stück Wild; die Jungen (Kälber) heißen nach dem Geschlechte verschieden, Hirschkalb und Wildkalb: Mehrere zusammen nennt man einen Trupp oder ein Rudel.
Schalen heißen die hornig gespaltenen Klauen.
Tritt, der mit dem Ballen und den Schalen hinterlassene Eindruck im Boden.
Fährte, mehrere hintereinander folgende Tritte der Vorder- und Hinterläufe.
Oberrücken, Geäfter oder Aftern, beide über den Ballen stehenden hörnernen Spitzen.
Läufe heißen die Beine von allem Haarwild.
Die Blätter stehen über den Vorderläufen, — die Keulen über den Hinterläufen, — das Schloß liegt zwischen den letztem.
Zimmer oder Ziemer ist der Teil über der Kugel von hinten bis zu den Rippen; der Rücken fängt von hier an und geht bis zum Halsknochenwirbel.
Flanken heißen die Dünnungen.
Wildpret oder Wildbret ist das Fleisch von allem Wild.
Schweiß ist Blut. — Feist ist Fett.
Kehlbraten sind die beiden Streifen Wildbret, die neben der Gurgel an der Wirbelsäule anliegen, und Mehrenbraten sind jene am Rückgrat über den Nieren.
Lichter, die Augen des Edelwildes. — Gehör auch Lauscher, die Ohren. — Haut, das Fell.
Es färbt sich, wenn es die Winterhaare verliert.
Geräusch, Gelünge oder Lunze ist Herz, Lunge und Leber zusammen.
Drossel, die Luftröhre. — Drosselknopf, der Kehlkopf.
Gescheide sind die vom Netz umschlossenen Gedärme. — Wanst oder Pansen der Magen.
Das Waideloch ist der Ausgang des Mastdarmes und öffnet sich unter dem Schwanze.
Blume auch Wedel, der Schwanz.
Losung sind die Extremente. — Es löset sich, Entleerung der Exkremente. — Nässen oder Brunsten ist Harnen.
Das Edelwild steht in einem Revier, oder hat seinen gewissen Stand darin, wenn es längere Zeit täglich darin angetroffen wird; — es steckt in einem Teile desselben, wenn es sich bloß zufällig verweilt, ohne seinen Stand darin zu haben.
Es tut sich nieder, — es legt sich nicht.
Das Bett ist der Ort der Ruhe im Holze, von welchem Laub und Rasen mit den Läufen weggeschlagen ist; ist dieser Platz aber auf einer Wiese und der Rasen nicht weggeschlagen, so sagt man das Niedertun.
Wechsel nennt man den Gang des Hochwildes um Nahrung zu suchen. — Äsung oder Geäse ist das zu seiner Sättigung Gewählte. — Es äset sich, wenn es die Nahrung zu sich nimmt.
Feist, nicht fett, wird es bei guter, — schlecht, nicht mager, bei schlechter Äsung.
Es zieht auf die Äsung, es geht nicht danach.
Es zieht zu Holze, und tritt aus demselben auf Felder und Wiesen oder Gehaue.
Es ist flüchtig, es rennt nicht. — Es trollt, wenn es sich trabend bewegt. — Es geht vertraut, bei der Bewegung im Schritt.
Es flieht oder fällt über Vermachungen und Jagdzeug; es springt nicht darüber.
Es fällt ins Garn, es springt oder stürzt nicht hinein.
Es ist verwundet, wenn es einen Schuß erhalten hat.
Es stürzt oder bricht zusammen, wenn es in Folge einer tödlichen Verwundung fällt.
Es klagt, wenn es aus einem Gefühl der Hilflosigkeit oder Schmerzes z. B. beim Genickfangen (Abnicken, Nicken) einen schreienden Laut ausgibt.
Es endet oder verendet, wenn der Tod eine Folge der Verwundung ist.
Es fällt oder geht ein, wenn der Tod durch Kälte, Hunger oder Krankheit veranlaßt wird.
Man bricht es auf, indem man nach dem Verenden Gescheide und Lunze herausnimmt.
Man zerwirkt und zerlegt es, um es in der Küche zu benutzen.
Es brunstet d. h. es begattet sich.
Brunstzeit ist Begattungszeit.
Brunstplatz – der Ort, wo der Hirsch mit dem weiblichen Wild brunstet. Orgeln oder Schreien ist der Laut des Hirsches in der Brunstzeit, Mahnen ist der des Tieres.
Mahnen gebraucht man auch, um dadurch jedes Zeichen anzudeuten, welches der Jäger dem sich flüchtig ihm nähernden Wilde durch leises Pfeifen, Husten, Zerknicken eines dünnen Reises u. dgl. gibt, um es für den Moment zum Stutzen (Stehen) zu bringen.
Es tritt auf die Brunst, wenn der Hirsch das Wild zu Anfang der Brunstzeit aufsucht.
Der Beschlag heißt die Begattung, oder man sagt: Der Hirsch beschlägt das Tier.
Es ist hochbeschlagen oder tragend, wenn das Tier während der Brunst empfangen oder sich bezogen hat.
Rute heißt das männliche Glied, und die langen Haare an seinem vorderen Teile Pinsel.
Kurzwildbret – die Hoden.
Feigenblatt heißt das weibliche Glied.
Das Gesäuge ist das, was beim Rindvieh der Euter heißt.
Das Tier setzt ein Hirsch- oder Wildkalb, – es gebiert nicht, und Die Setz- oder Satzzeit ist die Zeit zu welcher dieses geschieht.
Es meldet sich wenn das Tier, so lange die Kälber noch klein sind, einen Schreckenslaut von sich gibt.
Das Wildkalb d. i. das Junge weiblichen Geschlechts, behält diesen Namen das ganze erste Jahr.
Schmaltier heißt es im zweiten Jahre und so lange bis es brunstet (welches zuweilen in diesem, oder doch im folgenden Jahre geschieht.)
Ein altes Tier heißt es, sobald es das erste Mal hochbeschlagen ist.
Geltes Tier oder Gelt-Tier nennt man es, wenn das alte Tier nach der Brunstzeit nicht hochbeschlagen ist.
Das Hirschkalb d. i. das Junge männlichen Geschlechts, setzt, wenn es das erste Jahr vollendet hat, zwei Spieße auf und wird dann Spießer genannt.
Rosenstock ist der Stirnbeinhöcker und die Stelle, wo die Spieße auf dem Kopfe aufstehen.
Das Gehörn erhebt sich aus dem Rosenstock, und wird mit dem Namen Kolben so lange belegt, bis es vereckt





























