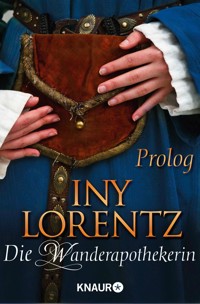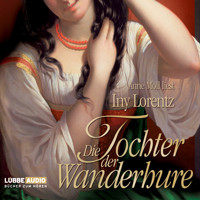9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderhuren-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der 8. historische Roman der beliebten historischen Roman-Serie um die Wanderhure Marie von der Bestseller-Autorin Iny Lorentz Zurück ins deutsche Mittelalter: Die ehemalige Wanderhure und ihr Mann Michel treffen auf einen Arzt aus dem Orient, der ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint. Deutschland, 1441; Marie und Michel trauen ihren Augen nicht: Vor ihnen auf dem Weg liegt eine junge, schwer verletzte Frau – einen Pfeil mitten durch die Brust. Michel lässt den geheimnisvollen orientalischen Arzt Rasul al Hakimi holen, den sie erst am Vorabend in einer Herberge kennengelernt haben. Ihm gelingt es, das verletzte Edelfräulein am Leben zu erhalten. Doch Marie und Michel geraten dadurch mitten in die Fehde verfeindeter Adelsgeschlechter, die um die Vorherrschaft kämpfen. Und der orientalische Arzt scheint mehr zu wissen, als er vorgibt. Um das Schlimmste zu verhindern, muss Marie das Geheimnis des Arztes aufdecken. Mit ihrer historischen Roman-Serie über das Schicksal der Kaufmannstochter Marie, die im späten Mittelalter als Hübschlerin auf Wanderschaft gehen muss, hat Iny Lorentz einen historischen Bestseller nach dem anderen gelandet. Hochspannend, dramatisch und opulent lässt uns die Bestseller-Autorin tief ins deutsche Mittelalter eintauchen. Alle Bände der historischen Saga um die Wanderhure Marie und deren Reihenfolge: - Band 1: Die Wanderhure - Band 2: Die Kastellanin - Band 3: Das Vermächtnis der Wanderhure - Band 4: Die Tochter der Wanderhure - Band 5: Töchter der Sünde - Band 6: Die List der Wanderhure - Band 7: Die Wanderhure und die Nonne - Band 8: Die Wanderhure und der orientalische Arzt - Band 9: Die junge Wanderhure (Prequel zu Band 1) - Band 10: Die Wanderhure. Intrigen in Rom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Iny Lorentz
Die Wanderhure und der orientalische Arzt
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Vierter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Fünfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Sechster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Siebter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Achter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Neunter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Zehnter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Elfter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Anhang
Glossar
Erster Teil
Bruderliebe
1.
Es war ein herrlicher Tag, gerade richtig zum Ausreiten, fand Gunther. Zu seiner großen Freude hatten ihn sein Bruder Radolf und dessen Vetter Otfried aufgefordert, sie zu begleiten. Das taten sie nicht oft, denn beide waren einige Jahre älter als er und galten bereits als erwachsene Männer, während er mit seinen sechzehn Jahren noch als Jüngling angesehen wurde.
»Wie wäre es mit einem scharfen Galopp?«, fragte Radolf eben.
Otfried lachte auf. »Um die Wette? Ich hätte nichts dagegen! Welchen Preis setzen wir für den Sieger?«
Da Otfried als ausgezeichneter Reiter galt, nahm Gunther an, dass sein Vetter von seinem Sieg überzeugt war. Radolf würde gewiss nicht auf die Wette eingehen, denn dieser war äußerst sparsam und tadelte jeden in der Burg, der in seinen Augen etwas verschwendet hatte.
»Was hältst du von meinem neuen Mantel? Wenn ihr etwas Gleichwertiges bietet, setze ich ihn«, antwortete sein Bruder jedoch zu Gunthers Überraschung.
»Wie wäre es mit meinem Dolch, der dir so gut gefällt?«, bot Otfried an.
»Da kann ich nicht mithalten, denn ich besitze nichts, was es wert ist, als Preis eingesetzt zu werden«, sagte Gunther bedrückt.
»Das wäre ja noch etwas, wenn wir von dir Säugling einen gleichwertigen Einsatz fordern würden!«, rief sein Bruder lachend. »Weißt du was? Wenn uns deine Großtante Mildburg das nächste Mal besucht, so kümmerst du dich um sie, damit ich meine Ruhe habe. Ich werde Otfried schon irgendwie entschädigen, falls er gewinnen sollte, so dass er nicht das Nachsehen hat.«
»Damit bin ich einverstanden«, antwortete Otfried sofort.
Es war ein Angebot, das Gunther nicht ablehnen konnte. Im Gegensatz zu Radolf kam er mit der alten Dame gut zurecht, und es langweilte ihn auch nicht, den endlosen Geschichten zu lauschen, die sie über Menschen erzählte, die längst tot und von den meisten vergessen waren. Er würde sich auch ohne eine verlorene Wette um die alte Dame kümmern, denn das hatte er noch bei jedem ihrer Besuche getan.
»Also gut, ich verspreche es«, erwiderte er. Ein wenig Hoffnung, zu gewinnen, hatte er sogar. Er war leichter als sein Bruder und dessen Vetter und sein Hektor kaum langsamer als deren Renner.
»Dann ist es beschlossen! Gewinne ich, erhalte ich Otfrieds Dolch, und du lässt das Geschwätz des alten Drachens über dich ergehen. Das tust du ebenfalls, wenn Otfried gewinnt.«
Radolf lachte auf und wies auf den Höhenzug, der vor ihnen lag. »Da wir stattliche Preise ausgelobt haben, sollte die Strecke länger sein. Was haltet ihr von der alten Kapelle bei der Schlucht als Ziel?«
Bis dorthin war es ein anstrengender Ritt, doch Gunther glaubte, ihn bewältigen zu können. »Ich bin einverstanden!«
Auch Otfried nickte. »Ich ebenfalls! Wir reiten los, wenn der Kuckuck das nächste Mal schreit.«
Die nächsten Augenblicke vergingen in gespanntem Lauschen. Da erklang der Ruf des Kuckucks, und sofort gaben alle drei ihren Pferden die Sporen. Radolf gewann rasch einen Vorsprung und versuchte, diesen auszubauen.
Trotz seiner Anspannung musste Gunther lächeln. Anders als Otfried, der seinen Dolch dem Sieger mit einem Lachen übergeben würde, würde Radolf der Verlust des Mantels und auch des Gegenstands schmerzen, den er für ihn an Otfried würde übergeben müssen. Die Überlegung, den Mantel unter den Augen des Bruders tragen zu müssen, brachte ihn fast davon ab, gewinnen zu wollen.
Dann aber dachte Gunther daran, dass er Radolf den Mantel als Geschenk zurückgeben konnte. Otfried hingegen würde seinem Dolch gewiss nicht nachtrauern, und da dieser ihm gefiel, spornte er nun seinen Hengst an. Zu sehr durfte er Hektor nicht hetzen, damit dem Hengst noch die Kraft für das letzte Stück blieb. In der Hinsicht handelte Radolf unüberlegt. Wahrscheinlich hoffte er, so viel Vorsprung zu gewinnen, dass er nicht mehr eingeholt werden konnte. Aber diese Rechnung würde nicht aufgehen.
Auch wenn er noch jung war, wusste Gunther mit Pferden umzugehen und hielt das richtige Maß, damit sein Hengst nicht zu weit hinter Radolf und Otfried, der nun ebenfalls schneller wurde, zurückfiel, aber genug Kraft behielt, um zuletzt noch einmal richtig galoppieren zu können.
Das flache Wegstück blieb hinter Gunther zurück, und er ritt in die Hügel des Ödlands hinein, deren Flanken von dichtem Laubwald bedeckt waren. Der Pfad, dem er folgte, schlängelte sich zwischen den Hügeln dahin. Gelegentlich sah er Otfried vor sich, dessen Hengst bereits langsamer wurde, und schließlich auch Radolf. Dieser warf einen Blick nach hinten und bog dann vom Weg ab, um die Strecke über einen Hügel abzukürzen.
Gunther schüttelte innerlich den Kopf. Sein Bruder musste doch merken, wie stark sich sein Hengst bereits verausgabt hatte. Ihn zu dieser Kraftanstrengung zu zwingen, würde das Tier vollends erschöpfen. Dabei war es noch gut eine Meile bis zu ihrem Ziel.
Gunther überlegte, wie er die letzte Strecke angehen sollte. Seinen Bruder würde er gewiss überholen. Ihm ging es jedoch um Otfried. Wenn dieser gewann, würde er Radolfs Mantel behalten. Dies hieß aber auch, dass Radolf etliche Tage äußerst schlecht gelaunt sein würde. Der Leidtragende würde dann er sein, denn an ihrem Vater konnte sein Bruder seinen Ärger nicht auslassen, und andere Geschwister gab es nicht.
Mit einer gewissen Selbstverspottung dachte Gunther daran, dass er dieses Wettreiten nicht für sich gewinnen wollte, sondern um seinem Bruder den Mantel zu erhalten. Dafür musste er nun aber zu Otfried aufschließen, sonst wurde dessen Vorsprung zu groß.
Mit einem Zungenschnalzen brachte er Hektor dazu, noch schneller zu werden, und kurze Zeit später sah er Otfried nicht mehr allzu weit vor sich. Fast zur gleichen Zeit kam Radolf die Hügelflanke herab und schaffte es gerade noch, einen kleinen Vorsprung vor seinem Vetter zu retten.
»Das war dumm von dir, Bruder«, murmelte Gunther und ließ seinem Hengst die Zügel. Er kam Otfried immer näher und überholte ihn schließlich. Wenig später hatte er auch Radolf hinter sich gelassen und galoppierte fröhlich auf die kleine Kapelle zu, die ein Eremit vor langer Zeit hier errichtet hatte. Da das Kirchlein sich weder auf einem Pilgerweg befand noch ihm besondere Kräfte nachgesagt wurden, kamen nur selten Leute hierher. Gunther war bisher höchstens zwei- oder dreimal an diesem Ort gewesen, allerdings nicht wegen der Kapelle selbst, sondern wegen der Schlucht, die sich ein Bach nur einen Steinwurf davon entfernt gegraben hatte.
Von einem gelehrten Magister, der auf der Burg seines Vaters zu Besuch gewesen war, war diese Schlucht als Wunder Gottes bezeichnet worden. Dort, wo man von der Kante aus bis auf den Grund sehen konnte, hätten fünf Männer übereinander auf den Schultern des jeweils unteren darin stehen müssen, damit der Oberste mit dem Kopf hinausschauen konnte. Zudem war der Einschnitt mehr als drei Klafter breit, und es hieß von den Jünglingen dieser Gegend, sie gälten erst dann als richtige Männer, wenn sie die Schlucht mit ihrem Pferd übersprungen hatten.
Gunther hatte dies noch nicht gewagt. Sein Bruder hingegen hatte vor zwei Jahren behauptet, den Sprung bewältigt zu haben. Radolfs Zeuge war Otfried, so wie er dessen Zeuge war. Irgendwann in den nächsten Jahren, sagte Gunther sich, würde auch er springen müssen. Dann aber sollte das Pferd, das er ritt, frischer sein als sein Hektor, dem der harte Ritt nun anzumerken war.
2.
Als Radolf und Otfried herankamen, winkte Gunther ihnen fröhlich zu. »Das war ein schöner Ritt!«
»Für dich vielleicht! Mein Gaul hat sich die Fessel vertreten und humpelt. Ich kann ihn nur noch im Schritt reiten, und das bedeutet, ich werde nicht vor der Nacht nach Hause kommen«, antwortete Radolf unwirsch.
»Der Weg zu unserer Burg ist näher. Komm doch mit mir! Gunther kann es eurem Vater mitteilen«, schlug Otfried vor.
»Das wird wohl das Beste sein.« Radolf stieg ab, hob den rechten Vorderfuß seines Pferdes auf und betastete das Gelenk. »So schlimm sieht es Gott sei Dank nicht aus. Ich werde wohl morgen nach Hause reiten können.«
»Jetzt sollten wir erst einmal Rast machen. Ich habe eine Lederflasche mit Wein bei mir, den wir uns teilen können. Als Sieger unseres Wettreitens gebührt Gunther der erste Schluck!« Bei diesen Worten nestelte Otfried die Flasche vom Sattel und warf sie Gunther zu.
Dieser fing sie auf, löste die Schnur, mit der sie verschlossen war, und trank durstig von dem überraschend süßen Wein.
»Der schmeckt ausgezeichnet!«, sagte er, als er die Flasche an Otfried zurückreichte.
»Er ist aus dem Fass, in dem mein Vater seinen besten Tropfen aufbewahrt«, meinte dieser grinsend und trank nun selbst.
Nachdem auch Radolf die Lederflasche erhalten hatte, war sie leer. Otfried befestigte sie wieder am Sattel und setzte sich neben die Kapelle ins Gras.
»Eigentlich müsse dieser Ort belebter sein«, meinte er.
»Weshalb?«, fragte Gunther verwundert.
»Das hier ist die Stelle, an der alle vier Herrschaften des Kleeblattbunds aneinanderstoßen würden, wenn das Ödland aufgeteilt worden wäre. Es müsste hier ein Dorf geben oder zumindest eine Schenke mit gutem Wein und einer hübschen Wirtstochter, mit der man gewisse Dinge tun kann.«
Radolf lachte. »Wein darf mein Bruder bereits trinken, doch mit einer hübschen Wirtstochter weiß er noch nichts anzufangen.«
»Die würde es ihm schon beibringen«, rief Otfried und zwinkerte Gunther zu. »Es würde dir gewiss Freude machen. Du bist ja kein Knabe mehr.«
Gunther grinste verlegen. Natürlich wusste er, was man mit Wirts- und anderen Töchtern anfangen konnte, auch wenn er es bislang noch nicht getan hatte. Bei den vielen Leuten beiderlei Geschlechts, die auf der Burg zusammenlebten, blieb so etwas kein Geheimnis. Schon bald würde auch er versuchen, mit einer der jungen Mägde in einem versteckten Winkel zu verschwinden. Die eine oder andere wäre gewiss gerne dazu bereit. Hatte ihn Bruni nicht letztens mit ein paar verheißungsvollen Blicken bedacht? Er wusste allerdings, dass diese öfter in der Kammer seines Bruders zu tun hatte und dort länger blieb. Da er Radolf nicht in die Quere kommen wollte, überlegte er, eine der anderen Mägde zu fragen, ob sie mit ihm eine gewisse Zeit verbringen mochte.
In Gedanken verstrickt, achtete Gunther nicht auf die leise geführte Unterhaltung von Radolf und Otfried, bis sein Bruder neben ihn trat und ihm die Hand auf die Schulter legte. »Unser Vetter hat recht! Du bist kein Knabe mehr.«
»Es wird Zeit für dich, den Sprung über die Schlucht zu wagen. Nachdem dein Hengst heute so gut gelaufen ist, wird er auch das noch schaffen«, rief Otfried.
»Ich weiß nicht … Hektor hat bei diesem Ritt doch einiges an Kraft aufwenden müssen«, wandte Gunther ein.
»So erschöpft, wie du glaubst, ist er nicht«, erklärte sein Bruder und legte den Arm um ihn. »Komm mit! Wir sehen uns die Schlucht an, und dann wirst du feststellen, dass sie ganz leicht zu überwinden ist. Es heißt, dass nicht nur Pferde darüberspringen können. Man erzählt sich, dass es auch ein junger Bauer getan hat, nachdem dessen Angebetete ihn damit verspottet hatte, er besitze ja nicht einmal ein Pferd, um über die Schlucht zu springen.«
Mit einem leisen Stöhnen ließ Gunther zu, dass sein Bruder ihn zur Schlucht führte, und starrte mit einem mulmigen Gefühl hinab. An den Seiten wuchsen ein paar Büsche, unten am Grund konnte er den Bach erkennen.
»Wer hier hineinfällt, steht nicht mehr auf«, sagte er abwehrend.
»Wer will denn hineinfallen?«, antwortete sein Bruder. »Du stellst dich mit deinem Pferd dort vorne hin, nimmst Anlauf und bist im nächsten Augenblick drüben. Zurück geht es noch leichter, da die Kante auf dieser Seite eine gute Elle tiefer liegt. Worauf wartest du noch? Nach diesem Sprung bist du hier als wackerer Bursche bekannt und kannst bei Bruni lernen, wie es ist, einen weichen Frauenleib unter dir zu spüren!«
»Du bietest mir Bruni an? Aber ich dachte …«
Gunther brach ab, als sein Bruder schallend zu lachen begann. »Wäre Bruni mein angetrautes Weib, würde ich es dir sehr verargen, wolltest du ihr die Röcke heben. Sie aber ist eine Magd, die jeder haben kann. Auch Vater hat sie bereits gestoßen. Jetzt bist eben du an der Reihe.«
Radolfs Worte klangen für Gunthers Ohren ein wenig derb. Knechte sprachen so, aber doch kein Edelmann! Er begriff allerdings, dass er sich nicht länger widersetzen konnte. So breit, dachte er für sich, war die Schlucht wirklich nicht, als dass sein Hengst sie nicht überspringen konnte.
»Also gut, ich tue es!«
»Ich wusste doch, dass du Mumm in den Knochen hast. Immerhin bist du mein Bruder, und Brüder müssen zusammenhalten, jetzt wie auch später, wenn du Guntramsweil als Erbe deiner Mutter übernommen hast und wir uns Bogenberg nach dem Tod unseres Vaters geteilt haben.«
In Radolfs Stimme schwang ein neidischer Unterton mit, der Gunther jedoch entging.
»Wir sollten zur Kapelle zurückgehen, damit ich springen kann«, antwortete der Jüngere und wurde von seinem Bruder mit einem Schulterklopfen belohnt.
Als sie die Kapelle wieder erreichten, lag Otfried im Gras und schlief, schreckte aber hoch, da Radolf ihn mit der Fußspitze berührte. »Irgendwie hat der Wein mich müde gemacht«, sagte er mit einem verzerrten Grinsen.
»Du hast ja auch am meisten getrunken. Für mich ist kaum etwas geblieben«, antwortete Radolf und wies auf Gunther. »Unser Kleiner will springen!«
»Ich dachte mir schon, dass er sich diese Gelegenheit nicht entgehen lässt, denn jetzt können wir beide bezeugen, dass er es getan hat«, antwortete Otfried und stand auf.
»Nachdem er gesprungen ist!«, schränkte Radolf ein. Er reichte seinem Bruder die Zügel und wies auf die Schlucht. »Nun zeig, was du kannst!«
Gunther hatte das Gefühl, als trauten die beiden es ihm nicht zu, den Sprung zu wagen, und nahm sich vor, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Mit einem Satz saß er im Sattel, steckte die Füße in die Steigbügel und lenkte den Hengst zu der Stelle, von der aus er Anlauf nehmen wollte. Sein Bruder und dessen Vetter kamen langsam hinter ihm her.
»Gib Hektor die Sporen, damit er schnell genug für den Sprung wird«, riet Radolf ihm.
»Das werde ich!« Gunther zügelte kurz das Pferd, richtete es so aus, dass es in gerader Linie auf die Schlucht zugaloppieren konnte, und trieb es an.
Der Hengst hatte bereits einen harten Ritt hinter sich. Aber es war, als begreife er, dass es galt, noch einmal alle Kraft einzusetzen. Er ging fast aus dem Stand in den Galopp und jagte auf die Schlucht zu.
Als Gunther diese auf sich zukommen sah, kribbelte alles in ihm vor Anspannung. Im nächsten Moment hob sein Hengst kraftvoll ab. Es war wie ein Flug, dachte Gunther noch. Dann aber, genau über der Schlucht, rutschte der Sattel unter ihm weg. Er versuchte noch, sich auf dem Rücken des Pferdes zu halten, kippte jedoch zur Seite und stürzte. Der Schwung trieb ihn bis an die gegenüberliegende Wand der Schlucht, und er fühlte einen Aufschlag, der ihm den Atem raubte. Instinktiv krallten seine Hände sich in einen dort wachsenden Busch. Fast gleichzeitig schlug der Sattel gegen seinen Rücken, und er verlor den Halt.
Verzweifelt versuchte er, sich an dem Grasbüschel, über das seine Hände glitten, festzuhalten, aber er riss es mit sich. Ein magerer Zweig gab ebenfalls sofort nach, und er schrammte die Hände an Buschwerk und rauen Felsen auf. Immer schneller glitt er in die Tiefe. Als er in das Wasser des Baches klatschte, verlor er das Bewusstsein. Er bekam nicht mehr mit, wie viel Glück er im Unglück hatte, denn er landete mit dem Kopf auf seinem Sattel und geriet dadurch nicht in Gefahr, zu ertrinken. Als er wieder zu sich kam, fühlte er zunächst kaum Schmerz, sondern war nur froh, am Leben zu sein. Vorsichtig begann er, Arme und Beine zu bewegen, und nun spürte er die Folgen seines Sturzes. »Mein Gott, hoffentlich habe ich mir nichts gebrochen«, stöhnte er.
Doch seine Gliedmaßen schienen in Ordnung zu sein. Vor Erleichterung atmete er tief durch, und sofort spürte er seine Rippen. Es tat fürchterlich weh, und er begriff, dass er die eine oder andere angebrochen oder zumindest schwer geprellt haben musste.
Langsam kam die Erinnerung zurück, dass er den Sprung über die Schlucht hatte wagen wollen. Anscheinend war dabei sein Sattelgurt gerissen. Wenn er und Radolf wieder nach Hause kamen, dachte er, würde er dem Stallmeister einige deutliche Worte sagen.
Erst aber musste er hier herauskommen, und dafür benötigte er die Hilfe seines Bruders und die von Otfried. Die beiden hatten seinen Sturz miterlebt und würden gewiss schon überlegen, wie sie ihm helfen konnten. Ihren Spott über seinen missglückten Versuch würde er wohl noch lange ertragen müssen.
Gunther drehte sich mühsam, so dass er hoch über sich das schmale Band des Himmels erkennen konnte, der sich über der Schlucht spannte. Die zwei Schatten, die sich oben über den Rand beugten, konnten nur Radolf und Otfried sein. Er wollte ihnen schon zurufen, dass er den Sturz halbwegs glimpflich überstanden hatte, als Otfrieds Stimme höhnisch zu ihm herabdrang. »Diesen Gimpel zu beseitigen, war leichter, als ich dachte. Meinen Glückwunsch, Vetter! Damit bist du der alleinige Erbe deines Vaters und wirst zudem noch die Herrschaft Guntramsweil für dich behalten können. Außer dem Grafen auf Hettenheim kommt dir dann niemand von den Herren in diesem Gau gleich.«
Gunther erstarrte. Hatte er recht gehört, oder narrten ihn die Sinne? Er erwartete, dass Radolf seinen Vetter zornig zur Rede stellen würde. Stattdessen hörte er ihn lauthals lachen. »Endlich ist dieses Ärgernis beseitigt! Ich musste mich jedes Mal beherrschen, wenn ich Gunther sah, um ihn nicht zu erwürgen.«
»Sei froh, dass du es nicht getan hast! Es hätte dir einen schlechten Ruf eingebracht – oder gar die Verbannung«, rief Otfried. »So war es am einfachsten! Du hast deinen Bruder weggelockt, so dass ich seinen Sattelgurt anschneiden konnte. Wie ich dir gesagt habe, hat das gereicht, damit der Gurt an der richtigen Stelle gerissen ist.«
»Soll einer von uns nach unten steigen und nachsehen, ob noch Leben in ihm ist?«
»Warum?«, fragte Otfried spöttisch. »Gunther dürfte sich bei dem Sturz das Genick gebrochen haben, und wenn nicht, so gewiss doch ein Bein oder alle beide. Selbst wenn er noch nicht tot ist, wird er es bald sein. Hier hilft ihm keiner! Wer sollte es auch tun, da nur selten jemand hierherkommt?«
»Ich hätte gerne Gewissheit!«, drängte Radolf.
»Ohne Seil können wir nicht in die Schlucht steigen, und wir haben keines bei uns. Komm, wir legen uns hier am Rand der Schlucht auf den Bauch und schauen hinab. So hell müsste es dort unten sein, dass wir deinen Bruder …«
»Halbbruder!«, unterbrach Radolf seinen Vetter mit knirschender Stimme.
»… dass wir Gunther sehen können. Sollte er sich noch regen, werfen wir ein paar schwere Steine auf ihn. Danach brauchst du dir seinetwegen keine Sorgen mehr zu machen.«
Gunther traute seinen Ohren nicht. Sein eigener Bruder – Halbbruder, verbesserte er sich – wollte ihn umbringen, und sein Vetter – oder vielmehr Radolfs Vetter, denn Otfried war der Sohn des Bruders von Radolfs Mutter – half ihm dabei.
Als die beiden oben die Köpfe über die Schlucht streckten, blieb Gunther starr liegen. Nicht bewegen!, durchfuhr es ihn, sonst bringen sie mich wirklich um! Er wagte nicht einmal mehr zu atmen und glaubte bereits, die Brust würde ihm zerspringen, als sein Bruder sich erhob.
»Wie es aussieht, hat es ihm das Rückgrat zerschmettert!«, sagte dieser.
Das hättest du wohl gern! Gunther befürchtete schon, es laut gesagt zu haben. Doch da stand auch Otfried auf und klang hochzufrieden, als er sagte: »Es bleibt dabei! Wir sagen, Gunther hätte sich von uns getrennt, und wir wüssten nicht, wo er abgeblieben ist.«
»Das ist besser, als wenn wir berichten würden, er habe in unserer Anwesenheit den Sprung über die Schlucht versucht. Vater würde es mir ankreiden, weil ich Gunther nicht davon abgehalten habe. Er mochte dieses Bürschlein immer lieber als mich.« Radolf klang bitter.
Dann verstummten die Stimmen der beiden, und kurz darauf hörte Gunther nichts mehr außer dem Rauschen des Wassers.
3.
Da nun der erste Schrecken wich, spürte Gunther die Schmerzen immer stärker. Er wollte sich aufsetzen, damit ihm nicht ständig Wasser ins Gesicht spritzte, doch es dauerte geraume Zeit, bis er sich aus dem Bach gezogen und auf einem trockenen Felsen Platz genommen hatte. Ein Blick nach oben verriet ihm, dass sein Bruder sich tatsächlich keine Sorgen machen musste. Hier kam höchstens ein Vogel heraus. Ein Mensch konnte dies niemals schaffen. Vor allem dann nicht, wenn ihm sämtliche Knochen so wehtaten wie ihm.
Es erschien ihm bereits als ein Wunder, dass er noch lebte. Als er die Stelle betrachtete, an der er herabgestürzt war, begriff er erst, wie viel Glück er gehabt hatte. Wäre sein Sattelgurt nur einen Augenblick eher gerissen, wäre er haltlos in die Schlucht gestürzt. So aber war er gegen die Felswand geprallt und hatte den Sturz mithilfe eines Gestrüpps bremsen können. Er war daher weniger gestürzt als gerutscht. Damit hatten Radolf und Otfried nicht gerechnet.
Der Gedanke an seinen Halbbruder und dessen ebenso üblen Verwandten weckte seinen Trotz. Er wollte nicht an dieser Stelle sterben und von allen Menschen vergessen werden. Daher schöpfte er ein wenig Wasser aus dem Bach und trank es durstig, um den Nachgeschmack von Otfrieds Wein fortzuspülen. Als er anschließend das Gebüsch an den Wänden der Schlucht musterte, erschien es ihm nicht dicht genug, um daran hochklettern zu können.
Gunthers Blick glitt die Schlucht entlang. Ein Stück weiter vorne war diese breiter und eine der Wände nicht ganz so steil. Auch wuchsen dort mehr Büsche. Mit zusammengebissenen Zähnen humpelte er in die Richtung und sah dann besorgt nach oben. Ihm tat alles weh, und er glaubte nicht, die Kraft aufbringen zu können, dort hinaufzusteigen. Doch welche andere Wahl hatte er, als es zu versuchen? Dem Bach weiter zu folgen, half ihm wenig, da er sich ein Stück abwärts zwischen immer größer werdenden Felsblöcken entlangwand, die zu überwinden unmöglich war. Bachaufwärts hingegen wurde die Schlucht schmaler und die Wände noch steiler.
»Gott, hilf mir!«, flüsterte Gunther und fasste nach einem über seinem Kopf wachsenden Strauch. Als er daran zerrte, saßen dessen Wurzeln fest genug, um sein Gewicht auszuhalten. Trotz seiner schmerzenden Rippen atmete er noch einmal durch und machte sich an den Aufstieg.
Es wurde eine Qual, die er nicht einmal seinem größten Feind gewünscht hätte. Mehr als ein Mal geriet er in Gefahr, den Halt zu verlieren und wieder nach unten zu stürzen. Irgendwann aber hatte er die Felskante erreicht und kroch ins Freie. Dort blieb er erst einmal liegen und weinte vor Erschöpfung und Schmerz.
Nach einiger Zeit hatte er sich so weit erholt, dass er aufstehen und sich umschauen konnte. Als er feststellte, dass er sich auf der falschen Seite der Schlucht befand, stöhnte er enttäuscht. Die Kapelle lag jenseits der Schlucht – und damit auch der Weg nach Hause. Bei dem Gedanken zuckte er zusammen. Wollte er überhaupt heimkehren? Wenn er vor den Vater trat und Radolf beschuldigte, dieser habe ihn umbringen wollen, stand sein Wort gegen das des Bruders. Nein, gegen zwei, denn Otfried würde sich auf Radolfs Seite schlagen. Wahrscheinlich würden sie behaupten, er wäre wohl vom Pferd gestürzt und habe sich den Kopf so schlimm angeschlagen, dass er wirres Zeug redete.
»Vater würde ihnen glauben – und die meisten anderen in der Burg auch«, murmelte er vor sich hin. Wenn er nach Hause zurückkehrte, bot er seinem Bruder nur die Gelegenheit, ihn zu einem anderen Zeitpunkt umzubringen.
Gunther überlegte, was er sonst tun konnte. Sein Vater und sein Bruder waren mit allen drei Nachbarn des Kleeblattbunds eng befreundet. Mit Graf Udalrich von Hohenwald verhandelte sein Vater bereits, weil dessen Tochter Ursula seiner Vorstellung nach einmal Radolf heiraten sollte. Also würde jener ihm niemals helfen. Auch Engelbrecht von Löwenberg würde es sich seinetwegen nicht mit seinem Vater verderben wollen, sondern ihn ebenfalls ungesäumt nach Hause bringen lassen. Und was Otto von Drachenstein betraf, den Vierten im Bunde, so war dieser Otfrieds Vater und würde diesem auf jeden Fall mehr glauben als ihm.
Einen Augenblick lang überlegte er, nach Hettenheim zu gehen. Vor Kurzem noch hatte mit Graf Falko ein Feind des Kleeblattbunds dort geherrscht. Nun aber war der unangenehme Nachbar tot, und sein Vetter Heinrich hatte den Besitz übernommen. Dieser war nun der mächtigste Herr in ihrem Gau und brauchte seinen Vater gewiss nicht zu fürchten. Doch anders als sein Vorgänger Falko würde Graf Heinrich es nicht auf einen Streit ankommen lassen, wenn der Vater verlangte, dass er nach Hause zurückkehrte.
Welche Möglichkeiten blieben ihm noch?, fragte Gunther sich. Von seiner Mutter her besaß er das Erbrecht auf deren Besitz Guntramsweil. Der dortige Kastellan war jedoch von seinem Vater eingesetzt worden und würde ihn ebenfalls wie einen dummen Jungen behandeln und zurückschicken.
Gunther war zu matt und zu mutlos, um zu einem Entschluss zu kommen. Außerdem sorgte er sich um seinen Hengst. Dieser war so dressiert, dass er, wenn der Reiter aus dem Sattel fiel, in der Nähe blieb. Doch als er nach Hektor rief, kam weder das Pferd, noch hörte er es wiehern.
Da mittlerweile die Nacht heraufdämmerte, brauchte er einen Unterschlupf, in dem er vor Wölfen und Bären sicher war. Drüben auf der anderen Seite hätte er in der alten Kapelle schlafen können, aber diesseits der Schlucht kannte er sich nicht aus. Zwar hielten sich hier Köhler und Sauhirten auf, doch er hatte weder die Zeit noch die Kraft, um nach einer ihrer Hütten zu suchen.
Mit einem bitteren Gefühl stolperte er in die Nacht hinein. Irgendwann hörte er einen gellenden Schrei, der ihm durch Mark und Bein fuhr. Erst danach begriff er, dass es kein Mensch gewesen war, sondern ein Pferd.
»Mein Hektor!«, stöhnte Gunther.
Er stolperte in die Richtung, aus der der Schrei gekommen war, und geriet nach kurzer Zeit in die völlige Dunkelheit der Nacht. Der Mond ließ sich nicht sehen, und am Himmel standen erst wenige Sterne, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich hinzusetzen und mit dem Rücken an einen Baum zu lehnen. Mit zitternden Händen tastete er nach seinem Dolch. Wenn ein Wolfsrudel erschien oder ein Bär, war dies eine jämmerliche Waffe. Etwas anderes aber besaß er nicht, und so bat er Gott im Gebet, ihn während der nächsten Stunden zu beschützen.
4.
Die Nacht wollte und wollte nicht enden. Manchmal dämmerte Gunther kurz weg, doch die meiste Zeit hielten die Kälte, die ihm eisig in die Glieder kroch, und seine Angst ihn wach. Er hörte ganz in der Nähe Wölfe heulen und betete verzweifelt, dass sie nicht in seine Richtung kamen.
Erst gegen Morgen fiel er in einen etwas längeren Schlaf, wurde aber von üblen Träumen gequält und schrak schließlich hoch, als er endlos zu fallen glaubte. Es dauerte einige Augenblicke, bis er begriff, dass er noch lebte und an einem Baum lehnte. Als er aufschaute, hatte die Sonne fast schon den halben Weg zum Zenit zurückgelegt. Der Entscheidung aber, was er nun tun sollte, war er um keinen Deut näher gekommen.
Da sein Körper nur noch aus Schmerz zu bestehen schien, stand Gunther mühsam auf. Er stellte fest, dass es um ihn herum nur dichten Wald gab und er nichts als die Sonne, die er durch eine Lücke im Blätterdach erkennen konnte, zur Orientierung hatte. Im Augenblick wusste er nicht einmal, wo die Schlucht lag. Da es ihm in seinem Zustand unmöglich war, diese zu überwinden, vertrieb er sie aus seinen Gedanken und stapfte in die Richtung los, in der er am ehesten hoffte, auf Menschen zu treffen.
Unterwegs dachte er über das nach, was am Vortag geschehen war. Hätte er seinen Bruder und dessen Vetter nicht miteinander reden gehört, würde er annehmen, sein Sattelgurt wäre aus einem dummen Grund von selbst aufgegangen. Niemals wäre ihm der Gedanke gekommen, dass Radolf ihn beseitigen wollte.
Das würden auch die Nachbarn nicht glauben. Die Besitzer der vier Herrschaften bildeten eine verschworene Gemeinschaft, die lange Jahre gegen Falko von Hettenheim zusammengehalten hatte. Hilfe hatte er weder von ihnen noch von jemand anderem zu erwarten. Gunther verlor jede Zuversicht und sagte sich, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn er sich gestern, wie von Radolf gewünscht, das Genick gebrochen hätte.
Das Land um ihn herum wurde wieder schroffer. Da er sich nicht in der Lage fühlte, die steilen Hänge hochzuklettern, blieb Gunther im Tal und stapfte durch teilweise feuchten Untergrund und einmal sogar durch einen richtigen Sumpf.
Irgendwann entdeckte er Hufspuren. Der entsetzliche Schrei vom Vorabend kam ihm in den Sinn, und er eilte so rasch weiter, wie seine Schmerzen es erlaubten. Bald waren die Hufspuren deutlicher zu erkennen, also war der Hengst an dieser Stelle galoppiert. Neben den tief eingesunkenen Spuren des Pferdes bemerkte er andere, die kaum Eindrücke hinterlassen hatten. Ein Abdruck aber war deutlich zu sehen. Er war groß und zeigte kräftige Krallen.
»Ein Bär!«
Gunther wusste, wie schnell diese Bestien sein konnten, und eilte weiter. Kurz darauf blieb er erschrocken stehen, denn vor ihm lag der Kadaver seines braven Hektors. Sein Leib war von scharfen Krallen und Zähnen förmlich zerfetzt worden, aus dem aufgerissenen Bauch hingen die Gedärme heraus, und die Innereien waren zum größten Teil gefressen.
An den Spuren in der Nähe erkannte Gunther, dass nicht nur der Bär, sondern auch Wölfe über das tote Pferd hergefallen waren.
»Auch das ist Radolfs Schuld!«, stieß er unter Tränen hervor. Er hatte den Hengst geliebt, der nun von einem Bären zerrissen hier lag.
Gunther wusste nicht, wie lange er wie erstarrt neben dem Pferdekadaver gestanden hatte. Irgendwann hörte er jemanden singen, drehte sich verwundert um und sah einen Mann den Hügel herabkommen. Der Fremde war mit einer schmutzigen Mönchskutte bekleidet und trug einen großen Beutel auf dem Rücken. Noch hatte der Mann ihn nicht entdeckt, sondern starrte nur den Pferdekadaver an und kam mit raschen Schritten näher.
»Man muss auch einmal Glück haben«, sagte er zu sich selbst und zog ein Messer, um sich an einer Stelle, die von den wilden Tieren nicht besudelt worden war, ein Stück Fleisch herauszuschneiden.
»He, was soll das?«, rief Gunther empört.
Der Mönch drehte sich zu ihm um und lächelte. »Dich habe ich ja ganz übersehen, Jüngelchen! Ist das dein Pferd?«
Gunther nickte. »Es hat mich abgeworfen und ist davongelaufen! Dann habe ich es gesucht.« Zugeben, wie es wirklich gewesen war, wollte er vor einem Fremden nicht.
»Jetzt hast du es gefunden. Ist wohl einem Wolfsrudel in die Fänge gelaufen«, meinte der Mann und machte unbeirrt weiter.
»Du darfst kein Fleisch herausschneiden!«, protestierte Gunther.
Der Mönch hielt kurz inne. »Und warum nicht? Es würden sonst doch nur die Wölfe und Geier fressen.«
»Es ist Pferdefleisch, und das zu essen ist verboten!«
»Jüngelchen, du hast in deinem Leben wohl noch nicht viel erlebt? Jemand wie ich, in dessen Magen der Hunger fröhlich jault, kümmert sich nicht darum, ob das Fleisch, das er an den Bratspieß stecken kann, von einem Schwein oder von einem Rind stammt – oder gar von einem Pferd. Du hast doch auch Hunger, oder?«
Tatsächlich verspürte Gunther bei den Worten ein Grummeln im Magen, wusste aber gleichzeitig, dass er niemals einen Bissen vom Fleisch seines treuen Reittiers über die Lippen bringen würde.
»Wie heißt du?«, fragte der Mönch, während er mehrere Stücke Fleisch in seinem Beutel verstaute.
»Heinz«, antwortete Gunther, da er seinen richtigen Namen nicht nennen wollte.
»So, wie du aussiehst, wirst du auf dem Heimweg einen Gefährten brauchen. Dich hat es bei dem Sturz vom Pferd ja ziemlich erwischt.« Der Mann grinste, und Gunther ahnte, dass er auf eine Belohnung hoffte. Die aber konnte es nicht geben.
»Ich bin fremd hier und war auf der Durchreise«, erklärte er.
»Und wo willst du hin?« Der Mann machte keinen Hehl aus seinem Zweifel. Misstrauisch musterte er Gunther. »Hast du vielleicht etwas ausgefressen, weil du durch diese üble Gegend geritten bist?«
Unwillkürlich nickte Gunther.
»Weißt du, ein Kamerad auf meiner Pilgerfahrt wäre mir recht lieb. Wenn du mitkommen willst, lade ich dich ein. Ich bin Bruder Vigilius und auf dem Weg ins Heilige Land, um dort meine Seele im Wasser des Jordanflusses zu reinigen. Es ist ein harter Weg bis dorthin, und der lässt sich mit einem Begleiter leichter bewältigen, als wenn man ihn allein zurücklegen muss.«
Das Angebot kam sehr überraschend, wirkte auf Gunther aber wie ein Geschenk des Himmels. Nach Hause konnte er nicht zurück, und da war es gewiss besser, nach Jerusalem und an den Jordan zu pilgern, als ziellos durch die Lande zu streifen.
»Wenn es dir recht ist, würde ich mitkommen«, sagte er daher. Er blickte auf den Kadaver des Pferdes und verzog das Gesicht zu einer angewiderten Grimasse. »Eines ist jedoch fest wie ein Felsen: Ich werde kein Fleisch von meinem Hektor essen.«
»Ich habe noch ein Stück Brot in meinem Beutel. Es ist zwar schon ein wenig hart, und du musst an einer Stelle den Schimmel wegkratzen, aber für heute wird es reichen, und für morgen solltest du den Herrn im Himmel bitten, für uns Manna regnen oder uns etwas anderes finden zu lassen, das unsere Mägen füllt.«
Noch während Vigilius es sagte, griff er in seinen Beutel und brachte den Rest eines Brotlaibs zum Vorschein, der hart genug war, um es mit einem Felsen aufnehmen zu können.
Er warf ihn Gunther zu, und diesem blieb nichts anderes übrig, als einen Bach zu suchen, um das Brot in dessen Wasser einzuweichen. Da das Stück nicht allzu groß war, schnitt er nur die am schlimmsten vom Schimmel befallenen Teile weg und verschlang eine Hälfte davon heißhungrig. Den Rest ließ er übrig für den restlichen Tag.
Unterdessen fertigte Vigilius ihm einen Wanderstab an, blickte dann auf den noch halbwegs intakten Kopf des Pferdes und nahm diesem Halfter und Zaumzeug ab. »Kann sein, dass wir das unterwegs verkaufen können«, sagte er zu Gunther und musterte ihn danach schärfer. »Geld hast du nicht zufällig bei dir?«
Gunther schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Vielleicht ein Schmuckstück oder ein Amulett, das wir bei einem Juden zu Geld machen können?«, fragte Vigilius weiter.
Gunther verneinte auch das. Zwar besaß er ein kleines Medaillon, aber das stammte von seiner verstorbenen Mutter, und er wollte es als Andenken an sie behalten.
Vigilius zog erst ein säuerliches Gesicht, winkte dann aber lachend ab. »Deine Kleider sind zwar ein wenig verschmutzt, sehen aber noch gut aus. Ein Trödelhändler wird uns gewiss etwas anderes für dich geben, und noch ein paar Groschen dazu. Es ist ein weiter Weg bis zum Jordan, und nicht immer findet man eine Hand, die einen tränkt und füttert.«
»Die Kleider? Gut, das mag sein«, antwortete Gunther und fragte Vigilius, woher dieser stamme und warum er nach Jerusalem pilgern wolle.
»Das kann ich dir unterwegs erzählen. Jetzt sollten wir uns von dannen machen. Nicht, dass die Wölfe oder ein Bär Hunger verspüren und uns gleich mitfressen«, antwortete der Mönch und setzte sich in Bewegung.
Gunther hatte wegen seiner Verletzungen zunächst Schwierigkeiten mitzuhalten, und so dauerte es eine gewisse Zeit, bis er Vigilius zuhören konnte.
»Weißt du …«, begann dieser. »Mein Vater hat mich in ein Kloster gesteckt. Ich war damals noch ein Kind und habe halt Streiche gespielt, wie Knaben es so tun. Nur war unser Abt ein strenger Mann, und so hat mein Hinterteil immer wieder Bekanntschaft mit dem Haselstock gemacht, den mein Lehrer meisterhaft zu schwingen vermochte.
Als ich älter wurde, habe ich beschlossen, dass das Klosterleben nichts für mich ist, und bin bei erster Gelegenheit ausgerückt. Als ich nach Hause kam, zeigte es sich allerdings, dass mein Vater nichts mit dem Vater aus der Bibel gemein hatte, der für den verlorenen Sohn ein Kalb geschlachtet hat. Ich wurde in meine Kammer gesperrt und anschließend in ein noch strengeres Kloster geschafft. Dort blieb ich, bis meinem Vater einfiel, er bräuchte einen Begleiter auf seinen Pilgerreisen und Wallfahrten. Die letzten vier Jahre habe ich mit ihm buchstäblich jeden Wunderbrunnen und heiligen Stein im Umkreis von fünfzig Meilen besucht und zugesehen, wie er den Pfaffen, Mönchen und Nonnen aus vollen Händen Geld für sein Seelenheil gespendet hat. Schließlich überließ er mir diese Aufgabe, und das gab mir die Gelegenheit, auch ein wenig an mich zu denken.«
Vigilius lachte bei der Erinnerung auf und hieb mit seinem Wanderstock gegen einen Baumstamm. »Zu meinem Pech besuchte uns der Abt eines dieser Klöster und geriet mit meinem Vater ins Streiten darüber, wie viel dieser seinem Kloster gespendet hatte. Da beide Summen nicht übereinstimmten, kam ihnen der Verdacht, ich könnte mich daran bereichert haben. Sie durchsuchten meine Kammer und fanden dort leider meinen kleinen Schatz. Ich hätte ihn wohl besser verstecken sollen.«
Gunther fragte sich, weshalb Vigilius offen zugab, gegen Recht, Gesetz und Gottes Ordnung verstoßen zu haben. Diesem schien es sogar zu gefallen, sich als lockeren Vogel darzustellen.
Vigilius grinste und deutete mit seinem Wanderstock nach Osten. »Zur Strafe wurde mir aufgetragen, nach Jerusalem und an den Jordan zu pilgern, auf dass Gott mich von meinen vielen Sünden erlöse. Ich erhielt genau einen Gulden Zehrgeld und wurde aus dem Haus gewiesen. Das war vor drei Wochen. Seitdem befinde ich mich auf Pilgerfahrt.«
»Und was suchst du dann hier in dieser Einöde?«, wollte Gunther wissen. »Die Pilger- und Handelswege sind doch meilenweit von hier entfernt.«
»Ich wollte den Weg abkürzen«, antwortete Vigilius und wies nach vorne, wo eben ein Reh aus dem Dickicht brach. »Es ist schade, dass du keinen Bogen bei dir hast. Das Tier hätte uns einen saftigen Braten eingebracht.«
»Oder den Strick, wenn man uns beim Wildern erwischt hätte«, antwortete Gunther mit leichtem Spott. Eines wusste er nun bereits: Sein neuer Weggefährte war ein seltsamer Kerl, der das Leben nicht allzu ernst zu nehmen schien. Er hielt Vigilius gewiss nicht für ehrlich, doch dieser war der einzige Mensch, dem er sich anschließen konnte. »Willst du wirklich bis an den Jordan reisen?«
Vigilius nickte verkniffen. »Es geht nicht ums Wollen, sondern ums Müssen! Mein Vater hat mir eine hübsche Summe als Erbe ausgesetzt, wenn ich ihm eine Flasche mit Jordanwasser bringe. Der Haken ist nur: Ich brauche eine Bestätigung, dort gewesen zu sein, und zwar nicht irgendeine, sondern von einem seiner Freunde, der als Priester in Jerusalem lebt und dessen Handschrift ich nicht kenne.«
Für Gunther hieß dies, dass Vigilius bereit gewesen wäre, diese Bestätigung zu fälschen. So aber blieb dem ehemaligen Mönch nichts anderes übrig, als den langen Weg tatsächlich anzutreten. Dass er dies als Bettler tun musste, geschah aus Absicht, um ihn Demut zu lehren. Gunther bezweifelte, dass dies gelingen würde. Dafür war Vigilius zu sehr ein Gauner. Für ihn aber bot sich als dessen Begleiter die Gelegenheit, den Staub seiner Heimat von den Schuhen zu schütteln und Dinge zu sehen und zu erleben, die er sonst niemals kennenlernen würde.
Zweiter Teil
Der orientalische Arzt
1.
Marie drehte sich lächelnd zu ihrem Ehemann Michel um, der eben Hildegard aus dem Sattel hob. »Es ist schön, wieder einmal gemeinsam reisen zu können.«
»Vor allem ohne Angst, von einem hinterhältigen Ritter oder von Räubern gejagt oder gar gefangen zu werden«, warf Trudi ein. Sie war bereits abgestiegen und erinnerte sich bei den Worten ihrer Mutter an die Ereignisse des letzten Jahres. Damals waren sie beide in Thüringen und ihr Vater in Österreich nur um Haaresbreite dem Tod entronnen.
»Wenn ich gewusst hätte, wie sehr es dich noch quält, wären wir besser zu Hause geblieben«, sagte Marie besorgt.
Trudi schüttelte lächelnd den Kopf. »Es geht schon, Mama! Ich bin sogar froh, dass wir reisen. So gewöhne ich mich wieder daran, dass man dabei nicht an karge Mahlzeiten oder üble Menschen denken muss.«
»Üble Menschen gibt es auch bei Kibitzstein«, warf Hildegard mit einem leisen Fauchen ein.
Marie wusste, dass sie damit auf den Fürstbischof Gottfried Schenk zu Limpurg anspielte, der immer noch alles tat, um die von seinen Vorgängern erteilten Privilegien und Vorrechte einzukassieren. Bei Michel und ihr hatte er sich bislang die Zähne ausgebissen. Auch ihre Nachbarn Ludolf von Fuchsheim und Hertha von Steinsfeld wahrten ihre Rechte wieder stärker, und selbst von Maximilian von Albach hieß es, er habe sich den letzten Forderungen des Fürstbischofs mit Erfolg widersetzt.
In Kibitzstein war daher zurzeit alles wohlbestellt, und so hatten Michel und sie es gemeinsam verlassen können. Ihr Ziel war die Stammburg ihres Freundes Heinrich von Hettenheim. Dort würden sie ihren Sohn Falko wiedersehen und ihre Ziehtochter Lisa, die nun fast ein Jahr bei ihren Verwandten auf Hettenheim verbracht hatte, auf der Rückreise mit nach Hause nehmen.
»Noch einen Tag, dann haben wir Hettenheim erreicht«, sagte Michel und gesellte sich zu Marie. »Aber um zu deiner Frage zurückzukommen: Es ist wirklich schön, gemeinsam reisen zu können. Doch genauso gerne bleibe ich auch mit dir zusammen zu Hause.«
»Das ist mir mindestens einen Hauch lieber als das Reisen«, antwortete Marie und lachte leise. In ihrem Leben hatte sie bereits viele Meilen zurückgelegt, und man hatte sie sogar als Gefangene ins ferne Russland verschleppt. Von dort aus war sie bis Konstantinopel gekommen und hatte viele andere Länder gesehen. Inzwischen hatten schon einige gelehrte Männer Kibitzstein aufgesucht und sie gebeten, von jenen fernen Landen zu berichten, damit sie es aufschreiben konnten. Gegen die meisten dieser Reisen war jene nach Thüringen im letzten Jahr zwar kurz, dafür aber doppelt so gefahrvoll gewesen.
»Ich bleibe auch gerne zu Hause«, bekannte Hildegard. Sie war jünger und auch ängstlicher als Trudi und Lisa, und Marie hätte sie ungern solchen Gefahren ausgesetzt gesehen wie jenen, denen Trudi und sie im letzten Jahr ausgeliefert gewesen waren.
»Auf Burg Hettenheim wird es dir gewiss gefallen«, sagte sie lächelnd zu dem Mädchen.
Hildegard nickte, wirkte jedoch nicht überzeugt.
Nun wandte Marie sich der Herberge zu, in der sie die Nacht verbringen wollten. Das Gasthaus nannte sich Krone und bestand aus einem stattlichen Gebäude, dessen Hof Anbauten und Stallungen begrenzten. An diesem Ort war man es gewohnt, Reisende von Stand zu empfangen, und so erwartete Marie ein Bett, das sich durch die Abwesenheit von Wanzen und Flöhen auszeichnete, und in der Gaststube keine Reisenden, die ihre Läuse unter dem Hemd hervorholten und quer durch den Raum schnellten.
»Ich habe Hunger«, sagte Michel und winkte einen Knecht heran. »Wir benötigen eine Stube für meine Frau und mich, eine für unsere Töchter und deren Betreuerin sowie eine weitere für unsere Begleitung.«
Letztere bestand aus sechs Mann und sollte Räuber und andere Gauner von der Reisegruppe fernhalten. Michel hatte jeden von ihnen selbst ausgewählt und Karel zu ihrem Anführer bestimmt. Der war zwar noch jung, hatte sich aber bereits als feste Stütze erwiesen. Auf den treuen Hannes hatte Michel diesmal verzichtet, denn dieser sollte die Aufsicht über die Knechte auf Kibitzstein führen.
Der Wirtsknecht hob bedauernd die Hände. »Verzeiht, Herr, aber wir können Euch nur noch einen einzigen Raum anbieten. Es ist allerdings der größte, und wenn wir ein paar Strohsäcke auslegen, können Eure Töchter und deren Magd mit darin schlafen. Eure Begleiter müssen hingegen mit dem Boden über dem Stall vorliebnehmen.«
»Ich dachte, ihr führt ein großes Haus«, antwortete Marie verwundert.
»So ist es auch, aber wir haben bereits Junker Udo und Fräulein Ursula von Hohenwald zu Gast, ebenso Esau von Löwenberg mit mehreren Mannen, Junker Radolf von Bogenberg mit seinen Begleitern und mehrere Reiter aus Drachenstein. Wir können diesen jetzt nicht die Kammern wegnehmen, die wir ihnen zugeteilt haben. Aber wenn Ihr zum Adler reiten wollt: Der befindet sich am anderen Ende der Stadt beim Rheintor.«
Ganz wohl war dem Mann nicht, hochrangigen Gästen diesen Vorschlag machen zu müssen, zumal an diesem Tag gewiss keine Reisenden mehr zu erwarten waren, die das noch freie Zimmer nahmen.
»Was meinst du?«, fragte Michel Marie.
Diese überlegte kurz und wies dann auf den Gasthof. »Für eine Nacht mag es gehen. Ich habe wenig Lust, noch einmal in den Sattel zu steigen und eine andere Herberge aufzusuchen. Wer weiß, vielleicht ist dort auch alles voll.«
»Das Essen ist dort auf jeden Fall nicht so gut wie hier«, sagte der Wirtsknecht, um Marie einen weiteren Grund zum Bleiben zu geben.
»Da du Hunger hast, mein Lieber, ist dies die Entscheidung«, sagte Marie zu Michel und wandte sich an den Knecht. »Kümmere dich um die Pferde und leg ihnen genug Hafer vor. Sie haben es verdient.«
Nun mischte Karel sich ein. »Ich gebe acht, dass dies geschieht. Wir werden auch selbst nach den Pferden schauen. Wenn hier so viele Gäste eingekehrt sind, haben die Knechte des Wirts gewiss nicht die Zeit, sich so um die Tiere zu kümmern, wie es sich auch gehört.« Er warf seinen Untergebenen einen strengen Blick zu.
»Also, das schaffen wir schon«, widersprach der Wirtsknecht beleidigt.
Seine Kameraden aber hatten nichts dagegen, wenn Michels und Maries Eskorte ihnen bei der Arbeit behilflich waren. Daher übernahmen Karel und seine Männer die Zügel und führten die Pferde zum Stall, wo sie die Pferde absattelten. Danach übernahmen die Wirtsknechte die Tiere, denn deren feiner Sinn hatte die Neuankömmlinge als Gäste erkannt, die mit Trinkgeld nicht geizen würden. Da sie bei den Pferden anderer Reisender nicht so viel Aufwand betrieben, nahm Karel an, dass deren Besitzer nicht allzu hoch in ihrer Achtung standen.
Die meisten Pferde waren stämmige Reittiere, wie sie in diesen Landen üblich waren. Ein Pferd stach jedoch hervor. Es war eine Handbreit niedriger als die anderen, schlanker und gewiss ein schneller Renner. Zu Karels Verwunderung stand es neben einem großen, dunklen Esel mit entsetzlich langen Ohren und einem weißen Maul.
»Wem gehören die dort?«, fragte er einen der Wirtsknechte.
»Dem orientalischen Arzt und seinem Knecht. Ihr werdet sie in der Gaststube finden«, antwortete der Mann und striegelte Maries Stute voller Eifer, damit deren Begleiter auch sahen, wie fleißig er war.
2.
Als Marie die Gaststube betrat, stellte sie fest, dass der Wirtsknecht nicht übertrieben hatte, denn die vier großen Tische waren alle besetzt. Nur hinten in der Ecke war noch einer frei, doch der würde niemals für ihre gesamte Gruppe reichen. Ein Teil würde am Nebentisch Platz nehmen müssen, an dem bis jetzt nur ein Mann und ein Knabe saßen. Der Mann trug ein weites Kleidungsstück aus blauem Tuch, wie es hierzulande unbekannt war. Es hatte nicht einmal richtige Ärmel, sondern nur gesäumte Öffnungen für Hände und Kopf. Darunter trug er ein wohl ebenfalls blaues Kleidungsstück, das die Arme bedeckte, und das Tuch, das der Mann sich um den Kopf gewickelt hatte, war von dem gleichen Blau wie sein Oberkleid. Da das von der Sonne tief gebräunte Gesicht von einem Kinnbart ungewohnter Art gesäumt wurde, wirkte der Fremde sehr exotisch. Doch als er den Kopf drehte und Marie seine Augen erkennen konnte, waren diese von weitaus hellerem Blau als seine Kleidung.
Der Knabe, der bei ihm saß, mochte um die zwölf Jahre alt sein und war etwas hellhäutiger als sein Herr. Im Gegensatz zu diesem bestand seine Kleidung nur aus einem langen, hemdartigen Gewand und ledernen Sandalen, während der Mann kurze Stiefel mit nach oben gebogener Spitze trug.
»Was mag die beiden in diese Gegend verschlagen haben?«, fragte sie Michel.
Zu einer Antwort kam dieser nicht, da der Wirt eifrig auf sie zuwieselte und nach ihren Wünschen fragte.
»Einen Krug guten Weines für uns, sechs Becher dazu und dann das Beste, was deine Küche hervorzubringen vermag«, antwortete Michel.
»Für mich könnten es auch Bratwürste sein«, setzte Marie hinzu.
Seit ihrer Wanderschaft als verworfene Hure hatte sie eine Vorliebe für diese Speise gefasst und konnte nicht mehr davon lassen.
»Wein, Braten, Bratwürste. Mögt ihr auch Suppe?«, fragte der Wirt.
»Schaden wird sie uns gewiss nicht«, sagte Michel lächelnd und wies auf den Tisch mit den beiden Fremdlingen. »Vier unserer Knechte werden sich dorthin setzen müssen. Ich hoffe, Ihr habt nichts dagegen?«
Die Frage galt dem Mann in dem weiten blauen Gewand. Dieser wandte sich ihm zu und schüttelte bedächtig den Kopf. »Es ist genug Platz, nur bitten wir Eure Männer, uns in Ruhe speisen zu lassen!« Er sprach die deutsche Sprache mit einem kehligen Akzent, der aber gut verständlich war.
Michel dankte ihm und grinste. »Wenn die Kerle nicht spuren sollten, erhalten sie keinen Wein, sondern müssen nach draußen und ihren Durst in der Pferdetränke löschen.«
»Karel wird schon darauf achten, dass sie sich so benehmen, wie es sich gehört«, warf Trudi ein, während ihre Begleiterin, eine hübsch aussehende Frau mit dunkelbrauner Hautfarbe, sie tadelnd ansah.
»Wir Kibitzsteiner wissen uns allezeit zu benehmen!« Die Bemerkung galt nicht zuletzt den Gästen an den vier Tischen, die nicht gerade leise waren und, wie Marie bemerkte, etliche boshafte Bemerkungen austauschten.
Noch mehr als sie wunderte Michel sich über diese Gäste. Bei früheren Besuchen bei Graf Heinrich von Hettenheim hatte er feststellen können, dass sich die vier anderen großen Herrschaften in diesem Gau zu einem engen Bündnis zusammengeschlossen hatten, welches sich viele Jahre gegen Graf Heinrichs Vorgänger Falko von Hettenheim hatte behaupten können. Nun zu hören, wie die Hohenwalder und Löwenberger einander beleidigten, war höchst verwunderlich.
Auch Marie passte der gehässige Tonfall nicht, und sie sah Michel missmutig an. »Wenn die so weitermachen, kann es noch übel werden. Wir hätten vielleicht doch besser zum Adler weiterreiten sollen.«
»Die Löwenberger soll der Teufel holen, und den Hettenheimer gleich dazu!«, rief eben ein junger Mann, der den goldenen Baum von Hohenwald auf der Brust trug.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Marie verwundert.
Michel zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.« Er wandte sich an den Mann, der die Verwünschung ausgesprochen hatte. »Wenn du etwas gegen Herrn Heinrich von Hettenheim einzuwenden hast, dann sage es laut und deutlich. Wir sind auf dem Weg zu ihm und können ihm deine Botschaft überbringen.«
Der junge Mann sprang auf und wollte etwas sagen. Da packte ihn einer seiner Begleiter mit einem festen Griff und zog ihn auf die Bank zurück. »Beherrscht Euch! Oder wollt Ihr auch noch eine Fehde mit Hettenheim herbeiführen? Wir haben auch so schon genug Schwierigkeiten am Hals.«
»Die werden wir auch mit Hettenheim haben, wenn Graf Heinrich sich wirklich mit den Löwenbergern zusammentun will.« Der junge Mann warf der Gruppe an einem der anderen Tische einen hasserfüllten Blick zu.
Ein Mann, der zwei gekreuzte Pfeile in Silber als Abzeichen trug, stand von einem dritten Tisch auf und kam auf Michel zu. »Was habt Ihr mit Hettenheim zu schaffen?«
Die Frage klang so unverschämt, dass Michel ihn verärgert musterte. »Geht Euch das was an?«
»Wir hätten doch zum Adler weiterreiten sollen«, flüsterte Hildegard.
Mittlerweile war auch Marie zu der Erkenntnis gelangt, dass dies wohl besser gewesen wäre. Sie hatten jedoch die Krone gewählt und mussten zusehen, wie sie darin zurechtkamen. Zu ihrer Erleichterung erschienen nun Karel, sein Stellvertreter Gereon und deren vier Kameraden in der Wirtsstube. Angesichts dieser Schar setzte sich der Mann mit dem Pfeilabzeichen auf der Brust wieder hin.
»Was für eine seltsame Situation!«, raunte Marie Michel zu.
Dieser nickte verkniffen. »Mich wundert, dass Heinrich von Hettenheim in seinem Brief davon nichts hat verlauten lassen. Auf jeden Fall scheint der Herr mit dem goldenen Baum als Wappen nicht gerade sein Freund zu sein.«
Michel winkte den Wirt heran. »Du hast heute viele Gäste. Vielleicht kannst du uns sagen, zu welchen Herrschaften diese gehören?«
Der Wirt warf einen Blick über die Männer an den vier Tischen und seufzte. »Das tue ich gerne, Herr! Jene mit dem goldenen Baum gehören zu Herrn Udalrich von Hohenwalds Gefolge. Herr Udo«, er wies auf den jungen Mann, »ist Herrn Udalrichs Sohn und Erbe, und das Fräulein neben ihm ist seine Schwester Ursula.«
»Wir sind die Bogenberger und zählen zu Herrn Rainald von Bogenbergs Mannen. Hier führt uns Junker Radolf von Bogenberg an«, rief einer der Männer vom zweiten Tisch, der es nicht dem Wirt überlassen wollte, sie vorzustellen. Dabei wies er auf den jungen Mann mit den gekreuzten Pfeilen, der eben Michel angeblafft hatte.
Die beiden letzten Gruppen stellte wiederum der Wirt vor. »Die Herrschaften mit dem roten Drachenkopf auf Silber sind Gefolgsleute von Herrn Otto von Drachenstein, und der goldene Löwe ziert das Wappen derer von Löwenberg, über die Herr Engelbrecht gebietet. Ihr Anführer ist Herr Esau«, erklärte er und wies auf einen kräftig gebauten Mann um die vierzig.
»Und wer seid Ihr, der Ihr hier so großmäulig fragt?«, rief Udo von Hohenwald, der sich von seinem älteren Begleiter nicht auf Dauer den Mund verbieten lassen wollte.
»Mein Name ist Michel Adler, Reichsritter auf Kibitzstein.«
Michels Antwort ließ einige Gäste nach Luft schnappen. Immerhin war Michel als erfahrener Krieger und Anführer bekannt, der sowohl im Dienst von Kaiser Sigismund wie auch im Dienst des neuen Königs Friedrich großen Ruhm errungen hatte. Zudem wussten alle hier von seiner Freundschaft zu Heinrich von Hettenheim, und der schien bei den meisten, die hier versammelt waren, nicht beliebt zu sein.
»Ich glaube, du hast eben einigen dieser Männer etwas zum Nachdenken gegeben«, spottete Marie, obwohl ihr nach dem Auftritt, den sich die Gäste hier geleistet hatten, nicht wohl zumute war. Sie waren von Kibitzstein aufgebrochen, um Heinrich von Hettenheim zu besuchen und auf der Rückreise Lisa mit nach Hause zu nehmen. Nach alledem, was sie von Graf Heinrich wusste, sollte dieser mit seinen Nachbarn in bestem Einverständnis leben. Danach aber sah es hier ganz und gar nicht aus.
Eines zeigte sich rasch: Die Gäste an den vier Tischen waren von nun an um einiges leiser, und immer wieder sah jemand zu Michel hin, als wolle er ihn abschätzen. Der Reichsritter auf Kibitzstein hatte die vierzig bereits vor einigen Jahren überschritten, wirkte aber kraftvoll genug, um es mit jedem hier im Raum aufnehmen zu können. Dazu kamen Karel und die fünf Waffenknechte, die auch nicht so aussahen, als könne man ihnen die Butter vom Brot nehmen. Marie hingegen und die beiden Mädchen beachtete keiner. Dafür aber starrten einige Maries Freundin an, der noch weitaus stärker als dem Fremden in seinem weiten Gewand anzusehen war, dass ihre Wiege in einer anderen Weltgegend gestanden haben musste als in den Gauen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
»Die hat sich anscheinend noch nie in ihrem Leben gewaschen«, sagte Ursula von Hohenwald mit gerümpfter Nase.
»Die müsste man einmal ausziehen, um zu schauen, ob sie überall so schwarz ist«, meinte ihr Bruder, den beim Anblick der hübschen Afrikanerin der Hafer stach.
Als Karel dies vernahm, stand er auf und ging zum Tisch der Hohenwalder hin. »Ihr solltet solche Gedanken besser für Euch behalten, oder noch besser, sie gar nicht erst denken. Es könnte nämlich sein, dass sie Euch nicht gut bekommen.«
»Du wagst es, mir zu drohen?« Udo von Hohenwald sprang auf und langte zum Schwertgriff.
»Haltet Frieden, meine Herren!«, rief da der Wirt, den die wachsende Spannung im Saal zunehmend beunruhigte.
Für einen Moment sah es so aus, als würde Udo von Hohenwald dennoch sein Schwert ziehen. Da packte ihn der ältere Mann, der ihn schon vorhin zurechtgewiesen hatte, und zerrte ihn auf die Bank zurück. »Seid kein Narr! Oder wollt Ihr es Euch tatsächlich mit den Hettenheimern verderben?«
»Wenn du das tust, wird Vater nicht umhinkönnen, dich wegzuschicken«, warf Udos Schwester ein, deren Bemerkung über Alika den Zwist herbeigeführt hatte.
»Das würde dir so passen! Du würdest dann Vater dazu bringen, dir das Erbe zu überlassen«, fauchte Udo sie an, blieb dann aber still.
Auch die anderen beruhigten sich wieder, und so konnten Marie, Michel und die Ihren ohne weiteren Ärger ihr Mahl zu sich nehmen. Der Wirtsknecht, der sie auf dem Hof empfangen hatte, hatte nicht zu viel versprochen. Sowohl die Suppe wie der Braten und die Bratwürste schmeckten ausgezeichnet. Auch der Wein war gut und ebenso das Brot, von dem der Schankknecht zwei Laibe brachte.
»So lasse ich es mir gefallen«, meinte Michel. Seine Worte konnten sowohl dem Mahl wie auch der Tatsache gelten, dass die Streithähne an den vier Tischen mit gesenkten Köpfen dasaßen und die einzelnen Gruppen sich nur noch leise miteinander unterhielten.
Auch Marie war nun zufrieden. Da spürte sie, wie die neben ihr sitzende Trudi sie am Ärmel zog. »Was ist, Kind?«
»Hast du dir diesen Fremden angesehen, Mama? Er tut so, als würde ihn dies hier alles nicht interessieren. Doch wenn man ihn genau beobachtet, lässt er die Leute an den anderen Tischen nicht aus den Augen.«
Marie warf dem Mann einen raschen Blick zu. Tatsächlich blickte dieser unverwandt zu dem Tisch hinüber, an dem die Bogenberger saßen. Aber gleich darauf war es, als spüre er ihren Blick, denn er wandte sich dem Knaben zu und sagte etwas in einer fremden Sprache, von der Marie sicher war, sie noch nie vernommen zu haben.
3.
Der kurze Streit am Abend blieb der einzige Zwischenfall bis zum Morgen. Obwohl sie ihre Kammer mit Alika, Trudi und Hildegard teilen mussten, hatten Marie und Michel gut geschlafen und konnten über das, was am Vorabend geschehen war, schon wieder lachen. Eines hatten sie jedenfalls begriffen: Auch wenn die Nachbarn nicht so gut Freund mit Heinrich von Hettenheim waren, wie dieser behauptet hatte, so fürchteten sie ihn doch zu sehr, um es auf einen Streit oder gar einen Kampf mit ihm ankommen zu lassen.
Marie machte sich für den Tag zurecht, und Alika packte mithilfe der Mädchen die Decken zusammen, die zu ihrem Gepäck gehörten und die meist unsaubere Bettwäsche in den Herbergen ersetzten. Währenddessen ging Michel nach unten und wusch sich am Brunnentrog.
Einer der Gefolgsleute Engelbrecht von Löwenbergs trat zu ihm. »Gott zum Gruße, Herr von Kibitzstein«, sagte er gerade laut genug, so dass Michel es hören konnte.
»Gott zum Gruße!«, antwortete Michel und griff mit beiden Händen ins Wasser, um sich das Gesicht zu benetzen.
»Ihr reitet heute nach Hettenheim?«
»Das ist unser Ziel«, antwortete Michel.
»Könntet Ihr vielleicht Graf Heinrich etwas von uns ausrichten?«
»Sagt, was es ist, und ich werde entscheiden, ob ich es tue!«, antwortete Michel, der nicht dazu bereit war, Beleidigungen und dergleichen wortwörtlich zu übermitteln.
»Bitte teilt ihm mit: Gleichgültig, was andere sagen mögen, es waren gewiss nicht wir Löwenberger, die ihm des Nachts mehrere Schafe abgeschlachtet haben, auch wenn ihre Vliese später bei unserem Meierhof gefunden wurden.«
Michel spürte, dass der Mann es ehrlich meinte. Das besagte jedoch wenig, denn Engelbrecht von Löwenberg hatte noch andere Gefolgsleute, von denen der eine oder andere sich durchaus diesen üblen Scherz erlaubt haben konnte.