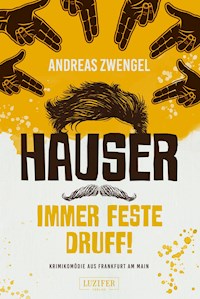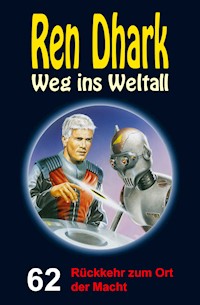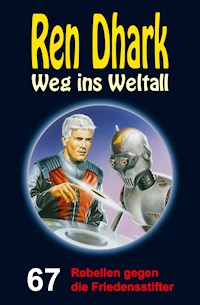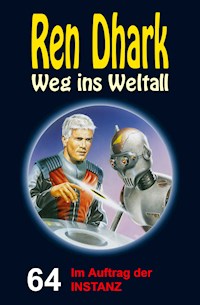Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wurdack Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Mysteriöse Zeichen, Schäden in europäischen Bergwerken: Ein Sonderermittler des Auswärtigen Amtes und ein Professor der Geschichte machen sich im Berlin der Kaiserzeit auf die Suche nach den Ursachen. Eine Begegnung in den U-Bahn-Tunnels der Stadt weist auf ein fremdes Volk hin, das in Höhlensystemen Europas lebt. Welche Rolle spielt ein übersinnlich begabtes Mädchen, das von skrupellosen Wissenschaftlern gequält wurde und nun auf der Flucht vor den Kopfgeldjägern eines Geheimbundes ist? Die Welt am Abgrund – der Siegerroman einer Ausschreibung des Onlinemagazins geisterspiegel.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Zwengel
Die Welt am Abgrund
Roman
(c) 2019 Wurdack Verlag, Nittendorf
www.wurdackverlag.de
Covergestaltung: Ernst Wurdack
Prolog
Wales, 31. Dezember 1899
Die gewaltigen Bohrer arbeiteten sich mühelos ins Erdreich. Reihe um Reihe, wie eine Formation römischer Legionäre, bewegten sich die gewaltigen Maschinen vorwärts. Sobald die Bohrer ihre angestrebte Tiefe erreicht hatten, schoben sie sich einen Quadranten weiter und setzten ihre Arbeit fort. Bei früheren Abbaumethoden hätte das Tal wie ein Stillleben gewirkt, mit Hunderten von Arbeitern, die unter Tage kaum hörbar Steine klopften. Heute war es eine bewegliche, lärmende und stinkende Fabrik, die sich mit einer beängstigenden Geschwindigkeit über das Land schob und nur verwüstete, von Bohrlöchern durchzogene Erde zurückließ, die im Nachhinein oft genug absackte oder einstürzte.
Das Dampfzeitalter war auf seinem Zenit, auch wenn die Lobby für den elektrischen Strom immer mehr Zuspruch gewann. Deren öffentliche Vorführungen legten Wert auf vergleichende Werbung und betonten die saubere Nutzung im Gegensatz zu der Luft verschmutzenden, atemraubenden und Kleider verpestenden Energie früherer Tage. Die meisten Menschen scheuten sich noch vor einem Wechsel, blieben lieber bei dem Vertrauten und Bewährten. Was jahrzehntelang gut gewesen war, konnte nicht mit einem Male völlig schlecht sein.
Es war eine eiskalte, sternenklare Nacht. Der Jahreswechsel stand kurz bevor und die meisten Menschen würden, wenn auch verfrüht, den Beginn eines neuen Jahrhunderts feiern. Es war den Mitgliedern der Nachtschicht zwar schwer gefallen, auf die Feier mit ihren Familien zu verzichten, aber der Erfolg in dieser Nacht war einfach zu verlockend. Sie hatten auf den letzten drei Quadranten die Bohrtiefe um jeweils zehn Meter erhöht und standen kurz vor einem neuen Tiefenrekord. Es herrschte ausgelassene Stimmung auf den Maschinen. Sie sicherten die Vormachtstellung des Empires, und alle Versuche der Vereinigten Staaten, ihm diese streitig zu machen, waren zum Scheitern verurteilt.
Der Mechaniker auf der Führungsmaschine, ein Dampfmann aus Überzeugung, absolvierte in dieser Nacht eine unbezahlte Doppelschicht, weil er dabei sein wollte, wenn sie den bisherigen Rekord brachen. Eine Flasche Sekt stand in seinem Führerstand bereit. Um Mitternacht würden sie anhalten und die Flasche gemeinsam leeren.
Eher zufällig nahm er den gewaltigen Umriss auf der Erhebung rechts des Tals wahr, der sich deutlich von dem helleren Nachthimmel abhob. Er spähte angestrengt in die Dunkelheit, doch er konnte nicht erkennen, um was es sich dort oben handelte. Ein Haus konnte es nicht sein. Die Gegend war dünn besiedelt, sodass sie keine Lärmbelästigung der Anwohner befürchten mussten. Dem Mechaniker war es auch lieber, wenn die Einheimischen, denen er außerhalb seiner Schicht begegnete, nicht übernächtigt und missgelaunt waren. Das Ding erschien ihm auch viel zu groß für ein Haus und zu glatt und gleichmäßig geformt, um natürlichen Ursprungs zu sein. Die Scheinwerfer seines Raupenbohrers reichten nicht weit genug, aber wenn der Mechaniker sich nicht sehr irrte, stieg Rauch daraus hervor.
Er wandte sich zur Nachbarmaschine, um den Fahrer auf das merkwürdige Objekt aufmerksam zu machen, als er ein Geräusch hörte, wie ein Finger, der aus einem Flaschenhals gezogen wurde. Ein Krachen, und die Maschine links von ihm kippte nach vorne. Sie bohrte sich in die Erde und bewegte sich nicht mehr. In ihrem Inneren schrien die Heizer, glühende Kohlestücke fielen leuchtend aus der Maschine heraus. Der Kessel war getroffen. An Bord brach Feuer aus und fraß sich schnell durch die gesamte Einrichtung. Die nachfolgende Maschine schaffte es nicht, rechtzeitig zu bremsen, und stieß mit ihr zusammen. Der Mechaniker gab den Befehl zum Bremsen und zog zur Warnung mehrmals am Signalhebel. Der Raupenbohrer auf seiner rechten Seite versuchte aus der Formation auszuscheren, wurde mit ungeheurer Macht getroffen, angehoben und gegen die folgenden Maschinen geworfen. Er löste damit einen lautstarken Domino-Effekt aus.
Vergeblich versuchte der Mechaniker, die Kollegen der hinteren Maschinen zu verständigen, als etwas das Dach seiner Kabine wegriss. Als Veteran des Deutsch-Französischen Krieges hatte er bei der Belagerung von Paris gelernt, was es bedeutete, im Kugelhagel von Kanonen zu stehen. Doch er hörte keine Schüsse, sah keinen Rauch aufsteigen. Stattdessen knickten Stützen ein, Kollegen wurden durch ihre Kabinen geschleudert und purzelten hilflos von Bord. Wer griff sie an? War es die ausländische Konkurrenz oder ein Feind der britischen Regierung? Eine Stahlkugel durchschlug den Aufbau der Nachbarmaschine, zertrümmerte den Bohrer und kullerte anschließend harmlos über das Deck davon. Der Mechaniker sah seine Kollegen am hinteren Ende der Formation aus ihren Kabinen springen und davonlaufen. Die führerlosen Maschinen stießen ungebremst in das Chaos hinein und stifteten noch mehr Verwirrung. Es gab kaum noch einen Raupenbohrer in aufrechter Position, überall hörte man das laute Quietschen sich verbiegenden Metalls. Die Bohrstäbe knickten der Reihe nach wie Zahnstocher. Etliche Förderbänder rissen und Gesteinsbrocken wurden in hohem Bogen durch die Luft geschleudert, bis sie wie Geschosse niedergingen. Unzählige Feuer waren ausgebrochen und breiteten sich in und auf den Maschinen aus. Menschen schrien und flüchteten. Niemand versuchte mehr, die Brände zu löschen.
Der Mechaniker wollte ebenfalls seinen Posten aufgeben, als das Bohrgestänge seiner Maschine getroffen wurde, umkippte und die Kabine unter sich begrub. Die Sektflasche rollte vom Tisch und zerbarst mit einem lauten Knall. Schäumend lief die kalte Flüssigkeit über den schrägstehenden Boden und tränkte seine Kleidung. Dann wurde es still. Eingeklemmt zwischen Stahl und Kohle hörte der Mechaniker das Ding auf der Erhebung Dampf ausstoßen. Eine Stichflamme loderte hinter ihm hoch in den Himmel und er konnte den gewaltigen Koloss erkennen, der die beeindruckenden Ausmaße ihrer Maschinen noch weit in den Schatten stellte. Das monströse Gefährt setzte sich langsam in Bewegung und rollte über den Kamm hinweg, während in weiter Ferne Raketen in den Himmel aufstiegen und den Beginn des neuen Jahres einläuteten.
Erster Teil
Das Mädchen
Erstes Kapitel
Tsingtau, Juni 1900
Anton Slabon arbeitete als Vermessungsingenieur in Berlin. Als er von der Suche des Reichsmarineministeriums nach Männern seines Faches hörte, die zudem noch Dolmetscher für die chinesische Sprache waren, fügte er diese Profession seinem ohnehin geschönten Lebenslauf noch hinzu. Das plötzliche Fernweh hatte zu einem nicht geringen Teil mit Spielschulden an Hinterhofwürfeltischen zu tun. Seine schwangere Frau Helene dagegen brachte nur wenig Begeisterung für die siebenwöchige Schiffsreise auf und dafür, ihrem Mann ans andere Ende der Welt zu folgen. Es blieb ihr jedoch wenig anderes übrig, wenn sie nicht reumütig in den Schoß ihrer Familie zurückkehren wollte, die diese Entwicklung angeblich schon immer vorhergesehen hatte. Von Bremerhaven bis Shanghai knirschte sie mit den Zähnen und gönnte sich dann eine kleine Pause vom Unleidlichsein, um ihre Tochter Esther zu gebären.
In der Heimat hatte man seit den Opiumkriegen von einem Handels- und Flottenstützpunkt am Ostchinesischen Meer geträumt. Die Welt war unter den europäischen Mächten fast vollständig aufgeteilt und das Deutsche Kaiserreich hatte das Gefühl, viel zu kurz gekommen zu sein. Den erforderlichen Anlass, um tätig zu werden, bot ein Übergriff auf Missionare der Steyler Mission, die bereits seit Jahren unter dem Schutz des Reiches stand. Daraufhin besetzte die Kaiserliche Marine am 14. November 1897 kampflos die Bucht von Kiautschou. Kritiker monierten, dass der Übergriff an einem völlig anderen Ort im Norden stattgefunden habe und Tirpitz die Bucht bereits ein Jahr zuvor auf seine Tauglichkeit als Stützpunkt hatte inspizieren lassen. Nichtsdestotrotz bekam China ein Ultimatum zur Einwilligung in einen Pachtvertrag über 99 Jahre und fügte sich. Keine schwierige Entscheidung, wenn die Kriegsflotte des Verhandlungspartners vor der Haustür ankerte.
Anton Slabon kam als einer der ersten Facharbeiter nach Inkrafttreten des Pachtvertrages im März 1898 nach Tsingtau. Eine Woche später begannen die Vermessungsarbeiten. Er war erleichtert, dass man ihn in seiner Eigenschaft als Vermesser dringender brauchte, denn als Dolmetscher, und er genoss die einmalige Gelegenheit, eine Stadt von Grund auf zu planen. Mitte April traf Kapitän zur See Carl Rosendahl in der neuen Kolonie ein und wurde am folgenden Tag offiziell zum Gouverneur ernannt. Marineoffizier durch und durch, der er war, ließ er das ehemalige Fischerdorf zu einem imposanten Flottenstützpunkt ausbauen.
»Die bauen hier eine ganze Stadt und wir hausen wie Maria und Josef«, beschwerte sich Helene Slabon.
Wegen der allgemeinen Wohnungsnot waren einige sehr schlichte Gebäude errichtet worden. Zusätzlich hatte man einfache Holzhäuser, sogenannte ›Tropenhäuser‹, aus Deutschland importiert.
»Selbst der Gouverneur wohnt in einem solchen Haus. Wie soll ich da Anspruch auf ein größeres haben?«
»Immerhin hat er sich zwei davon zusammensetzen lassen.«
»Er hat auch repräsentative Pflichten. Du wirst dein Haus schon noch bekommen. Ich bin dabei, uns eine Zukunft aufzubauen.«
»Aber warum hier? Warum nicht in Südfrankreich?«
***
Die kleine Esther war das ruhigste Kind, das man sich vorstellen konnte, beinahe besorgniserregend still. Trotzdem bot sie ihrer Mutter noch ausreichend Grund zur Klage. Als Anton so weit war, die Ersparnisse in eine Rückfahrkarte für seine Ehefrau zu investieren, sprach eine junge Frau bei ihm vor und bot sich als Kindermädchen an. Ihr Verlobter habe sich im Hafen von Singapur von Bord geschlichen und sie völlig mittellos sich selbst überlassen. Helene war begeistert von der Idee, vergaß ihr übliches Misstrauen gegenüber Fremden und hieß Marie Frost, so war ihr Name, in ihrem bescheidenen Heim willkommen. So bescheiden, dass Marie im Kinderzimmer unterkommen musste. Sie kümmerte sich von da an um Esther, den Haushalt und die Mahlzeiten, und verschaffte Helene mehr Freizeit, als diese sinnvoll zu füllen verstand. Das Angebot an Beschäftigung war nicht sehr groß, wenn man auf einer gigantischen Baustelle lebte und mit dem Großteil der Bevölkerung nichts zu tun haben wollte, die aus Kaufleuten, Verwaltungsbeamten, Missionaren, Soldaten und chinesischen Arbeitern bestand. Da es in der Kolonie noch nicht genügend Frauen gab, um einen ausgewählten Freundeskreis aufzubauen, verbrachte sie den größten Teil des Tages damit, Marie bei ihren Tätigkeiten zuzusehen. Ihr Mann war der Meinung, dass sie in diesem Fall die Arbeiten auch selbst erledigen könnte, anstatt jemanden dafür zu bezahlen. Aber die erste Diskussion über dieses Thema war auch gleichzeitig die letzte. Freiwillig würde er sich einem solchen Feuerwerk an Vorwürfen über Verschleppung aus der Heimat und grober Vernachlässigung nicht mehr aussetzen.
Das Leben im Hause Slabon nahm dank Marie einen etwas entspannteren Rhythmus an. Helene interessierte sich nicht sehr für Kindererziehung. Die Schwangerschaft war mehr ein Projekt mit ihren Freundinnen in Berlin gewesen, die sich vorgenommen hatten, gemeinsam schwanger zu werden, um sich dann regelmäßig zu treffen, Erziehungstipps auszutauschen, Kinderkleidung auszusuchen und über geeignete Schulen zu diskutieren. Marie belästigte sie nicht mit Details, sondern erledigte alle Pflichten ohne Aufsehen. Abends sah Anton zu, wie Marie seine Tochter badete, fütterte und wickelte. Sie verströmte Mutterliebe in gleichem Maße, wie sie bei seiner Frau fehlte. Wenn Marie seinen Blick bemerkte, lächelte sie ihn unbefangen an. Sehr schnell sorgte sie dafür, dass sie unentbehrlich wurde. Die beiden Frauen plauderten und scherzten viel, gerieten in Aufregung über die neueste Mode und den aktuellsten Klatsch. Marie versorgte Helene mit Zeitschriften, Kleidern und Parfüm. Alles, worauf sie bisher so schmerzlich verzichten musste. Marie beschaffte all diese Dinge über einen jungen Marineinfanteristen, der über sagenhafte Kontakte zur Lagerverwaltung verfügte und ihr schöne Augen machte. Auch nach tagelangem Bohren konnte Helene ihr nicht das Geständnis einer Liebschaft entlocken und schmollte wegen ihrer unbefriedigten Neugier, aber im Gegenzug für eine Indiskretion über die Frau des Gouverneurs war sie bereit, das Thema zu vergessen.
Die angenehme Stimmung hielt nur bis Oktober an, als Anton von einer Sitzung mit dem Stabschef, dem Zivilkommissar und anderen wichtigen Funktionären zurückkam. Was sie schon lange befürchtet hatten, war nun eingetreten. Der Staatssekretär des Reichsmarineamtes Tirpitz, dem die gesamte Kolonie unterstand, war stets unzufrieden mit Rosendahls Ergebnissen gewesen, weil er sich lediglich um die militärischen Belange kümmerte und die wirtschaftliche Entwicklung vernachlässigte. Anton hatte dem Gouverneur immer wieder deutlich zu machen versucht, welche Bedeutung die Kolonie für das Ansehen der deutschen Marine besaß. Dass sie als Musterkolonie der Flottenpropaganda dienen sollte und ein Beispiel für die effektive deutsche Kolonialpolitik darzustellen hatte. Jetzt würde Anton mit einem Nachfolger neu beginnen müssen, und das bedeutete noch mehr Arbeit und noch weniger Zeit zu Hause.
Seiner Frau bekam auf Dauer das einsame Leben in der Kolonie nicht. Sie war eine schöne Frau gewesen, bevor sie aus der Aufsicht ihrer Freundinnen geriet und nachlässig mit sich wurde. Helene verließ kaum noch das Haus, lehnte alles Einheimische ab und hungerte lieber, als chinesisches Essen anzurühren. Glücklicherweise schaffte Marie es, ihr nur deutsche Gerichte vorzusetzen, und zeigte sich dabei erstaunlich kreativ. Esther gedieh unterdessen in der Obhut des Kindermädchens prächtig und wandelte sich in ein fröhliches und aufgewecktes Kind. Eines Abends bemerkte Anton, wie sich das Mobile über dem Kindbett im Wind drehte. Es wurde immer schneller, bis es beinahe rotierte. Er betrat das Kinderzimmer, um das Fenster zu schließen, und machte Marie insgeheim Vorhaltungen wegen ihrer Nachlässigkeit. Doch kaum hatte er die Schwelle übertreten, blieb das Mobile abrupt stehen. Er nahm dies ebenso verwundert zur Kenntnis wie das geschlossene Fenster und schrieb seine überreizte Fantasie der hohen Arbeitsbelastung zu.
Gouverneur Rosendahl musste noch bis zum Februar des folgenden Jahres bleiben, bis sein Nachfolger eintraf. Unter Otto Ferdinand Paul Jaeschkes Führung machte die Entwicklung der Kolonie Fortschritte. Alle Bauvorhaben wurden unter Hochdruck vorangetrieben. Bis zur Jahrhundertwende sollte Tsingtau über eine moderne Trinkwasseranlage, eine Abwasserentsorgung, eine Brauerei, sowie einen Bahnhof verfügen. Dadurch würde die Kolonie ein selbstständiges Wirtschaftsgebiet werden, das auf keine Zuschüsse angewiesen war, sondern sogar Gewinne für die heimatliche Wirtschaft erbrachte. Dies wollten sie den Chinesen vor Ort, den Zweiflern in der Heimat und überhaupt der ganzen Welt beweisen. Der Entwicklung zu einer Großstadt nach europäischem Vorbild stand nichts mehr im Wege.
Zu Hause warf Helene Slabon ihrem Mann vor, sie und das Kind zu vernachlässigen. Die Diskussion endete wie gewöhnlich in gegenseitigen Beschimpfungen und dem stürmischen Abgang in verschiedene Räume. Anton verbrachte weiterhin mehr Zeit auf Baustellen als im eigenen Heim, bis ihn auf der Feier zum ersten Geburtstag seiner Tochter die Frau eines Arbeitskollegen ansprach. Sie redete von einer unheimlichen Aura, die Esther umgab. Ob er bemerkt habe, dass Tiere und andere Kinder ihre Nähe mieden. Ihm war nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Aber wie auch, er verbrachte alle ihre wachen Stunden außer Haus, bekam sie höchstens schlafend zu sehen und am Sonntag, bei den Ausflügen mit der Familie, war er in Gedanken bei der Arbeit. Dasselbe galt für seine Frau. Sie kümmerte sich nie um Esther, höchstens in Gesellschaft anderer Mütter. Dann zog sie ihre Tochter schnell aus Maries Armen und schaukelte sie ungelenk auf ihren Knien, bis sie zu weinen begann. Anton musste einsehen, dass die eigenen Eltern am wenigsten über Esther wussten. Marie war ihre engste Bezugsperson und niemand kannte sie besser. Als Anton ihr von der Äußerung der Frau erzählte, lachte Marie schallend über diesen ausgemachten Blödsinn. Sie schob es auf Neid und Missgunst wegen seines reizenden Kindes oder seiner beruflichen Erfolge und schaffte es schnell, ihn zu beruhigen. Das Einzige, das an Esther besonders sei, waren ihr schnelles Wachstum und ihre außergewöhnliche Intelligenz. Er dachte nur noch ein einziges Mal an den Vorfall, wenige Wochen später, als er hörte, dass sein Arbeitskollege samt Ehefrau bei einem Bootsunfall ertrunken sei.
Das Jahr 1900 begann und Anton saß an seinem Schreibtisch mit mehreren Schichten Vorratslisten, Anträgen, Lieferscheinen und Rechnungen. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, hatte viel an Gewicht und Haaren verloren, doch der Erfolg konnte sich sehen lassen. Entlang der Uferstraße der Europäerstadt befanden sich Handelshäuser und Hotels. In der Straße dahinter die Geschäftshäuser, gefolgt von den Wohngebäuden. Weiter nördlich hatte man villenartige Wohnungen geschaffen, in deren Mitte das Regierungsgebäude stand. Manchmal konnte man direkt vergessen, dass man in China war. Einheimische Architektur gab es nur noch im Stadtteil der chinesischen Bevölkerung zu sehen. Durch seinen schier unermüdlichen Einsatz war Anton vom einfachen Ingenieur zu einem wichtigen Mitglied des Gouvernementsrates aufgestiegen, was seine Arbeitsbelastung noch um ein Vielfaches erhöhte. Längst war sein Verantwortungsbereich nicht mehr auf die Stadt selbst beschränkt, sondern auf die Entwicklung der gesamten Provinz ausgedehnt. Er erhielt Angebote aus der Heimat. Hoch bezahlte Stellungen, für die ihn früher niemand in Betracht gezogen hätte. Reizvolle Vergünstigungen wurden ihm in Aussicht gestellt und Anton fühlte sich geschmeichelt, aber jetzt, wo alles nach seinen Vorstellungen lief und er die ersehnte Anerkennung für seine Arbeit erhielt, würde er den Teufel tun und nach Deutschland zurückkehren.
Gleichzeitig bekam seine Frau – von ihm unbemerkt – Briefe ihrer Familie, in denen um ihre Rückkehr gebettelt wurde. Alles sei vergeben und vergessen, sie wollten nur ihre Tochter und ihr Enkelkind im Schoße der Familie haben. Anton wurde in keinem der Briefe erwähnt.
Das Thema Rückkehr wurde zum ständigen Auslöser von hitzigen Debatten. Nach einem besonders heftigen Streit sprang Anton vom Abendbrottisch auf und verließ das Haus. Er spazierte einige Stunden über die Hügel oberhalb der Stadt, trank in seinem Stammlokal ein paar Bier und kehrte erst nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Er erwartete, alle schlafend vorzufinden, als er das Haus betrat, doch aus dem Badezimmer war schwacher Kerzenschein zu sehen. Er trat näher an die Tür. Marie saß im Badezuber und wusch sich mit einem großen Schwamm. Sie drückte ihn an ihrem Hals aus und ließ das Wasser über ihre kleinen Brüste laufen, die vom Seifenschaum kaum bedeckt waren. Anton leckte sich nervös über die Lippen. Er hatte schon oft seine Frau beim Baden gesehen, doch die wickelte den Vorgang wie eine lästige Pflicht ab, redete dabei unterbrochen und schrubbte wie an einem alten Möbelstück mit eingetrockneten Flecken. Marie dagegen genoss den Vorgang und strich in sanften Bewegungen den Schaum von ihrer weißen Haut. Sie trug eine Haube, unter der einige Haarsträhnen feucht in ihr Gesicht hingen. Mit geschlossenen Augen wiegte sie den Kopf leicht hin und her. Als sie ein Bein aus dem Wasser streckte und mit dem Schwamm über die Innenseite der Oberschenkel fuhr, schob sich Slabon weiter vor. Mit einem Mal öffnete Marie die Augen und sah ihn direkt an. Ihren Gesichtsausdruck konnte er nicht deuten. Es war keine Scham, kein Schreck, keine Verärgerung oder gar Belustigung. Anton wich in die Dunkelheit zurück und schlich ins eheliche Bett.
Am nächsten Morgen war er sehr befangen, während Marie sich nichts anmerken ließ. Er beobachtete sie, versuchte, unbemerkt mehr von dem zu sehen, was sie ihm bereits unabsichtlich gezeigt hatte. Am zweiten Tag nach der nächtlichen Begegnung sprach sie ihn abends darauf an. Er saß zusammengesunken an seinem Schreibtisch, als sie im Nachthemd hereinkam und sich vor ihn kniete. Sie legte zart eine Hand auf seinen Oberschenkel und er zuckte leicht zurück.
»Keine Sorge, Ihre Frau schläft. Ich habe Ihre Blicke bemerkt. Wie Sie mich angesehen haben.«
Anton schob ihre Hand sanft von seinem Bein. Marie beugte sich vor, er spürte ihren Schenkel an seiner Wade. Sie roch so gut nach Seife und Jugend. Ganz anders als seine Frau, die ihren eigenen Duft unter teuren Parfüms verbarg. Sein Gesicht glühte und er stand schnell auf. Marie kam gleichzeitig mit ihm hoch und drängte sich an ihn, sodass er ihre Brüste durch den Stoff des Nachthemdes spüren konnte. Er fasste sie an den Schultern und schob sie von sich. Sie war bereits eine erwachsene Frau, trotzdem trennten sie wohl an die zwanzig Jahre an Lebensalter und eine Affäre in den eigenen vier Wänden würde unweigerlich zur Katastrophe führen.
»Tut mir leid, aber das muss ein Missverständnis sein. Wenn ich dich angesehen habe, dann nur aus Sympathie.«
Marie trat zurück und lächelte ohne Verlegenheit. Und ohne ihm zu glauben.
Sie schien sich nichts daraus zu machen, dass er sie abgewiesen hatte. In den folgenden Tagen erwartete er geradezu, dass sie ihm das Essen provozierend auf den Teller klatschte, schnippische Antworten gab oder Anspielungen in Gegenwart seiner Frau machte. Doch nichts davon geschah. Sie blieb gleichbleibend freundlich und behandelte ihn genauso wie zuvor. Es war keine jugendliche Schwärmerei gewesen, die sie zu ihrem Angebot bewegt hatte, erkannte Anton, sie schien nur einfach den Wunsch zu haben, jeden im Haus so zufrieden wie möglich zu stellen. Beschämt wegen ihrer Entdeckung seiner Begierden, hielt er sich noch seltener zu Hause auf.
Sein exzessives Arbeitspensum forderte bald seinen Tribut. Er litt unter permanenten Kopfschmerzen und beim Aufstehen vom Schreibtisch wurde ihm mehrfach schwarz vor Augen, sodass er sich auf dem Fußboden wiederfand. Glücklicherweise blieb es von den Kollegen unbemerkt. Marie dagegen fiel sein Zustand sofort auf.
»Sie sind überarbeitet, Herr Slabon, es wird Zeit, dass Sie sich schonen und lernen, sich zu entspannen. Man kann von den Chinesen viel in dieser Hinsicht lernen.«
Beim morgendlichen Ausritt hatte Anton oft alte Chinesen beim Tai’-Chi auf den Hügeln beobachtet, doch Marie meinte etwas anderes. Sie bot ihm ein Präparat zur Entspannung an und kaum einen Monat später war er unrettbar opiumsüchtig.
***
Seit Jahresbeginn hörte man von ersten Ausschreitungen innerhalb der Provinz. Der Geheimbund der Boxer wehrte sich gegen die Missionierung und Industrialisierung Chinas. An vielen Orten kam es zu Unruhen. Im Frühjahr hatte es im Norden eine verheerende Dürre gegeben, an der man den Ausländern die Schuld gab. Wie sie das gemacht haben sollten, konnte Anton allerdings niemand beantworten. Das chinesische Kaiserhaus hatte sich bisher herausgehalten, um nicht länger selbst das Ziel der Aufständischen zu sein. Anton bereiteten die Übergriffe große Sorgen. Er konnte verstehen, dass die Leute auf dem Land aufgebracht waren, weil die Eisenbahn durch landwirtschaftlich genutzte Gebiete geführt wurde und Missionare sich in die Rechtsprechung mischten, die meist zugunsten der christlichen Chinesen ausfiel. Aber erkannten diese Leute nicht den längerfristigen Nutzen? Die Boxerbewegung unterstützte und mobilisierte die ländliche Bevölkerung und erhielt dafür starken Zulauf. Ihre Botschaft fiel auf fruchtbaren Boden. Die meisten Europäer blieben in ihren Häusern und mieden größere Zusammenkünfte, weshalb es an Esthers zweitem Geburtstag kaum Gäste gab.
Im April begannen die Angriffe auf christliche Wohnstätten, Kirchen und Bahnlinien. Ein offener Aufstand war abzusehen und es hieß, die Bewegung verlagere sich in den Großraum Peking. Anton verbrachte seine Abende auf der Veranda und trank. Das Klima in Tsingtau unterschied sich nicht allzu sehr von dem der Heimat, abgesehen von den langen und schwülheißen Sommern. Gelegentlich wankte er zum Pinkeln in den Garten. Er bestrafte die Zuchtrosen seiner Frau mit seinem alkoholgetränkten Urin und genoss dabei den Ausblick über die Bucht. Kleine Racheakte wie dieser halfen ihm, in seiner Ehe nicht allzu unglücklich zu sein. Sie hatten sich ohnehin kaum noch etwas zu sagen, und wenn er tagsüber nach Hause kam, weil er Unterlagen aus seinem Arbeitszimmer brauchte, fand er meistens Marie und Esther allein dort vor.
»Sie sollten besser auf Ihre Frau aufpassen«, sagte Marie von der Tür aus.
»Das habe ich überhört«, lallte Anton zerknirscht und sie wiederholte es lauter. Er wusste, dass sich seine Frau in der Stadt herumtrieb, aber deshalb musste er es sich nicht von seinem Kindermädchen unter die Nase reiben lassen. Er wusste allerdings nicht, dass es Marie gewesen war, die seine Frau mit dem feschen Korvettenkapitän bekannt gemacht hatte, mit dem sie Unzucht trieb. Helene traf sich mit ihrem Liebhaber im Prinz-Heinrich-Hotel an der Seepromenade Kaiser-Wilhelm-Ufer. Anton war ihr einmal gefolgt und hatte das Paar zusammen auf dem Balkon stehen sehen, nur mit einem Bettlaken bekleidet. Direkt neben ihnen, auf der schmalen Seite des Hotels, befand sich im Putz das chinesische Symbol für »shou«, was »Langes Leben« bedeutete. Anton war bereit gewesen, dies Lügen zu strafen und sich einen Revolver zu besorgen. Aber der schnittige Korvettenkapitän war zweifellos viel geübter im Umgang mit Schusswaffen und würde ihm nicht den Hauch einer Chance lassen. Außerdem verspürte Anton nicht den Wunsch, um Helene zu kämpfen. Um diese redselige und selbstgefällige Matrone, die aus dem schüchternen jungen Mädchen geworden war, das er einmal geheiratet hatte.
Marie hatte seine Pfeife vorbereitet und er folgte ihr in sein Arbeitszimmer. Sie sah schweigend zu, wie er in tiefen Zügen den Rauch einsog und auf das Sofa sank. Langsam zog sie ihm die Schuhe aus und legte seine Beine hoch, bevor sie sich leise zurückzog. Anton dämmerte ruhig vor sich hin, versuchte, die Bilder von seiner Frau und ihrem Liebhaber zu verdrängen, wie sie sich lüstern aneinanderpressten, ihre schweißnassen Brüste gegen seinen breiten Oberkörper klatschten und sie in höchster Verzückung schrie. Als er die Augen öffnete, sah er Esther. Sie stand mit dem Rücken zu ihm im Wohnzimmer. Marie kniete vor ihr und sah sie erwartungsvoll an. Er kniff die Augen zusammen, um besser erkennen zu können, was dort vor sich ging. Esther hob ihre Arme und breitete sie zur Seite aus. Er konnte nur die Reaktion auf Maries Gesicht sehen, aber was er dort sah, erschreckte ihn. Alle Güte, Unschuld oder gar Naivität, die er bisher in ihr zu sehen geglaubt hatte, war verschwunden. Wie durch ein Vergrößerungsglas sah er die Augen eines zu allem entschlossenen, aber kühl kalkulierenden Menschen. Er sah Zufriedenheit und Gier. Als wäre etwas eingetreten, auf das Marie schon lange hatte warten müssen. Dann schaffte er es nicht mehr, seine Augen aufzuhalten, und schlief ein.
***
Die Folgen der Opiumsucht beeinträchtigten seine Arbeitsleistung, und zwar in einem Ausmaß, das bereits seinen Mitarbeitern auffiel. An einem besonders harten Tag Mitte Mai kam Anton früher nach Hause und fand seine ermordete Frau im Wohnzimmer. Ihre Kleider befanden sich in Unordnung. Zuerst dachte er an einen Streit mit ihrem Liebhaber, doch als er sie auf den Rücken drehte, sah er den Dolch in ihrer Brust. Der Griff war umwickelt mit einem scharlachroten Tuch. Die Boxer, dachte er und stürzte ins Kinderzimmer, um nach seiner Tochter zu sehen. Esther lag reglos in ihrem Bett und rührte sich nicht. Als er ihre Haut berührte, zuckte seine Hand zurück und Tränen schossen ihm in die Augen. Ihr Leib war kalt und steif. Vorsichtig nahm er den toten Körper hoch. Dabei verrutschte die Decke und er sah die Leiche eines chinesischen Kindes. Erst jetzt fiel ihm der penetrante Petroleumgeruch auf, der von dem Leichnam und dem Bett ausging. Anton legte das Kind in die Wiege zurück und als er sich umdrehte, stand Marie vor ihm.
»Gut, dass euch nichts passiert ist«, sagte er erleichtert, »wo ist Esther?«
Er bemerkte den Dolch in ihrer Hand. Das Gegenstück zu der Waffe, mit der Helene getötet worden war.
»Oh mein Gott«, stöhnte Anton. Marie machte zwei rasche Schritte auf ihn zu und stach mit dem Messer nach ihm. Er schlang beide Arme um sie und hielt sie an sich gepresst. Mit aller Kraft, die seinem geschwächten Körper zur Verfügung stand, versuchte er, das Leben aus ihr zu quetschen. Sie verlor ihr Messer und wand sich in seinem Griff. Mehrfach versuchte sie, ihre Stirn in sein Gesicht zu stoßen, doch er ließ nicht locker. Schließlich biss sie ihm mit aller Kraft in den Hals. Anton spürte Blut an seinem Rücken herablaufen und schrie laut auf. Marie zerrte an seinem Fleisch, als wolle sie einen gewaltigen Brocken herausreißen. Er schleuderte ihren zierlichen Körper durch den Raum und sie landete quer auf der Kommode. Der Spiegel splitterte und Parfümflakons fielen zu Boden.
»Esther!«, brüllte er und rannte verzweifelt durch die Zimmer. Marie war schnell wieder auf den Beinen, erwischte ihn in der Küche und stieß ihm das Messer mehrmals von hinten in den Leib. Röchelnd ging Anton zu Boden. Sie machte einen großen Schritt über ihn hinweg und ging ins Kinderzimmer. Er konnte sich nicht bewegen und seine Lunge füllte sich mit Blut. Mühsam hob er den Kopf. Hinter Marie flammte das Kinderzimmer auf und sie trug die betäubte Esther heraus. Er rief immer wieder verzweifelt nach seiner Tochter und kroch auf Marie zu, dabei zog er eine Blutspur über den Boden und hinterließ blutige Handabdrücke. Verzweifelt bettelte er Marie an, bis er resignierend in sich zusammensackte.
»Was für ein Mensch bist du nur?«, flüsterte er kraftlos.
Marie ließ die Frage unbeantwortet. Das letzte, was Anton Slabon sah, bevor das Dach auf ihn stürzte, war Marie, die mit Esther auf dem Arm in die Dunkelheit schritt, und der brennende Hauseingang schuf einen flammenden Rahmen für dieses Bild.
Zweites Kapitel
Peking, Sommer 1900
Sie erreichten Peking am 3. Juni 1900, kurz bevor die Bahnlinie zwischen Tientsin und der Hauptstadt von den aufständischen Boxern unterbrochen und damit jede Unterstützung von der Küste abgeschnitten wurde. Fünfzig Marineinfanteristen der kaiserlichen Marine aus Tsingtau unter dem Kommando von Oberleutnant Graf Soden marschierten in die Hauptstadt. Unter ihnen der junge Fabian aus Berlin, von seinen früheren Lehrern als Schlitzohr beschimpft und von den Kameraden in Krisensituationen als Rampensau geschätzt.
Der Staub der unbefestigten Straßen, aufgewirbelt durch geschäftig umherhetzende Chinesen, kratzte in der Kehle. Die Düfte und weniger angenehmen Gerüche aus den unzähligen Garküchen zwängten sich tief in die Nase hinein, und das Gebrüll der Marktschreier quälte wegen seiner Lautstärke, Vielstimmigkeit und Unverständlichkeit die Ohren. Die Farbenpracht der Läden, Stände und Fahnen überforderte die Augen, während die Hitze des Sommers unablässig auf der Haut brannte. Europäische Frauen mit Sonnenschirmen und ihre Männer mit Kreissägen und anderen Kopfbedeckungen flanierten über die Straßen. Man hatte die Wahl, sich zu Fuß die Knöchel zu verstauchen, sich in einer Rikscha die Knochen durchrütteln zu lassen oder den Geruch eines Mietesels zu ertragen. Würdenträger in schweren Seidenroben wurden in Sänften getragen, Händler liefen mit einem Joch über den Schultern herum, in denen sie Früchte und Gewürze anboten, und Bettler entblößten ihre Geschwüre, um ein Almosen zu erhalten. Peking erschien Fabian wie eine Mischung aus Jahrmarkt, Zirkus und Zeltlager, die sich rasend schnell um sich selbst drehte.
Das Gesandtschaftsviertel lag inmitten der Hauptstadt. Die englische Gesandtschaft als ehemaliges Palastgebäude war die bei weitem geräumigste unter ihnen. Südlich von ihr befanden sich die russische, holländische und amerikanische Gesandtschaft. Gegenüber den Amerikanern, auf der anderen Seite des schmalen Kanals, lag die deutsche Gesandtschaft und nördlich davon diejenigen der Spanier, Japaner, Franzosen und Italiener. Etwas abseits in nordöstlicher Richtung war die österreichische Gesandtschaft untergebracht. Nur wenige hundert Meter weiter, durch eine hohe Mauer vom Gesandtschaftsviertel abgegrenzt, lag die Verbotene Stadt.
Geordnet marschierten die Marineinfanteristen in den Hof der deutschen Gesandtschaft ein und alles wurde etwas angenehmer. Man kam aus Lärm und Dreck in eine schattige Oase, bestehend aus einem Komplex aus Wohnräumen, Höfen und Gärten, und erhielt die Gelegenheit kurz durchzuatmen. Fabian wollte so schnell wie möglich zurück nach Tsingtau.
Am 26. Januar 1898 war er an Bord des Reichs-Post-Dampfers »Darmstadt« in der neuen Garnison eingetroffen. Als Marineinfanterist sollte er zusammen mit seinem speziell für diesen Zweck gegründeten Bataillon die Sicherung des Gebietes übernehmen. Sie waren 1100 Mann und ihre erste Amtshandlung im fremden Land bestand in einer Parade zu Ehren des Geburtstages des Kaisers. Sie fand während eines heftigen Sandsturms und bei eisiger Kälte statt.
Fabian hatte die reine Abenteuerlust dazu getrieben, wochenlang über die Weltmeere zu kreuzen. Er verschlang alle Bücher von Karl May und Jules Verne und tagträumte von edlen Indianern, fernen Ländern, Ballonfahrten und Unterseebooten. Durch diverse Glücksspiele während der langen Überfahrt verfügte er über ein gutes Startkapital, als er in China ankam. Während seine Kameraden noch staunend die grünen Berge und die gelben Menschen betrachteten, marschierte er zum Lagerverwalter, drückte ihm seine Gewinne in die Hand und stellte sich als sein neuer bester Freund vor. Gemeinsam betrieben sie kreative Buchführung und verkauften Materialüberschüsse überall in der Provinz Schantung. Im ersten Jahr nahmen sie noch zwei Mitarbeiter in ihr kleines Unternehmen auf, die an zentralen Geschäftsknotenpunkten der Kolonie saßen und nachdem Fabian sich gemütlich eingerichtet hatte, sorgte er dafür, vom jährlichen Wechsel der Besatzung ausgenommen zu werden. Im zweiten Jahr wusste Fabian mehr über die Vorgänge in Tsingtau als der Gouverneur, aber seine Geschäfte blieben nicht unbemerkt. Und so hatte er es einem Vorgesetzten, der es nicht schaffte, ihm gewisse Unregelmäßigkeiten nachzuweisen, zu verdanken, dass er sich mit 50 Kameraden Richtung Peking in Marsch setzen durfte, um die dortigen Gesandtschaften zu schützen. Gouverneur Jaeschke hatte den tüchtigen jungen Graf Soden zum Befehlshaber bestimmt, weil er den Meldungen über die aufständischen Boxer nur wenig Bedeutung zumaß und deshalb den Ausflug in die Hauptstadt für einen Urlaub hielt. Fabian dagegen hatte überhaupt keine Zeit für diese Reise, da wichtige Geschäfte auf ihn warteten. Er hatte laufende Verpflichtungen zu erfüllen und musste außerdem seinem Geschäftspartner in Tsingtau auf die Finger schauen. Er konnte nur hoffen, dass sich alle Parteien schnell beruhigten, damit er seine eigentliche Tätigkeit wieder aufnehmen konnte.
***
Vor Ort erwiesen sich die Befürchtungen wegen der Boxer keinesfalls als übertrieben und tatsächlich waren sie keine Sekunde zu früh eingetroffen. Überall aus den nördlichen Gebieten flüchteten die Ausländer nach Peking. Meist Missionare mit zahlreichen Bekehrten, die das Hauptangriffsziel der Boxer waren. Täglich trafen chinesische Christen ein, die von den Gräueltaten der Boxer berichteten. Von abgeschnittenen Nasen und Ohren und herausgerissenen Zungen war die Rede.
Im Verlauf der ersten Woche häuften sich die schlechten Nachrichten. Admiral Seymour, der mit zweitausend Männern aus acht Nationen die Gesandtschaften verstärken sollte, war auf dem Weg nach Peking in erste Kämpfe verwickelt und aufgehalten worden. Nachts marschierten die Boxer durch die Straßen von Peking und brüllten, dass sie alle fremden Teufel töten wollten. In der Nacht zum 14. Juni richteten sie innerhalb der Stadtgrenzen ein Massaker unter chinesischen Christen an. Männer, Frauen und Kinder wurden in Stücke gehackt oder lebendig verbrannt, während die chinesischen Soldaten nicht eingriffen. Mit Grammophonen, Chören und dem Gesang einer ehemaligen russischen Opernsängerin versuchte man in den Gesandtschaften, die entsetzlichen Schreie zu übertönen. In den folgenden Nächten steckten die Boxer zahlreiche Kirchen und öffentliche Gebäude in Brand, sodass die Feuer die ganze Nacht über die Stadt erhellten. Das gesamte Eigentum von Ausländern und chinesischen Christen im Umkreis von Peking wurde zerstört. Ein Brand in den Straßen der Händler legte ein gesamtes Stadtviertel in Schutt und Asche. Alle befanden sich in höchster Alarmbereitschaft.
»Denken Sie an Tsingtau, wo die Boxer eine komplette deutsche Familie umgebracht und ihr Haus in Brand gesetzt haben. Wir hätten damals schon losziehen und die bezopften Bastarde fertigmachen sollen.«
Fabian hatte die Familie Slabon nie persönlich kennen gelernt, nur ihr Kindermädchen, aber trotzdem hatte ihr Schicksal ihn sehr betroffen gemacht. Vor allem der Tod des kleinen Mädchens. Jeder in der Kaserne dachte genauso wie sein Gesprächspartner. Er selbst interessierte sich nicht für Politik und die Hintergründe des Aufstandes waren ihm egal, aber wer ihm bewaffnet gegenübertrat – wie gerechtfertigt seine Motive auch sein mochten –, der hatte die Konsequenzen zu tragen.
Am Dienstag den 19. Juni erhielten die Gesandtschaften das Ultimatum der chinesischen Regierung, die Stadt innerhalb von vierundzwanzig Stunden zu verlassen. Kein verlockendes Angebot, nachdem die Bahnstrecke zerstört worden war und vor den Toren der Stadt inzwischen an die zwanzigtausend Boxer warteten.
Man bat den Kaiserpalast um sicheres Geleit. Als die Antwort ausblieb, kündigte der deutsche Gesandte Baron von Kettler an, am nächsten Tag persönlich im Palast vorzusprechen, doch auf dem Weg zum kaiserlichen Palast wurde er von einem chinesischen Soldaten erschossen.
Danach dachte niemand mehr an Abreise. Eilig wurden Baumaterial und Lebensmittel ins Gesandtschaftsviertel geschafft und Türen und Fenster zugemauert. Möbel, Kisten, Fuhrwerke, Fässer und Bücher wurden verwendet, um Barrikaden zu errichten, ebenso herumliegende Ziegel der Neubauten, Balken und Gerümpel. Überall surrten Nähmaschinen, um aus den teuren Kleidern und Vorhängen Sandsäcke zu nähen.
Die englische Gesandtschaft war die größte und am besten befestigte, weshalb alle Frauen und Kinder aus den anderen Gesandtschaften bereits dorthin gebracht worden waren. Sie war auf beiden Seiten von anderen Gebäuden umgeben und relativ geschützt. Außerdem groß genug, um Munitions- und Proviantlager einzurichten und die meisten Flüchtlinge aufzunehmen. Im Gesandtschaftsviertel hielten sich am 20. Juni vierhundertfünfzig Soldaten, ebenso viele ausländische Zivilisten und etwa zweitausend chinesische Christen auf, doch die Straßen waren leer. Diener, Reitknechte, Sänftenträger, Gärtner und Dolmetscher hatten die Gesandtschaften unauffällig verlassen. Die chinesischen Christen wurden nicht nur wegen ihres Glaubens im Gesandtschaftsviertel aufgenommen, sondern auch, damit sie die geflohenen Bediensteten ersetzten. Pünktlich zum Ablauf des Ultimatums eröffneten die Chinesen das Feuer auf die Gesandtschaften.
***
Den ganzen Tag wurde das Viertel von den Mauern aus beschossen. Fabian zählte sieben Granaten, die mitten auf dem Gesandtschaftsgelände krepierten, aber glücklicherweise niemanden verletzten. Die Chinesen mochten einiges sein, gute Schützen waren sie nicht. Die österreichische Gesandtschaft wurde als Erste eingenommen, geplündert und in Brand gesetzt. Einen Angriff auf die holländische Gesandtschaft schlugen die Amerikaner erfolgreich zurück und mussten dabei feststellen, dass sich die Boxer mit den chinesischen Truppen verbündet hatten. Bis zum Ende der Woche hatten sie auch die holländische und die italienische Gesandtschaft erobert.
Am Sonntag, genau drei Wochen, nachdem Fabian mit seinen Kameraden in Peking eingetroffen war, begann am frühen Morgen der gezielte Beschuss der deutschen Gesandtschaft. Zusammen mit einigen Amerikanern wurden Fabian und seine Kameraden beim Bau einer Barrikade davon überrascht. Er hatte sich mit einem Zivilisten angefreundet, der als Sohn deutscher Auswanderer über ausreichend Sprachkenntnisse verfügte. Wade Bishop war ein waschechter Cowboy und für Fabian damit per se schon ein Held. Er überprüfte an ihm sein gesamtes, bei Karl May angelesenes Wissen und Bishop schien in den Feuerpausen durchaus amüsiert darüber. Als die ersten Boxer mit ihren scharlachroten Schärpen um die Hüften und den feuerroten Bändern an Hand- und Fußgelenken auf der Mauer erschienen, griffen sie zu ihren Waffen. Unter Führung von Graf Soden stürmten sie über die Rampe hinter ihrer Gesandtschaft zur fünfzehn Meter hohen Mauer hinauf. Sie stürzten sich den Boxern mit ihren Bajonetten entgegen und bald schmerzten Fabian die Arme vom Zustoßen. Es war ein wirres Gemetzel, in dem er schnell den Überblick verlor. »Wo ist George?«, brüllte er zu seinem Hintermann.
»Du stehst auf ihm!«
Hinter ihnen kamen die Italiener und Franzosen zu Hilfe und übernahmen das Zurückdrängen des östlichen Angriffs. Durch Hitze und Rauch drängten sie die Angreifer zurück, konnten die Position aber nicht lange halten. Alles um die amerikanische Gesandtschaft herum war von den Boxern in Brand gesetzt worden und stand in hellen Flammen. Das Atmen war eine Qual. Mit den Bajonetten lösten sie Steine aus der Mauer und errichteten damit eine Barrikade, während sie permanentem Kugelhagel ausgesetzt waren.
Wade Bishop reichte seinen Flachmann herum und bestätigte wieder einmal das Gerücht, dass die amerikanische Gesandtschaft über gewaltige Whiskeyvorräte verfügte. Wade hatte sein Hemd bis zur Brust aufgeknöpft und zeigte weißes Brusthaar. Er lehnte am zersplitterten Gebälk und wischte sich mit einem karierten Taschentuch den Schweiß von Stirn und Nacken. Dann griffen die Boxer wieder an. Junge Kerle mit wutverzerrten Gesichtern stürmten ohne Deckung auf die Barrikade zu.
»Warum tun die das?«, fragte Fabian fassungslos.
»Überall werden Versammlungen abgehalten, bei denen man die jungen Männer mit Zaubersprüchen weiht. Sie fallen in eine Art Trance und ...«, Wade erschoss einen Angreifer kurz vor der Absperrung, »... halten sich anschließend für unverwundbar.«
Ein alter Haudegen wie Wade Bishop gab nicht viel auf abergläubigen Hokuspokus. Das hatte er nicht bei den Indianern getan, nicht bei der Baptistengemeinde seines Heimatortes und hier im fernen China würde er nicht damit anfangen.
Der Kampf auf der Mauer dauerte die ganze Nacht, an deren Ende getötete und verwundete Boxer über den Rand nach draußen geworfen wurden.
***
In den folgenden Wochen blieben die Kämpfe brutal und blutig. Obwohl sich ihre Verluste in Grenzen hielten, stieg doch die Zahl der Verletzten täglich. Die ständige Bedrohung durch Heckenschützen und Überraschungsangriffe bei Tag und Nacht zermürbten die Belagerten. Es war ein einziges Gefecht, unterbrochen nur von kurzem, unruhigem Schlaf, aus dem man beim nächsten Einschlag einer Kugel sofort wieder gerissen wurde. Die Boxer und chinesische Soldaten, die sich inzwischen verbündet zu haben schienen, hatten sich überall in den Häuserruinen verschanzt und schossen auf alles, was sich bewegte. Die Belagerten verbrachten Tag und Nacht kniend oder liegend hinter niedrigen Barrikaden, während sie vom schlechten Wasser, der mangelnden Nahrung und dem fehlenden Schlaf krank und geschwächt wurden.
Mindestens genauso bedrückend wirkte sich die Sommerhitze aus. Tür- und Fensteröffnungen waren mit Sandsäcken verbarrikadiert und der fehlende Luftzug machte es unerträglich. Die Temperatur stieg an vielen Tagen auf fünfundvierzig Grad im Schatten. Die Uniformen waren zerrissen, verschmutzt und versengt und die Soldaten hatten sie seit Wochen am Leib. Allein mit ihrem Geruch hätten sie den Gegner in die Flucht schlagen müssen, wenn nicht alles um sie herum noch viel fürchterlicher gestunken hätte.
Anfang Juli überrannten die Chinesen mit ihrer Übermacht die Barrikaden auf der Mauer und brachten mehrere Geschütze in Stellung, mit denen sie das gesamte Gesandtschaftsviertel unter Beschuss nehmen konnten. Jeder Versuch, die Mauer zurückzuerobern, wurde unter hohen Verlusten vereitelt. Die chinesische Artillerie verwandelte die Häuser in Ruinen. Die Verteidiger besaßen als Geschütze nur eine italienische Kanone, der bald die Munition ausging, und »Betsy«, zusammengebaut aus einem alten, verrosteten Kanonenrohr und einer Ersatzlafette der italienischen Kanone. Verwendet wurden leidlich passende russische Granaten und später Nägel und Eisenstücke als Schrapnelle.
Angriffswelle folgte auf Angriffswelle und wurde mit schwindender Energie zurückgeschlagen. Bei gelegentlichen Ausfällen gelang es, die Munition und Gewehre der Gefallenen beider Seiten einzusammeln. So zog sich der Stellungskrieg hin. Von den Boten, die sich nachts aus dem Viertel schlichen, kehrte keiner zurück. Niemand wollte sich vorstellen, was geschehen würde, wenn sie nicht mehr in der Lage wären, die Frauen und Kinder zu schützen.
Mehrere Häuser waren stark beschädigt und drohten einzustürzen. Die Breschen in den Mauern wurden mithilfe der Kulis ausgebessert. Dutzende von ihnen arbeiteten Tag für Tag unter Beschuss an Schützengräben und Barrikaden, um mit der schmalen Entlohnung ihre Familien ernähren zu können. Kleine Kinder, Alte und Kranke unter den chinesischen Christen starben bereits zu Dutzenden an Hunger. Wade Bishop reichte einem der Kulis missmutig seine Essensschale.
»Na, wieder ein Hufeisen im Essen gefunden?«, fragte Fabian grinsend.
»Verdammte Schande, kein Mann sollte gezwungen werden, sein Pferd zu essen.«
»Herrje, der Cowboy wird wieder melancholisch«, johlten die Kameraden.
Bishop schob sich seinen Hut in den Nacken und begann, seinen Revolver zu säubern. »Nicht mehr lange, dann kann ich damit nur noch Köpfe einschlagen.«
»Jedem geht die Munition aus, schließlich dachten alle, dass wir die Gewehre nur für ein paar Salutschüsse einsetzen würden.«
»Verdammt. Mit den Boxern wären wir fertig geworden, aber seit die Armee mitmischt ...«
»Die Gelben haben ihre Chance erkannt, alle Ausländer mit einem Schlag loszuwerden.«
»So naiv können sie doch nicht sein, dass sie sich mit der ganzen Welt anlegen und glauben, damit durchzukommen.«
Fabian lauschte den Kritikern des Kolonialismus genauso unbeteiligt, wie den Verfechtern einer aggressiven Wirtschaftspolitik. Er lehnte an einer Barrikade und blätterte in einem Buch über die Napoleonischen Kriege. Er hatte die Gesamtausgabe direkt neben seinem Kopf, auch wenn einige Bände bereits durch Kugeln zerfetzt waren. Die meisten seiner Kameraden dösten in der Hitze, da sie jede ruhige Minute nutzen mussten. Dann sah er sie.
Es war Marie, das Kindermädchen der Slabons, und sie war gekleidet wie eine chinesische Bäuerin. Sie trat aus einem Haus und zog sich ihre Kapuze tief ins Gesicht. Kaum auf der Straße, veränderte sie ihre Haltung und ihren Gang. Fabian hätte sie nicht erkannt, wenn er nicht zuvor die Verwandlung beobachtet hätte. Sein Partner in Tsingtau hatte sie immer »die Hübsche mit den Sonderwünschen« genannt. Fabian hatte nie bei ihr landen können und sie ermutigte ihn stets nur so weit, dass er hilfreich und loyal blieb. Er besaß mehr Lachfältchen um die Augen als eine humorvolle Hundertjährige und sein Lächeln schmolz die Herzen von Kellnerinnen und Tänzerinnen, doch dieses Kindermädchen schien sich für etwas Besseres zu halten. Oder hatte sich für ihre Heirat höhere Ziele als einen einfachen Soldaten gesteckt. Fabian hatte einige Prügeleien ausgetragen, um ihre Ehre zu verteidigen und aufdringliche Verehrer und anzügliche Pfeifer in ihre Schranken zu verweisen. Trotzdem behaupteten einige Kameraden hinter seinem Rücken, dass das Kindermädchen gar nicht so prüde war, wie sie sich ihm gegenüber gab.
Marie hatte ein Kind in ein schmutziges Laken gehüllt und hielt es dicht an ihren Leib gedrückt. Es war verständlich, dass sie wieder als Kindermädchen arbeitete, aber wer überließ ihr sein Kind, um mit ihm hinter den feindlichen Linien herumzuspazieren? Fabian verließ seinen Posten, denn er konnte die Frau nicht in ihr Verderben laufen lassen. Er lieh sich zwei Pistolen und schob sie vorne und hinten in seinen Hosenbund, dann kletterte er über die Barrikade. Er kam nur wenige Meter weit, bis die Heckenschützen ihn entdeckten. Kugeln schlugen vor und hinter ihm in die Hauswand und nagelten ihn an einem Mauervorsprung fest. Querschläger flogen ihm um die Ohren und Mauersplitter trafen seine Haut. Sie schossen sich auf ihn ein, während Marie hinter der nächsten Ecke verschwand.
Von der Barrikade aus wurde das Feuer eröffnet und Fabian nutzte die Gelegenheit. Er schlug Haken, bog um eine Hausecke und brachte sich vorläufig aus der Schusslinie. Die schmale Gasse vor ihm war leer. Er rannte los, bog nach rechts ab bis zur nächsten Kreuzung. Keine Spur von Marie. Er lief zurück, nahm den Abzweig nach links und als er um die nächste Ecke bog, sah er sie am Ende dieser Gasse vor einem Laden stehen. Fabian ging sofort in Deckung. Marie klopfte an die Eingangstür und er war überrascht, als ihr geöffnet wurde, hatte er doch angenommen, dass alle Häuser längst verlassen waren. Fabian betrat einen geplünderten Gemischtwarenladen, schob sich einen Stuhl ans Fenster und wartete.
Er war kurz davor, einzudösen, als er eine Bewegung bemerkte. Zwei junge Boxer schlichen draußen vorbei. Vielleicht wollten sie Feuer legen oder hofften, dass die vorherigen Plünderer etwas vergessen hatten. Wenn er sich ruhig verhielt, würden sie nur einen kurzen Blick in den leeren Laden werfen und sich nach einem lohnenderen Ziel umschauen. Nur ein paar Minuten, dann würden sie verschwunden sein und er musste sein Versteck nicht preisgeben.
In diesem Moment öffnete sich die Tür des Ladens und Marie trat heraus. Die Boxer standen ihr Auge in Auge gegenüber. Fabian konnte keine Anzeichen von Angst bei ihr ausmachen, aber sie würde die beiden mit ihrer Verkleidung nicht täuschen können. Die Boxer verstellten Marie den Weg und griffen nach dem Kind. Dabei verrutschte dessen Kapuze. Fabian sah etwas Farbiges und ein dünnes Rinnsal Blut auf dem Kopf des Kindes, bevor Marie den Stoff wieder über die kahle Stelle zog. Einer der Boxer packte lachend den Saum von Maries Kleid und hob ihn hoch. Sie gab ihm eine Ohrfeige, was ihn nur anspornte. Es war sicher, dass sie nicht einfach von ihr ablassen und ihres Weges ziehen würden. Fabian hatte keine andere Wahl, als einzugreifen. Er riss die Tür auf und hörte sofort das pfeifende Geräusch. Die Granate schlug durch das Fenster, an dem er eben noch gesessen hatte. Die Explosion blies ihn und den verbliebenen Ladeninhalt auf die gegenüberliegende Straßenseite. Eine Staubwolke walzte in beide Richtungen durch die Gasse. Begraben unter Schutt und Gerümpel blieb er liegen. Ein hohes Pfeifen quälte seine Ohren und sein Blick war verschleiert.