
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
DER HÄRTESTE KAMPF IST DER GEGEN DEN EIGENEN VERSTAND! Ende des 21. Jahrhunderts. Die 17-jährige Cathryn Hawkins erhält die einmalige Chance, ihre Familie aus der Armut zu befreien: eine Ausbildung bei der Firma Dream. Dort lernt sie, durch ihre eigenen Gedanken und Gefühle ganze Welten entstehen zu lassen, so genannte Gedankenwelten. In diese Welten können andere Menschen eintauchen und erleben sie so, als wären sie die Realität. Durch einen vermeintlichen Zufall erfährt Cathryn von der World of Dream – einer streng geheimen Gedankenwelt, die zu unendlichem Reichtum und Ruhm führt. Doch sie erkennt zu spät, worauf sie sich da tatsächlich einlässt. Die World of Dream macht ihre tiefsten Wünsche und ihre schlimmsten Alpträume zur Wirklichkeit, und schon bald weiß sie nicht mehr, was real ist und was nicht… Ein packender Young-Adult-Psychothriller in einer dystopischen Zukunft – voller Spannung und Romantik und mit vielen verblüffenden Wendungen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Young Adult Thriller
Von H.C. Besdziek
Romane von H.C. Besdziek
DIE GALILEO VERSCHWÖRUNG
DAS HOLLYWOOD PUZZLE
DAS SISSI GEHEIMNIS
DIE WELT DER GEDANKEN
ELFENMASKEN UND DÄMONENSTIMMEN
+++ #0 +++
Wer tot ist, wird für immer tot bleiben. Jeder Mensch hat nur ein einziges, einmaliges Leben.
Es ist eine einfache Tatsache, die für jeden selbstverständlich sein sollte. Die in der Vergangenheit galt, im Jetzt und bis in alle Ewigkeit hinein auch noch. Tote werden nicht wieder lebendig.
Mein Vater starb am 7. Dezember 2090. Ich weiß es, ich bin dabei gewesen.
Er war bei Weitem nicht der Einzige, der draußen in den Vorstädten sein Leben ließ. Nur jeder Dritte stirbt dort eines natürlichen Todes, heißt es. Ich kehrte gerade von der Schule zurück, als ich sah, wie sie ihn erschossen.
Die Straßenbande stand dort, in ihren grässlichen schwarz-roten Totenkopfmasken, ihrem Zeichen. Sie standen vor dem Haus, in dem unsere Wohnung lag, und sie hatten ihn gepackt und in ihre Mitte gedrängt. Ich sah, wie sie mit ihren Stöcken gegen sein Gesicht schlugen, immer heftiger, immer brutaler. Ich sah, wie das Blut in Strömen aus seinen Wunden hervorquoll.
Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, ich weiß nur noch, wie die pure Verzweiflung mich packte. Voller Zorn, Hass, Panik und was ich sonst noch alles fühlte, rannte ich auf die Bande zu.
Und dann traf mich der Blick meines Vaters. Er sah mir in die Augen, und für einen Moment lang lächelte er. Doch dann verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht, und er begann, zu schreien. Er schrie, so laut er konnte.
„Flieh, Cathryn! Flieh!“
Einen Moment lang verstand ich nicht, was er damit sagen wollte. Meine Verzweiflung war so groß, dass ich nicht mehr klar denken konnte. Doch dann, als einer der Maskierten wieder mit dem Schlagstock auf sein Gesicht einschlug, begriff ich die Worte meines Vaters. Ich rannte, und ich rannte, so schnell ich konnte.
Doch kaum, dass ich losgespurtet war, hörte ich ihn, den unvermeidlichen Schuss. Ich wusste nicht wirklich, ob ich es tatsächlich sehen wollte, doch ich konnte nicht anders, ich musste mich ein letztes Mal umdrehen. Da lag er, blutüberströmt und reglos, auf dem Boden vor dem Haus.
Dad… war… tot…
Tränen liefen über meine Wangen, ohne dass ich sie kontrollieren konnte. Ich konnte nicht anders, ich musste weinen. Mein Vater war tot, und er würde nie wieder zurückkehren.
In diesem Moment drehte sich die Bande zu mir um, und sie kamen auf mich zu. Dads Worte fielen mir wieder ein, und ich rannte weiter. So schnell ich konnte. Ich wusste, dass jetzt nicht die Zeit zum Trauern war. Es waren Dads letzte Worte gewesen. Ich würde entfliehen. Ich würde es schaffen.
Und ich schaffte es tatsächlich. Ich versteckte mich hinter einer der stinkenden Mülltonnen, die mit dem grässlichen Chemieabfall zugestopft waren, bis die Bande endlich an mir vorbei war. Ich hatte es geschafft. Ich war in Sicherheit. Wie Dad es wollte.
Dads Leiche war weg, als ich am Abend nach Hause zurückkehrte. Und dennoch saß ich viele Minuten lang einfach nur da und starrte auf das Blut, das auf dem schwarz geteerten Weg lag, und ich weinte und weinte und weinte. Dad würde nie wieder zurückkehren, er würde nie wieder bei mir sein.
Ich werde diesen Tag nie vergessen. Die Straßenbande mit ihren Totenkopfmasken werde ich für immer hassen. Nie werde ich aufhören, mich in die Zeit zurückzusehnen, in der Dad noch für mich da war. Und niemals werde ich seine blutende Leiche aus meinem Kopf bekommen. Dieses grauenvolle Bild wird für immer in meinem Gehirn verankert sein.
Nie werde ich vergessen, wie ich mit angesehen habe, wie mein Vater ermordet wurde. Wie er für immer aus der Welt verschwand. Denn Tote werden nicht wieder lebendig.
Und doch traf ich Dad wieder, ich sprach mit ihm, ich umarmte ihn, er war wieder für mich da. Dad kehrte zurück in mein Leben. Jahrelang begegnete mir seine Leiche Nacht für Nacht in meinen Alpträumen, und auf einmal stand er wieder lebendig vor mir.
Es ist wie ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Wäre da nur nicht diese leise Stimme in meinem Hinterkopf: Er ist nicht real.
Aber auf diese Stimme will ich nicht hören.
+++ #1 +++
Ich stehe vor der Tür zu einem besseren Leben.
Um ehrlich zu sein, frage ich mich immer noch, wie ausgerechnet ich es geschafft habe, diesen Job zu bekommen. Ich blicke das riesige Gebäude hinauf, in dem ich von nun an arbeiten werde. Ein Wolkenkratzer, der so hoch reicht, dass ich seine Spitze in der Wolkendecke gar nicht mehr wahrnehmen kann. Die Fassade des Gebäudes ist vollständig aus blauem Glas gefertigt, nur das in etwa zwanzig Metern Höhe angebrachte Wort DREAM sticht mit seinen gigantischen, gelben Lettern hinaus.
Einen Moment lang betrachte ich mein Spiegelbild in der Glasfassade. Ich erblicke ein abgemagertes Mädchen im Alter von 17 Jahren, mit Sommersprossen im Gesicht und lockigen, kastanienbraunen Haaren, die ihr bis zur Schulter reichen. In ihrem schwarzen Kleid sieht sie aus wie all die anderen wohlhabenden Mädchen aus der Innenstadt, doch die Unsicherheit in ihren dunkelblauen Augen verrät, wie sie sich wirklich fühlt. Wie ein Fremdkörper, der nicht hierher passt.
Ich atme tief durch und versuche, an Selbstsicherheit zu gewinnen. Ich darf jetzt nicht versagen. Dann drehe ich mich noch einmal um und blicke auf die große, vierspurige Straße mit all den teuren Autos in den auffälligsten Farben und auf die Häuser dahinter, die wie Schlösser aussehen. Natürlich werde ich nie solch ein Leben führen können, doch zumindest kann ich mir und meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen. Wenn ich hier nicht versage.
Ich denke noch einmal an Mom, die jeden Tag über zwölf Stunden schuftet, nur um uns zu ernähren, und an meinen Bruder Griffin, der das wahre Leben längst hinter sich gelassen hat und nur noch in Gedankenwelten lebt. Es ist eigentlich kurios, dass genau die Technologie, die meinem zehnjährigen Bruder schon jetzt das Leben zerstört hat, uns den Aufstieg in ein besseres Leben bieten soll. Ich spüre beinahe die Verantwortung, die jetzt auf meinen Schultern liegt. Dann atme ich ein letztes Mal tief ein und wieder aus und betrete die Firma durch den Haupteingang.
Da ich bereits beim Vorstellungsgespräch hier gewesen bin, bin ich nicht mehr ganz so beeindruckt von dem edlen Empfangssaal mit seinem goldenen Steinboden, den schwarzen Sesseln und den dazwischen postierten Glastischen sowie dem riesigen, silbernen Kronleuchter an der Decke. Dennoch muss ich zugeben, dass das hier wirklich toll aussieht.
Ich gehe zielstrebig auf die weiße Empfangstheke zu, hinter der ein Mann mittleren Alters auf seinem Bürostuhl sitzt. Ich weiß noch, wie ich beim Vorstellungsgespräch vor sechs Wochen ziemlich perplex gewesen bin, weil der Mann am Empfang solch ein kleines, schwarzes, quadratisches Gerät mit einem Magneten auf seiner Stirn befestigt hat. Doch jetzt weiß ich natürlich, dass es sich dabei um ein neues Modell der Bonnet handelt, mit der Dream das ganze Geld macht. Wahrscheinlich schaut er sich gerade einen Film an oder spielt etwas. Solch ein dummer Zeitvertreib für reiche Leute. Und, ich schlucke, ein Zeitvertreib, nach dem mein Bruder süchtig geworden ist.
„Guten Tag“, sage ich freundlich.
Der Mann nimmt die Bonnet von seiner Stirn und blickt mich an.
„Mein Name ist Cathryn Hawkins“, fahre ich fort. „Ich habe einen Platz für eine Ausbildungsstelle bei Dream“, ich krame in meiner grauen Handtasche nach dem Blatt Papier, bis ich es gefunden habe, und reiche es dem Mann, „diese Ausbildung soll heute um neun Uhr beginnen.“
„Danke schön“, sagt der Mann und nimmt sein Board aus der Hosentasche.
Ich kenne mich mit Technik nicht wirklich aus, doch weiß ich, dass dies ein neues Modell ist, das sich natürlich nur reiche Leute leisten können. Ich habe nur mein altes Board, das mir Dad geschenkt hat. Es ist älter als ich selbst und dementsprechend nicht einmal ansatzweise aktuell, doch telefonieren kann ich damit auch.
Der Mann tippt etwas in sein Board, vermutlich die Angaben auf dem Zettel. Meine Identifikationsnummer und so weiter.
„Hm“, meint er dann, „deine Ausbildung bei Dream besteht aus zwei Teilen. Die Theorie findet in Raum 34287 statt, das liegt im 34. Stock. Deine erste Theorielektion wird morgen stattfinden, um Punkt neun Uhr. Die Praxisausbildung wird Adrian Porter übernehmen. Ich rufe ihn am besten gleich.“
Wieder tippt er irgendetwas in sein Board. Wahrscheinlich informiert er diesen Porter, dass ich da bin. Als er seine Nachricht zu Ende geschrieben hat, sieht er wieder zu mir und gibt mir das Blatt Papier von meinem Vorstellungsgespräch zurück, das ich in meiner Handtasche verstaue.
„Ich bin übrigens Christian Thunder“, sagt er und reicht mir seine Hand.
Ich schüttele sie, was mir ziemlich seltsam vorkommt. Draußen in den Vorstädten gibt man sich keinen Händedruck, so vornehm ist dort niemand.
„Darf ich fragen, warum du dich für unsere Firma entschieden hast?“
Ich überlege einen Augenblick. Die ehrliche Antwort wäre, dass mein Mathematiklehrer aus der Abschlussklasse offensichtlich viel von meinen Fähigkeiten hielt und zufällig jemanden bei Dream kannte. Ich finde aber, dass sich das nicht wirklich gut anhört.
„Gedankenwelten sind wirklich spannend“, antworte ich anstatt dessen.
„Absolut“, erwidert Mr. Thunder. „Ich denke, es gibt kaum einen spannenderen Beruf.“ Er grinst. „Ach, hier kommt ja schon dein Ausbilder.“
Ich drehe mich um und bin erst einmal ziemlich überrascht. Ich habe mir vorgestellt, dass ein weiser, alter Mann meine Praxisausbildung übernehmen würde, einer wie die Leute bei meinem Vorstellungsgespräch. Tatsächlich jedoch ist mein Ausbilder ein junger Mann, kaum älter als ich.
Er ist groß, rund einen Kopf größer als ich, hat eine ziemlich sportliche, gute Figur und dunkelbraune, lockige Haare. Er trägt ein dunkelblaues Hemd, eine schwarze Anzughose und dazu passende, edel wirkende schwarze Schuhe. Auf den ersten Blick muss ich zugestehen, dass er ziemlich gut aussieht.
Zu meiner Überraschung tritt er aber gar nicht auf mich zu, sondern blickt nur Mr. Thunder an.
„Ist die hier die Azubi?“, fragt er genervt.
„Ja, so ist es, Adrian.“
„Danke, Christian“, sagt er und wendet sich jetzt zum ersten Mal an mich. „Mein Name ist Adrian Porter“, er reicht mir seine Hand, und ich schüttele sie, „ich bin für deine Praxisausbildung bei Dream zuständig.“
Ohne ein weiteres Wort geht er durch den Empfangssaal. Einen Moment lang weiß ich nicht, was ich tun soll, dann meint Mr. Thunder leise: „Folge ihm.“ Schnell gehe ich zu meinem Ausbilder, der inzwischen vor einem der acht Fahrstühle steht und wartet, dass dieser ankommt.
„Ich habe mir vorher deine Daten angeschaut“, meint er. „Du wohnst ja in den… Vorstädten?“ Er spricht das Wort sehr abfällig aus. „Ist dem tatsächlich so?“
Ich kenne meinen Ausbilder noch keine fünf Minuten, und schon weiß ich genau, dass ich ihn nicht leiden kann. Dieser Adrian Porter ist ein egoistisches Arschloch, das sich für etwas Besseres hält als mich, nur weil er in der Innenstadt wohnt und eine Menge Geld auf dem Konto hat. Sicherlich hasse auch ich die Vorstädte mit all ihrem Dreck, dem Gestank und insbesondere den Straßenbanden. Doch er hält die Bewohner der Vorstädte, wenn ich mich nicht ganz täusche, für Abschaum. Und dazu gehöre ich dann auch.
„Ja“, antworte ich deshalb knapp.
„Hm“, macht er und blickt mich mit einer abfälligen Miene an.
Der Aufzug kommt, und er steigt ein. Mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Er drückt einen Knopf, woraufhin wir in die Höhe rasen. Natürlich spürt man nichts, doch weiß ich, dass wir uns zig Stockwerke in die Luft bewegen.
„Nenn mich übrigens Adrian“, meint er und lächelt. „Ich mag diese Sache mit den Nachnamen nicht.“
Der Aufzug hält an, und wir steigen aus. Nun befinden wir uns in einem weitaus weniger feudalen Bereich des Gebäudes. Wir stehen in einem grauen Korridor, und um uns herum sind nichts als triste, weiße Bürotüren mit Nummern darauf, nicht einmal ein Fenster ist vorhanden.
„Wie heißt du?“, fragt er, während er mit schnellen Schritten den Korridor entlang geht.
Ich habe Schwierigkeiten dabei, mit ihm Schritt zu halten, doch das ist ihm sicherlich vollkommen egal.
„Du hast dir gemerkt, dass ich aus den Vorstädten komme, aber nicht einmal auf meinen Namen geblickt.“
Die Bemerkung platzt mir einfach so heraus. Überrascht dreht sich Adrian zu mir um. Ich werde etwas rot, doch weiß ich nicht wirklich, ob ich es überhaupt bereue, das gesagt zu haben.
„Deine Herkunft ist für deinen Beruf von Relevanz“, sagt er lächelnd, „dein Name dagegen ist vollkommen irrelevant. Ich glaube kaum, dass du bessere Ergebnisse erzielen wirst, wenn du Susan heißt.“
Einen Moment lang starre ich Adrian an. Dann versuche ich, genauso breit zu grinsen wie er.
„Ich bin Cathryn. Ich freue mich wirklich, dich kennenzulernen, Adrian.“
„Bestens“, erwidert er. „Dann lass uns jetzt diesen Smalltalk beenden. Ich denke ohnehin, dass du mir genug Persönliches von dir erzählt hast, ich möchte schließlich auch nicht zu neugierig sein.“
Er geht auf die Tür am Ende des Korridors zu, die doppelt so groß ist wie die der anderen Büros. Sie trägt die Nummer 27000.
„Das hier ist das Gedankenlabor“, erklärt Adrian.
Dann nimmt er sein Board aus der Hosentasche, wobei ich registriere, dass es sich auch bei diesem schwarzen Gerät um eines der neuesten und kostspieligsten Board-Modelle handelt, und hält es gegen die Tür, sodass diese nach innen aufschwingt.
„Willkommen bei Dream, Cathryn.“
Ich folge meinem Ausbilder in den Raum, bevor er die Tür wieder hinter uns schließt. Als Adrian gesagt hat, dass es sich hierbei um das Gedankenlabor handelt, habe ich erwartet, dass ich nun zahlreiche Regale mit seltsamen Flüssigkeiten vorfinden würde. In der Tat jedoch befinde ich mich in einem künstlich beleuchteten, großen Raum ohne Fenster, mit weißen Wänden und weißer Decke. Darin stehen nichts weiter als fünf schwarze Sessel, die aussehen wie die im Empfangssaal. Die Sessel sind auf die andere Seite des Raumes hin ausgerichtet. Dort ist eine Leinwand aufgebaut, auf die der Beamer an der Decke momentan ein Standbild mit dem Logo von Dream projiziert. Zudem steht neben uns ein großer, weißer Schrank.
„Also, Cathryn“, meint Adrian, „dann lass uns doch mit deiner Ausbildung beginnen. Was siehst du?“
Ich denke einen Moment lang nach.
Immer noch habe ich nicht die geringste Lust, mit Adrian zu sprechen, schon gar nicht, wenn er auch noch der Lehrer ist. Aber ich erinnere mich daran, dass Mom all ihre Hoffnung darin setzt, dass ich diese Lehre erfolgreich abschließen werde und wir dann endlich aus diesem Elend heraus kommen werden. Dann kann auch ich in der Stadt wohnen. Dummes Arschloch, denke ich mir, dann kannst du dich nicht mehr als etwas Besseres als mich betrachten.
„Also?“, fragt Adrian nach. „Siehst du nicht gut? Bekommt man in den Vorstädten etwa nicht einmal Kontaktlinsen, wenn man Sehprobleme hat?“
Ich verspüre den starken Impuls, ihm eine zu ohrfeigen. Ich unterdrücke diesen jedoch und versuche anstatt dessen, die Frage zu beantworten.
„Nun ja“, sage ich betont selbstsicher, „ich sehe fünf schwarze Sessel und eine Leinwand davor.“
Adrian beginnt, laut zu lachen.
Ich drehe mich zu ihm um. Er lacht weiter, doch nach ein paar Sekunden verstummt sein Lachen wieder.
„Das war ja eine fabelhafte Antwort“, meint er. „Jedes Schulkind hätte so viel zusammengebracht. Fünf schwarze Sessel und eine Leinwand, wirklich grandios. Deiner Meinung nach stehen wir hier also in einem Museum für Filmkunst.
Es ist wirklich interessiert, sich diese Museen anzusehen. Noch vor fünfzig Jahren saßen Menschen gemeinsam in einem Saal und sahen sich einen Film an, nur mit den Augen, ganz ohne Empfindungen. Heutzutage kann man das gar nicht mehr nachvollziehen, das muss schließlich todlangweilig gewesen sein.
Also, Cathryn, glaubst du wirklich, dass wir in solch einem Filmsaal sind – Kino hat man das übrigens genannt, fällt mir gerade wieder ein. Oder meinst du nicht doch eher, dass dieser Raum einem anderen Zweck dient?“
Wieder ist es schwer für mich, meine Wut zu zügeln.
„Nein“, antworte ich langsam, „ich denke, dass hier Gedankenwelten entstehen.“
„Schon besser. Fünf Sessel und eine Leinwand davor, wirklich grandios.“ Er lacht wieder. „Das war in der Tat die beste Antwort, die mir eine Azubi jemals auf diese Frage gegeben hat. Danke, Cathryn, war sehr lustig. Also“, er hält kurz inne und fährt dann fort, „richtig, Cathryn, hier werden Gedankenwelten gemacht. Beziehungsweise, hier werden wir Gedankenwelten entstehen lassen.“
Adrian geht zu dem Schrank, schließt eine der Türen mit seinem Board auf und nimmt eine weiße Bonnet heraus.
„Ich denke, sogar du wirst wissen, was das hier ist?“
„Eine Bonnet“, erwidere ich sogleich.
„Wozu ist dieses Gerät gut?“
Ich betrachtete das weiße, runde Gerät. Ich kenne dieses Gerät. Es ist ein altes Modell der Bonnet, so wie mein Bruder Griffin eines besitzt. Es passt noch auf den ganzen Kopf, sodass das gesamte Gehirn mit dem Gerät verbunden ist.
„Es lässt Gedankenwelten im eigenen Kopf entstehen.“
„Nun ja“, erwidert Adrian, „das ist wieder einmal eine ziemlich miserable Antwort von dir, Cathryn. Aber keine Sorge, das bin ich von dir ja schon gewohnt, also mach dir nichts draus. Ich könnte dir jetzt im Detail erläutern, wie dieses Gerät funktioniert. Ich könnte dir auch etwas über die Geschichte der Bonnet erzählen, von ihrer Markteinführung im Jahr 2031 bis hin zu ihrem jetzigen Entwicklungsstand, über sechzig Jahre später.
Aber leider habe ich nur genau eine Stunde Zeit für dich, Cathryn, sodass wir das alles verschieben werden, und ich denke ohnehin, dass das alles auch zum Theorieunterricht gehört. Also, Cathryn, lass uns nicht die restlichen vierzig Minuten vergeuden, sondern lass uns mit deiner Ausbildung beginnen. Setz dich, Cathryn.“
Mir bleibt nichts anderes übrig, ich setze mich auf einen der schwarzen Sessel. Adrian stellt sich neben mich.
„Wir werden nun Folgendes durchführen, Cathryn“, erläutert er. „Du wirst mir beweisen, dass du eine Gedankenwelt erschaffen kannst. Ich werde dir jetzt gleich die Bonnet aufsetzen, und du wirst deine Augen schließen. Das, was du dir dann vorstellst, wird auf der Leinwand hier vorne erscheinen, weil die Bonnet drahtlos mit dem Beamer verbunden ist.
Natürlich ist das zweidimensional, wie eben in diesen alten Filmsälen – genau, Kinos hat man sie ja genannt. Dennoch kannst du dir beim Betrachten ein gutes Bild davon machen, wie viel du schon kannst und wie viel du noch lernen musst, wenn du in drei Jahren bei uns als Kreatorin arbeiten willst.
Du hast folgende Aufgabenstellung, Cathryn: erschaffe eine einfache Gedankenwelt – eine Landschaft, bestehend aus einem Baum und einem See und dahinter, in der Ferne, einer Bergkette. Ach, vielleicht nehmen wir noch das Abendrot hinzu. Also, Cathryn, du hast genau dreißig Sekunden Zeit für diese Aufgabe. Hier, setze die Bonnet auf.“
Adrian reicht mir die Bonnet, und ich setze sie auf meinen Kopf. Sie ist schwer, mir fängt schon der Kopf an, zu schmerzen. Doch ich will diese Aufgabe gut erledigen, ich will Adrian beweisen, dass ich das wirklich kann.
„Schließe die Augen, Cathryn“, sagt Adrian.
Ich gehorche, schließlich will ich die Aufgabe ja gut erfüllen.
„Und – los!“
Ich versuche, mich mit all meiner Kraft auf Adrians Aufgabenstellung zu konzentrieren. Ich halte meine Augen geschlossen und konzentriere mich darauf, vor meinem geistigen Auge eine Landschaft entstehen zu lassen. Es klappt nicht, ich sehe nichts als schwarz, weil die Bonnet auch über meinen Augen liegt.
Ich strenge mich an, an einen Baum zu denken. Eine große Buche, so wie man sie zu Hunderten draußen vor den Vorstädten findet – dort, in dem Wald, wo wir zumindest einmal im Jahr hinausfahren. Da, ich sehe sie vor mir, eine große Buche mit braunem Stamm und grünem Baumwipfel.
Nun denke ich an einen blauen See. Ich habe noch nie einen See gesehen, nur Bilder in den Nachrichten. Ich versuche, an solch ein Bild zu denken. Ein blauer See. Ein blauer See. Und jetzt – die Berge im Hintergrund. Ich kneife meine Augen noch stärker zusammen und gebe alles, auch an diese zu denken. Ich habe noch nie Berge gesehen, aber ich kenne doch Bilder davon. Graue Berge. Mit schneebedeckten Gipfeln. Graue Berge.
Ich muss es schaffen. Ich muss Adrian beweisen, dass ich es kann. Adrian soll sehen, dass ich der Aufgabe absolut gewachsen bin. Dass es keinen Grund gibt, nichts von mir zu halten. Graue Berge…
„Und – aus!“, ruft Adrian.
Bevor ich so recht realisiere, dass es schon wieder vorbei ist, hat er mir die Bonnet bereits abgenommen. Ich öffne meine Augen und schaue nach vorne zur Leinwand, auf der immer noch das Logo der Firma zu erkennen ist. Ein menschliches Gehirn in der Mitte und darum herum fliegende Drachen, ein Wasserfall und ein sich küssendes Liebespaar. Darunter steht Lebe deine Träume – DREAM.
„Also, Cathryn, dann lass uns dein Resultat einmal ansehen“, meint Adrian mit ziemlich gelangweiltem Tonfall.
Ich ärgere mich darüber, da ich sehr aufgeregt bin, doch lasse ich mir das nicht anmerken.
„Dreißig Sekunden dauert die Aufzeichnung. Das hier ist dein erster Test, Cathryn.“
Er drückt einen Knopf auf dem Beamer und lässt sich dann in den Sessel links neben mir fallen.
Einen längeren Moment lang sehe ich gar nichts, nur weiß. Dann taucht etwas auf der Leinwand auf. Ein dunkelbrauner, vertikaler Strich. Auf der Spitze des Striches befindet sich eine grüne Kugel. Das hier ist also der Baum, den ich mir vorgestellt habe. Ich habe an eine große Buche gedacht und – was taucht auf? – ein Bild, das aussieht wie die Zeichnung eines Kleinkinds.
Nach einer Weile beginnt der Baum, zu flackern, und verschwindet dann wieder. An seine Stelle tritt etwas Graues, Unscharfes. Das Ding wird schärfer, bis ich erkennen kann, dass es eine Zeitung ist. Dann verschwindet diese wieder, und an ihre Stelle tritt sogleich ein blaues Oval. Wieder geschieht eine Weile lang nichts, dann flackert auch das Oval und verschwindet wie schon zuvor der Baum. An seine Stelle tritt ganz kurz ein graues Dreieck, dann ist auch dieses wieder weg.
Anstatt dessen erscheint urplötzlich Adrians Gesicht auf der Leinwand. Ich erschrecke. Sein Gesicht ist wie real. Seine dunkelbraunen, lockigen Haare. Seine blauen Augen. Seine Nase. Sein Mund. Alles sieht so echt aus, sogar der winzige Pickel auf seiner linken Wange, die auf dem Bildschirm natürlich seine rechte ist. Nach wenigen Sekunden flackert auch Adrians Gesicht, und das Bild wechselt wieder auf das Logo von Dream.
Ich vermeide es, Adrian anzusehen, und starre einfach weiter auf die Leinwand, als ob diese immer noch sehr spannend sei. Doch plötzlich steht Adrian direkt vor mir. Er muss aufgestanden sein, ich habe es gar nicht gemerkt.
„Das soll dein Resultat gewesen sein? Ein paar Striche?“ Er wirkt recht zornig. „Ich denke mal, du hast komplett versagt, Cathryn! Habe ich nicht gesagt, du sollst eine Landschaft erschaffen, habe ich das nicht gesagt?“
„Ähm… ja“, murmele ich.
„Und warum, Cathryn, hast du meine Anweisung dann so verstanden, dass du zuerst an den Baum denkst, dann an den See und so weiter? Ist es nicht selbstverständlich, dass eine Landschaft aus all diesen Elementen besteht und nicht nur aus einem! Warum bist du so unfähig? Kapierst du denn wirklich rein gar nichts?“
Ich stehe auf, damit er nicht mehr über mir steht, doch auch jetzt ist er immer noch einen Kopf größer als ich. Ich gebe ihm keine Antwort. Warum auch. Das sind doch keine richtigen Fragen. Ich brauche ihm nicht zu antworten.
„Cathryn, du solltest eines wissen“, sagt er immer noch wütend, „nicht einmal zehn Prozent unserer Azubis bekommen in drei Jahren eine Anstellung in diesem Unternehmen. Wenn du dies in Erwägung ziehen solltest, woran ich nach diesem Test erhebliche Zweifel hege, solltest du deine Leistungen sehr, ich wiederhole, sehr stark steigern.“
Ich nicke. Natürlich ist genau das mein Ziel. Ich will meine Ausbildung mit einem guten Ergebnis beenden und dann bei Dream arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist die Hoffnung meiner Mutter, und das ist auch meine Hoffnung. Doch heute habe ich auf ganzer Linie versagt. Dieses Ergebnis ist katastrophal.
„Deine erste Praxislektion ist hiermit beendet“, fährt Adrian fort. „Wir sehen uns morgen Nachmittag wieder, um 14 Uhr. Den heutigen Tag hast du frei.“
Er verlässt das Gedankenlabor, und ich folge ihm. Dann schließt er die Tür wieder mit dem Board zu. „Den Weg nach unten findest du ja von alleine.“
Er wendet sich nach rechts und schließt eines der Büros mit seinem Board auf. Ich mache mich auf den Weg zu den Fahrstühlen.
Doch dann, plötzlich, ruft Adrian: „Cathryn!“
Genervt drehe ich mich wieder um. Ich war so froh, ihn für den gesamten restlichen Tag nicht mehr sehen zu müssen. Was will er denn jetzt noch? Hat er noch eine weitere, besonders abfällige Bemerkung zum Abschied parat? Irgendetwas ganz Fieses, das er sich extra für den Schluss aufgehoben hat?
„Eins noch, Cathryn“, sagt er und kommt auf mich zu, die Bürotür lässt er offen stehen. „Das Ergebnis deines Tests war zwar rundum miserabel, doch muss ich eingestehen, dass du in einer Hinsicht wirklich fabelhaft gewesen bist.
Ich weiß nicht, wieso du an mein Gesicht gedacht hast, Cathryn, aber das Bild von diesem, von meinem Gesicht war unglaublich. Die ganzen Details, sogar die Perspektiven. Wer diesem Gesicht in einer neuronalen Projektion, also in einer Gedankenwelt, begegnet, würde behaupten, dass es aussieht wie echt. So etwas haben bislang nur ausgebildete Kreatoren – nein, was rede ich da, so etwas hat bislang noch niemand zustande gebracht. Das war die beste alleine aus dem Kopf entstandene Gedankenwelt, die ich je gesehen habe. Das war unglaublich.“
Ich merke, wie ich rot anlaufe, weiß aber gar nicht, warum. Ich freue mich riesig, weiß aber überhaupt nicht, weshalb. Bin ich wirklich so begeistert davon, dass mich dieser Kerl, der mich zuvor immer nur abfällig angeredet hat, auf einmal lobt?
„Aber nun ja“, fährt Adrian fort, „leider war es eigentlich deine Aufgabe, dir eine Landschaft vorzustellen. Und dabei hast du eben komplett versagt.“
Und dann, ohne ein weiteres Wort, geht er in das Büro und schließt die Tür hinter sich. Ich bleibe verdutzt stehen. Die Aufgabenstellung habe ich katastrophal gelöst, aber dennoch habe ich das beste Ergebnis aller Zeiten abgeliefert. In meiner ersten Praxislektion. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber eigentlich ist es mir im Moment auch vollkommen egal.
Hauptsache, ich kann jetzt endlich nach Hause. Denn heute werde ich Mom und Griffin zum letzten Mal für zwei Wochen besuchen.
+++ #2 +++
Obwohl ich es eigentlich sehr eilig habe, die Innenstadt zu verlassen, bleibe ich erneut vor dem Firmengebäude stehen und blicke auf die große Straße mit all ihren sündhaft teuren Autos. Rote Cabriolets, blaue Limousinen, gelbe Sportwägen. Hunderte Autos rasen in kürzester Zeit vorbei, eines auffälliger als das andere. Ich weiß nicht, wie teuer solch ein Auto ist, doch ich weiß, dass ich nie in meinem ganzen Leben genug Geld besitzen werde, um mir eines zu leisten.
Ich finde es ungerecht, dass es solch große Unterschiede in der Bevölkerung gibt. Meine Mom schuftet den ganzen Tag, um die Familie ernähren zu können, während diese Leute hier mit schicken Luxuskarosserien durch die Stadt fahren. Leute wie Adrian, denke ich verärgert. Leute, die sich für etwas Besseres halten als wir aus den Vorstädten.
Ich wende mich von den Autos ab und gehe zur U-Bahn-Station. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass die Gesellschaft ungerecht ist. Dass es arme Leute gibt, die gerade einmal vom Existenzminimum leben und jeden Tag damit rechnen müssen, von einer Bande überfallen oder gar getötet zu werden, und dass es reiche Leute gibt, die sich ein Leben in Luxus gönnen und noch nie selbst in den Vorstädten gewesen sind.
Meine Mom hat mir erzählt, dass das früher einmal, zur Zeit meiner Urgroßeltern, noch nicht so gewesen ist. Auch damals hat es schon Unterschiede zwischen Arm und Reich gegeben, doch waren diese viel kleiner, und die Unterschiede gab es in jeder Stadt, in jedem Dorf. Dann aber sind immer mehr Menschen vom Land in die Städte gezogen, und die Städte sind größer und größer geworden. In den äußeren Gebieten gab es immer mehr Verschmutzung und Kriminalität, während die Innenstädte immer eleganter und prunkvoller geworden sind.
Es war um diese Zeit, dass die einzelnen Staaten abgeschafft wurden, dass der Council die Macht übernommen hat. Und natürlich sind das alles reiche Leute in dem Council, und anstatt die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern, hat die Weltregierung die Entwicklung noch befeuert. Meine Mom weiß nicht genau, was der Council getan hat. Sie konnte mir nur sagen, dass die Politiker irgendwelche sozialen Sicherungssysteme abgeschafft haben, aber sie wusste nicht einmal, was dieses Wort genau bedeutet, und in der Schule haben wir nichts darüber gelernt.
Kaum jemand in den Vorstädten interessiert sich für Politik, auch die älteren Leute nicht. Wir haben zwar alle ein Wahlrecht, aber das nützt nicht wirklich viel, wenn man nur die Auswahl zwischen den immer gleichen Politikern hat, die alle nur die Reichen unterstützen. Wieso das so ist, weiß ich nicht, aber ich will es auch gar nicht wissen. Ich kann ohnehin nichts daran ändern.
Unten an der U-Bahn-Station ist nicht viel los. Das wundert mich kaum. Draußen in den Vorstädten benutzt jeder die Bahn, da nur die wenigsten ein Auto besitzen und die Straßen ohnehin in einem katastrophalen Zustand sind. Doch hier fährt jeder lieber mit seinem eigenen Wagen, anstatt in die Bahn zu steigen.
Ab und zu lese ich eine dieser Zeitungen, die an der U-Bahn-Station ausliegen. In einer davon habe ich einmal gelesen, dass viele Reiche die Bahn meiden, da sie glauben, Passagiere aus den Vorstädten würden gefährliche Viren verbreiten, die sie anstecken könnten. Ich habe die Zeitung wutentbrannt zerrissen und in den nächsten Mülleimer geschmissen. Aber jetzt, da ich in der Innenstadt bin und gerade einmal vier weitere Leute an der Station warten, glaube ich, dass es tatsächlich so ist, wie es damals in der Zeitung gestanden hat.
Alles um mich herum ist grau, an den Wänden ist bereits Lack abgeblättert. Hier unten sieht es gar nicht aus wie in der Innenstadt, sondern vielmehr wie in den Vorstädten. Nur der Geruch ist besser. Ich blicke auf die Anzeige, die an der Decke befestigt ist. Es dauert noch drei Minuten, bis meine Bahn kommt.
Ich setze mich auf einen der schwarzen Stühle vor dem Gleis. Auf den Stuhl neben mir hat jemand eine heutige Zeitung geworfen. Ich werfe einen kurzen Blick darauf. Unter dem Namen der Zeitung und dem heutigen Datum, dem 18. Juni 2099, ist ein großes Bild, das irgendjemanden aus dem Council zeigt. Ich habe den Mann schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt, und es ist mir auch egal. Ich lege die Zeitung wieder weg.
Gedankenverloren starre ich auf die graue Wand vor mir, hinter dem Gleis. Ich stelle mir vor, wie es wäre, ein Leben als Reiche zu verbringen. Wir würden in einem der Schlösser in der Innenstadt wohnen, ich hätte zu meinem 16. Geburtstag solch ein unglaubliches Auto geschenkt bekommen, Mom säße im Büro und würde immer nur vor dem Board sitzen, anstatt Fließbandarbeit zu verrichten, Griffin würde Basketball spielen, anstatt in irrealen Welten herumzuhängen und, ich schlucke, Dad wäre noch am Leben. Es wäre ein wundervolles Leben. Alles wäre perfekt. Vor meinem geistigen Auge taucht das Bild auf, wie meine Familie vor einem dieser Schlösser steht, Arm in Arm, überglücklich. Der Gedanke an ein solches Leben ist…
Aber Moment mal, denke ich plötzlich, und das Bild vor meinem geistigen Auge zerplatzt, das hier muss eine sehr gute Gedankenwelt gewesen sein. Wenn ich mir dieses Bild vorgestellt hätte anstatt den Baum und den See, dann hätte ich mit Sicherheit eine überzeugende Gedankenwelt erschaffen. Doch eigentlich bin ich froh, dass Adrian dieses Bild nicht gesehen hat. Meine Familie geht diesen arroganten Kerl überhaupt nichts an.
Die blaue U-Bahn kommt, und ich steige ein, um nach Hause zu gelangen. Denn obwohl ich die Vorstädte hasse, unsere Wohnung dort ist und bleibt mein Zuhause.
+++ #3 +++
Ich brauche über zwei Stunden, um von der Innenstadt zu unserer Wohnung zu gelangen. Als ich die überfüllte U-Bahn-Station endlich verlasse, ist es bereits Mittag. Doch obwohl die Sonne auf die Stadt herunterbrennt, kommt es mir hier draußen kaum wie Mittag vor. Das monotone Grau der Hochhäuser, die mit Müllbergen übersäten Straßen, auf denen schon ewig kein Auto mehr gefahren ist, und der grässliche Gestank geben mir den Eindruck, in der ewigen Düsternis gefangen zu sein.
Mit schnellen Schritten gehe ich nach Hause. Hier lässt sich niemand Zeit, zu groß ist die Angst davor, von einer Straßenbande überfallen zu werden. Schließlich komme ich vor dem Hochhaus an, in dem wir wohnen. Ohne auf die Müllberge vor dem Gebäude und die hässlichen Graffitis auf der Fassade zu achten, drücke ich die Klingel neben dem Namensschild mit der Aufschrift Hawkins.
„Wer ist da?“, höre ich Moms Stimme.
Ich atme erleichtert auf. Sie hat den Mittag tatsächlich frei bekommen. Das hat mir Mom zwar schon zahlreiche Male versprochen, doch bis jetzt habe ich nicht wirklich daran geglaubt, dass die Fabrik ihr freigibt.
„Ich bin’s, Mom.“
Das Summen ertönt. Ich stoße die Tür auf und befinde mich nun in dem dunkelgrauen Flur, der zu den Erdgeschosswohnungen und zum Fahrstuhl am Ende des Ganges führt. Zielstrebig gehe ich zum Aufzug und fahre damit in den achten Stock herauf.
Ich brauche gar nicht mehr an unserer Wohnungstür zu klingeln, Mom macht mir schon von alleine auf. Sie strahlt, sie scheint sich richtig zu freuen. Wahrscheinlich darüber, dass ich den Job bei Dream bekommen habe.
Wir begrüßen uns, dann gehen wir ins Wohnzimmer. Um genau zu sein, handelt es sich dabei nur um einen recht kleinen Raum mit einem weißen Tisch, vier darum stehenden Stühlen und einem schwarzen Schrank. Durch zwei kleine Fenster kann man auf die anderen Hochhäuser sehen. Es ist dunkel in dem Raum, genauso wie draußen.
„Ist Griffin in der Schule?“, frage ich hoffnungsvoll, als wir uns auf die Stühle fallen gelassen haben.
Mom schüttelt mit trauriger Miene den Kopf. Ich brauche gar nicht mehr weiter nachzufragen. Ich weiß, dass mein Bruder in seinem Zimmer sitzt und in Gedankenwelten herumhängt. Ich werde später nach ihm sehen, er würde mich jetzt ohnehin nur fortjagen.
„Dann fängst du jetzt tatsächlich deine Ausbildung an“, meint Mom. „Und, wie war dein erster Tag?“
„Ziemlich spannend“, antworte ich, da ich keine große Lust dazu habe, auf all die Einzelheiten einzugehen.
„Gut“, erwidert Mom und fährt dann mit ernstem Tonfall fort, zu sprechen. „Cathryn, das ist deine große Chance. Es geht nicht nur um das Geld, es geht auch um ein… nun ja, ein besseres Leben. Bitte, Cathryn, strenge dich bei dieser Ausbildung wirklich, wirklich an. Du hast die einmalige Chance bekommen, etwas Besonderes in deinem Leben zu erreichen. Bitte, Cathryn, vermassle es nicht.“
Ich hasse es, diese Worte von ihr zu hören. Natürlich weiß ich, dass sie all ihre Hoffnung jetzt in mich gesetzt hat. Mom weiß, dass sie selbst an ihrem Leben nichts mehr ändern kann, die Arbeit in der Fabrik ist ihr Leben. Nur ich kann etwas Besseres erreichen, für mich und meine Familie. Doch ich will dies alles nicht schon wieder hören. Die Verantwortung, die auf meinen Schultern lastet, wird dadurch nur immer noch größer. Und meine Angst, zu versagen, ebenfalls.
Ich denke daran, wie schlecht ich mich bei meinem ersten Test angestellt habe. Wie ich keine Landschaft, sondern eine Strichzeichnung erschaffen habe. Schnell schiebe ich diesen misslichen Gedanken weg.
„Ich kriege das schon hin, Mom“, sage ich und versuche, von meinen eigenen Worten überzeugt zu klingen. „Ich schaffe das.“
„Danke.“
Mom steht auf, und ich merke, wie ihr die Tränen kommen. Auch ich erhebe mich und gehe zu ihr, und dann umarmt sie mich. Sie hat ein zerfurchtes Gesicht, von der Arbeit wunde Hände und trägt ein zerschlissenes Kleid. Doch für mich ist sie wunderschön.
„Du wirst das wirklich schaffen, Cathryn. Du bist so klug, so mutig.“ Mom beginnt, leise zu weinen.
Entgegen meiner eigentlichen Absicht, noch eine Stunde zu warten, gehe ich gleich in das andere Zimmer mit den zwei Betten und einem Schrank. Ich wohne immer noch mit meinem Bruder in einem Zimmer, Geld für eine größere Wohnung haben wir eben nicht. Wie erwartet sitzt Griffin auf seinem Bett, die Bonnet auf dem Kopf. Er blickt nicht einmal auf, als ich hereinkomme. Ich weiß nicht einmal, ob er es überhaupt mitbekommt, schließlich sind seine Augen und Ohren von dem Gerät überdeckt.
Griffin ist selbst für einen Zehnjährigen sehr klein, hat blonde Haare und ist ziemlich dick, weil er sich so viel von dem Fastfood ernährt. Damit ist er aber nicht der Einzige, die meisten Leute in den Vorstädten essen entweder zu wenig oder zu viel Fastfood. Gutes Essen bekommen wir hier draußen kaum, weil es einfach zu teuer ist.
„Hi, Griffin“, begrüße ich ihn.
Einen Moment lang denke ich, er hätte mich wirklich nicht bemerkt, doch dann schiebt er sich die Bonnet über die Augen und blickt mich an. Er scheint wirklich glücklich zu sein. Auch das verwundert mich kaum, denn mein Bruder lebt schon seit drei Jahren nicht mehr in der grässlichen wirklichen Welt, er geht auch kaum noch zur Schule.
Anstatt dessen spielt er sich durch irgendwelche Gedankenwelten, die Kreatoren von Dream entworfen haben. Eigentlich hasse ich diese Leute, da sie dafür verantwortlich sind, dass Griffin danach süchtig geworden ist, und ich hasse mich am meisten, da ich auch noch eine von ihnen werden will. Doch in gewisser Hinsicht bin ich den Kreatoren auch dafür dankbar, dass sie meinen Bruder glücklich machen, was ich kaum jemals gewesen bin.
„Hi, Cath“, sagt er.
Nur er nennt mich so, und das gefällt mir, weil es mich an die Zeit früher erinnert, als wir noch eine ganze Menge zusammen unternommen haben. Doch dann bin ich immer so lange in der Schule gewesen, und Mom hat ihm von ihrem ganzen Geld eine dieser Bonnets gekauft, damit er etwas Spaß haben kann. Ich habe mitbekommen, wie er auch an den Abenden immer weniger mit mir geredet hat, sondern dafür immer mehr mit diesem bescheuerten Ding auf seinem Kopf herumgesessen hat, doch konnte und wollte ich kaum etwas dagegen tun. Ich glaube, dass Mom ihm nicht noch einmal eine Bonnet geschenkt hätte, wenn sie gewusst hätte, wozu das führen würde.
„Warst du in der Schule?“
Ich schüttele traurig den Kopf. Die reale Welt scheint ihn tatsächlich kaum noch zu interessieren.
„Griffin, ich bin doch schon 17. Ich habe meinen Schulabschluss schon vor drei Monaten gemacht. Ich habe heute mit meinem Job begonnen, meiner Ausbildung.“
„Ach so“, erwidert mein Bruder. „Weißt du, was ich heute gemacht hab, Cath?“ Sein Tonfall verändert sich, er klingt jetzt geradezu begeistert.
„Ich habe die Black Warriors vernichtet! Über dreihundert von ihnen haben den Tempel belagert, meine Verbündeten und ich waren von den Black Warriors umzingelt, Cath. Doch dann habe ich gesagt: Zieht eure Schwerter und lauft! Und du wirst es nicht glauben, aber wir haben diese Meute getötet. Ich glaube, ich habe den ganzen Tempel gerettet, vielleicht sogar unser gesamtes Königreich!“
Höflich warte ich, bis er seinen Monolog beendet hat, dann ergreife ich aber wieder das Wort.
„Jetzt hör mal genau zu, Griffin“, sage ich und merke, dass ich dabei recht zornig klinge, „das alles ist nur ein Spiel! Nur ein Spiel! Es gibt keine Black Warriors, es gibt keinen Tempel, es gibt kein Königreich. Das sind Gedankenwelten – Welten, die sich jemand ausgedacht hat. Das Einzige, was diese Welten tatsächlich bedeuten, ist, dass Mom jeden Monat die Zugangsgebühr für deine Bonnet bezahlen muss – und das, obwohl wir ohnehin so wenig Geld haben!“
Mein Bruder blickt mich verdutzt an, dann zuckt er mit den Achseln und meint lässig: „Natürlich weiß ich, dass das nur ein Spiel ist, Cath. Aber das ändert doch nichts daran, dass es unglaublich Spaß macht.“
Ich weiß nicht mehr, wie ich ihm widersprechen soll. Ich würde nie auf die Idee kommen, meine Zeit mit solch einem Schwachsinn zu vergeuden und dafür auch noch Geld auszugeben. Doch andererseits, nun ja, andererseits will ich für genau solch einen Schwachsinn arbeiten.
Also nicke ich und wende mich ab, um das Zimmer zu verlassen und wieder mit Mom zu reden. Ich drehe mich ein letztes Mal um und sehe noch, wie er die Bonnet wieder aufsetzt. Ich bin bereits auf halbem Weg zurück ins Wohnzimmer, als er mich plötzlich ruft.
„Cath!“ Er klingt fast schon panisch.
Erschrocken renne ich zurück in sein Zimmer und sehe, wie er mich angsterfüllt anblickt. Die Bonnet hat er wieder über die Augen hinauf gezogen, sodass er mich ansehen kann. Ich habe nicht den geringsten Schimmer, was ihn derartig ängstigen könnte.
„Sei vorsichtig, Cath“, sagt er langsam. „Sie werden dich jagen und töten.“
„Was?“
Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Wer soll mich denn bitte schön jagen und töten?
„Die Black Warriors“, erwidert Griffin, immer noch voller Angst. „Der Herrscher des Östlichen Reiches hat davon erfahren, dass ich seine Armee vernichtet habe. Er hat mir einen Geisterboten geschickt, um mir mitzuteilen, dass er sich rächen werde. Gerade eben.“ Er hält kurz inne.
„Der Geist hat gesagt, dass der Herrscher weiß, wie er mich bestrafen könne. Er werde meine Schwester Cathryn jagen, bis er sie gefunden habe. Dich, Cath.“ Mein Bruder beginnt, zu weinen. „Sie werden dich foltern und umbringen, wenn sie dich finden. Bitte, Cath, sei auf der Hut. Sie dürfen dich nicht töten…“
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Am liebsten würde ich auf ihn zu rennen, ihm die Bonnet vom Kopf reißen und das Gerät aus dem Fenster werfen. Doch ich beherrsche mich.
„Ich passe schon auf mich auf“, sage ich und grinse. „Diese verfluchten Black Warriors. Ich werde sie alle umbringen!“
„Du bist wundervoll, Cath!“ Griffin lacht begeistert. „Gemeinsam werden wir den Tempel schützen. Und das ganze Königreich!“
„Natürlich“, sage ich und versuche, genauso begeistert zu klingen wie er, obwohl mir elend zumute ist. „Wir sind die Besten! Wir beide!“
Dann verlasse ich das Zimmer und sehe, wie mein Bruder die Bonnet wieder aufsetzt und in die Gedankenwelt der Black Warriors zurückkehrt. Ich hasse, was mit meinem Bruder los ist. Er lebt nur noch in diesen grässlichen Gedankenwelten. Raumschiffe, Königreiche, Heldengeschichten – das ist seine Realität.
Ich hasse die Gesellschaft, weil sie daran schuld ist, was aus ihm geworden ist. Hier in den Vorstädten gibt es kein wirkliches Leben. Man kann nur verzweifeln – oder sich in Fantasiewelten hineinträumen. Und eigentlich sollte ich auch Dream hassen, weil die Leute dort dafür verantwortlich sind, dass es diese Fantasiewelten überhaupt gibt. Und doch will ich dort arbeiten.
Ich bin so traurig, dass mein Bruder nach diesen Gedankenwelten süchtig geworden ist. Dass er sogar glaubt, dass ich von den Fantasiemenschen gejagt werden könnte.
Doch dann packt mich ein zugleich erschreckender als auch verblüffender Gedanke. Mein Bruder hat sich nicht eingebildet, dass die Black Warriors mich jagen werden. Sie werden das tatsächlich tun. Irgendwie hat es Dream geschafft, mich in diese Gedankenwelt zu integrieren, obwohl ich sie noch nie betreten habe.
Das ist wirklich seltsam. Aber es ist auch wirklich erstaunlich.
+++ #4 +++
Als ich am nächsten Morgen vor dem Raum ankomme, in dem ich meinen Theorieunterricht haben werde, ist außer mir noch niemand da. Ich nehme mein Board aus der Handtasche und werfe einen Blick auf die Uhranzeige. Es ist acht Minuten vor neun. Anscheinend kommen die Leute aus der Innenstadt immer erst im letzten Moment.
Eigentlich bin ich froh, dass ich die Erste vor dem Unterrichtsraum bin, denn so hat wenigstens niemand mitbekommen, dass ich den Raum schon wieder vergessen habe. Der Mann am Empfang, meines Wissens heißt er Christian, hat mich ohnehin etwas komisch angeschaut, als ich ihn nach dem Raum fragen musste, obwohl er mir diesen ja schon gestern genannt hat.
Der Korridor ist hell erleuchtet, doch wie überall in dem Firmengebäude kann man nicht nach draußen sehen. Um mich herum sind nichts als graue, eintönige Bürotüren. Aber auch wenn ich erst den zweiten Tag hier bin, habe ich mich an diese Umgebung schon gewöhnt.
Eine Minute lang lehne ich mich an die Wand des Korridors und schaue immer wieder vom einen Ende des Ganges zum anderen, in der Erwartung, dass wenigstens irgendjemand aufkreuzt. Als ich mich bereits frage, ob ich vielleicht doch im falschen Stockwerk ausgestiegen bin, sehe ich, wie sich die Tür des Fahrstuhls öffnet und ein Mädchen aussteigt. Sie läuft zielstrebig auf mich zu.
„Das ist doch der Raum für die Ausbildung?“, fragt sie mich, sie klingt etwas unsicher.
„Ja“, erwidere ich knapp.
„Gut, zum Glück.“ Sie ist sichtlich erleichtert. „Ich hab schon befürchtet, dass die Leute einen Fehler in diese Demo eingebaut haben. Das ist ihnen schon öfters passiert.“
„Hm“, mache ich, ohne genauer nachzufragen, worüber sie eigentlich spricht.
Anstatt dessen mustere ich das Mädchen. Sie scheint ähnlich alt zu sein wie ich und ist auch ähnlich groß. Sie hat lange, blonde Haare, die ihr bis zu ihren Schultern reichen, und eine recht schlanke Statur. Ihrer Kleidung, einem edel wirkenden, hellblauen Kleid und dazu passenden Stöckelschuhen, nach zu urteilen, ist sie ziemlich reich. Über ihre Schulter trägt sie eine kleine, graue Handtasche.
„Hast du auch gestern deine Praxisausbildung angefangen?“, fragt sie mich und lehnt sich neben mich an die Wand.
Ich nicke nur, woraufhin sie weiter spricht.
„Das war doch so langweilig gestern. Ich hab nichts machen dürfen. Ich dachte, wir machen da solche Tests, Übungen für Kreatoren. Aber anstatt dessen hat mich meine Ausbilderin einfach nur mit irgendwelchem Zeugs vollgelabert. Fast, als hätte ich Theorie. Und, bei wem machst du Praxis?“
„Adrian Porter“, sage ich knapp.
„Oh!“, ruft sie aus, sie klingt beeindruckt und neidisch zugleich. „Da hast du ja wirklich Glück. Ich hab diese Leute alle mal bei einer Firmenparty kennengelernt, der gilt ja als wirkliches Genie – und gut aussehen tut er auch noch. Und mir haben die diese dumme… ach egal, da kann man jetzt auch nichts machen…“
Ich kommentiere ihre Worte nicht. Ich finde meinen Ausbilder nicht im geringsten Maße umwerfend, ich halte Adrian für ein arrogantes Arschloch. Aber andererseits glaube ich, dass ich dieses Mädchen genauso wenig leiden kann wie ihn. Sie erzählt mir irgendwelche Dinge, ohne mich überhaupt erst einmal zu fragen, ob ich das alles wirklich hören will. Wenn sie wüsste, dass ich in der Tat aus den Vorstädten stamme, würde sie mich wahrscheinlich genauso behandeln wie Adrian es tut. Aber, denke ich mit einem Grinsen, das soll sie ja auch nicht gerade über mich erfahren.
Also verhalte ich mich am besten wie ein Mädchen aus der Innenstadt. Und auch wenn ich kaum etwas über die reichen Teenager aus dem Zentrum weiß, so kann ich mir deren Art leicht vorstellen: reiche Mädchen reden viel, über irgendwelche dummen Themen, sind egoistisch, selbstbewusst und lässig.
„Das muss ja richtig dumm sein“, meine ich daher, „mit solch einer schlechten Ausbilderin zusammenarbeiten zu müssen. Diese verdammte Zuteilung!“
„Ja, genau“, erwidert sie, „wir sollten uns die Ausbilder einfach aussuchen können. Ich meine, das wäre ja genauso, als ob wir alle nur Dream als Option gehabt hätten – wir hätten ja alle auch woanders hin gehen können.“
„Ja, wirklich.“ Dann füge ich lächelnd hinzu: „Ich bin übrigens Cathryn, und du?“
„Alicia“, sagt sie. „Alicia McKittrick.“
In diesem Augenblick tritt ein Junge aus dem Fahrstuhl und kommt auf uns zu. Er stellt sich allerdings nicht zu uns, sondern geht zur anderen Seite der Tür. Auf seiner Stirn ist eine Bonnet befestigt.
Alicia blickt ihn einen Moment lang an, dann dreht sie sich wieder zu mir um.
„Wo wohnst du eigentlich?“, fragt sie, sie klingt ziemlich neugierig.
„Im 14. Viertel“, sage ich wahrheitsgemäß, denn tatsächlich liegt meine Ein-Zimmer-Wohnung in einem der besten Viertel der Innenstadt, wenngleich in einem Hochhaus.
„Echt?“ Alicia wirkt überrascht. „Wie ich. Also, wie ich aktuell noch. Ich plane nämlich schon längst, mir endlich mal ein eigenes Haus zu nehmen. Ich organisiere gerade, mal eines der tollen Häuser in diesem Viertel zu bekommen, direkt hier in der Nähe“, sie spricht sicherlich von den Schlössern, „aber mein Dad unterstützt mich nicht dabei. Er glaubt ja immer noch, dass ich zu jung bin, um alleine zu wohnen – ich meine, was soll das?, ich bin doch schon 17, schon seit einem Jahr volljährig.
Wir wohnen ja in der Innenstadt und nicht in den grässlichen Vorstädten mit all diesen Straßenbanden und diesem asozialem Pack.“ Sie verzieht angewidert das Gesicht. „Ich meine, na gut, dort würde ich auch nicht alleine wohnen wollen, also nicht ohne ein Gewehr, um diese verdammten Leute einen nach dem anderen umzulegen, aber hier, da kann doch nichts passieren…“
„Hier sind wir doch sicher…“, sage ich und widerstehe dem Impuls, sie auf der Stelle zusammenzuschlagen.
Ich weiß, dass ich Alicia schon jetzt über alles hasse, doch andererseits wäre eine Freundschaft mit ihr genau das, was ich für meinen Aufstieg in ein besseres Leben gebrauchen könnte.
Meine Mom hat all ihre Hoffnung in mich gesetzt, sage ich mir immer wieder. Die Verantwortung ist groß, und doch beruhigt mich dieser Gedanke. Ich habe ihr versprochen, diese Ausbildung hinzubekommen. Ich werde nicht versagen. Ich werde nicht versagen.
Mit Pünktlichkeit nehmen es viele Leute in der Innenstadt offensichtlich nicht ganz so ernst. So dauert es noch eine weitere Viertelstunde, bis die Ausbilderin die Tür des Raumes aufschließt und die inzwischen versammelte Menge an Azubis den Unterrichtsraum betritt.
Das Zimmer ist groß und sieht aus wie eines der Klassenzimmer aus meiner alten Schule, nur mit dem Unterschied, dass hier alles sauber ist und kein ekliger Geruch in der Luft liegt. Es gibt fünf Räume mit langen, weißen Tischreihen und jeweils zehn schwarzen Bürostühlen, wobei die hinteren Reihen höher gelegt sind als die vorderen. Alle Stühle sind zu der großen Leinwand hin ausgerichtet, vor der die Ausbilderin steht, mit ihrem Mikrofon in der Hand. Auch auf jedem unserer Tische steht ein Mikrofon. Nach rechts hin kann man durch eine riesige Glaswand auf die wunderschöne Innenstadt mit all ihren architektonischen Meisterwerken und dem großen Park blicken.
Alicia und ich setzen uns in die Mitte der dritten Reihe. Neben mir sitzt der Junge, der immer noch das schwarze, quadratische Gerät trägt und daher nach wie vor irgendeine Gedankenwelt durchlebt, Musik hört oder sonst irgendeiner sinnlosen Beschäftigung nachgeht.
„Guten Morgen“, sagt die Ausbilderin in ihr Mikrofon.
Sie sieht aus wie all die älteren reichen Leute, die ich aus den Zeitungen kenne. Mit Make-up und Schönheits-OPs wirkt sie wie Ende 20, doch weiß eigentlich jeder, dass sie mindestens 40 Jahre alt ist. Sie hat lange, schwarze Haare und trägt ein rotes, auffälliges Kleid. In ihrer rechten Hand hält sie lässig ihr Board.
„Ihr habt es also geschafft. Auf euch alle hier wartet eine Ausbildung bei dem vermögendsten Unternehmen der Welt: Dream.“
„Bei Dream – oh wie toll“, raunt ein Junge vor mir einem anderen Jungen zu. „Dieser Job ist doch saumäßig scheiße. Ich würde so gerne was anderes machen…“
„Ich bin Juniper Chrystal“, fährt die Ausbilderin fort.
Ich lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. Alle Leute hier sind in etwa so alt wie ich, zu meiner Überraschung sind zwei Drittel Mädchen. Der Junge neben mir nimmt die Bonnet von seiner Stirn und stützt den Kopf auf den Arm, während er nach vorne blickt.
Ms. Chrystal tippt auf eine Taste ihres Boards, woraufhin auf der Leinwand ein Bild in gigantischer Größe erscheint. Es zeigt das rundliche Gesicht einer Frau mit kurzen, dunkelbraunen Haaren, die offensichtlich alt ist. Zwar sieht sie aus wie eine 40-Jährige aus den Vorstädten, doch ist mir sogleich klar, dass dieses Aussehen wie bei allen älteren Leuten aus dem Stadtzentrum nur mithilfe von Schönheitsoperationen herbeigeführt werden konnte. In Wirklichkeit muss sie 70 oder 80 Jahre alt sein.
„Kennt jemand von euch diese Frau?“, fragt die Ausbilderin.
„Joanna Hayman“, sagt der Junge vor mir laut in sein Mikrofon, der sich wenige Augenblicke zuvor über Dream lustig gemacht hat.
„Und worin bestand ihr Beruf?“
„Sie ist die Begründerin von Dream.“
„Ganz genau“, stimmt Ms. Chrystal zu. „Joanna Hayman war Professorin an einer Universität in Seattle, bevor sie sich im Jahr 2030 mit einer bahnbrechenden neuen Technologie selbstständig machte. Sie gründete das Unternehmen Dream, das innerhalb von wenigen Jahren zu einer der erfolgreichsten Firmen der ganzen Welt aufstieg.
Dream verwendet die Möglichkeiten der Hirnforschung, um Fantasiewelten zu erschaffen. Unsere Kreatoren lassen alleine aus ihren Gedanken ganze Welten real werden. Über das zentrale Gerät, die Bonnet, können Kunden von Dream in diese Welten eintauchen. Über die Bonnet sieht und fühlt man diese Gedankenwelten so, als wären sie die Realität.
Natürlich sahen diese Welten in der Mitte des 21. Jahrhunderts bei Weitem nicht so perfekt aus, wie sie es heutzutage tun. Die erste Bonnet, die 2031 auf den Markt kam, ermöglichte nur die Darstellung einfacher Landschaften. Mit jeder Bonnet-Generation wurden die Möglichkeiten jedoch vielfältiger. Die unglaublich komplexen Welten der aktuellen Spiele, die Dream seinen Kunden anbietet, erfordern neuestes Equipment und modernste Forschung. Joanna Hayman hat nach wie vor absolut Recht mit ihrer berühmten Behauptung aus dem Jahr 2034: Dream lässt deine Träume real werden.“
„Dumm nur, dass sie jetzt Selbstmord begangen hat…“, kommentiert der Junge in sein Mikrofon.
Die Ausbilderin blickt ihn einen Moment lang verdattert an. Dann schaut sie auf ihr Board, um den Namen des Jungen zu erfahren.
„Edward Simmons“, sagt sie dann zornig, „wie kommst du denn darauf, dass Ms. Hayman sich das Leben genommen hat?“
„Hm“, erwidert er, „ich hab da halt so meine Quellen.“
„Was auch immer ihr diesbezüglich gehört haben mögt“, fährt Ms. Chrystal an uns alle gewandt fort, „ist reinster Unsinn. Joanna Hayman starb vor zwei Wochen in ihrem Ferienhaus in Spanien – an einem natürlichen Tod.“
„Macht ja wirklich Sinn, weil schließlich so viele Leute schon mit 117 sterben“, sagt Edward mit unüberhörbarer Ironie in seiner Stimme.
Wieder ärgere ich mich über die reichen Leute aus der Innenstadt. Natürlich hat er Recht, im Stadtzentrum stirbt kaum jemand unter 150 Jahren. Doch bei uns draußen in den Vorstädten ist bereits 50 ein hohes Alter.
„Jetzt reicht’s, Edward!“, brüllt die Ausbilderin wütend. „Sonst schalte ich dein Mikro ab!“ Dann fährt sie mit ihrem Vortrag zu Joanna Hayman, der Gründerin der Firma Dream, fort.
Neben mir nimmt Alicia ihr Board aus der Handtasche und beginnt gelangweilt, irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Auch ich schweife mit meinen Gedanken schnell ab. Anstatt weiter der monotonen Laudatio auf Ms. Hayman zuzuhören, denke ich daran, was diese Frau meinem Bruder angetan hat. Sie ist daran schuld, dass er nicht mehr in der Wirklichkeit lebt. Hätte sie die Bonnet niemals auf den Markt gebracht, so wäre Griffin jetzt nicht süchtig nach diesen grässlichen Spielen und würde noch genau wissen, was Realität ist und was Fantasie. Und doch, obwohl ich Dream eigentlich hassen sollte, ist es mein Ziel, hier zu arbeiten.
Als der langweilige Theorieunterricht endlich vorbei ist, ist es bereits Mittag. Die Sonne brennt mit all ihrer Kraft durch die Fenster des Unterrichtsraumes, es ist bereits kurz nach zwölf. Drei Stunden lang musste ich mir diesen nicht enden wollenden Vortrag über die Geschichte von Dream anhören. Auch wenn ich es mir nicht eingestehen will, habe ich Adrian tatsächlich etwas vermisst, weil der Praxisunterricht wenigstens spannend war. Aber ich weiß genau, dass ich in zwei Stunden wieder eine ganz andere Meinung haben werde, wenn ich mir seine dummen Bemerkungen anhören muss.
Alicia fragt mich, ob wir gemeinsam in die Kantine gehen. Ich nicke und folge ihr in den Fahrstuhl, hinunter in den zweiten Stock und einen langen, grauen Korridor entlang bis in einen riesigen Saal mit zahlreichen besetzten Tischen und Stühlen. Durch die gigantische Glaswand kann man nach draußen auf die Stadt sehen.
Ich achte jedoch nur auf die Theke, von der es nach köstlichem Essen dampft. Ich bin unglaublich hungrig. Ich bin mir sicher, dass das Essen fantastisch sein wird. In der Innenstadt gibt es nur gutes Essen, es gibt ja sogar diese Idioten, die locker mal tausend für ein Abendessen in einem Gourmetrestaurant ausgeben. Seit meiner Kindheit war ich immer froh, wenn Mom Griffin und mir etwas Brot und Käse aus dem weit entfernten Discounter mitgebracht hat. Ansonsten gab es nur dieses grässliche Fastfood oder eben gar nichts. Das ist wohl auch der Grund, weshalb ich so mager bin.
Da ich das merkwürdige System mit dem Tablett und all den verschiedenen Tellern und Schüsseln nicht so ganz durchblicke, lasse ich Alicia vor mich. Eine Minute lang stehen wir in einer Schlange mit diversen Mitarbeitern von Dream, dann nehmen wir uns von allem etwas und setzen uns an einen Tisch an der Wand. Ich werfe einen Blick nach draußen. Die Straße ist nur rund zwei Meter unter uns. Die bereits gewohnten Sportwägen und Cabriolets rasen mit Höchstgeschwindigkeit vorbei.
„Freust du dich schon auf die Firmenparty?“, fragt Alicia.
Ich muss erst einmal einen großen Bissen Fleisch herunterschlucken, bevor ich ihr antworten kann. So viel Essen habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie auf einmal bekommen. Und dazu schmeckt es auch noch so köstlich.
„Ähm… was?“
„Die Firmenparty? Glaubst du, es wird toll?“
„Ähm… welche Firmenparty?“ Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet.
„Ach so… das weißt du noch gar nicht?“ Sie klingt ziemlich verwundert. „Hast du dir die Demo nicht angeschaut? Stimmt ja, die machen immer so viele Fehler in diese Demos. Du hast eigentlich Recht, ist doch wirklich Zeitverschwendung.“
„Also, Alicia, was für eine Party?“
„Ach so, ja genau. Das ist ein Event der Firma. Die verschiedenen Ausbilder wollen die Azubis kennenlernen, damit sie sich ein besseres Bild von uns machen können. Und natürlich ist es auch eine erstklassige Gelegenheit, damit wir Azubis uns alle besser einander kennenlernen. Ich meine, das wird sicher lustig. Natürlich ist es ein Firmenevent, aber eine Tanzfläche soll es schon geben, und die Cocktails sind bei solch einem Ereignis eigentlich immer erste Sahne.“
Ich nicke nur. Partys sind wieder solch eine Beschäftigung für reiche Leute. Die Teenager aus der Innenstadt lieben es, nachts wegzugehen und in irgendwelchen teuren Clubs Spaß zu haben. Feiern, tanzen, Musik hören und Alkohol trinken sind Aktivitäten, die für reiche Jugendliche grundsätzlich zum Wochenende dazugehören, während wir aus den Vorstädten arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Aber natürlich bin ich jetzt ein Teil dieser anderen Welt, der Welt der Innenstadt. Jetzt gehört für mich auch eine Firmenparty zu meinem Leben.
„Wann ist diese Party genau?“, frage ich.
„Freitagabend, um acht. Also so drei Stunden nach dem Praxisunterricht. Ich finde es sowieso ziemlich gut, dass sie die Party auf den Freitag legen und uns das Wochenende freigeben. Schließlich haben wir da doch was Besseres zu tun, als in die Firma zu gehen, nicht wahr?“
Wieder nicke ich nur. Sie meint sicherlich, irgendwo anders zu feiern oder einer anderen überflüssigen Freizeitbeschäftigung nachzugehen.
„Also ich freue mich schon“, fährt Alicia grinsend fort. „Ich hab sowieso Lust, die ganzen Jungs hier mal kennenzulernen. Da ist solch ein Event eigentlich immer ideal. Du musst wissen, mein Ex hat mich vor drei Monaten verlassen – also eigentlich hat er mit einer meiner Freundinnen rumgemacht, und dann war’s natürlich zwischen uns beiden aus.“ Sie lacht, als sie daran denkt. „Und wie steht’s mit dir, Cathryn? Hast du einen festen Freund?“
„Nein, zurzeit nicht“, erwidere ich schnell. „Aber wer weiß? Solch eine Party ist eigentlich immer ideal, um jemanden kennenzulernen.“
Das ist im Grunde genommen dasselbe wie das, was sie vorher gesagt hat, aber sie merkt es nicht. Na gut, natürlich wünsche ich mir, einmal einen festen Freund zu haben. Ich weiß, dass reiche Mädchen sich unglaublich viele Gedanken über Jungs machen und darüber reden, wer gerade mit wem zusammen ist. In den Vorstädten haben wir dafür keine Zeit, wir müssen viel zu viel arbeiten. Vor allem jedoch würden wir auch dann nicht über solch alberne Dinge reden, wenn wir die Zeit dazu hätten. Wir haben viel zu große Sorgen, um über Derartiges zu lachen. Wir hätten jeden Tag ermordet werden können, und jeden Tag hätten unsere Eltern tot sein können, wenn wir von der Schule nach Hause kamen.
„Noch eineinhalb Stunden bis zum Praxisunterricht“, sagt Alicia mit einem Blick auf ihr Board. Ich bin froh über den Themenwechsel, ich habe keine Lust mehr, über die Party zu sprechen. „Ich will jetzt eigentlich nicht nach Hause gehen, und du?“
„Hm, keine Ahnung.“



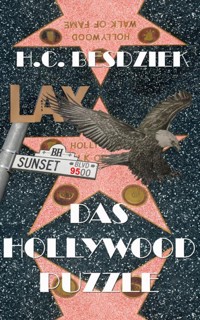















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









