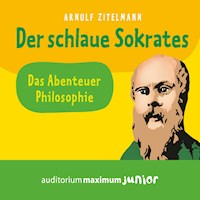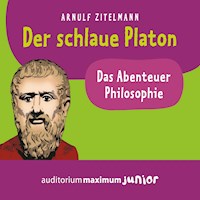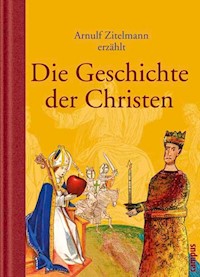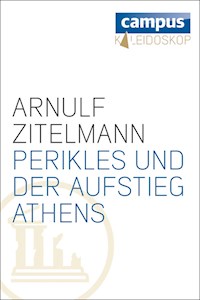Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
ab 12 Jahre Vom Alphabet bis zu den Olympischen Spielen – vieles in der europäischen Kultur hat seine Wurzeln in der griechischen Antike. Arnulf Zitelmann begibt sich auf die Spuren der alten Griechen und entdeckt Spannendes und Überraschendes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LESEPROBE
Zitelmann, Arnulf
Die Welt der Griechen
LESEPROBE
www.campus.de
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2008. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40424-0
|7|Die Vorväter Griechenlands
Kreta, Mykene und die dunklen Jahre
Lange, bevor die Akropolis gebaut wurde, lange vor Sokrates und Aristoteles und lange, bevor es Städte wie Athen und Sparta gab, erblühte auf der langgestreckten Insel Kreta im östlichen Mittelmeer die früheste Hochkultur Europas. Die Minoer hatten noch nie etwas von einem »Griechenland« gehört, sprachen kein Griechisch und gebrauchten eine bis heute unbekannte Schrift. Und doch sind sie irgendwie Verwandte, man könnte sagen, kulturelle Vorläufer der Griechen.
Die früheste griechische Hochkultur war die sogenannte »mykenische Kultur«. Sie hat viel von der kretischen Kultur übernommen. Heute ist der Ort Mikine eine kleine Bahnstation südlich der Landenge des Peloponnes. Doch in archaischer Zeit war Mykene ein bedeutendes Kulturzentrum, mit einer ausgedehnten Palastanlage, in der die ersten Könige Griechenlands residierten. Beide Kulturen zerfielen mit der Zeit und gingen unter. Aus ihren Ruinen jedoch sollte ein Reich hervorgehen, das jahrhundertelang den Mittelmeerraum prägte und beherrschte: Griechenland.
Wie Kreta zu den Griechen kam
Eine gewaltige Explosion erschütterte die Inselwelt der griechischen Ägäis in vorgeschichtlicher Zeit. Der Santorin-Vulkan, nördlich von Kreta, öffnete sich, riss die Insel entzwei und schleuderte vulkanisches Material über das Ägäische Meer. 40 bis 60 Kubikkilometer. Die Katastrophe von Santorin bezeichnen Wissenschaftler als eine der größten Vulkan-Explosionen in den zurückliegenden 5000 Jahren.
Vulkanisches Material regnete auf die Städte von Santorin, begrub sie unter meterhohen Ascheschichten. Archäologen gruben eine der Städte, Akrotiri, |8|im vorigen Jahrhundert aus. Und sie staunten. Überwältigt von den Resten einer großzügigen Stadtanlage, wie sie bis dahin niemand in der griechischen Inselwelt erwartet hatte.
Der Ausbruch ereignete sich um 1600 vor unserer Zeit. Akrotiri aber besaß bereits wassergespülte Toilettenanlagen, man wohnte komfortabel in bis zu drei Stockwerken hohen Häusern, die freigelegten Vorratsräume bargen gewaltige Gefäße für die Einlagerung von Getreide, Oliven und Wein. Gepflasterte Straßen führten durch die Stadt. Die Straßen säumten Werkstätten: Trauben- und Ölpressen, Mühlen, Töpfereien und metallverarbeitende Betriebe. Und unter dem Straßenpflaster legten die Ausgräber ein ausgeklügeltes Kanalsystem frei.
Akrotiri öffnet ein Zeitfenster. In eine überraschend moderne Vergangenheit.
Auf sterbliche Überreste der Bewohner von Akrotiri ist man bisher nicht gestoßen. Offenbar hatten die Familien ihre Stadt noch rechtzeitig vor dem großen Ausbruch verlassen können. Unter Mitnahme ihrer wertvollsten Besitztümer, wie Schmuck und Waffen.
Doch sie hinterließen ihre Wandbilder, auf Putz gemalte Fresken. Sie geben uns Einblicke in das Leben der versunkenen Stadt. Blaue Äffchen turnen über die Wände, zwei Jungen messen sich im Faustkampf, Frauen sammeln gelbe Safranblüten zum Färben kostbarer Gewänder, stark geschminkte, festliche Damen der feinen Gesellschaft, Flusslandschaften mit Jagdszenen, Lilien, zwischen denen anmutige Schwalben segeln, ziehen an den Augen des Betrachters vorbei.
Schriftliche Hinterlassenschaften der Inselbewohner sind bislang nicht aufgetaucht. Um so wertvoller sind die Fresken von Akrotiri. Sie vermitteln uns einen anschaulichen Eindruck der farbenfrohen Inselkultur in der griechischen Ägäis.
Fast möchte man meinen, dass griechische Künstler diese Fresken malten, so typisch griechisch mutet uns die Lebenswelt der Inselstadt an, so sehr erinnern sie an Szenen aus den Epen Homers. Dieser große griechische Dichter schuf mit seinen Erzählungen Ilias und Odyssee nicht nur die ältesten erhaltenen Werke unserer Literatur, sie sind auch die einzigen überlieferten Zeugnisse aus den frühen Jahrhunderten der griechischen Geschichte.
Doch als die Fresken von Akrotiri entstanden, gab es noch kein Griechenland|9|. Santorin lag im Einflussbereich der kretischen Kultur. Und die Kreter der Frühzeit stammten vermutlich aus einer der Regionen des Nahen Ostens, wo die junge Menschheit zuerst gelernt hatte zu siedeln, Landbau zu betreiben.
Die Paläste Kretas waren überreich mit Fresken ausgestattet, wie sie auch die Bewohner von Akrotiri liebten. Auf Kreta begegnen wir ebenfalls Blumen, Vögeln, spielenden Delfinen. Und sportlichen Wettkämpfern, Männern und Frauen der Hofgesellschaft, oft in Lebensgröße dargestellt, schlanken, anmutigen Gestalten mit sehr engen Taillen. Die Damen tragen bodenlange Zierkleider, knapp ausgeschnittene Mieder, die ihre Brüste frei lassen. Frauen wie Männer legen großen Wert auf ihre Haarpracht. Sie lassen ihr dunkles Haar lang wachsen, legen es in füllige, bis über die Ohren hängende Locken.
Eines der Palastgemälde zeigt Akrobaten, junge Männer und auch Mädchen, die einen Stier bei den Hörnern fassen, sich purzelbaumschlagend über dessen Rücken schwingen und nach dem Sprung von einem anderen Akrobaten auffangen lassen. Vermutlich sind es Tänzer, die einen rituellen Tempeltanz für den auf Kreta verehrten Gottes-Stier aufführen.
Die kretische Freskenkunst ist auf der Welt ohne Gegenbeispiel. In ihrer Blütezeit strahlte ihr naturalistischer Stil über das ganze östliche Mittelmeer aus. Bis nach Ägypten, bis in den Vorderen Orient.
Ihre Paläste errichteten die kretischen Herrscher dort, wo der Blick weit übers Meer oder über die offene Landstaft strich. Ihre Erbauer waren empfänglich für die Schönheit der Natur, was sich auch in ihren Fresken äußert.
Der Palast von Knossos, nahe der nördlichen Küste, umschloss einen Innenhof von 54 mal 27 Metern, und sein Gesamtkomplex bedeckte ein Areal von 13000 Quadratmetern. Ein Labyrinth von Hallen, Gängen, Zimmerfluchten, Vorratsräumen und mehreren kleinen Innenhöfen, dazwischen eine Kapelle, die Quartiere des Herrschers und seiner Gemahlin, die über ein eigenes Badezimmer verfügte, alles über zwei Stockwerke mit ansteigenden und fallenden Treppen verbunden, durchzogen von einem ausgeklügelten Wasserableitungssystem, das den Palast gegen plötzliche Regenstürze absicherte. Ein unkundiger Besucher fand allein kaum aus diesem Labyrinth heraus.
So entstand wohl die Sage vom Labyrinth des Minotauros, dem gewaltigen Stiergott, dessen Abbild, der Herrscher von Knossos, inmitten eines von verwirrenden Irrwegen durchkreuzten Palastes residierte.
Merkwürdig, dass auf Kreta alle monumentalen Festungsbauten fehlen. Steile Mauern, Wehrtürme, massive Torbefestigungen. Solche Bauten prägen |10|das Bild der umliegenden Kulturen, sei es in Ägypten oder im Zweistromland, auf Kreta sieht man sie nirgends.
Altertumswissenschaftler rätseln, warum das so ist. Fühlten sich die Kreter auf ihrer Insel so sicher, dass sie glaubten, auf mauerbewehrte Paläste und Städte verzichten zu können? Bis heute gibt es keine sichere Antwort auf diese Frage. Zumindest aber musste Kreta keine überseeischen Feinde fürchten. Ägypten war keine Seemacht. Allein schon die Holzarmut im Niltal verhinderte den Ausbau einer hochseetauglichen Kriegsflotte. Und die phönizischen Städte an der Küste des heutigen Libanon schufen erst nach dem Niedergang der kretischen Palastkultur ihre Handels- und Kriegsmarine. Also lag Kreta wie eine natürliche Festung mitten im Meer, sicher vor auswärtigen Feinden.
Die Siedlungsgeschichte Kretas reicht zurück bis in die Steinzeit. Auf zerbrechlichen und einfachen Fahrzeugen hatten Menschen immer wieder im Lauf der Jahrtausende die Insel erreicht, hatten dort in den Ebenen und auf den Hügeln gesiedelt.
Die kretische Palastkultur jedoch geht auf eine Einwanderungswelle zurück, die erst am Ende der Steinzeit, im Übergang zur Bronzezeit, die Insel in Beschlag nahm. Ungefähr um das Jahr 3000 vor unserer Zeit. Sie waren wahrscheinlich schon mit seetüchtigen Schiffen übers Meer gekommen. Womöglich brachten die Neuankömmlinge auch die ersten Haustiere mit auf die Insel und führten die Landwirtschaft in Kreta ein. Die Eroberer legten Siedungen an, betrieben Ackerbau und Viehzucht. Doch sie blieben dem Meer treu, das sie hierher getragen hatte. Die Neukreter schufen die erste maritime Macht des Mittelmeeres. Die Wissenschaft nennt sie die »Minoer« nach ihrem sagenhaften König Minos. Dass es diesen König Minos wirklich gab, ist eher unwahrscheinlich. Die ägyptischen Hieroglyphen nannten die kretischen Handelsleute die »Keftiu«. Wie sie sich selbst bezeichneten, wissen wir nicht, denn die Minoer hinterließen uns kein literarisches Vermächtnis. Wohl hatten sie schreiben gelernt. Doch ihre Schriftzeichen konnte bislang niemand entziffern. Es scheint auch, dass sie ihre Fertigkeit zu schreiben nur benutzten, um Inventarlisten von Verbrauchsgütern anzufertigen. Und so kennen wir keinen einzigen Menschen der minoischen Zeit mit Namen, der jener versunkenen Kultur ein persönliches Gesicht geben könnte.
Das Ende der kretischen Kultur kam um das Jahr 1400. Die bunten Paläste brannten aus. Nie wieder in den nachfolgenden Jahrtausenden brachte Kreta |11|seine Stimme in das Konzert der großen Kulturen ein. Altertumsforscher suchen zu verstehen, was den Höhenflug der minoischen Kultur so plötzlich beendete. Doch ihr Niedergang bleibt ein Rätsel.
Eine griechische Sage erinnert mit Daidalos und Ikaros an zwei Kreter. Daidalos, dessen Name »der kunstfertige Mann« bedeutet, soll für König Minos das ausweglose Labyrinth entworfen und erbaut haben. Die Legenden schildern ihn als technisches Universalgenie. Er erfand so praktische Gebrauchsgegenstände wie Säge und Axt, Bohrer, Holzleim und das Bleilot, die antike Wasserwaage, war zudem ein begabter Bildhauer. Für sich und seinen Sohn Ikaros soll er Flügel aus Wachs und echten Federn angefertigt haben. Ikaros flog von Kreta aus der Sonne entgegen, kam ihrer Glut zu nahe und stürzte ins Meer.
Enthält Ikaros’ Geschichte eine ferne Erinnerung an jene rätselhafte Katastrophe, die den Höhenflug der minoischen Kultur so jäh beendete? Es wäre gut möglich. Doch das minoische leichtbeschwingte Kreta, das unsere Augen gefangen nimmt, bleibt stumm. Auch die Griechen wussten nur wenig von der kretischen Palastzeit, deren Blüte fast tausend Jahre vor ihnen auf der Insel im Süden stattgefunden hatte. Herodot, einer ihrer frühesten Geschichtsschreiber (um 700), stellte jedoch zumindest fest, dass »ganz Kreta vor Zeiten von Nicht-Griechen bewohnt« war. Die Inventarlisten der Palastverwaltung belegen, dass die Minoer kein Griechisch sprachen, denn ihr Vokabular lässt sich bis heute keiner der uns bekannten Sprachen zuordnen.
Dennoch erscheint uns die Kultur der Minoer so typisch griechisch, weil die Griechen in vielfacher Hinsicht Kretas Kultur beerbten. Griechische Stämme kamen nach und nach vom Festland herüber und ließen sich auf der Insel nieder. Auf dem Festland machten sich etwa zu der Zeit, als Kretas Stern zu sinken begann, griechische Städte bereit, das minoische Erbe anzutreten. Besonders Mykene im nördlichen Peloponnes.
Mykene. Die prächtigen ersten Griechen
Noch Pausanias, der als Geograf und Schriftsteller das antike Griechenland bereiste, beschreibt in seinem Reiseführer aus dem 2. Jahrhundert unserer Zeit Mykenes Mauern und vor allem das Löwentor. »Über ihm stehen zwei Löwen und diese Mauern sollen das Werk von Kyklopen sein. In den Trümmern |12|von Mykenai befinden sich die unterirdischen Räume des Königs Atreus und seiner Söhne, in denen sich ihre Schätze befanden.« Ein Jahrtausend vor Pausanias nennt Homer Mykene die »weitgebaute«, die »golderfüllte« Stadt.
Solche und ähnliche Hinweise brachten im 19. Jahrhundert den deutschen Kaufmann Heinrich Schliemann auf die Spur der verschollenen Kultur. Der Bewunderer Griechenlands reiste 1874 nach Mykene, warb Arbeitskräfte an und begann mit Grabungen. Die Fachwelt belächelte Schliemann. Für die Gelehrten war Homer ein Märchenerzähler, dessen Schilderungen einer frühen griechischen Gesellschaft und eines »golderfüllten« Mykenes ein Produkt dichterischer Phantasie. Doch Schliemann ließ sich nicht beirren. Seine Helfer gruben sich durch den Schutt der Jahrtausende, und dann »stieß etwa 6 Meter tief die Hacke auf den Grund. Auf dem Grunde aber lagen in fünf Gräbern an 15 Leichen, angetan mit einem überreichen, man darf sagen fabelhaften Goldschmucke«, heißt es in Schliemanns Erinnerungen. »Dass dies die Gräber einer Herrscherfamilie waren, daran konnte der Glanz ihrer Ausstattung keinen Augenblick einen Zweifel lassen.«
Die kostbaren Grabbeigaben stammten von überall her. Blauer Lapislazuli und Elfenbein aus dem Nahen Osten, Silber aus Kleinasien, Trinkgefäße aus Straußeneiern hatten aus Ägypten und Äthiopien übers Meer den Weg nach Griechenland gefunden. Tausende von Bernsteinperlen aus Nordeuropa, Glasschmuck aus Kreta und unzählige weitere Gegenstände hatten die Mykener ihren Herrschern auf dem Weg ins Jenseits mitgegeben: Trinkgefäße aus Edelmetall, eine kostbare, aus Bergkristall geschnittene Opferschale, Ketten mit kunstvollen Anhängern, Diademe und Kronen, dünn gehämmertes Goldblech in Gestalt von Schmetterlingen, Sternen, Tintenfischen, Blättern und Blüten, Armreifen aus massivem Gold, Gürtelschnallen – die Menschen in den Gräbern waren buchstäblich in Gold gekleidet. »Goldene Masken, welche die Züge der Verstorbenen nachbildeten, lagen über dem Antlitz der Männer, goldene Platten, reich mit Spiralen verziert, deckten die Brust. Aber damit, dass sie den Leichen das stolzeste Prachtgewand anlegten, ließen es die Hinterbliebenen nicht genug sein. Man gab dem König auch mit, was er dort drüben zum künftigen Leben nötig hatte: Kostbare Salben und Öl enthielten die irdenen, bronzenen, silbernen Krüge, silberne und goldene Becher, sein goldumsponnenes Szepter, seine kunstvoll mit Gold und Silber eingelegten Schwerter an goldenen Wehrgehängen geleiteten den Herrscher ins Grab.« Und in der Auffüllung über den |13|Grabschächten lagen die Leichen geopferter Menschen und Tiere, um die Geister der Toten zu versöhnen.
Die Schreibtischgelehrten konnten sich auf Schliemanns Funde keinen Vers machen. Sie mutmaßten, der goldene Überfluss stamme aus den Perserkriegen, also aus der Zeit um 500, als die Perser in Griechenland eindrangen. Ein zeitgenössischer Historiker urteilte: »Höchst lächerlich war die Verlegenheit der heutigen Gelehrsamkeit, als diese wirklichen Reste von Menschen aus mythischer Zeit zum Vorschein kamen.« Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass bereits lange vor dem klassischen Griechenland eine hoch entwickelte, märchenhaft reiche griechische Kultur existiert haben könnte. Schliemann dagegen war überzeugt, die Gräber jener Könige, von denen einst Homer erzählte, wiedergefunden zu haben. Und der Griechenland-Enthusiast kam der Wahrheit tatsächlich sehr nahe.
Die Blütezeit der mykenischen Kultur datiert man heute auf die Zeit zwischen 1600 und 1200, und sie umfasste ganz Griechenland. Mykenische Zentren befanden sich auch in Tiryns, südlich von Mykene, in Pylos, im südwestlichen Peloponnes, in Theben, einer Stadt in Mittelgriechenland, und auf dem Burgfelsen von Athen, seiner Akropolis.
Schliemann hatte Homers Epen als Geschichtsbuch der Griechen wieder zu Ehren gebracht.
Den letzten Beweis, dass die Mykener die Griechen waren, über die Homer schreibt, lieferte die Entschlüsselung der mykenischen Schrift. Sie lehnt sich an die noch unentzifferte kretische Schrift an. Diese nennt man das »Linear A«. In der Linearschrift bezeichnen Strichzeichen, senkrechte, waagerechte, schräg geritzte »Linien«, die Laute oder Silben eines Schriftkörpers. Die mykenische Schrift nennt man »Linear B«. Beide, die kretische wie die mykenische Schrift, sind auf kleinen hartgebrannten Tontäfelchen erhalten. Britische Sprachforscher entschlüsselten 1952 die Linearschrift B. Die bis dahin rätselhaften Zeichen erwiesen sich als Aufzeichnungen in griechischer Sprache.
Mit etwas Phantasie erkennen wir in dem mykenischen Wortschatz Vokabeln, die auch uns vertraut sind. Mate-re und pa-te sind »Mutter« und »Vater«, ne-wa bedeutet »neu«, do-se die »Dose« oder »Gabe«, min-ta die »Minze«, wa-ka der »Wagen«. Te-ke ist die »Theke«, da-mo, das »Dorf«, ist in unserem Wort »Demokratie« enthalten, a-ne-mo, der »Wind«, finden wir in unserer »Anemone«, dem Windröschen, wieder. Auch mehrere uns geläufige Personennamen gehen auf mykenische Namensgebungen zurück. Zum Beispiel |14|Alexandra, Daidalon oder Hektor. Dazu Länder- und Ortsnamen wie Knossos, Kreta, Korinth, Phönizien, Zypern. Schließlich sind die meisten griechischen Götternamen bereits in der Linearschrift B vorhanden. An ihrer Spitze der des »erderschütternden« Poseidon.
Neben dem Chinesischen ist das Griechische die einzige Sprache, die ununterbrochen seit Jahrtausenden bis heute gesprochen wird. Die griechische Sprache ist ein Zweig der indoeuropäischen Sprachfamilie, der die meisten westlichen Sprachen angehören. Ihr Ausgangspunkt ist das ur-indoeuropäische Spracherbe. Die Mehrzahl der Sprachforscher siedeln die indoeuropäischen Völkerschaften um das 5. bis 3. Jahrtausend in den südrussischen Steppen an.
Indoeuropäer kamen auf ihren Wanderungen bis nach Indien, bis in den Iran, nach Kleinasien und Westeuropa. Sie bewegten sich als Vieh-Nomaden von einem Aufenthalt zum anderen. Nicht weil sie Länder erobern wollten, sondern um jeweils den nächsten Weideplatz für ihre Kühe, Ziegen und Schafe zu finden.
Die griechische Sprachgruppe erreichte um das Jahr 2000 den südlichen Ausläufer der Balkan-Halbinsel, das heutige Griechenland. So sieht es die Mehrzahl der Historiker.
Andere verlegen die Ankunft der archaischen Indoeuropäer schon in das Jahr 7000 vor unserer Zeit. In Griechenland hätten sich die Einwanderer mit den eingeborenen Jägervölkern genetisch vermischt. Und daraus seien die griechisch sprechenden Mykener hervorgegangen.
Unbestritten stellt die mykenische Kultur einen Einschnitt in der Siedlungsgeschichte Griechenlands dar. Einen Neubeginn. Die Mykener waren die erste Kriegerkultur auf griechischem Boden. In einer Grablegung fanden sich beispielsweise 90 Schwerter. Hieb- und Stichwaffen waren, anders als bei den Kretern, die liebsten Prunkstücke mykenischer Herrscher. Ihre Wandmalereien, die allerdings wenig gut erhalten sind, preisen den mörderischen Kampf und die Tierhatz. So realistisch wie die späteren homerischen Epen. Auch die Erstürmung von Siedlungen, Wagenkämpfe und Wagenrennen werden ständig auf Vasen und Grabstelen dargestellt. Ein unwiderleglicher Beweis, in welch hohen Ehren das Kriegshandwerk bei den Mykenern, den ersten Griechen, stand.
Die indoeuropäischen Steppenvölker erfanden das Rad ein zweites Mal. Aus den runden Vollholzscheiben entwickelten sie das leichte Speichenrad. |15|Das erforderte viel Geschick bei der Holzverarbeitung, eine technische Spitzenleistung. Und sie nahmen das Pferd in ihren Dienst, das man bislang nur als Fleischlieferant kannte. Pferd und Wagen vergrößerten den Aktionsradius der Steppenvölker. Aus nomadisierenden Viehtreibern wurden Wagennomaden.
Die Minoer Kretas, deren Kultur zu dieser Zeit ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte, suchten den Interessenausgleich mit den benachbarten griechischen Neuankömmlingen. Griechische Handwerker arbeiteten auf Kreta und die kretischen Handwerker waren den Mykenern hochwillkommen. Von ihnen lernten die Griechen die Kunst des Schiffbaus. Auch sonst war man auf Zusammenarbeit angewiesen. Seit die Mykener sich im späteren Athen mit einer Befestigungsanlage auf der Akropolis festgesetzt hatten, befanden sich die erzreichen Laureion-Berge, südlich der Stadt, in deren Hand. Seit Jahrhunderten wurden dort Silber, Kupfer und Blei gefördert. Und darauf war Kreta angewiesen, denn die Insel war arm an Metallvorkommen.
Umgekehrt besaßen die athenischen Mykener keinerlei Kenntnisse in den komplizierten Bergbautechniken. Also arrangierte man sich.
Kurzum, ich stelle mir vor, dass beide Kulturen voneinander profitierten. Wenn auch jede ihre Eigenart bewahrte. Die mykenischen Palastanlagen sind gewiss mit Hilfe kretischer Architekten entstanden. Doch die Paläste von Pylos oder Mykene sind keine Kopien der kretischen Anlagen. Auch die mykenischen Fresken sind zwar inspiriert von der kretischen Wandmalerei. Sie setzen jedoch formal und inhaltlich verschiedene Akzente.
Eventuell haben die Mykener von Kreta den Straßenbau gelernt. Doch sie passten die Straßen ihren Wagen an. Den schnellen zweiräderigen Speichenwagen. Straßen der mykenischen Zeit sind in der Nachbarschaft der Städte von Mykene und Pylos aufgefunden worden, auch in Mittel- und Nordgriechenland. Einige weisen eine Durchschnittsbreite von drei Metern auf, Brücken und Entwässerungssysteme machten sie selbst zu Regenzeiten passierbar. Der mykenische Adel liebte es offenbar, mit Wagen übers Land zu fahren. Ein Fresko aus Tiryns, südlich von Mykene, zeigt sogar zwei Damen auf einer Spazierfahrt durch die Landschaft. Die herrschaftlichen Frauen stehen, purpurrote Zügel in den Händen, in einem karminroten Wagenkorb, die Vierspeichenräder sind gelb bemalt.
Ob die Mykener schon Wagenrennen veranstaltet hatten? Diese haben Griechenlands Geschichte bis tief in die christlich-byzantinische Zeit begleitet|16|. Auf mykenischen Vasenbildern glaubt man Hinweise auf Wagenrennen zu finden. Und auf ein spontan angesetztes Rennen sollen ursprünglich die späteren Olympischen Spiele (seit 776) zurückzuführen sein.
Zwei Jahrhunderte länger währte die mykenische Kultur. Ihre Herrscher kontrollierten jetzt das östliche Mittelmeer. Noch Homer wusste davon. In seiner Ilias stellt Mykene das größte Schiffskontingent, als die griechischen Städte vereint nach Troja aufbrechen.
Zwischen 1984 und 1994 unserer Zeit bargen Unterwasser-Archäologen ein antikes Schiffswrack vor der südwestlichen türkischen Küste. Vor dem Kap Uluburun. Ungefähr um das Jahr 1300 war das Schiff dort mitsamt seiner Ladung versunken. Vielleicht bei einem Unwetter. Das 15 Meter lange Frachtschiff hatte sich in 50 Meter Tiefe auf den Meeresboden gesenkt. In riskanten und langwierigen Manövern bargen die Archäologen seine 20 Tonnen schwere Ladung. Die Funde gewähren einen einzigartigen Einblick in den Handelsverkehr der Ägäis zu mykenischer Zeit.
Das Uluburun-Schiff hatte Waren aus aller Welt geladen. Aus dem Zweistromland, dem Iran, aus Zypern, Ägypten und Mykene. 10 Tonnen seiner Fracht machten Kupferbarren aus, 40 Zinn-Barren wurden geborgen. Beide Metalle wurden zur Bronzeherstellung benötigt, dem Leitmetall jener Zeit, die noch keinen Eisengebrauch kannte. An weiteren Rohmaterialen hatte das Schiff afrikanisches Ebenholz, Elefanten- und Nilpferdzähne an Bord genommen, 3 Tonnen farbiges Rohglas, 150 Krüge mit Grundsubstanzen zur Salben- und Parfumherstellung. Außerdem enthielt die Fracht eine Menge luxuriöser Fertigwaren. Rasiermesser, elegante mykenische Keramik, goldene Anhänger, Armbänder, Tausende bunte Perlen aus Glas, Bernstein, Achat, Karneol, dazu verschiedene Kosmetika. Und natürlich tauchten auch Werkzeuge alle Art auf. Bronzene Bohrer, Meißel, Äxte, eine Säge, Harpunen und außerdem ein kleines Waffenarsenal, Speer- und Pfeilspitzen, Schwerter, steinerne Keulenköpfe.
Zu den kulturhistorisch interessantesten Artefakten gehören zwei hölzerne Klapp-Schreibtafeln. Ihre Wachsbeschichtung, die Schriftzeichen waren abgetragen. Schade, die Aufzeichnungen hätten eventuell über die Herkunft und den Bestimmungsort des Uluburun-Schiffs Auskunft geben können. So ist man auf Vermutungen angewiesen.
War es ein phönizisches oder ein zyprisches oder ein ägyptisches Schiff, das vor der türkischen Küste havarierte? Oder war es vielleicht sogar ein |17|mykenisches Handelsschiff? Mit an Bord haben sich offenbar zwei mykenische Würdenträger befunden. So deuten die Archäologen zwei Löwen-Siegel, die sie als mykenisch identifizierten.
»In elf Jahren absolvierten wir 22413 Tauchgänge und verbrachten insgesamt 6 613 Arbeitsstunden mit Bergungsarbeiten am Wrack«, schreibt Cemal M. Pulak, einer der Mitarbeiter des Projekts. Eine Vielzahl der Funde präsentiert heute das Museum von Bodrun in einer eigens dem Uluburun-Schiff gewidmeten Dauer-Ausstellung. Bodrun liegt in unmittelbarer Nähe des Fundortes. Das »Unterwasser-Museum« ist ein 5-Sterne-Museum, im Wettbewerb der europäischen Museen erhielt es 1995 das Prädikat »Besonders Lobenswert«.
Ein Prunkstück der Präsentation ist ein goldenes Skarabäus-Siegel von Nofretete, deren Gemahl, Pharao Echnaton, von 1352 bis 1336 Ägypten regierte. Ihre weltbekannte Büste befindet sich im »Alten Museum« von Berlin und zieht jährlich Tausende Besucher an. Manche legen Blumen vor Nofretete nieder, eine Huldigung an die Schöne über den Abgrund von 3000 Jahren hinweg.
Nofretete war eventuell noch unter den Lebenden, als das Uluburun-Schiff zur letzten Fahrt seine Segel setzte. Und die Frage ist, wie so ein kostbares Siegel an Bord gelangte. Das ist bis heute ebenso wenig geklärt wie die mit zwei Siegeln bezeugte mykenische Präsenz auf dem Segler.
Doch der Unterwasserfund unterstreicht die Bedeutung Mykenes in der Spätbronzezeit. Schliemann und seine Nachfolger hatten die älteste griechische Kultur wieder ans Licht gebracht. Sie gaben Mykene den gebührenden Platz in der Weltgeschichte zurück.
Lichtlose Jahrhunderte
Um das Jahr 1200 fanden die mykenischen Städte ein plötzliches Ende. Doch nicht allein in Griechenland, rings um das östliche Mittelmeer gingen Städte in Flammen auf. Die Atlantis-Sage, die uns der griechische Philosoph Platon überliefert hat, spielt vielleicht auf jene großräumige Katastrophe an.
Danach überzogen die »Atlanter« damals »ganz Europa und Asien« mit Krieg. Sie unterwarfen sich die Völker »in Libyen bis Ägypten« und die Bewohner »Europas bis Tyrrhenien«, dem Etruskerland. Nur die Athener, »auf sich allein |18|angewiesen«, hielten den »übermütigen«, aggressiven Atlantern stand. So erzählt Platon unter Berufung auf Solon. Dieser war ein entfernter Verwandter von Platons und soll im 6. Jahrhundert die Atlantis-Sage aus Ägypten nach Athen gebracht haben.
Sind Platons Atlanter jene »Seevölker«, die ägyptische Inschriften erwähnen? Die »nördlichen Völker« taten sich zusammen, heißt es dort, und »sie legten ihre Hand auf den ganzen Erdkreis, siegesgewiss, voll Unternehmungslust«. Pharao Ramses III. rühmt sich, die Seevölker endlich bezwungen zu haben, die bis in das fruchtbare Nildelta mit seinen berühmten Städten eingedrungen waren. Den Sieg des Pharao verherrlicht sein Totentempel in Medinet Habu am Mittellauf des Nils. Ein Relief zeigt feindliche Kämpfer mit Federkronen und Hörnerhelmen, die gerade in einen Nilarm eindringen wollen. Glaubt man der ägyptischen Inschrift, hatten die Seevölker im Nildelta eine entscheidende Niederlage hinnehmen müssen. Nachdem sie zuvor ringsum die Länder ausgeraubt und gebrandschatzt hatten.
Dass die Mykener von den »Seevölkern« überrannt wurden, ist nur eine Vermutung. Aber es gibt keine alternative Erklärung. Die mykenische Kultur endet tatsächlich in einem Schwarzen Loch, soviel ist sicher. Und so sieht es auch die griechische Sage.
Agamemnon, König der Mykener, kehrt aus dem Trojanischen Krieg in seine Heimat zurück und findet dort ein schmähliches Ende. Odysseus muss endlose Prüfungen bestehen, bis seine Frau Penelope ihren Mann zurück hat: »Da versagten ihr das Herz und die Knie, weinend ging sie grad auf ihn zu und schlug ihre Arme fest um den Hals des Odysseus«, erzählt Homer. Odysseus hatte Glück, er hatte in der Göttin Athene eine Helferin in allen Nöten. Den meisten trojanischen Helden jedoch war keine glückliche Heimkehr beschieden.
Mit dem Trojanischen Krieg beginnen die »Dunklen Jahrhunderte«, die zwischen Mykene und der griechischen Klassik liegen. Den Begriff »Greek Dark Ages« haben Archäologen geprägt. Die Wortprägung hebt darauf ab, dass nach dem Untergang von Mykene die Bodenfunde in Griechenland nichts mehr zu bieten haben, was das Herz eines Archäologen höher schlagen ließe. Sie vermissen schön dekorierte Keramik, prunkvolle Grabbeigaben, nirgends treten neue Großbauten an die Stelle der eingeäscherten Paläste. Sogar bronzene Gebrauchsgegenstände werden Raritäten. Und nirgends stießen Archäologen in nachmykenischer Zeit auf schriftliche Hinterlassenschaften|19|. Die Schreiber waren mit den Dunklen Jahrhunderten arbeitslos geworden. Schließlich gab es nichts mehr zu verwalten und zu inventarisieren. Und gleichzeitig verloren die Künstler ihre Fertigkeiten, weil es keine fürstlichen Gönner mehr gab, die ihnen Aufträge erteilten.
Griechenland ist ein küstenreiches Land. Man rechnet 15000 Kilometer Küstenlänge für ganz Griechenland, seine Inseln mit einbegriffen, und davon entfallen etwa 4000 Kilometer aufs Festland. Das Meer ist von jedem Ort aus in einem Fußmarsch von ein, zwei Tagen zu erreichen. So war Griechenland vielleicht besonders den Seeräubern ausgeliefert. Ein spürbarer Rückgang der mykenischen wie der vorgriechischen Bevölkerung muss die Folge gewesen sein.
Die »Pelasger«, so nennen griechische Geschichtsschreiber die vorgriechische Bevölkerung, wohnten schon seit der Steinzeit auf dem Festland und den griechischen Inseln. Als Jäger und Sammler durchstreiften sie die Lande, wurden schließlich sesshaft und bearbeiteten den Boden mit der Hacke. Den mykenischen Zuwanderern, die sich zu ihren Herren aufwarfen, mussten die Pelasger sicher Frondienste leisten. Neben dem Getreideanbau kultivierten die Urbewohner auch den Ölbaum und die Weinrebe. So berichtet es Herodot. »Welche Sprache die Pelasger hatten, kann ich nicht genau sagen«, schreibt er weiter. »Wenn man nach den heutigen Pelasgern urteilen darf, haben sie eine nichtgriechische Sprache gesprochen.«
Die einheimische Bevölkerung Attikas und Athens rechnet Herodot ebenfalls zu den Pelasgern: »Mit dem Übergang zu den Griechen haben sie dann ihre Sprache gewechselt.« Die Ur-Athener waren also keine Griechen. Sie wurden Griechen, indem sie lernten, griechisch zu sprechen. Gewiss schon in mykenischer Zeit. Die Mykener waren an den Erzvorkommen des südlichen Attikas interessiert, an Kupfer, Silber und Blei, und so mag es zu engeren Kontakten zwischen ihnen und den Pelasgern Athens gekommen sein.
Griechen definieren sich nicht über »griechisches Blut«, sondern über ihre Sprache. Grieche ist, wer griechisch spricht. Und genetisch gesehen sind die Griechen ein Zusammenschluss verschiedener Völkerschaften. Die »Barbaren«, von denen sich die Griechen später so gern unterschieden und abhoben, waren für sie nicht die dem Blut nach, weil nicht verwandten, Fremden, sondern Menschen mit einem anderen, ungriechischen kulturellen Hintergrund.
Nach der Entvölkerung durch den Seevölkersturm sickerten vom Balkan |20|her noch andere griechisch sprechende Völkerschaften ins Land ein. Antike Historiker heben unter ihnen besonders die sogenannten »Dorer« hervor. »Die Dorer nahmen zusammen mit den Nachkommen von Herakles den Peloponnes in Besitz«, bemerkte der Historiker Thukydides. Die Dorer galten als die Vorfahren der Spartaner. Möglicherweise, weil sie erst so spät ins Land gekommen waren, hören sie am liebsten »Heldensagen und solche Geschichten, die sich in fernen Zeiten zutrugen«. Und die Dorer statteten sich mit einer ruhmreichen Vergangenheit aus, die auf Herakles, den ruhmreichsten Sagenhelden Griechenlands, zurückgriff. Wer weiß, vielleicht ein Werbetrick. Wenn schon die Athener sich rühmen konnten, »autochthon«, also einheimisch, dem griechischen Boden entsprossen zu sein, hatten die Spartaner keinen geringeren Ahnherrn vorzuweisen als Herakles. Den keulenschwingenden, mit einem Löwenfell bekleideten Heroen. Ihn verehrte ganz Griechenland.
An der Schwelle zum 10. Jahrhundert nehmen Archäologen erste Zeichen einer wirtschaftlichen Erholung der Region wahr. Die Zahl der Siedlungen wächst, Gräber sind reicher ausgestattet. Mehr Nahrung wird produziert. Eine besser ernährte Bevölkerung wächst, und eine wachsende Bevölkerung produziert wiederum mehr Nahrung. Eisen kommt in Gebrauch. Es ist überall zu finden, ein demokratisches Metall. Eisen macht durchschnittlich fünf Prozent der Erdkruste aus.
Dass Eisen in allen Kulturen erst so spät in Gebrauch kam, liegt daran, dass es schwieriger zu verhütten ist als Kupfer. Seine Verhüttung, das heißt die Ausschmelzung des Metalls aus dem Erz, verlangt einen präzisen Feuerungsprozess. Das Feuer muss mit einem starken Luftstrom gespeist werden, in einem Eisenerzofen, in dessen Inneren glühende Holzkohle das eisenhaltige Gestein völlig umgibt. Nach der Ausschmelze taugt das Eisen auch noch nicht viel. Es ist porös und muss intensiv gehämmert werden, damit sich die Metallpartikel zu einem konsistenten Werkstück vereinen. Seit dem Jahr 1500 vor unserer Zeit beherrschen die Schmiedemeister Kleinasiens diese schwierige Technik. Erst ein halbes Jahrtausend später findet man sie in Griechenland. Gewiss durch wandernde, hoch zu entlohnende Eisenschmiede aus dem Osten.
Dass man solche Spezialisten jetzt in Griechenland anwerben kann, ist ein weiterer Hinweis auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation. In Lefandi, auf der langgestreckten, großen Insel Euboia, nördlich von Attika, |21|wurden unter anderen kostbaren Grabbeigaben einer adeligen Frau eiserne Gewandnadeln sowie eine Eisenklinge an einem Elfenbeingriff gefunden.
Eiserne Gebrauchsgegenstände lassen sich in der frühen Eisenzeit kaum mit Gold aufwiegen. Nicht weil es an Eisenvorkommen fehlte, sondern weil Eisenschmiede Seltenheitswert besaßen.
Das Vorkommen von Eisenerzeugnissen in einem griechischen Grab zeigt, wie man jetzt in Griechenland dabei ist, Anschluss an die östlichen Hochkulturen zu gewinnen.
Auch die anderen Grabbeigaben aus Lefandi offenbaren, dass sich wieder eine adelige Oberschicht installiert hatte. Goldene Haarspiralen, Ohrringe, ein Anhänger mit einem fein granulierten Kreis- und Sternenmuster, eine Halskette mit Fayence-Perlen, zwei Brustscheiben mit spiralförmigem Dessin fanden sich bei der Leiche. Ganz gewiss war die Unbekannte eine hochstehende Dame.
Adelstitel, wie sie im späteren christlichen Europa durch König oder Kaiser verliehen wurden, gab es in Griechenland nicht. Zum Aristokraten wurde man vielmehr auf Grund von erworbener und ererbter Tüchtigkeit.
Die Devise des griechischen Adels heißt: »Immer der Erste sein und unter allen der Beste.« Der Erste als Vorkämpfer in der Schlachtordnung, der Beste im sportlichen Wettkampf. Das will trainiert sein. Also hat der Adelige auch adelige Eltern, die sich um seine Ausbildung kümmern. Und adelig ist, wer seinen Stammbaum zurück bis zu einem der homerischen Helden verfolgen kann. Griechische Adelige können ihre Abstammung möglicherweise sogar an einem der Götter oder Heroen festmachen. Mythischer Glanz fällt auf die Aristokraten.
Diese soziale Elite nannte sich die »Schönen und Guten« (kaloi kagathoi) und ihre Herrschaft eine »Aristokratie« (»Führung durch die Besten«). Im späteren Athen hießen sie auch die »Eupatriden« (»hochwohlgeborene Nachkommen edler Eltern«). Die griechischen Eliten rekrutierten sich aus den Adelshäusern der Mykener, andere hatten es in den »Dark Ages« durch Seeräuberei zu Ruhm und Reichtum gebracht, wieder andere, indem sie priesterliche Ämter für sich monopolisierten.
In den »Dark Ages« hatte es wohl keine reisenden Sänger und Poeten mehr gegeben. Denn sie lebten von der Gunst der Fürsten und deren Sitze waren verwaist. Gewiss schon in mykenischer Zeit hatten Poeten die Helden besungen, den Gastgeber und dessen ruhmreiche Ahnen und wurden dafür |22|reichlich belohnt. »Denn bei allen Menschen auf Erden genießen die Sänger Ehre und Ehrfurcht, lehrt doch die göttliche Muse die Sänger den hohen Gesang, und lieb ist der Muse die Kunst der Poeten«, sagt Homer.
Als Entstehungszeit seiner Epen setzt man das Jahr 700 an. Das Ende der Dunklen Jahrhunderte. Der Dichter Homer greift allerdings auf eine umfangreiche Epenproduktion zurück, die lange schon vor ihm entstand. Irgendwann in den »Dark Ages« bildeten sich neue Siedlungen, Leben kehrte zurück in die Städte, die Gesellschaft fächerte sich auf. Künstler und Handwerker fanden bei neuen Herrschaften wieder ins Brot.
Griechenland am Ende der Dunklen Jahrhunderte ist eine Kultur noch ganz ohne Schrift. Noch immer sind es, neben den Mythen, allein die Bodenfunde, die zu uns sprechen, besonders die Überbleibsel der Keramikindustrie. Tiefer liegende Bodenschichten haben sie massenweise konserviert. Das ist nicht verwunderlich. Denn erstens überdauert hartgebrannte Keramik Jahrtausende. Zum anderen war die Keramikindustrie eine der Schlüsselindustrien der Antike. Sie stillte den unerschöpflichen Bedarf an Gegenständen des täglichen Haushalts. Tausende und Abertausende von Töpferscheiben drehten sich, um keramische Gebrauchsgüter zu produzieren. Teller und Tassen, Kannen und Krüge, Schalen und Schüsseln, dazu Vorratsbehälter für Milch und Molkereiprodukte, für Öl und Oliven, Bier und Wein. Man benötigte sie im Haushalt ebenso wie in der Palast- und Tempelwirtschaft. In riesigen Stückzahlen. Den Töpfer konnte keine antike Wirtschaft entbehren.
Irgendwann gingen die Töpferwaren zu Bruch und landeten beispielsweise als Füllmaterial auf Wegen und Straßen. Heute kommen sie bei Ausgrabungen wieder zum Vorschein. Und unter den Händen von Restaurateuren entsteht aus dem keramischen Abfall wieder das eine oder andere Gefäß, das wir in den Museumsvitrinen bewundern können.
In der Mitte und gegen Ende der »Dark Ages« übernehmen griechische Töpfer die Dekoration und das Design ihrer Ware zunehmend von östlichen Vorbildern. Sie schmücken Trinkgefäße und Schalen mit Fabeltieren, mit Sphinxen und Greifen, mit stilisierten Lotosblüten und Palmblättern, die der östlichen Keramikproduktion nachempfunden sind. Auch Siegel, kleine Bronzereliefs lassen orientalische Einflüsse erkennen, und ebenso erinnern die szenischen Darstellungen der Vasenmaler stark an östliches Design. Die Geschichtswissenschaft spricht geradezu von einer »Orientalischen Revolution«, die während der Dunklen Jahrhunderte in Griechenland stattfand. Es |23|war dieser Kulturtransfer, der den Anstoß zu den späteren Hochleistungen gab.
Daneben hatte Griechenland jedoch noch einen weiteren Vorteil: Gegenüber anderen Kulturen ist es durch seine geografische Situation begünstigt.
Zuerst und vor allem ist Griechenland eine maritime Kultur. Seine Küsten bieten überreichlich Ankerplätze und natürliche Hafenbuchten. Die alten Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens sind Stadt-Land-Flusskulturen. Ihre räumliche Weitläufigkeit erschwert den schnellen Informationsaustausch. Darin ist das maritime Griechenland den Altkulturen überlegen. Von Segeln und Rudern bewegte Schiffe sind schneller und haben einen weiteren Aktionsradius als Menschen- oder Pferdefüße. Zweitens bietet das zerklüftete, kleinräumige griechische Festland zwar ein fast unüberwindliches Hindernis zur Etablierung großflächiger, zentral gelenkter Staaten, dafür finden sich viele Nischen für eigenständige Stadt- und Kleinstaaten. Das begünstigt eine differenzierte Entwicklung regionaler Kulturkerne, die miteinander konkurrieren. Ganz anders verhält es sich bei den riesigen Flächenstaaten des Ostens. Und ganz anders liegen auch die Verhältnisse in Ägyptens langgezogener Flussoase. Hier konnten und mussten sich zentralisierende Herrschaftsstrukturen herausbilden, sonst wären solche Großräume gar nicht regierbar gewesen.
Passte es einem Griechen nicht in seiner Heimatstadt, konnte er notfalls ausweichen. In eine der anderen vielhundert selbstregierten Stadtgemeinden. Oder er konnte mit Gleichgesinnten irgendwo in der Ferne ein neues Gemeinwesen gründen. Ein Ägypter jedoch oder ein Bewohner des Zweistromlands war ein Gefangener seines zentral regierten Landes. Wohl oder übel musste er sich damit abfinden, »in einem Staat von Untertanen und Unterdrückern zu leben«, wie der Philosoph Aristoteles es ausdrückt.
Unter diesen Voraussetzungen lässt sich für die folgenden Jahrhunderte in der Tat Großes von Griechenland erwarten.
|24|Geburt des »klassischen« Griechenlands
Die Vordenker der griechischen Wissensexplosion
Nach den Verheerungen, die die eingefallenen Seevölker im griechischen Raum hinterlassen hatten, waren die Menschen zunächst gezwungen, sich ums nackte Überleben zu kümmern, so stellte es sich Aristoteles einige Jahrhunderte später vor. Als es ihnen dann wieder besser ging, gönnten sie sich die Annehmlichkeiten des Lebens. Sie erfanden Künste, um ihr Leben zu verschönern, lernten wieder Feste zu feiern und zu musizieren. Zuletzt, nachdem ihre dringendsten Bedürfnisse gestillt waren, wandten sie sich der freien Wissenschaft, der Philosophie zu.
Aristoteles hatte Recht. Genau nach diesem Schema verlief der ökonomische und kulturelle Wiederaufstieg Griechenlands.
Ein Beispiel dafür ist die alte Handelsstadt Milet. Sie liegt an der Westküste Kleinasiens und zählte, zusammen mit der vorgelagerten Inselkette, zu Großgriechenland. Schon die Minoer unterhielten in Milet wegen seiner guten Naturhäfen eine wichtige Handelsniederlassung. »Milet wurde zuerst von den Kretern jenseits des Meeres gegründet und von einem Bruder des Minos besiedelt«, weiß ein antiker Geograf zu berichten. Kretische Schrifttäfelchen, die man in Milet fand, bestätigen das. Die minoische Handelsniederlassung stieg zu einem wichtigen Umschlagsplatz auf, der das metallarme Kreta mit den reichen Metallvorkommen Kleinasiens verband.
Nach dem Erlöschen der minoischen Kultur wurden die Mykener in Milet ansässig. Zahlreiche mykenische Keramikfunde belegen das. War das bei Uluburun havarierte Frachtschiff unterwegs nach Milet? Das ist anzunehmen. Die Stadt war mittlerweile ein pulsierendes griechisches Handelszentrum. Spätere Texte bezeichnen Milet als »Hauptstadt« der Ägäis. Sie konnte sich offenbar zunächst des Ansturms der Seevölker erwehren, versank dann aber, wie so viele Städte des östlichen Mittelmeeres, um 1100 in Schutt und Asche.
Die Keramikfunde der Folgezeit ähneln denen Athens. Dazu passt die |25|mythische Überlieferung, nach der Neleus, der Sohn eines Athenerkönigs, Milet wieder neu gegründet haben soll. Der Vorfahre von Neleus war ein Mann namens Ion. Nach ihm nennen sich die Athener und die Griechen der kleinasiatischen Küste die »Ionier«.
Homer erfindet die griechische Nation
Griechenland ist eine Erfindung Homers. Anders gesagt, ohne Homer hätte es kein »griechisches Wunder« gegeben.
Die fast zeitgleichen Etrusker Italiens sind im Treibsand der Geschichte verschwunden. Obwohl auch sie sich in einer vorteilhaften geografischen Situation befanden. Und Etrurien war noch dazu, anders als Griechenland, reich mit Bodenschätzen gesegnet. Auch verdanken die Etrusker, genau wie die Griechen, viel dem Einfluss der östlichen Hochkulturen. Doch die Etrusker traten von der Bühne der Weltgeschichte ab. Kaum dass den späteren Jahrhunderten noch eine Erinnerung an sie blieb. Erst die Archäologen unserer Zeit entdeckten wieder ihr glänzendes Erbe.
Das hätte auch den Griechen passieren können. Wenn da nicht Homer gewesen wäre. Hätten nicht seine Epen die kulturelle Einheit Griechenlands erschaffen und dauerhaft befestigt. Griechenland ist tatsächlich eine Erfindung Homers.
Seine Werke, die beiden Ependichtungen der Ilias und der Odyssee, entstanden um 700, am Ende der Dunklen Jahrhunderte. Von da an tritt die Geschichte Griechenlands langsam in helleres Licht.
Der Dichter lebte an der Grenze zweier Zeitalter. Während sein Werk schon im hellen Licht der Geschichte steht, bleibt seine Person für uns völlig im Dunkeln.
Natürlich umranken sein Leben mannigfaltige Legenden. Einer genaueren Prüfung aber halten sie alle nicht Stand. Im 19. Jahrhundert unserer Zeit hat man sogar heftig darüber gestritten, ob man das homerische Werk überhaupt einem Einzelverfasser zuordnen dürfe. Vermutlich, so dachte man, hatten viele Hände das Werk zusammengefügt. Heute, nach zwei Jahrhunderten Homer-Forschung, ist man sich einig, dass Homer seine Dichtung mit uralten, verstreuten Epenstoffen angereichert hat.
Ein ganz normaler Vorgang, schließlich bringt kein Poet seine Verse aus |26|dem Nichts hervor. Den Kampf um Troja, die tragische Heimkehr der Helden, hatten vor ihm schon viele Wanderpoeten an Fürstenhöfen besungen. Homer greift auf seine Vorgänger zurück.
Doch sein Epos über den Trojanischen Krieg setzt neue Akzente. Es stilisiert die Brand- und Raubzüge des Seevölkersturms zu einem gesamtgriechischem Rachefeldzug. Sämtliche Völkerschaften Griechenlands lässt er vor Troja aufmarschieren, macht die Belagerung der Stadt zu einem vaterländischen Krieg, in dem es die Ehre aller Griechen zu verteidigen und zu behaupten gilt.
Paris, ein trojanischer Prinz, hat die schöne Griechenfrau Helena entführt, das löst den Krieg aus. Die Fürsten der Griechen, »alle mit Szeptern geschmückt«, versammeln sich zum Kampf, ihnen folgen ihre Völker, »gleichwie Schwärme von Bienen in dichtem Gewimmel sich nahen« – so schildert Homer den Aufmarsch der Griechen, die der gemeinsame Rachefeldzug zum ersten Mal als Nation vereint.
Doch so war es ganz sicher nicht. Einen vereinten Kampf aller Griechen gegen die Stadt am Hellespont in der heutigen Türkei hat es nie gegeben. Jedenfalls nicht in dieser Größenordnung, wie Homer das Unternehmen schildert, mit einer Armada von 12000 Schiffen und einer Streitmacht von 150000 Kriegern aus 164 Städten der Griechen. Troja als griechisches Nationalliga-Unternehmen fand nur im Kopf des Dichters statt.
Dennoch, die Ilias wurde zum Nationalepos aller Griechen, so wie die Mosesbücher der Israeliten die jüdische Nation begründeten. Anders aber als die Mosesbücher kommt Homers Dichtung in einem strahlenden poetischen Gewand daher. Das bewies den Griechen die göttliche Inspiration des Dichters und bekräftigte die Glaubwürdigkeit seiner Verse. An der Tatsache des Trojanischen Krieges haben die Griechen niemals gezweifelt. Der Kampf um Troja blieb für sie auf immer das Gründungsdatum ihrer gemeinsamen Geschichte.
Eine Hörbuch-Wiedergabe der Ilias dauert 17, die die der Odyssee 15 Stunden. Dabei tauchen die Hörer in eine wahre Bilderflut. Achilleus und sein Gefolge stürzen sich in den Kampf »wie Wölfe, gierig nach Fleisch und erfüllt von unverwüstlichen Kräften, die einen Hirsch mit starkem Geweih in den Bergen zerreißen und verschlingen, dass allen vom Blute sich röten die Kiefern, dann im Rudel zur dunkelfließenden Quelle getrieben, schlecken mit dünnen Zungen sie dort von des schwarzen Gewässers oberem Rand und speien das Blut des Mordes, und furchtlos bleibt ihr Herz in der Brust, |27|geschwollen sind allen die Bäuche«. Ein Bild folgt dem anderen. Steinschläge hört man zu Tale donnern, Quellen rauschen, Erdbeben lassen die Erde bersten, Krieger fallen »wie Blätter«, Blut, »rot wie Mohn«, entquillt den Wunden, wie ein »Waldbrand« gleißen die Waffen des heranrückenden Heeres. Homers Epen sind übervoll von solchen Bildern. Vereinzelt finden sich auch friedliche Landschaftsbilder. In seiner Odyssee beschreibt Homer eine Nymphengrotte mit den Versen: »Rund um die Grotte hin wuchs ein sprießendes Waldstück, Erlen und Pappeln, Zypressen verbreiteten köstliche Düfte, Vögel mit langen Schwingen erbauten sich dort ihre Nester: Eule und Habicht, Krähen des Meeres mit länglichen Zungen. Strotzend von Trauben umrankte dort die geräumige Grotte jung und veredelt der Weinstock. Schließlich flossen auch Quellen, vier an der Zahl, mit blinkendem Wasser daneben. Rundum blühten die Wiesen in Polstern von Dolden und Veilchen.« Doch solche beschaulichen Bildzitate sind selten. Im Paradiesgärtlein wohnen nicht Menschen, hier ist eine der unsterblichen Nymphen zu Hause.
In Homers Epen finde ich zwar nirgends eine Szene, die Lust an Grausamkeiten verriete. Doch Homers Krieger gehen mitleidlos zur Sache, jedes Mal, wenn er einen der zahllosen Zweikämpfe beschreibt. Eigentümlichkeiten seiner Sprache weisen darauf hin, dass Homer in Ionien zu Hause war. Möglicherweise sogar in der Nähe von Troja, das er in seiner Ilias besingt.
Das, was wir heute vorzugsweise Griechenland nennen, das griechische Festland also, stand in Homers Zeiten kulturell noch weit hinter den Ionieren Kleinasiens zurück. Der Dichter der Griechen hat vielleicht das griechische Festland nie betreten.
Wie dem auch sei, der Sänger kannte sein Publikum. Wusste, was seine adeligen Gönner von ihm erwarteten: Das ehrende Gedenken der Taten ihrer Heldenahnen. Jeder der griechischen Adeligen führte, selbst noch in klassischer Zeit, seine Vorfahrenlinie auf einen der Kriegshelden vor Troja zurück. Es wäre ja eine Schmach, nicht mit von der Partie gewesen zu sein! Hatten doch, wie es Homer darstellt, alle Fürsten Griechenlands, mitsamt ihrem Gefolge, 150000 Krieger, die Schiffe bestiegen, um die Ehre der Griechen vor Troja wiederherzustellen.
Der Kampf um Troja war eine Ehrensache, von Anfang bis zu Ende. Die Ilias schildert 51 Tage des zehnjährigen Ringens. Gerade mal sieben von mehr als 500 Wochen. Ein genialer Kunstgriff, und in der Beschränkung zeigt sich der Meister.
|28|Mit ihren 16000 Versen ist die Ilias ein wahrhaft voluminöses Wortpaket. Sie und die Odyssee waren ein Spiegel der ganzen Welt.
Da es strikt verboten war, den beiden Epen auch nur einen einzigen Vers hinzuzufügen, ist die Dichtung Homers fast im Originalzustand erhalten geblieben. Und weil beide bald nach ihrer Entstehung schriftlich vorlagen, konnten die griechischen Homer-Experten den Text genau kontrollieren. Wir wissen, dass sie das mit eifernder Sorgfalt taten. Der Meister hatte sich weise beschränkt und niemand sollte ihm später darein pfuschen.
Man hat dieses Verbot respektiert. Obwohl Homer viele Stoffe, die im Zusammenhang mit dem Trojanischen Krieg in der Öffentlichkeit zirkulierten, nicht in sein Werk aufgenommen hat. Zum Beispiel findet sich die berühmte Episode von dem »Trojanischen Pferd« nicht bei Homer. Der Dichter übergeht auch den Aufbruch der Schiffsarmada nach Troja: die Geschichte von Agamemnon, der seine Tochter Iphigenie den Göttern opfert, damit die Himmel den Schiffen günstige Winde schicken. Und die Ilias macht von Anfang an klar, dass Zeus den Untergang von Troja unabwendbar beschlossen hat. Homer allerdings schildert das Kriegsende nicht. Auch der Tod des strahlenden Achilleus ist eine ausgemachte Sache, doch das Ende des Vorkämpfers aller Griechen ging nicht in die Ilias ein. Das alles sind erstaunliche Beschränkungen, die sich der Dichter auferlegte. Und darin beweist sich sein Genie. Hätte es Homer nicht als Person gegeben, hätte stattdessen ein anonymer Redaktionsstab die Texte zusammengefügt, würden die Redakteure kaum der Versuchung widerstanden haben, den Stoff ständig weiter aufzufüllen. Das geschah nicht.
Homer legte das geistige Fundament der Griechen. Sie wussten das. Philopator, ägyptischer König in der Nachfolge Alexanders des Großen, errichtete dem Dichter ein Heiligtum, das »Homereion«. In der Mitte des Tempels thronte Homer, umgeben in einem Halbkreis von den Statuen der sechs Städte, die darauf Anspruch erhoben, der Geburtsort des Dichters zu sein. Strabon, ein renommierter antiker Geograf, schreibt um die Zeitenwende: »Homer überragt alle Menschen des Altertums wie der Gegenwart. Nicht allein wegen seiner unübertrefflichen Dichtkunst, sondern auch wegen seiner umfassenden Kenntnisse auf allen Lebensgebieten.« Für einen antiken Homer-Kommentator sind alle Leser Homers »Priester und Tempelwächter seiner göttlichen Worte«. Homer ist der »göttliche« Homer.
Das Lob trägt der Tatsache Rechnung, dass es für sein Genie keine Erklärung |29|gibt, die Homers Wirkung gerecht würde. Hippokrates, der Mediziner, Sokrates, der Stadtphilosoph, Alexander, der Eroberer, tragen große Namen. Doch keiner hätte sich mit Homer messen wollen. Im Gegenteil, sie alle beriefen sich auf ihn, waren sein Kinder. Homers Kinder wurden alle Griechen.
Milet: Licht aus dem Osten
Hoch zu Ross, in Ochsenkarren und zu Fuß waren die Griechen einst ins Land gekommen. An seinen buchten- und hafenreichen Küsten wurde aus ihnen ein Seefahrervolk. Sie durchkreuzten das östliche wie das westliche Mittelmeer, segelten durch die Meerenge der Dardanellen, schwärmten aus ins Schwarze Meer. An allen Küsten nahmen sie Land, gründeten Handelsniederlassungen und Städte und warfen sich, dank ihrer technischen und militärischen Überlegenheit, zu Herren der einheimischen Völker auf.
Die Erde ist riesig, lesen wir bei Platon, wir bewohnen nur ihren kleinsten Teil: »Wir sitzen wie Ameisen oder Frösche um einen Teich«, den wir das Meer nennen. Währen der Dunklen Jahrhunderte war der Horizont noch eng gewesen. Er umschloss gerade mal Haus und Hof, Berg und Tal, die nächsten Nachbarsiedlungen, unten am Meer die Buchten und ein paar Städte in der Ferne. Jetzt, im 7. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, weitet sich der Blick. Bis zu den Sternen.
Schauen wir uns den Froschteich Mittelmeer zur Zeit der Griechen an, so sehen wir tatsächlich, wie sich ringsherum die Wissenskolonien bilden. Zunächst in Milet, einer Stadt an der Westküste Kleinasiens, auf dem Gebiet der heutigen Türkei, die zahlreiche große Söhne hervorbrachte.
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|42|Recht und Gesetz inE griechischen Städten
Sparta und Athen wollen beide Macht
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|100|Einigkeit macht stark
Die griechischen Stadtstaaten und die Perserkriege
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|129|Es kann nur einen Gewinner geben
Athen strebt die Vorherrschaft an
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
|155|Sparta gegen Athen, Athen gegen Sparta
Die Entscheidung im Peloponnesischen Krieg
Möchten Sie mehr lesen?
Den vollständigen Text gibt es als eBook bei Ihrem Online-Händler.
Sparta hatte in der langen Auseinandersetzung mit Athen den Kürzeren gezogen. Es war an seinem unflexiblen System regelrecht erstickt. Doch auch die Vormachtstellung der attischen Demokratie war keinesfalls sicher. Denn ständig drohte die Gefahr aus dem Osten, vom riesigen Perserreich her. Allein würde Athen dieser Großmacht auf Dauer nicht standhalten können. Der allmähliche Aufstieg eines neuen möglichen Bündnispartners im Norden Griechenlands wurde daher mit Hoffnung, wenngleich nicht ohne Sorge betrachtet. Philipp II. von Makedonien hatte große Pläne, für sein Reich und für seinen Sohn Alexander. Für ihn rief er einen Lehrer an seinen Hof, der dem großen Sohn bis heute nicht an Ruhm nachsteht.
Aristoteles und seine Geschichte
Als Bildungsstätte zog Platons Akademie junge Männer aus ganz Groß-Griechenland an. Sogar einige Frauen sollen unter Platons Hörern gewesen sein. Diogenes Laertios führt zwei von ihnen, Lastheneia und Axiothea, namentlich auf. Als Platon Mitte Fünfzig war, ließ sich Aristoteles in das Vereinsregister der Akademie eintragen. Die Akademie nahm längst nicht jeden. Doch Aristoteles hatte Glück. Der 17-Jjährige bestand das Vorstellungsgespräch und durfte bleiben. Die Akademie wurde seine Heimat. Erst 20 Jahre später, nach dem Tod Platons, sollte Aristoteles sie wieder verlassen.
Er stammte aus Stageira, einer Stadt an der ägäischen Nordküste. Dort hatten sich griechische Kolonisten vor einem Jahrhundert niedergelassen, bereits Herodot erwähnt Stageira. Seine Jugendzeit verbrachte Aristoteles im Hinterland, in Makedonien mit seiner Hauptstadt Pella. Auch die Makedonen waren Griechen. Die aber noch lange in Klan-Gesellschaften und losen Stammesverbänden |188|lebten. Den Athenern galten sie als »Halbbarbaren«. Makedonien war für Athen vor allen Dingen als Holzlieferant interessant. Dort wurden Weißtannen geschlagen, das begehrte Bauholz für die athenischen Trieren.
Der Makedonen-König Archelaos verstand es, dem Königtum innerhalb der rivalisierenden Klans festen Bestand zu geben. Während des Peloponnesischen Krieges, als das übrige Griechenland in Blut ertrank, brachte Archelaos Makedonien vermehrt als Rohstofflieferant ins Spiel. Er verwandte die Einnahmen dazu, feste Plätze, Städte und Straßen anzulegen und verbesserte so die Infrastruktur des bis dahin verschlossenen Landes. »Er tat in allem mehr für Makedonien, als die acht Könige vor ihm«, bemerkt Thukydides. Den Königssitz in Pella baute Archelaos zu einer modernen griechischen Stadt aus, und er zog neben den griechischen Handwerkern auch Dichter und Künstler aller Art in sein Reich. Seine Zeitgenossen priesen ihn als den reichsten und glücklichsten Menschen der ganzen Welt.
Der Vater von Aristoteles, Nikomachos, war Leibarzt der makedonischen Könige. Von ihm erbte Aristoteles das naturwissenschaftliche Interesse. Allein die zoologischen Vorlesungsnotizen von Aristoteles umfassen Tausende von Seiten. Er beschreibt Säugetiere, Vögel, Kriechtiere, Lurche, Fische, Insekten, Tausendfüßler und Spinnen mit einer akribischen Genauigkeit. Dabei muss man sich vor Augen halten, dass Aristoteles weder Mikroskop noch Fernglas noch ein modernes Sezierbesteck besaß. Dass er dennoch all dies beobachten konnte, verwunderte schon seine Zeitgenossen in der Antike.
Alles und jedes interessiert Aristoteles. Besonders die »Kinderfragen«. Zum Beispiel, warum mehr Männer als Frauen kahlköpfig sind. Oder, wieso der Regenbogen bunt ist. Oder warum Bäume nur an Land und nicht auf dem Meeresgrund wachsen. Das naturwissenschaftliche Werk von Aristoteles setzte Standards, die erst in der Neuzeit überboten wurden. Noch der Klassiker des Tierlexikons, Alfred Brehm, zitiert im 19. Jahrhundert den »vortrefflichen Naturforscher« Dutzende von Malen.
Die beschreibende Zoologie ist nur ein Teilgebiet seiner wissenschaftlichen Untersuchungen. Mit einem Team von Mitarbeitern erforscht Aristoteles die Geschichte der Olympischen Spiele, erstellt eine Chronik des Athener Theaters. An anderer Stelle beschreibt er verschiedene Methoden des Gedächtnistrainings. Unter seinen Schriften findet sich auch eine tiefschürfende Abhandlung darüber, warum und wieso Menschen träumen.
Und Aristoteles beschäftigt sich eingehend mit den Sozialwissenschaften. |189|In einem Handbuch stellt er 158 Staatsverfassungen seiner Zeit vor, analysiert und bewertet sie nach ihren Stärken und Schwächen. Kurz gesagt, Aristoteles lässt kaum ein Wissensgebiet aus. Seine uns erhaltenen Vorlesungsnotizen enthalten Bemerkungen über den Magnetismus, die Meteorologie, die Optik, die Astronomie, und so weiter. Es ist unglaublich, dass so viel in ein einzelnes Menschenleben hineinpasst!
Dabei ist das alles erst die Hälfte seines Werks. Die andere Hälfte ist logischen Untersuchungen, den Sprachwissenschaften und besonders der philosophischen Grundlagenforschung gewidmet. Mit der gleichen Hingabe, wie Aristoteles das Fortpflanzungsverhalten des Tunfischs im Schwarzen Meer untersucht, geht er den letzten philosophischen Fragen auf den Grund.
Irgendwann gehörte er dann dem Lehrkörper der Akademie an. Zusammen mit Platon und anderen Kollegen führte er die jungen Leute ins akademische Denken ein.
Aus dieser Zeit stammen seine ersten Schriften. Wie sein Lehrer schreibt er damals noch in Dialogform. Spätere antike Autoren loben deren »goldenen Redefluss«. Uns sind diese Erstlingsschriften leider nur bruchstückhaft erhalten geblieben. Doch aus ihnen geht hervor, dass Aristoteles zu dieser Zeit noch ganz in den Fußstapfen seines Lehrers wandelt. Wie dieser schildert er das Heimweh der Seele nach dem göttlichen Sein, dem Wahren, Schönen und Guten.
Doch schon zu Platons Lebzeiten beginnt Aristoteles sich von Platons Überwelt zu verabschieden. Dabei bleibt er dem »göttlichen Platon«, wie man ihn jetzt schon nennt, in Bewunderung und Hochachtung zugetan. In seinen vielen Texten findet sich keine einzige herabsetzende Äußerung über seinen verehrten Lehrer. Obwohl er sich immer deutlicher von ihm abgrenzt.
Für Platon ist die Welt Fremde, Heimat ist sie für Aristoteles. Platon glaubt an die unsterbliche Seele, dem Aristoteles passt sie nicht ins Konzept. Platon und seine Akademiker forschen nach dem Anfang der Welt, Aristoteles interessiert das nicht. Er will nicht erklären, warum es die Welt gibt, er versucht zu begreifen, wie die Dinge funktionieren.
Für Aristoteles ist die Welt, wie sie ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit folgt sie den ewig gleichen Gesetzen. Die Welt ist, was sie ist, ein Perpetuum mobile. Was aber soll das Perpetuum mobile der Welt in ewiger Bewegung halten? Aristoteles antwortet: »Es gibt etwas, das unaufhörlich alles Bewegte bewegt, nämlich der erste Beweger«. Und dieser »erste Beweger« ist seiner Natur nach |190|»ein ewiges, unbewegliches und von allen wahrnehmbaren Dingen abgehobenes Sein. Daraus ist deutlich, dass jenes Sein ohne körperhafte Ausdehnung ist, nicht zerlegbar und unteilbar.« Dieses Sein also ist es, das bewegende Kraft in den Dingen auslöst und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Und wer bewegt den ersten Beweger? Nichts bewegt ihn. Denn er ist Sein, das in sich selbst ruht. Und dieser »unbewegte Beweger« ist Gott, »ein ewiges und bestes Lebendigsein«, das nur Schönes und Gutes denken kann, also »sich selber denkt«. Dies ist die höchste Spitze der aristotelischen Metaphysik. An seinem Dasein »hängt Himmel und Erde«. Und an jenem Sein wollen alle Dinge teilhaben. Sehnsucht nach dem in sich ruhenden, glückseligen Sein hält sie in immerwährender Bewegung.
Liebe durchzieht die Welt, Liebe hält sie in Bewegung, die Sehnsucht des Werdens, im Sein zur Ruhe zu kommen. Das ist ein tiefer und schöner Gedanke.
Als Platon stirbt, ist Aristoteles 36 Jahre. Die Akademie muss einen neuen Leiter wählen. Aristoteles kommt dafür nicht in Frage. Die Akademie ist ein eingetragener Verein der Stadt. Und sein Vorsitzender muss Athener Bürger sein. Das aber ist Aristoteles nicht, obwohl er jetzt schon 20 Jahre in Athen lebt. Das Bürgerrecht in Athen kann nur innehaben, wer zwei Athener Eltern hat. Das ist seit Perikles so. Also müssen sich die Akademiker nach einem Vollathener umsehen. Ihre Wahl fällt auf Speusippos, den Neffen Platons.
Hermias, Fürst von Assos, einer griechischen Küstenstadt Kleinasiens, ersucht Aristoteles, dort eine Zweigstelle der Akademie einzurichten. Aristoteles nimmt die Einladung an. In Begleitung einer Hand voll anderer Akademiker reist er nach Assos. Die Freunde verbringen einige Jahre in der Stadt, Aristoteles heiratet dort Pythias, eine Nichte des Herrschers.
In ein antipersisches Komplott verwickelt, wird Hermias an den Königshof zitiert und hingerichtet. Aristoteles und seine Gefährten siedeln nach Lesbos über. Die Insel liegt in Sichtweite von Assos, der junge Theophrast ist dort zu Hause. Theophrast ist auch Akademiker, in späteren Jahren wird er die Nachfolge von Aristoteles als Schulleiter des Lykeions von Athen antreten.
Auf der Insel Lesbos verbringt Aristoteles mehrere Studienjahre, angefüllt mit naturwissenschaftlicher Forschung. Dann beruft ihn der Makedoner-König Philipp zum Erzieher seines 13-jährigen Sohnes Alexander. Aristoteles folgt im Jahr 342 der Einladung Philipps.
Aristoteles kannte Pella, die makedonische Königsstadt. Er hat dort in |191|seiner Jugend mit den makedonischen Adelssprösslingen auf der Schulbank gesessen, in Pellas Sportstätten trainiert. Wahrscheinlich kennen sich Aristoteles und Philipp aus dieser Zeit, beide waren Altersgenossen.
Aristoteles als Lehrer
Philipp regierte seit dem Jahr 359 vor unserer Zeitrechnung das Land in Griechenlands Norden. Der Vater von Alexander war ein König mit großen Visionen. Und zugleich besaß er ein ungewöhnliches Organisationstalent. Philipp reorganisierte die Armee, leitete Wirtschaftreformen ein, gründete neue Städte, ließ Sümpfe trockenlegen, steigerte den Ertrag seiner Gold- und Silberminen. Und vor allen Dingen, Philipp gliederte die bisherigen Stammesfürstentümer seiner Herrschaft ein und schuf in Makedonien einen straff gelenkten Zentralstaat. Bald war Makedonien zu klein für ihn. Jahr für Jahr weitete der unternehmungslustige König seinen Herrschaftsbereich nach Osten und Westen weiter aus.
Einflussreiche Politiker Athens sahen in Philipp einen Hoffnungsträger. Makedonien, vereint mit Athen und dessen Verbündeten, könnte ein Gegengewicht zum persischen Großreich schaffen. Isokrates, ein athenischer Redner, appellierte an die Griechen: »Vergessen wir unsere inneren Streitigkeiten! Lasst uns mit vereinten Kräften gegen die Perser zu Felde ziehen. Die Reichtümer Asiens müssen wir zu uns nach Europa holen!« Und an Philipp persönlich adressiert sagte Isokrates: »König, es ist deine Pflicht, dass du dich für die Griechen einsetzt! Wenn du die Perser unter deine Herrschaft bringst, werden alle Griechen dir dankbar sein.« Manchen Athenern war das recht aus dem Herzen gesprochen.
Die Volksversammlung allerdings mahnte zur Vorsicht, ja zur Wachsamkeit gegenüber Philipp. Dessen expansive Politik berührte Athens wirtschaftliche Interessen in Nordgriechenland. Denn aus dem Norden bezog Athen viele seiner lebenswichtigen Rohstoffe. Und an den kommerziellen Schiffsrouten ins Schwarze Meer hing vor allem die Getreideversorgung der Stadt.
Sprecher der antimakedonischen Fraktion war Demosthenes. Aristoteles kannte den Redner, er hatte dessen Auftritte in Athen persönlich miterlebt. Demosthenes bezeichnete Philipp als den »ärgsten Feind Athens«. Er votierte in der Volksversammlung sogar dafür, dem Makedonen den Krieg |192|zu erklären. So weit wollten die Athener nicht gehen, doch die antimakedonische Stimmung in der Stadt wuchs. Man bezeichnete Philipp als »Barbaren«. Und man wäre froh gewesen, wenn jemand den umtriebigen König umgebracht hätte, was das gewöhnliche Schicksal der Makedonen-Herrscher war.
Aristoteles begab sich also auf dünnes Eis, wenn er nach Pella ging. Dennoch, er entschied sich für Makedonien. Die nächsten sechs oder sieben Jahre verbrachte er in der Residenz. Davon war er zwei, drei Jahre als Erzieher des jungen Alexanders tätig. Danach fungierte er wohl als politischer Berater Philipps.
Lernte Alexander die Welt mit den Augen seines Lehrers zu betrachten? Aristoteles war ein genauer Beobachter mit scharfem Blick fürs Detail, zugleich verstand sich der Philosoph darauf, in großen Zusammenhängen zu denken, die bewegte Welt als Ganzes zu sehen. In dieser Hinsicht konnte Alexander sicher eine Menge von seinem Lehrer lernen. Strategisches, methodisches Herangehen an eine Sache war eine der Hauptstärken des aristotelischen Denkens, und Alexander, selbst ein geborener Stratege, wird davon profitiert haben.
Hat Aristoteles mit seinem Zögling auch politische Fragen diskutiert? »Die Politikwissenschaft ist nichts für junge Leute«, befindet der Philosoph in späteren Jahren. »Sie haben keine Lebenserfahrung und hören zu sehr auf ihre Gefühle.« Und überhaupt, das Politikverständnis von Aristoteles orientiert sich an den selbstständigen griechischen Stadtstaaten. Doch deren Zeit war passé.
Die Zukunft gehörte großen Flächenstaaten wie Makedonien. Auf die jedoch ließen sich die demokratischen Spielregeln der Stadtstaaten nicht übertragen. »Ein Bürger muss sich darauf verstehen, regiert zu werden und selbst zu regieren«, verlangt Aristoteles in seiner Politik. Und das bedeutet, dass ein Bürger auf die Politik seiner Stadt Einfluss nehmen kann. Durch Wahlen, Ämterbesetzung, durch öffentliche Diskussionen. Das glückte in den überschaubaren griechischen Städten. Die laut Aristoteles darum nicht größer sein sollen als der »Ruf eines Herolds« reicht. Wie aber soll das alles in großen Flächenstaaten funktionieren?
Organisationen, in denen sich Bürger mit gleichen politischen Zielen zusammenschließen, Parteien also, als Medien politischer Willensbildung, kannte die Antike noch nicht. Erst im christlichen Byzanz nahmen die Parteien |193|der »Blauen« und der »Grünen« tatsächlich Einfluss auf die Politik. Danach brauchte es noch einmal tausend Jahre, bis sich in den westlichen Staaten Parteien als Organe der Volksvertretung institutionell etablierten.
Wie also sollten in den Flächenstaaten der Antike Bürger politisch aktiv werden können? Schon die Frage lag außerhalb des politischen Denkhorizonts von Aristoteles. Die Barbaren, das heißt jene Menschen, die nicht in selbstverwalteten Städten leben wie die Griechen, müssen sich eben damit abfinden, als Sklaven regiert zu werden. Wie bei den Persern, wo der Großkönig nach Belieben schaltet und waltet, ohne dass ihm jemand dazwischenredet.
Ob Aristoteles dem jungen Alexander darlegte, wie eine griechische Stadt funktioniert? »Bürger sein bedeutet schlicht und einfach mitzuregieren«, heißt es in seiner Politik. Doch Begriffe wie »Selbstverwaltung« oder »Ämterrotation« waren seinem Zögling völlig fremd. Schließlich regierte auch Philipp als unumschränkter Alleinherrscher und beriet sich allenfalls mit einer Hand voll ausgesuchter Adeliger.
Alexander führte, laut Plutarch, seinen Stammbaum bis auf Achilleus zurück. Weil er sich als Vollblut-Grieche fühlte, hat er gewiss begierig aufgenommen, was sein Erzieher ihn über die griechische Wesensart lehrte. »Die Völker, die in einem rauen Klima leben, sind Draufgänger. Wie beispielsweise die Europäer. In intellektueller und künstlerischer Hinsicht bringen sie allerdings nur wenig zuwege. Deshalb leben sie zwar in Freiheit, doch sie finden nicht zu einer politischen Ordnung. Und das macht sie unfähig, sich ihre Nachbarn zu unterwerfen. Die Völker Asiens sind zwar intellektuell wie künstlerisch begabt, doch sie sind keine Draufgänger. Deshalb herrscht keine Freiheit bei ihnen und sie leben nach Sklavenart. Das Volk der Griechen hingegen hält zwischen beiden Extremen die Mitte. Sie sind beides, Draufgänger wie Denker, sie leben in Freiheit und sind bestens politisch organisiert. Das befähigt sie, über andere Völker zu herrschen, vorausgesetzt, sie schaffen es, vereint aufzutreten«, so lesen wir bei Aristoteles.
Seine Träume also hat Alexander nicht einfach ins Blaue auf Reisen geschickt. Griechischer Erwählungsglaube inspirierte ihn, sich den Erdkreis untertan zu machen. Schon einmal, so sah es der zukünftige Eroberer, waren die Griechen zu einem Rachefeldzug gegen die asiatischen Nachbarn aufgebrochen: Vor Troja stellten sie die Ehre der Griechen wieder her. Und der löwengleiche Achilleus war ihr Vorkämpfer gewesen. Ihn ließ das Schicksal zwischen Heimkehr |194|und Ruhm wählen, unsterblichen Ruhm um den Preis eines frühen Todes. Wie Achilleus wählte Alexander den Ruhm.
Die virtuelle Wirklichkeit seines waffenglänzenden Helden nahm unwiderstehlich von Alexander Besitz. Plutarch berichtet, Aristoteles habe Alexander eine Homerauswahl als Geschenk vermacht. Sie soll ihn auf seinem ganzen Asienfeldzug begleitet haben, und der junge König habe diese Schriftrolle als seinen kostbarsten Besitz gehütet.