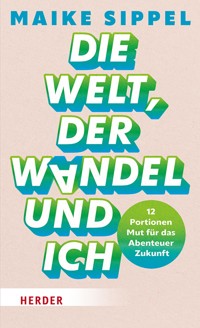
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie kann der Wandel in die Welt kommen, mit dem wir eine enkeltaugliche Zukunft sichern? Und was hat dieser Wandel mit mir zu tun? In Zeiten grundlegender Veränderungen zeigt Maike Sippel, Professorin für Nachhaltigkeit, warum wir nicht hilflos auf Weichenstellungen der Politik warten müssen. Es ist an der Zeit, selbst die Segel zu setzen. Maike Sippel entwirft einen Plan, wie wir den gesellschaftlichen Wandel wahrscheinlicher machen und zugleich unsere Resilienz stärken. Sie präsentiert zwölf mutige Gedanken, um die Welt zu verändern – mit Kopf, Herz und Hand. Positiv, undogmatisch und konkret – das Handbuch für die Abenteuerreise des Wandels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maike Sippel
Die Welt, der Wandel und ich
Zwölf Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft
Mit Illustrationen von Yannic Seitz
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Straße 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Illustrationen: Yannic Seitz
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timișoara
ISBN Print 978-3-451-60167-5
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83998-6
Inhalt
Vorwort
1. Sehen Sie sich als Teil dieser Welt
2. Seien Sie dankbar
3. Lassen Sie Schmerz und Trauer zu
4. Nehmen Sie sich ernst und machen Sie Ihre Werte zur Grundlage Ihres Handelns
5. Machen Sie sich ein Bild von der Zukunft
6. Erinnern Sie sich, dass Wandel möglich ist
7. Ihre Werkzeuge für den Wandel? Hand und Fuß!
8. Finden Sie Ihre Rolle und tun Sie sich mit anderen zusammen
9. Sprechen Sie darüber
10. Versorgen Sie sich mit guten Nachrichten
11. Sehen Sie das Ganze als Abenteuer
12. Passen Sie auf sich auf
Dank
Zum Vertiefen
Quellenverzeichnis
Über die Autorin
Über das Buch
Vorwort
Unsere Zeit ist geprägt durch eine Reihe von Krisen. Leider. Schon seit Jahren wird es heißer, Überflutungen und Hitzewellen nehmen zu. Dann kamen in enger Taktung die COVID-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Wirtschaftsflaute. Das Leben ist teurer geworden, weltweit werden populistische Strömungen stärker, und die Demokratien stehen unter Beschuss.
Es ist offensichtlich: So geruhsam wie es einmal war, wird es nicht weitergehen. Ob wir es wollen oder nicht – die nächsten Jahrzehnte werden ein turbulentes Abenteuer. Die Welt ist im Wandel. Wie wir diesen Wandel gestalten, wird darüber entscheiden, wie wir selber, unsere Kinder und Enkel und viele Generationen nach uns auf der Erde leben.
Werden sintflutartige Regenfälle sich mit Dürrekatastrophen abwechseln? Stoßen wir das erste Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten seit dem Ende der Dinosaurier an? Werden wir von Konflikten durchgeschüttelt? Fallen unsere Gesellschaften auseinander? Oder schaffen wir es, das Klima zu stabilisieren, die Vielfalt des Lebens zu erhalten und trotz aller Unsicherheiten das Verbindende zu stärken? Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht! Zwei von drei Menschen auf der Welt wären bereit, ein Prozent ihres persönlichen Einkommens für die Lösung der Klimakrise zu verwenden, etwa neun von zehn wünschen sich stärkere politische Maßnahmen.1
Was bei diesem Wandel herauskommt, hängt mit unserer Grundhaltung der Welt gegenüber zusammen. Wie stehen wir in dieser Welt, die uns mit Krisen überschüttet? Warten wir ohnmächtig darauf, dass andere (die Politik, die Wirtschaft, …) etwas tun? Lassen Sie uns lieber selbst Hand anlegen! Das geht auch, wenn wir uns nicht sicher sein können, ob unser Handeln zum Erfolg führen wird. Ein aktives Hoffen ist das: Mit einem Bild von der wünschenswerten Zukunft vor Augen sein Möglichstes tun, dass diese Zukunft wahrscheinlicher wird – in dem Wissen, dass wir mit unserem Handeln Teil einer größeren Bewegung sind.
Als Expertin für gelingenden Wandel ist mein Spezialgebiet das gemeinsame Anpacken für Lösungen zur Klimakrise. Oder etwas verkopfter ausgedrückt, die „sozial-ökologische Transformation“. Diese Facette des Wandels verdient einen Sonderplatz, weil die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen das Überleben der Menschheit an sich gefährdet. Zugleich können wir viel von dem, was wir über den Umgang mit der Klimakrise wissen, auf die anderen Krisen, vor denen wir heute stehen, übertragen.
Mein Herz brennt dafür, das vorhandene Wissen zu diesem Thema nutzbar zu machen. Deshalb bin ich Hochschullehrerin und probiere mit meinen Studenten Werkzeuge für die Baustellen des Wandels aus. Und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Grundlage sind zahlreiche wissenschaftliche Studien und meine Projekt- und Lehrerfahrungen der letzten Jahre.
Mit dem Schreiben dieses Buches hat es übrigens ganz harmlos angefangen – mit einem dreiseitigen Artikel in der Neujahrsausgabe der taz 2023. Neben zahlreichen positiven Rückmeldungen wurde ich daraufhin zu einem Vortrag eingeladen. Einige Monate später organisierten wir ein Kombipaket aus Vortrag und Geschichten vom Anpacken – erzählt von Menschen, die vor Ort an Lösungen arbeiten, sei es am Bauernhof, im Kloster, im Einzelhandel, in der Kita oder als engagierte Bürger. An diesem Abend stand ein älterer Herr auf und forderte mich auf, aus den zwölf Portionen Mut ein Buch zu schnüren – damit hat er den Lebensinhalt meiner letzten Monate entscheidend geprägt … Sie halten also einen über mehrere Runden „gereiften“ Prototypen in der Hand – und ich bin gespannt, was sich als Nächstes daraus ergeben wird.
In diesem Buch präsentiere ich Ihnen zwölf Gedanken, um die Welt zu verändern – für Kopf, Herz und Hand. Es geht um die Frage, wie es sich gelingend leben lässt in diesen stürmischen Zeiten. Ich skizziere eine Lebenskunst, die beim gesellschaftlichen Wandel mitanpackt und gleichzeitig unsere Resilienz und Zufriedenheit stärkt. Das Buch ist keine Weltformel. Aber ich hoffe, es kann Ihnen helfen, Ihren inneren Kompass zu finden für unsere gemeinsame Abenteuerreise in die Zukunft.
Bitte bedienen Sie sich in diesem Buch wie an einem Buffet. Suchen Sie sich das raus, was Ihnen schmeckt. Vielleicht greifen Sie immer wieder einmal darauf zu, wenn es gerade in Ihr Leben passt. Sie werden erklärende Texte finden (ich habe mich bemüht, Dinge korrekt zu beschreiben, ohne in einen Fachjargon abzurutschen). Sie können sich inspirieren lassen von zwölf Geschichten, die von Menschen erzählen, die einfach mit der Veränderung angefangen haben. Zum Ende jedes Kapitels finden Sie einige Fragen. Hier lade ich Sie ein, das Gelesene mit Ihrem eigenen Leben in Verbindung zu bringen.
Was für ein historischer Zufall, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der wir die Weichen stellen für die nächsten Zehntausende Jahre des Lebens auf der Erde. Welche Chance und welche Verantwortung! Ich will mein Bestes tun, damit diese Geschichte gut ausgeht. Das bin ich mir selber und meinen Kindern schuldig.
1. Sehen Sie sich als Teil dieser Welt
„Welche Schönheit. Ich sah Wolken und ihre hellen Schatten auf der weit entfernten geliebten Erde … Das Wasser dunkel und leicht schimmernd … Als ich den Horizont betrachtete, sah ich den abrupten, kontrastreichen Übergang von der hellen Oberfläche der Erde zum absolut schwarzen Himmel. Ich erfreute mich am reichen Farbspektrum der Erde. Sie ist von einer hellblauen Lichthülle umgeben, die sich allmählich verdunkelt und in Türkis, Dunkelblau, Violett und schließlich in ein Kohlrabenschwarz übergeht.“
YURI GAGARINOberst der sowjetischen Luftstreitkräfte und erster Mensch im Weltraum2
Stellen Sie sich vor, Sie steigen in eine Weltraumrakete, nehmen Platz und warten auf den Start. Sie werden kräftig durchgerüttelt und geschüttelt, und da ist auch eine gewisse Angst, ob alles gut gehen wird. Doch dann, plötzlich, ist das Rütteln weg. Sie atmen auf und werfen endlich einen Blick aus dem Fenster. Dort sehen Sie zum ersten Mal von außen auf die Erde, auf unseren Heimatplaneten.
Der Blick von außen auf die Erde
Astronauten beschreiben diesen Moment als überwältigend. Von totaler Glückseligkeit angesichts der in leuchtendes Blau gehüllten Erde berichten sie und davon, dass die Ländergrenzen nicht mehr wichtig sind. Auch Alexander Gerst hat der Blick von oben zutiefst berührt: „Ich habe die Erde plötzlich als Gesamtsystem gesehen, als Kugel, abgeschlossen mit einer hauchdünnen Atmosphäre. Unvorstellbar zerbrechlich sieht sie von oben aus, als könnte man sie mit einem Hauch wegpusten. Und man sieht gleichzeitig, wie wir Menschen Schadstoffe hineinpusten. Sie wirkt zerbrechlich und gleichzeitig einsam und klein, als unser einziges Raumschiff, das wir Menschen haben, mit dem wir durch das schwarze Universum fliegen.“3
Die Eindrücke der Raumfahrer haben alle eins gemein: Der Blick von außen ist bewegend und er weckt ein Verantwortungsgefühl dafür, die Schönheit der Erde und unserer Welt zu erhalten. Seit 1987 firmiert dieses Phänomen unter dem Namen Überblicks-Effekt (Overview Effect).4 Warum es einen Unterschied macht, wenn wir auf einmal den weltweiten Überblick haben? Psychologen erklären das so: Wenn die Raumfahrer von oben auf die Erde schauen, löst das Gefühle von Ehrfurcht aus. Dadurch weitet sich ihr Bewusstsein. Sie öffnen sich für Werte, die über ihr eigenes Ich hinausgehen, und für das Leben als Ganzes. „Selbsttranszendenz“ nennen Psychologinnen das.5
Nehmen Sie sich etwas Zeit, legen Sie das Buch zur Seite und betrachten Sie tatsächlich vor Ihrem geistigen Auge die Erde. Wie sie dasteht, mit ihren gewaltigen blauen Ozeanen und den deutlich kleineren Landmassen, von weißen Wolken überzogen – inmitten des kalten und scheinbar unendlichen Weltalls …
Ja, das ist unsere Welt! Alles, was wir haben. Und wir sind ein Teil davon, ein winziger Mosaikstein innerhalb des Lebens, das sich bis heute auf dieser Erde entfaltet hat. Wir sind aufs Engste mit diesem Leben um uns herum verbunden. Nicht nur sitzen wir mit allen Menschen weltweit im selben Boot, wir sind auch vollkommen abhängig von der Natur – ob es darum geht, was wir essen, oder ums bloße Atmen von sauberer Luft mit Sauerstoff, den Pflanzen über Jahrmillionen produziert haben.
Ein größeres „Wir“ …
Lässt sich dieses pralle Gefühl, Teil allen Lebens auf der Erde zu sein, auch jenseits von Gedankenreisen erleben? Ich bin zum Beispiel jedes Mal ergriffen, wenn ich von einem Gipfel auf die Bergketten der Alpen blicke, die sich bis zum Horizont aufreihen. Oder wenn ich die Sonne auf- oder untergehen sehe, wenn ich den Wald mit allen Sinnen auf mich wirken lasse oder die Vögel am Himmel ziehen sehe. Ich muss mir halt die Zeit zu alldem nehmen und anderen Verlockungen wie dem Griff nach meinem Smartphone widerstehen.
Nur wenn wir uns als Menschheit wieder klarwerden, dass wir mit der Welt und dem Leben verbunden sind, werden wir als Spezies überleben. Der US-Soziologe Jeremy Rifkin spricht von einem Wettlauf – zwischen der Schaffung einer empathischen Zivilisation und eines Bewusstseins für die Gesamtheit des Lebens auf der Erde einerseits und der Bedrohung durch Klimawandel und der Zerstörung durch Massenvernichtungswaffen andererseits.6
Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wir das schaffen. Sie fragen sich vielleicht, ob unser Schicksal nicht schon besiegelt ist – nicht wenige sprechen davon, dass es eh schon zu spät sei und die Menschheit nicht in der Lage, den Kollaps zu verhindern. Der Blick in die Geschichte zeigt aber, dass die Menschheit in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten bereits näher zusammengerückt und empathischer geworden ist. Dazu haben nicht zuletzt die zunehmende Vernetzung und verbindende Technologien beigetragen. Die positiven Folgen sind zum Beispiel die breite Ächtung von Folter und Völkermord, die Anerkennung der Menschenrechte und die gewachsene Toleranz bezüglich Religionen und sexueller Orientierung.6,7 Weltweite Umfragen berichten, dass die Hilfsbereitschaft von Menschen gestiegen ist – mehr als sieben von zehn Erdbewohnern haben 2022 Geld oder Zeit gespendet oder einer unbekannten Person geholfen.8 Obwohl wir am Rande einer Klimakatastrophe stehen, erweitert sich gleichzeitig unser Empathiehorizont – mit einem globalen Social-Media-Netzwerk, einer weltweiten Wissensbibliothek und einer globalisierten Weltwirtschaft.9 Wir identifizieren uns mit einem immer größeren Wir – von Stämmen zu Nationen, von Dörfern zu Megastädten. Und genau darum geht es. Als Menschen auf dieser Erde müssen wir unser Verständnis von uns selbst erweitern, sodass es neben unserer Familie und unserem sonstigen Umfeld auch die gesamte menschliche Zivilisation und das gesamte Netz des Lebens miteinschließt.
Allerdings ist nicht gesagt, dass sich unser Empathiehorizont automatisch kontinuierlich erweitert. Das machen die Konflikte und Kriege klar, die in den letzten Jahren ausgebrochenen sind, und wir können gegenläufige Entwicklungen beobachten, zum Beispiel in den USA. Auch deuten aktuelle Forschungen in Sachen Toleranz und Offenheit darauf hin, dass die Wertehaltungen in verschiedenen Teilen der Erde eher auseinanderdriften könnten.10
Die Menschheit besitzt also ein grundsätzliches Potenzial für den erforderlichen Bewusstseinswandel hin zu einem größeren Wir, aber die Nutzung dieses Potenzials ist kein Selbstläufer. Nur wenn wir die Entwicklung dieses größeren „Wir“ stärken und beschleunigen, können wir die anstehenden Probleme gemeinsam lösen und verhindern, dass wir in einer auseinanderfallenden Welt von Wir-gegen-die-anderen landen. Das Schöne daran: Wer diese Verbundenheit stärkt, trägt nicht nur zur Rettung der Welt bei, sondern bereichert auch seine Beziehungen und verbessert damit ganz nebenbei sein Leben. Ähnliches gilt für die Verbundenheit mit der Natur: Wer sich geistig, emotional und durch eigene Erfahrungen der Natur nahe fühlt, wird sich nicht nur eher für ihren Erhalt einsetzen, sondern fühlt sich wahrscheinlich auch besser, vitaler und glücklicher.11–13 Naturverbundene Menschen berichten auch von größerem persönlichen Wachstum.14
… und ein längeres „Jetzt“
Lassen Sie uns die räumliche Dimension nun um die zeitliche Dimension ergänzen. Wir stellen dem „größeren Wir“ ein „längeres Jetzt“ an die Seite, also einen Blick weit zurück und in die lange Zukunft. Können Sie vor Ihrem geistigen Auge einen Film entstehen lassen, der vom Anbeginn des Lebens auf der Erde bis in die Zukunft reicht? Wie hat das ausgesehen, als sich erstes Leben im Meer entwickelte? Als erste Pflanzen anfingen, Sauerstoff zu produzieren? Als Tiere an Land gingen und später anfingen, ihre Jungen zu säugen? Und als schließlich die Urzeitmenschen um das Feuer saßen? Und welche Geschichten werden sich wohl unsere Urururenkel einmal erzählen über unsere Zeit des großen Wandels?
Ich bin also eine Art Bindeglied zwischen meinen Großeltern, Urgroßeltern und den vielen Generationen davor und meinen Kindern und allen Generationen, die noch folgen. Eine Perspektive, die die Dinge in ein anderes Licht rückt, oder? Dabei sind diese Gedanken in der westlichen Welt nicht neu: Bereits 1972 beschreibt die Forschergruppe um Dennis Meadows in der vom Club of Rome beauftragten Studie Die Grenzen des Wachstums, dass die Lösung der drängendsten Probleme der Menschheit ein verändertes Denken in zwei Dimensionen braucht: Zum einen gilt es, räumlich gesehen über die eigene Familie, Arbeit, Nachbarschaft, Stadt und das eigene Land hinaus einen globalen Standpunkt einzunehmen. Und zum anderen geht es darum, in der zeitlichen Dimension über die kommende Woche, die nächsten Jahre und die eigene Lebensspanne hinaus auch die Lebensspanne der Kinder mitzudenken.15
Warum es notwendig geworden ist, dass wir als Menschheit unseren Verantwortungsbegriff ausdehnen, begründet Hans Jonas 1979 wie folgt: Technologische Entwicklungen haben zu einer gestiegenen menschlichen Handlungsreichweite in Raum und Zeit geführt.16 Schon in den 1970ern hatten die modernen Technologien unter anderem durch die Nutzung der Atomenergie und durch das zunehmende Ausmaß an Ressourcenausbeutung und Umweltzerstörung ein bis dato nicht da gewesenes Vernichtungspotenzial erreicht, das die Existenz der Menschheit gefährdet. Jonas’ Ethik ergänzt die Nächstenliebe deshalb um „Fernstenliebe“, und er fordert, dass wir auch diejenigen Folgen unseres Handelns bedenken, die erst zukünftige Generationen betreffen. Anknüpfend an Kant gibt uns Jonas dafür einen ethischen Imperativ an die Hand, einen moralischen Kompass: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ Oder anders herum ausgedrückt: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens.“16
Warum dieser Gedanke universell ist …
Jonas greift mit seiner Ethik der Verantwortung Überlegungen auf, die viele indigene Völker weltweit teilen. Ursprünglich einer Philosophie der Irokesen entstammt zum Beispiel die Frage: Was für Auswirkungen haben unsere heutigen Aktivitäten auf unsere Nachfahren in der siebten Generation?17 Nicht zuletzt da ein sorgsamer Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen das eigene Überleben sichert, pflegen indigene Kulturen das Bewusstsein von sich selbst und der Natur als Teile einer „großen Familie des Lebens“. Basierend auf dieser Haltung entwickelten Indigene extrem nachhaltige Praktiken der Landbewirtschaftung. Zum Beispiel haben die Rarámuri die sie umgebende Natur in der Sierra Madre in Chihuahua in Mexiko mit Formen des Gartenbaus und der Agroforstwirtschaft über Jahrhunderte bewahrt.18
Die sogenannte Erd-Charta bringt diese bewahrende Tradition indigener Völker mit den „neuen“ Aufrufen zur Verantwortung aus modernen Industriegesellschaften zusammen. Die Erd-Charta erklärt grundlegende ethische Prinzipien für eine zukunftsfähige Entwicklung im globalen Maßstab und hätte eigentlich sogar völkerrechtlich verbindlich werden sollen. Dazu kam es auf dem Erdgipfel in Rio 1992 dann zwar nicht, es schloss sich aber ein weltweiter Beteiligungsprozess an, wie es ihn zuvor noch nicht gegeben haben dürfte: Tausende Einzelpersonen und Hunderte Organisationen aus allen Regionen der Welt und verschiedenster kultureller Hintergründe formulierten an den 16 Kernprinzipien des Dokuments mit.19 Die Präambel der Charta benennt prägnant, worum es geht: Es sei „unabdingbar, dass wir, die Völker der Erde, Verantwortung übernehmen füreinander, für die größere Gemeinschaft allen Lebens und für zukünftige Generationen“.20
… und wie auch die Religionen daran anknüpfen können
Vielleicht ist die Erd-Charta für Sie als universelles Werte-Fundament passend? Ergänzend lässt sich auch aus den Religionen die Brücke zu einer zeitlich und räumlich weit gefassten Verantwortungshaltung schlagen. Diese Brücke erscheint mir deshalb besonders wichtig, weil sie gerade für eher an Bewahrung interessierte konservative Menschen die anstehenden Veränderungen schlüssig begründen kann.
So lässt sich auch aus dem Christentum heraus eine „Sorge für das gemeinsame Haus“ ableiten, wie Papst Franziskus das in der gleichnamigen Enzyklika Laudato si tut. In der – wie ich als Nichtkatholikin finde – sehr lesenswerten Enzyklika geht es zentral um die Umweltzerstörung, soziale Ungerechtigkeiten und unseren Umgang miteinander und mit der Erde. Franziskus betont darin, dass sämtliche Geschöpfe des Universums von ein und demselben Vater erschaffen wurden und deshalb durch unsichtbare Bande verbunden sind. Er sieht uns alle zusammen als eine Art universale Familie, mit einem „heiligen, liebevollen und demütigen Respekt“ voreinander.21
Der Text transportiert auch die relevanten Klimafakten für die Gläubigen und geht dabei sehr korrekt vor. Was für ein wichtiger Beitrag des Papstes, Glaube und Moral mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem konkret notwendigen Handeln zusammenzubringen! Tatsächlich wollte Papst Franziskus einen ganz weltlichen Effekt erzielen: Sein Timing für die Erstellung und Veröffentlichung der Enzyklika zielte explizit darauf ab, 2015 im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz Mut zu verbreiten.22
Erd-Verantwortung
Nicht nur das Christentum hat mit seinem moralischen Gerüst und Wertesystem das Potenzial, eine Verantwortung zu begründen, sich um die Erde zu kümmern. Für einen Großteil der über sechs Milliarden gläubigen Menschen weltweit lässt sich eine „Erd-Verantwortung“ aus ihrem Glauben ableiten, aus dem Islam ebenso wie aus dem Judentum, dem Buddhismus, dem Hinduismus oder aus traditionellen Religionen Amerikas, Australiens und Afrikas.23–25
Nun führt Gläubigsein offensichtlich nicht automatisch zu einer solchen Verantwortungsübernahme. Das zeigen die jüngere und ältere Kirchengeschichte und die vielen noch nicht mit Photovoltaik bedeckten Kirchendächer. Auch orientieren sich die Programme der christlichen Parteien bisher noch wenig an der Bewahrung der Schöpfung. Und man braucht keineswegs gläubig zu sein, um sich für die Erd-Verantwortung zu erwärmen. Meiner Meinung nach können die Religionen aber eine wichtige Rolle als moralischer Impulsgeber spielen – und dieses Potenzial ist definitiv noch nicht ausgereizt.
Wir haben nun unterschiedliche Zugänge zur Erd-Verantwortung erkundet: die wissenschaftlichen Analysen des Club of Rome und die Verantwortungsethik aus den 1970er Jahren, die international breit abgestimmte Erd-Charta, traditionelles indigenes Wissen und die Religionen. Haben Sie darunter einen für Sie passenden Zugang entdecken können? Vielleicht sieht der ja auch noch ganz anders aus als in den vorausgegangenen Zeilen skizziert …
Wichtig ist nicht, woraus sich unsere Erd-Verantwortung nährt, sondern welchen Einfluss sie auf unsere Haltung und unser Handeln hat: Sich mit der Welt und allem darin verbunden zu fühlen, geht zunächst einmal mit einem Mehr an Seelenfrieden einher.26 Die Erd-Verantwortung äußert sich in Gefühlen von Ehrfurcht, Respekt und Dankbarkeit angesichts der natürlichen Welt, in einem Wunsch, diese Welt zu bewahren. Erd-Verantwortung kann uns auch in Gefühle von Wut, Angst oder Schuld stürzen, wenn wir Umweltprobleme bewusst wahrnehmen. Beides kann uns motivieren, für den Erhalt der Erde und der natürlichen Lebensgrundlagen zu handeln. Aus einer Haltung der Erd-Verantwortung heraus kann uns ein solches umweltfreundliches Handeln mit Stolz erfüllen, oder wir können uns im Gegensatz schuldig fühlen, wenn wir es bewusst unterlassen.
Ist es Liebe? Oder Resonanz?
Begrifflich lässt sich die Erd-Verantwortung auch mit „Biophilie“ beschreiben – einer Liebe zu allem Lebendigen. Interessanterweise hat ein Psychoanalytiker diesen Begriff geprägt. Erich Fromm verbindet damit den Wunsch eines Menschen, Wachstum zu fördern, egal ob es sich um andere Menschen, um eine Pflanze oder ein Tier, um eine Idee oder eine soziale Gruppe handelt. Als einer, der sich mit menschlichen Stärken, Schwächen und Haltungen auskennt, sieht der Psychoanalytiker diese Liebe zum Lebendigen als erstrebenswert an. Er bezeichnet sie als „produktive Charakterorientierung“ von Menschen und meint damit, dass sie typisch ist für Menschen, die die ihnen mitgegebenen Fähigkeiten und Anlagen zur Selbstverwirklichung nutzen, die also ihre Potenziale entfalten.27,28 Biologisch gesehen könnte unsere Liebe zum Lebendigen sogar ein entscheidender evolutionärer Vorteil gewesen sein: Vorfahren, die eine stärkere Verbundenheit mit der Natur hatten, könnten zum Beispiel besser in der Lage gewesen sein, sich Zugang zu Nahrung, Wasser oder Schutz zu verschaffen.29 Unsere unbewusste Suche nach Verbindungen zum Leben und zu lebendigen Prozessen entspringt also vermutlich einem überlebenssichernden Grundbedürfnis.
Die Beziehungen zur Welt, zu anderen Menschen und zur Natur hält auch der Soziologe Hartmut Rosa für essenziell. Mit seiner Forschung entwickelt er Erich Fromms Arbeiten weiter. Rosa spricht von „Resonanzerfahrungen“ als intensiven Erfahrungen, die wir im Inneren suchen und ersehnen, weil sie das Leben erlebbar machen. Wir können Resonanz mit unseren Mitmenschen erleben, mit Dingen und Tätigkeiten und in Beziehung zu Natur, Kunst oder Religion. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diese Begegnungen und Beziehungen um ihrer selbst willen stattfinden, dass wir also nicht von Nützlichkeitserwägungen geleitet sind. Denken Sie zum Beispiel an das Eintauchen in Musik oder Tanz, an einen gemeinsamen Spieleabend, an das Streicheln einer Katze oder ein Dahinschlendern am Meeresstrand. Charakteristisch für Resonanzbeziehungen ist, dass ihnen ein Moment der Unverfügbarkeit innewohnt. Wie geht die Melodie weiter? Was wird in der Spielerunde als Nächstes erzählt? Wird die Katze gleich vom Sofa hüpfen? Taucht im Spülsaum am Strand vielleicht ein Seestern auf? Dieses Nichtwissen darum, was geschehen wird, unterscheidet Resonanzbeziehungen von instrumentellen Beziehungen, die als Mittel zum Zweck dienen.
Die besondere Qualität einer Resonanzbeziehung liegt also darin, dass ich mein Gegenüber als aus sich heraus wertvoll wahrnehme und nicht nur auf den Nutzen aus bin, den ich mir aus der Beziehung erhoffe. Können Sie sich vorstellen, welchen Unterschied diese Haltung macht, wenn Sie zum Beispiel daran denken, wie Sie mit einem Freund umgehen oder wie Sie einen Wald bewirtschaften?
In meinem Alltag merke ich, dass es mir gar nicht so leichtfällt, diese besondere Beziehungsqualität zu erleben. Es gibt viele Momente, in denen ich mir als berufstätige Mutter getrieben vorkomme, als ob ich bloß keine Zeit verlieren darf. Vermutlich bin ich damit nicht allein. Beschleunigung, Reizüberflutung und Kommerzialisierung weiter Lebensbereiche prägen unsere modernen Gesellschaften. Dabei sind Wettbewerb und Stress Faktoren, von denen sich zeigen lässt, dass sie unsere Bereitschaft und Fähigkeit für Empathie senken.30 Weil unsere Weltbeziehungen zunehmend darauf ausgerichtet sind, andere zu beherrschen oder Dinge verfügbar zu machen, spricht Rosa vom „Verstummen der Resonanz“. Hinzu kommt die Steigerungslogik des immer Mehr, immer Besser, immer Schneller, die unser Wirtschaftssystem und unser gesellschaftliches Zusammenleben dominiert. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Mensch-Umwelt-Krise als Folge von ausbeuterischen Beziehungen erklären. Auf der individuellen Ebene entspricht dem die Überschreitung der eigenen Belastungsgrenzen bis hin zu Erschöpfung und Burn-out.31
Wenn wir Rosas Gedanken folgen, lautet also die zentrale Frage: Wie können wir die Resonanz wieder zum Erklingen bringen? In uns selbst und für die Welt? Dazu gibt es keine einfache und schnelle Lösung, wir können nicht einfach den Lautstärkeregler hochdrehen. Aber die Art, wie wir unsere Beziehungen gestalten, kann eine wichtige Rolle spielen.
Die Krise im Mensch-Erde-System aus systemischer Perspektive
Gelingende – oder resonante – Beziehungen sind für den Weg in eine nachhaltigere Welt ebenso zentral wie für unseren persönlichen Lernprozess hin zu einer nachhaltigeren und potenziell glücklicheren Lebensweise. Warum das so ist, zeigt ein Blick in den Bereich der Wissenschaft, der sich mit Zusammenhängen und Wechselwirkungen in Systemen beschäftigt: Aus den Systemwissenschaften wissen wir, dass der Zustand eines komplexen Systems davon bestimmt wird, welche Beziehungsmuster innerhalb des Systems besonders häufig vertreten sind. Deshalb manifestiert sich im Gesamtzustand des Mensch-Erde-Systems letztendlich makroskopisch und im Großen, was die bevorzugten Beziehungsmuster innerhalb des Systems sind. Die Menschheit hat eine tiefe ökologische Krise provoziert, das ist ein Beleg dafür, dass die Beziehung zwischen Menschheit und Natur gestört ist. Aus systemischer Sicht ist diese Mensch-Umwelt-Krise eine Art Zusammenfassung oder Spiegelbild der gestörten Naturbeziehungen der einzelnen Teile dieses Systems, also von uns allen. Wenn ich bei meinen eigenen Alltagsentscheidungen (in den Urlaub fliegen, überallhin mit dem Auto fahren) nicht auf die Umwelt achte, bin ich also eine Art Abbild oder Vorbild für die von der gesamten Gesellschaft verursachte Umweltzerstörung.
Unser Sein und unsere jeweils individuelle Art der Weltbeziehungen sind demnach Bestandteil und zugleich Verkörperung des großen Ganzen. Wenn dem so ist, dann haben wir mit unserem eigenen Bewusstsein und mit unseren Beziehungsmustern einen zentralen Hebel in der Hand, um zum gesamtgesellschaftlichen Wandel beizutragen. Ist dieser Gedanke nicht verblüffend? Mir macht es Mut, zu wissen, dass es auf uns und unser In-die-Welt-gestellt-Sein ankommt. Denn das habe ich ja doch irgendwie in der Hand.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie wir ganz persönlich die Resonanz in unseren Weltbeziehungen wieder zum Erklingen bringen können? Neben dem imaginären Weltraumausflug und einigen Reflexionsfragen zum Abschluss dieses Kapitels hier noch zwei Ansätze: Sind Sie der Meditation zugeneigt? Dann interessieren Sie wahrscheinlich folgende neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse: Im Rahmen einer Studie trainierten gesunde Erwachsene zwischen 22 und 50 Jahren mehrere Monate täglich ihre Fürsorge und ihr Wohlwollen gegenüber anderen Menschen mithilfe verschiedener Meditationsformen. Um die Wirkung des Trainings zu erfassen, nahmen die Teilnehmer an Verhaltenstests teil und unterzogen sich Gehirnscans. Tatsächlich zeigte sich für eine bestimmte, aus dem Buddhismus stammende Meditationsform (Loving-Kindness-Meditation) ein deutlicher Trainingseffekt – und zwar nicht nur im Verhalten der Probandinnen, sondern auch in Form messbarer Veränderungen der Aktivitäten in verschiedenen Gehirnregionen.32,33 Die Forscherinnen schlagen vor, dass sich, basierend auf den Ergebnissen, gezielte Trainings für den Aufbau sozialer Intelligenz und prosozialen Verhaltens entwickeln lassen. Diesen Vorschlag greife ich gerne auf und rege an, die Meditation so weiterzuentwickeln, dass das trainierte Mitgefühl sich auf die gesamte Familie des Lebens erstreckt.
Vielleicht wäre das etwas für Sie? Oder genießen Sie es, Zeit in der Natur zu verbringen? Wenn wir Natur erleben, profitieren wir nicht nur von mentalen und psychologischen Gesundheitsvorteilen, sondern unsere Erd-Verantwortung kann auch eine Stärkung erhalten. Das belegen zahlreiche Studien für Naturerlebnisse im Kindesalter, die zu umweltfreundlicheren Einstellungen und Verhalten im Erwachsenenalter führen.34,35 Auch wenn die Forschungsergebnisse hier weniger klar sind: Ein Zusammenhang scheint auch für Erwachsene zu bestehen.36 Wenn das mal kein gutes Argument für den Waldausflug oder gar den Waldkindergarten ist!
Erd-Verantwortung und Empathie sind keine Selbstläufer – und wir können trotzdem Mut zur Zuversicht haben
Angesichts der zunehmenden Krisenhaftigkeit könnten Beziehungen auch leiden, es könnte auch eher schwerer werden, näher zusammenzurücken. Viele westliche Gesellschaften geraten zunehmend unter Druck, und Demokratien scheinen nicht mehr so stabil wie noch vor zehn Jahren. Wenn Menschen Vertrauen ineinander und in die Zukunft verlieren, machen sich Gefühle von Frustration, Machtlosigkeit und fehlender Zugehörigkeit breiter.37,38 Das scheint uns anfällig für ein „Wir gegen die anderen“ zu machen, für ein Auseinanderfallen der Gesellschaft – was es dann wiederum nur noch schwieriger macht, die ursächlichen Krisen zu lösen. Aber gleichzeitig liegt in den Krisen auch ein Potenzial für ein Mehr an Solidarität und zivilgesellschaftlichem Engagement.39
Neben der Erd-Verantwortung und wiedererklingenden Resonanzbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt müssen wir also auch das gesellschaftliche Miteinander fest im Blick haben. Für alle, die als „Pioniere des Wandels“ die anstehenden Veränderungen und Lösungen voranbringen wollen, besteht eine wichtige Aufgabe auch darin, Zugehörigkeit zu stärken, politische Gräben zu überbrücken und Geschichten zu erzählen, die die Menschen näher zusammenbringen.
Vielleicht zweifeln Sie jetzt, ob das überhaupt gelingen kann. Leider kann ich Ihnen diese Unsicherheit nicht nehmen. Aber ich bin überzeugt, dass wir vor einem Möglichkeitenfenster stehen. Ja, einerseits gibt es die Krisen und Rückschläge, und gleichzeitig haben wir es in der Hand. Wir können uns aus einem Zeitalter der Ausbeutung der Natur und des materiellen Überflusses verabschieden, wir können das Beste in uns hervorbringen und uns aufmachen in ein neues Zeitalter der Erd-Verantwortung. Wir brauchen uns nichts vorzumachen – wir stehen vor einer herausfordernden Aufgabe! Einer Aufgabe, die aber auch das Potenzial für ein Mehr an Zusammenhalt in sich trägt – dann nämlich, wenn wir es schaffen, den großen Wandel als gemeinsame Mission zu begreifen, als Aufgabe, für die wir jetzt gemeinsam anpacken für das größere Ganze – ich und Sie und wir alle zusammen.
Lassen Sie uns unsere zerbrechliche Erde mit ihrer hauchdünnen Atmosphäre schützen, unser einsames kleines Raumschiff, mit dem wir durch das schwarze Universum fliegen.
Warum es diesen Gedanken braucht
Die Erde brennt …
Seit 2009 erforscht Johan Rockström mit seinem Team, wie viel Umweltzerstörung wir uns als Menschheit leisten können, ohne dass uns die natürlichen Lebensgrundlagen wegbrechen. Wo sind wir noch auf sicherem Terrain, und ab wann wird es überlebenskritisch? „Planetare Grenzen“ oder „Belastungsgrenzen funktionierender Ökosysteme auf der Erde“ nennt Rockström das auch. Diese Forschungen zeigen, dass wir gerade dabei sind, die meisten der planetaren Grenzen zu überschreiten.40 Zum Beispiel im Bereich der Artenvielfalt, wo wir als Menschheit gerade das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte einleiten – das erste seit 65 Millionen Jahren, als nicht nur die Dinosaurier ausstarben, sondern drei Viertel aller damals lebenden Tierarten. Wenn Ihnen an dieser Stelle zum ersten Mal bewusst wird, was das eigentlich heißt, geht es Ihnen vielleicht wie mir beim Schreiben dieser Zeilen. Es macht mich unendlich traurig und wütend und noch viel mehr. Warum das eine total normale, gesunde und sogar hilfreiche Reaktion ist, damit beschäftigen wir uns in Kapitel drei.
Oder nehmen wir die Erhitzung des Klimas. Bereits heute erleben wir in rascher Folge Hitzerekorde, Jahrhunderthochwasser, Dürreperioden. Die Klimakrise ist nicht mehr nur täglich in den Weltnachrichten, sie betrifft nicht mehr „nur“ Menschen in Indien oder Afrika. Spätestens seit den Überschwemmungen im Ahrtal und in Niederösterreich ist sie vor unserer Haustür angekommen. Und leider ist das erst der Anfang. Für das Klimasystem können wir anhand von Klimamodellen deutlich sehen, wo uns ein Weiter-so-wie-bisher in den nächsten Jahrzehnten hinführen wird, nämlich zu um die 3 Grad Erderhitzung bis 2100.41 Die Folgen von 3 Grad Temperaturerhöhung sind dabei nicht nur doppelt so schlimm wie das, was wir 2024 bei einer 1,5 Grad höheren Jahresdurchschnittstemperatur erlebt haben. Dafür sorgen verschiedene nicht lineare Effekte und sogenannte Kipppunkte im Klimasystem. Klimaforscher Stefan Rahmstorf fürchtet für die 3-Grad-Welt Wetterchaos mit tödlichen Hitzewellen, verheerende Stürme und anhaltende, weit verbreitete Dürren, die globale Hungerkrisen auslösen könnten, und riesige Menschenzahlen auf der Flucht.42
Und 2100? Das könnten meine Kinder, die heute zur Schule gehen, noch erleben. Und damit sind wir erst bei der zweiten, dritten oder vierten Generation. Interessant, dass selbst die gängigen Projektionen der Klimamodelle nur bis hier präsentiert werden. Längerfristige Folgen wie der zeitlich verzögerte Anstieg des Meeresspiegels über die nächsten Jahrhunderte gelangen kaum in unser Bewusstsein. Ich empfehle Ihnen, sich einmal das Norddeutschland der Zukunft bei einem allein durch 2 Grad Erhitzung verursachten Meeresspiegelanstieg vor Augen zu führen – Gummistiefel reichen da leider nicht mehr aus. Konkret geht das zum Beispiel mit der Karte von Climate Central, auf der Sie den Meeresspiegelanstieg über die nächsten Jahrhunderte für einen Temperaturanstieg zwischen 2 und 4 Grad simulieren können.43 Google Earth illustriert den Meeresspiegelanstieg in 3D für einige Weltstädte noch anschaulicher (unter den Städten auch London, mit einem im Wasser stehenden Big Ben).44
… und wir können etwas tun
Die 3-Grad-Welt ist kein unvermeidliches Schicksal. Alle Länder der Erde haben 2015 auf der Klimakonferenz in Paris (Sie erinnern sich, die Konferenz, in deren Vorfeld Papst Franziskus seine Enzyklika platziert hatte) einstimmig beschlossen, die Erhitzung auf nahe der 1,5-Grad-Marke zu begrenzen und auf jeden Fall unter 2 Grad. Zwar bleibt das, was nationale Regierungen weltweit zur Umsetzung dieses Ziels tun, noch mehr oder weniger deutlich hinter dem zurück, was erforderlich wäre. Aber es gibt einige vielversprechende Entwicklungen, wie den raschen Ausbau von Wind- und Sonnenenergie oder eine zunehmende Offenlegungspflicht für Klimarisiken in den Unternehmensbilanzen.45
Warum wir den Zugang zur Erd-Verantwortung erst mal freibuddeln müssen
Es geht also ums Ganze, und es gibt Hoffnung! Trotzdem stelle ich manchmal fest, dass meine Lebensweise mir den Zugang zur Erd-Verantwortung nicht gerade leichtmacht. Viele der Güter, die ich konsumiere, werden arbeitsteilig und in häufig global verteilten Herstellungsschritten produziert. Wissen Sie da immer genau, wer daran mitproduziert hat, ob es fair zuging und wie die Natur dabei weggekommen ist? Obwohl ich von mir sagen würde, dass ich mich um ein nachhaltiges Leben bemühe, muss ich zugeben: Ich weiß das häufig alles nicht, es entzieht sich irgendwie meiner Aufmerksamkeit. Mein Alltag spielt sich außerdem vor allem in von Menschen geprägten Umgebungen ab, in Gebäuden und in Städten. Auch da scheint mir die Natur oft ganz schön weit weg. Es ist also kein Wunder, wenn man im Alltagstrott vergisst, dass wir nur im Austausch mit einer intakten Natur existieren können und wie sehr das menschliche Wohlergehen auf der Erde bedroht ist. Vielleicht geht es Ihnen genauso? Was mir hilft, ist immer wieder ein bewusstes Innehalten und Besinnen: Unser Haus brennt! Und es kommt auf mich und mein Handeln an.
Gerade wir als Bürger können das langfristige Denken ins Spiel bringen
Aber welche Rolle kann ich da schon spielen?, fragen Sie sich vielleicht. Sind da nicht eher die Politiker und Führungskräfte der Wirtschaft gefragt? Ja, es wäre schön, wenn die mutig den Weg wiesen. Und natürlich gibt es auch hier Pioniere des Wandels. Aber die Zeithorizonte, an denen sich immer noch viele Entscheidungen in Wirtschaft und Politik ausrichten, sind erschreckend kurz. In der Politik wird oft gerade mal bis zum Ende der Legislaturperiode und zur nächsten Wahl gedacht, und in vielen großen Unternehmen steht allein der nächste Quartals- oder Jahresbericht im Fokus. Im Finanzsektor rechtfertigen kurzfristige Profitchancen immer noch fossile Investitionen, obwohl selbst finanziell gesehen klar ist, dass die fossile Spekulationsblase mittelfristig platzen wird.
Deshalb kommt es auf Sie und mich an, auf uns Menschen in der breiten Bevölkerung. Wir können uns als Bürgerinnen und Bürger von diesem kurzfristigen Denken abheben. Über die Beziehungen zu unseren Kindern und unseren Enkeln sind viele von uns zutiefst emotional mit der Zukunft verbunden – Verantwortung für nachfolgende Generationen ist für uns weit mehr als ein abstrakter Begriff. Wir sind es, die tatsächlich ein langfristiges Interesse am Klimaschutz haben! Lassen Sie uns dieses Potenzial in die Gesellschaft einbringen.
Was Hoffnung macht
„Die Erde ist nun unser einziger Aktionär. Anstatt Nutzen aus der Natur zu schlagen und sie in Reichtum für Aktionäre umzuwandeln, werden wir den Wert, den Patagonia schafft, nutzen, um die Grundlage allen Reichtums zu schützen.“
YVON CHOUINARD
Yvon Chouinard ist das, was man wohl einen Naturburschen nennen kann. Seit seiner Jugend begeistert er sich für das Tauchen, Klettern, Vögel beobachten, Surfen und Angeln. Dass er überhaupt zum Unternehmer wird, ist eher einem Zufall geschuldet: Um Geld zu sparen, erlernt Yvon das Schmieden und stellt eigene Kletterhaken her, die er bald auch im Freundeskreis verkauft. Wenige Jahre später ist er zum größten Kletterausrüster der USA geworden. Da fällt ihm auf, dass seine Kletterhaken bei jedem Einschlagen den Felsen ein kleines Stück zerstören, unwiederbringlich. Yvon stellt komplett auf abnehmbare Steckhaken um – und kann seinen Kunden gut erklären, warum sie auf die neue Technik umstellen sollen.
Von da an begleitet Yvon die Frage, wie er Nachhaltigkeit in seinem Unternehmen umsetzen kann. Es ist eine stetige Lern- und Abenteuerreise. Für die Kleiderproduktion will Yvon zum Beispiel bereits in den 1990ern auf Biobaumwolle umstellen. Da es noch nicht genug Biobaumwolle auf dem Markt gibt, tut er sich kurzerhand mit indischen Produzenten zusammen und unterstützt sie bei der Umstellung auf ökologischen Anbau – obwohl ihn die Biobaumwolle doppelt so teuer kommt. Er stellt Fleecestoffe aus gebrauchten Plastikflaschen her, bevor die Öffentlichkeit etwas von Recycling gehört hat. Früh versorgt er sein ganzes Unternehmen mit sauberer Wind- und Sonnenenergie. Immer wieder macht er Schlagzeilen – mit der Anzeigenkampagne „Don’t Buy This Jacket“, mit der er Kunden dazu auffordert, zu überdenken, ob sie überhaupt eine neue Jacke brauchen, oder mit eingenähten Etiketten, die dazu auffordern, Klimaleugner nicht mehr ins US-Parlament zu wählen.
Auf einem Angelausflug entsteht 2001 die Idee, fortan ein Prozent des Umsatzes (Achtung, das ist deutlich mehr als ein Prozent des Gewinns!) an Umweltorganisationen zu spenden. Gesagt, getan. Yvons Initiative schließen sich nach und nach über 5.000 Unternehmen an. Mit 83 Jahren überträgt Yvon sein mit drei Milliarden Euro bewertetes Eigentum an Patagonia an eine gemeinnützige Stiftung und eine Treuhandgesellschaft. Die Treuhandgesellschaft sichert Patagonia gegen externe Einflüsse, die Stiftung ist der Bekämpfung der Umweltkrise gewidmet und verteilt die jährlichen Gewinne von Patagonia an Umweltschutzorganisationen, die die Klimakrise bekämpfen. Ein Modell, dass Yvon mit Absicht so designt hat, dass sich andere Unternehmer ein Beispiel daran nehmen können. Für Yvon ist das der Grund, warum er Unternehmer ist. Es geht ihm darum, das Verhalten seines eigenen Unternehmens in Ordnung zu bringen und andere Unternehmen und seine Kunden zu beeinflussen, ebenfalls das Richtige zu tun.
Yvon ist mit sich im Reinen: „Ich bin glücklich. Ich werde sterben. Mit einem guten Gewissen. Es ist besser, Teil der Lösung gewesen zu sein als Teil des Problems.“46–51
Ideen für den Alltag
Ich lade Sie ein, mit den folgenden Reflexionsfragen und Ideen tiefer einzusteigen.
1. Zum Nachdenken und Aufschreiben:
Wie definieren Sie Ihren Platz in der Welt, also in der Gesellschaft und in der Umwelt?
Welche Rolle spielen Empathie und Mitgefühl in Ihrem Leben? Wie reagieren Sie auf die Bedürfnisse und das Leid anderer, und wie beeinflusst das Ihr Selbstverständnis als Teil der Welt?
Würden Sie sagen, dass Sie den Gedanken der Verbundenheit und der „Erd-Verantwortung“ bereits verinnerlicht haben und er Ihr Handeln leitet?
Wenn ja, in welchem konkreten Handeln macht sich das bemerkbar?
Oder andersherum gefragt: Wo haben Sie auch gegen diesen Gedanken gehandelt (und warum)?
Wie könnten Sie Platz und Momente für ein Kultivieren dieses Gedankens im Alltag schaffen? In welchen nächsten Situationen und Entscheidungsprozessen könnten Sie diesen Gedanken wie einfließen lassen – und welchen Unterschied würde das machen?
2. Idee für den Alltag: Wald mit allen Sinnen
Weltraumflüge dürften für die meisten von uns unerschwinglich sein, und sie sind definitiv auch die klimaschädlichste Art zu reisen.52 Einem selbstüberschreitenden Moment kann man sich aber auch auf der Erde annähern. Wie wäre es mit einem Spaziergang durch den Wald oder eine andere ungestörte Umgebung in der Natur, bei dem Sie nachhorchen, ob Sie Ehrfurcht, Wunder und Demut erleben?
Wenn Sie im Wald (oder einem anderen Ort, an dem Sie sich befinden) losgelaufen sind – achten Sie auf Ihren Atem. Können Sie ihn hören und spüren?
Merken Sie den Boden unter Ihren Füßen? Welche Geräusche hören Sie in der Umgebung?
Können Sie sich darauf einlassen, mit allen Sinnen Ihre Umgebung wahrzunehmen? Das Blatt, das vielleicht vor Ihnen zu Boden segelt, den Geruch nach Bärlauch oder Pilzen, das plötzliche Rascheln einer Maus im Laub?
Regt etwas in dieser Umgebung Ihre Demut und Ihre Ehrfurcht an? Vielleicht ist es ein Gefühl der Weite? Oder der Blick von unten in die Baumwipfel? Vielleicht das Moos auf einem Baumstumpf? Das Zwitschern eines Vogels oder das Gluckern eines Baches? Oder etwas ganz anderes?
Während des ganzen Spaziergangs können Sie immer wieder noch mal bewusst ein- und ausatmen, weil uns das hilft, wirklich bei uns zu sein.
53
Hat es funktioniert? Vielleicht waren Sie eh schon überzeugt von Shinrin-Yoku, dem Wald-Baden, das in Japan als Bestandteil eines gesunden Lebensstils gilt?
Tatsächlich kann etwas Training hier nicht schaden. Mit etwas Übung schärfen sich unsere Sinne für die Momente, die uns zum Staunen bringen und uns eine Gänsehaut bescheren können. Das geht auch im Alltag, zum Beispiel, wenn ich mir angewöhne, auf dem Weg zur Arbeit einen kleinen Umweg durch den Park zu machen, um das Grün dort auf mich wirken zu lassen.
2. Seien Sie dankbar
„Die Welt ist schön und wert, dass man um sie kämpft.“
ERNEST HEMINGWAY, US-amerikanischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger54
Haben Sie sich schon mal durch den Kopf gehen lassen, was es eigentlich für ein Wunder ist, dass die Dinge in der Erd- und Menschheitsgeschichte gerade so gelaufen sind, dass es Sie und mich gibt? Über Milliarden Jahre war unsere Erde so lebensfeindlich wie unsere Nachbarplaneten Venus und Mars. Erst als erste Lebensformen entstanden, begannen sich die Dinge zu ändern: Mithilfe von Sonnenlicht produzierten die sogenannten Cyanobakterien Zellmasse, als Abfallprodukt entstand der lebensspendende Sauerstoff. Damit erfanden sie die Photosynthese, die heute noch den Sauerstoff bereitstellt, den wir atmen.
Allein dass es uns gibt – ein Wunder
Ist es nicht ein schier unendlich großer Zufall, dass sich das Leben dann über Milliarden Jahre so weiterentwickelt hat, dass Menschen entstanden sind? Im Buddhismus gibt es ein Gleichnis, das ausdrückt, wie besonders bereits unser bloßes Sein ist: Stellen Sie sich vor, in den Weltmeeren schwimmt exakt eine Schildkröte, und irgendwo auf der Meeresoberfläche treibt ein einzelner Rettungsring. Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau mich gibt, ist so groß wie die, dass die Schildkröte ihren Kopf beim Auftauchen zufällig genau durch diesen Rettungsring steckt.
Es geht noch weiter mit den Wundern. Auch die Dinge in meinem persönlichen Leben haben es ja in sich. Wie meine Kinder in meinem Bauch von einem Zellhaufen zu etwas Vollkommenem gewachsen sind – magisch! Oder wie aus den millimetergroßen Tomatensamen auf meiner Fensterbank mit einer Portion Erde, der richtigen Menge Wasser und den im Frühjahr durchbrechenden Sonnenstrahlen eine Tomatenpflanze heranwächst, von der wir einige Monate später eine Tomate nach der anderen ernten können. Und etwas alltäglicher: Wenn ich in den Bäumen die Vögel zwitschern höre oder wenn ich einen Anruf bekomme von der Mutter und ihrem Sohn, die meinen im Zug verlorenen Geldbeutel gefunden haben.
Wie wäre es, all das sacken zu lassen und inmitten der ganzen Alltagsbaustellen Platz zu schaffen, um für die großen und kleinen Wunder des Lebens einfach mal dankbar zu sein?
Die Falle des „immer mehr“ …
Moment mal! Sich darauf ausruhen, dass es einen einfach nur gibt? Aber von den vielen Plakatwänden im öffentlichen Raum und aus personalisierten Werbeanzeigen im Internet schreit es uns doch permanent entgegen, dass uns erst das Kaufen von immer mehr Dingen zu etwas Besonderem macht. Diese Werbung versucht unsere Zufriedenheitsgefühle an den Besitz und Erwerb von Dingen zu knüpfen. Sie will uns unzufrieden machen mit dem, was wir haben – das sagen Marketingratgeber ganz offen.55 Im Auftrag der Wirtschaft treibt Werbung uns so an, zu konsumieren – immer neue und häufig schnelllebige Produkte, die alle energie- und ressourcenintensiv hergestellt werden müssen. Besinnen auf ein vertretbares Maß an Konsum? Ein unerträglicher Verzicht, flüstert die Werbung. So lassen wir uns dazu verleiten, Dinge zu kaufen, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass wir sie brauchen. Das funktioniert besonders gut, wenn Produkte als „nachhaltig“ angepriesen werden (egal ob sie es auch sind), oder dann, wenn alle anderen auch mitmachen, schließlich will man ja mithalten und nicht hinter seine Nachbarn und sein Umfeld zurückfallen.
Vermutlich haben Sie aber auch die Erfahrung gemacht – ein Upgrade im Leben (neues Handy, größere Wohnung, Urlaubsreise in die Karibik) mag uns kurzfristig glücklich machen, aber schon relativ bald rutschen wir auf unser vorheriges Zufriedenheitsniveau zurück.56 Schon bald kommt uns die Wertschätzung abhanden. Haben wir uns an den neuen Zustand gewöhnt, muss das nächste Upgrade her. Willkommen in der hedonistischen Tretmühle.
Bringt das große Kaufen also wirklich die Erfüllung? Menschen, die materialistischen Werten und Zielen eine hohe Priorität einräumen, konsumieren – wer hätte das gedacht – auch tatsächlich mehr Produkte. Sie haben häufiger Schulden und verhalten sich öfter umweltschädlich. Die Motivation für Job und Ausbildung leidet ebenso unter der materialistischen Einstellung wie zwischenmenschliche Beziehungen. Materialisten stufen ihr persönliches und körperliches Wohlergehen als schlechter ein.57 Hätten Sie das erwartet? Und es kommt noch schlimmer: Diese negativen Auswirkungen lassen sich auch dann beobachten, wenn ursprünglich nicht an Konsum interessierte Menschen erst mal angestoßen werden müssen, sich materialistisch zu verhalten. Der Zusammenhang lässt sich nicht nur auf der Ebene von Individuen nachweisen, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. In EU-Ländern, in denen über die vergangenen drei Jahrzehnte die Werbebudgets deutlich anwuchsen, sank im gleichen Zug die allgemeine Lebenszufriedenheit.58 Die moderne Konsumkultur trägt also nicht nur zur Umweltzerstörung bei, sondern sie unterminiert auch unser Wohlbefinden.
… und wie wir ihr entkommen
Wenn es aber nicht das neue iPad, die Urlaubsreise oder der prall gefüllte Kleiderschrank sind, die uns glücklich machen, was ist es dann? Viel spricht dafür, dass wir uns gut und sicher fühlen, wenn wir merken, dass wir ein Teil der Welt sind und einen Unterschied machen können. Wenn wir dann die positiven Erfahrungen auskosten, können wir maximale Freude aus den guten Dingen in unserem Leben gewinnen. Nicht dass es Ihnen so geht wie der französischen Schriftstellerin und Varietékünstlerin Colette, die konsterniert festgestellt haben soll: „Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt.“59
Als Gesellschaft könnten wir diskutieren, ob wir die Werbung zurückdrängen. Städte wie São Paolo, Grenoble und Genf sammeln damit Erfahrung, den öffentlichen Raum von Werbetafeln zu befreien.60 Den Haag hat als erste Stadt weltweit Werbung für klimaschädliche fossile Energie, Flugreisen, Kreuzfahrten und Autos mit Verbrennungsmotor verboten.61 Auf der individuellen Ebene ist es die Dankbarkeit, die uns aus der hedonistischen Tretmühle befreien kann. Sie kann uns vom Immer-mehr-haben-Wollen und seiner glücksschmälernden Wirkung heilen.62,63





























