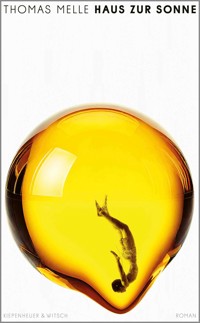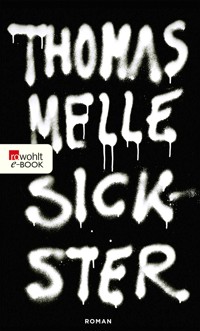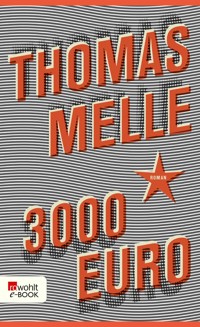9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2016 «Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit zerschossen, und in noch stärkerem Maße bedroht sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich Ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr, wer Sie waren. Was sonst vielleicht als Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort verworfen zu werden, wird im manischen Kurzschluss zur Tat. Jeder Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich, in welchen er bisweilen einen Blick gewährt; eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund, und was Sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. Sie fangen nicht bei null an, nein, Sie rutschen ins Minus, und nichts mehr ist mit Ihnen auf verlässliche Weise verbunden.» Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der manisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Nun erzählt er davon, erzählt von persönlichen Dramen und langsamer Besserung – und gibt so einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in einem Erkrankten vorgeht. Die fesselnde Chronik eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radikales Werk von höchster literarischer Kraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Thomas Melle
Die Welt im Rücken
Über dieses Buch
Auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2016
«Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Kontinuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit zerschossen, und in noch stärkerem Maße bedroht sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird Ihr Leben, wie Sie es kannten, weiter verunmöglicht. Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, besitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich Ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und Sie wissen nicht mehr, wer Sie waren. Was sonst vielleicht als Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort verworfen zu werden, wird im manischen Kurzschluss zur Tat. Jeder Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich, in welchen er bisweilen einen Blick gewährt; eine Manie aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund, und was Sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. Sie fangen nicht bei null an, nein, Sie rutschen ins Minus, und nichts mehr ist mit Ihnen auf verlässliche Weise verbunden.»
Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der manisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Störung genannt. Nun erzählt er davon, erzählt von persönlichen Dramen und langsamer Besserung – und gibt so einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in einem Erkrankten vorgeht. Die fesselnde Chronik eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radikales Werk von höchster literarischer Kraft.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Dan Krauss/Getty Images
ISBN 978-3-644-10002-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
1
Ich möchte Ihnen von einem Verlust berichten. Es geht um meine Bibliothek. Es gibt diese Bibliothek nicht mehr. Ich habe sie verloren.
Das Thema kam bei einem Essen zur Sprache, das zu meinen Ehren ausgerichtet wurde, denn ich hatte einen kleinen Erfolg zu verzeichnen. Es war mir unangenehm, an diesem Essen teilzunehmen, aber ich wollte den anderen nicht die Freude verderben, die sie mir zu machen meinten. Alles in allem war es dann auch eine gelungene Veranstaltung.
Neben mir saß Henry, die in Wirklichkeit einen viel schöneren Namen hat. Seit Längerem hatte ich eine gewisse Schwäche für sie. Wir redeten fast schon vertraut miteinander, wobei ich vermutete, dass diese Vertrautheit eher von ihrer sanften, bedächtigen Art herrührte als von einer tatsächlichen Nähe. Wir redeten, wie wir es schon öfter getan hatten, über Literatur, und anstatt mich von meiner besten und also auch leicht verlogenen Seite zu zeigen, offenbarte ich ihr, dass ich keine Bibliothek mehr besaß.
Es war ein Impuls, dem ich einfach folgte; seit einiger Zeit ging ich mit meinen Verlusten und Mankos offener um als zuvor, obwohl diese Bekenntnisse immer auch schambesetzt und anstrengend waren. Die eigene Katastrophe auszustellen, hat etwas Aufdringliches; es aber nicht auszusprechen, ist noch verquerer, wenn man ohnehin schon einmal bei den Konsequenzen angelangt ist. Bertram, der Gastgeber, bekam das Detail auf der anderen Seite des Tisches mit, und wir redeten über das langsame, aber stetige Anwachsen von Bibliotheken im Laufe des Lebens, überhaupt über die Anhäufung von Zeug und Material, das für manche über die Jahre zu einem nicht unwesentlichen Teil der Identität wird. Wir kamen überein, dass ein solcher Verlust ziemlich unerträglich sein muss. Dann zerstreute sich das Gespräch, und ich wandte mich wieder Henry zu, der ich den Grund für das Verschwinden meiner Bibliothek noch verraten musste, wenn unser Dialog nicht eine auffällige Leerstelle aufweisen sollte. Also sagte ich ihr wie beiläufig und leise, so leise, wie ich sonst selten sprach, aber sie selbst sprach leise, war kaum zu verstehen, zumal sie zu meiner linken und also tinnitusgeschädigten Seite saß: dass ich bipolar sei. Ich schätze, sie wusste das eh. Oder sie wusste irgendwas. Jeder wusste irgendwas.
Im Englischen gibt es die bekannte Wendung «the Elephant in the Room». Sie bezeichnet ein offensichtliches Problem, das ignoriert wird. Da steht also ein Elefant im Zimmer, nicht zu übersehen, und dennoch redet keiner über ihn. Vielleicht ist der Elefant peinlich, vielleicht ist seine Präsenz allzu offensichtlich, vielleicht denkt man, der Elefant werde schon wieder gehen, obwohl er die Leute fast gegen die Zimmerwände drückt. Meine Krankheit ist ein solcher Elefant. Das Porzellan (um ihn gleich durch sein zweites Bild stampfen zu lassen), das er zertreten hat, knirscht noch unter den Sohlen. Was rede ich von Porzellan. Ich selbst liege drunter.
Früher bin ich ein Sammler gewesen. Süchtig nach Kultur, hatte ich mir über die Jahrzehnte eine imposante Bibliothek aufgebaut, die ich mit großer Liebe zum Detail ständig ergänzte und erweiterte. Mein Herz hing an diesen Büchern, und ich liebte es, im Rücken all die Schriftsteller zu wissen, die mich früher geprägt und begeistert hatten, dazu die Kollegen, deren Neuerscheinungen mir immer wieder vor Augen führten, dass die Zeit voranschritt und die Dinge sich änderten. Ich hatte die Bücher nicht alle gelesen, aber ich brauchte sie alle, und ich konnte jederzeit nachlesen, was ich wollte, und mich in einem Buch erneut oder erstmals verlieren. Meine Musiksammlung war ebenfalls beachtlich gewesen, Indie, Elektro, Klassik. Die Sammlung und die Bibliothek waren auch bei mir zu einem Bestandteil meiner Persönlichkeit geworden. Seltsam, sein Ich in die Dinge um einen herum zu projizieren. Seltsamer allerdings, diese Dinge zu verschleudern, ohne es eigentlich zu wollen.
2006 hatte ich den größten Teil meiner Bibliothek verkauft, vor allem die Klassiker. Plötzlich waren mir, dem Maniker, die vorher geliebten Bücher ein Ballast, den ich so schnell wie möglich loswerden wollte. 2007, in der Depression, betrauerte ich diesen Verlust dann sehr. Ein Sammler hatte die Objekte seiner Leidenschaft in alle Winde verstreut, und eine Rückholaktion war nicht möglich. Drei Jahre harrte ich zwischen den dezimierten Beständen aus, dann wurde ich wieder manisch und verkaufte, 2010 war das, den größten Teil der übriggebliebenen Rumpfbibliothek, dazu alle CDs und Platten, die die Händler noch annahmen. Den Rest warf ich weg, genauso wie einen beträchtlichen Teil meiner Kleider. 2011 erwachte ich wieder aus dem irren Rausch und war bestürzt, alles verloren und verscheuert zu haben, was mir vorher lieb gewesen war.
Ich vermisse diese Bücher noch heute. Meist rede ich mir ein, dass auch bei normaler psychischer Konstitution eine Verschlankung der Bibliothek nicht die schlechteste Idee gewesen wäre (aber eine Verschlankung bloß!) oder dass ich irgendwann eh genug gehabt hätte vom ständigen Archivieren und Horten, um einem neuen, befreienden Minimalismus zu frönen, weiße Wände, ein Sofa, ein Tisch mit Gerhard-Richter-Kerze drauf, mehr nicht. Doch die Entscheidungen sind krankheitsbedingt gewesen. Kein freier Wille stand dahinter, und die leeren Wände, der Hall in der Wohnung verhöhnen mich noch heute und illustrieren, radikal gesprochen, das Scheitern eines Lebensversuchs.
Henry wusste nicht recht, was sie sagen sollte. Sie sah mich nickend an und versicherte dann, sie kenne selbst solche Zustände, auch wenn es ihr fern läge, meine und ihre Disposition auch nur im Ansatz miteinander vergleichen zu wollen. Wir redeten noch weiter über diese Zustände, diese massiven Hoch- und Tiefdruckgebiete der Psyche, ohne dass ich beschreiben wollte oder konnte, was meine Krankheit für mein Leben wirklich bedeutete. Kein weiteres der verheerenden Details kam über meine Lippen. Die Erwähnung der Bibliothek musste fürs Erste reichen. Es hatte dennoch nichts Peinliches, mit ihr zu reden, das Vertrauen war spürbar, genauso aber die sich einschleichende Distanz. Die Erkrankung stand, jetzt ausgesprochen, noch manifester zwischen uns, und dennoch bereute ich nicht, es ihr gesagt zu haben. Drei, vier Wochen später verliebten wir uns ineinander. Zusammen kamen wir jedoch nicht. Meine Krankheit machte ihr Angst, mir ihre altadelige, in aller Weltläufigkeit fast engstirnige Familie, und nach einer Woche, die wir wie im Traum verlebten, wussten wir, dass es keinen Platz für uns in der Wirklichkeit gab, auch wenn wir es gegen alle fremden und eigenen Einwände noch einige Monate lang störrisch versuchten. Ich habe ihr seitdem nur wenige Details meiner Geschichte erzählt, wiewohl sie eine der Personen wäre, denen ich alles erzählen könnte und müsste. Dieses Buch ist solchen Unmöglichkeiten gewidmet – und einer Liebe, die sich sofort zurücknahm.
2
Als ich Sex mit Madonna hatte, ging es mir kurz gut. Madonna war noch immer erstaunlich fit, was mich allerdings kaum verwunderte. Man hatte ja verfolgen können, wie sie um 2006 zur Fitnessmaschine mutiert war und sich im Video «Hung Up» abplackte, zwischen Splits und Squats, immer härter, immer extremer, als Gummimensch mit weichgezeichneten Kurven, der seinen Körper nach starkem Willen formt und der Vergänglichkeit so in den labbrigen Arsch tritt. Und jetzt wurde ich Nutznießer dieser Bemühungen; jetzt wurde ich endlich mit den Früchten ihrer schweißtreibenden Körperarbeit belohnt – ich, der ich ebenfalls in den letzten Monaten beachtlich abgemagert war und diesen Prozess auch mehr oder weniger lückenlos dokumentiert hatte, auf meinem Blog, den ich täglich zerstörte und erneuerte. Also war es jetzt so weit, und ich konnte sie mit der größten Selbstverständlichkeit von der Oranienstraße wegpflücken. Wieso sollte ich auch überrascht sein? Sie hatte ihr Leben lang über mich gesungen.
Wie auch Björk. Die allerdings ging mir inzwischen gehörig auf die Nerven. Verloren wuselte sie in Cafés und Bars um mich herum und versuchte, mein Herz mit ihrem brüchigen Elfengesang zur Räson zu rufen. Denn war sie nicht immer meine wahre Popliebe gewesen? Wieso denn jetzt plötzlich Madonna? So schien es aus ihr zu wimmern. Im Gegensatz zu Madonna aber hatte Björk nicht konsequent an sich gearbeitet, sich nicht ständig neu erfunden und gehäutet. Björk schien zu glauben, durch Aufsetzen ihrer Selma-Brille aus «Dancer in the Dark» und ihre schlampige, fertige, mitleidheischende Erscheinung könnte sie meine Jugendliebe zu ihr umstandslos neu entfachen. In ordinär verhangenen Cafés näherte sie sich mir, Laub in den Haaren, gurrte Unverständliches und machte sich dann unverrichteter Dinge davon. Ähnlich Courtney.
An den eigentlichen Geschlechtsakt mit Madonna kann ich mich kaum erinnern. Es wird weder besonders wild noch besonders langweilig gewesen sein. Madonna ist nämlich gar keine Sexbombe, genauso wenig wie Elvis eine war, von dem eine Liebhaberin bekanntlich meinte, er sei ihr im Bett wie ein kleines, unbeholfenes Baby vorgekommen, samt Schnappreflex zur Mutterbrust. Madonna war ähnlich inzestuös unterwegs, schien in mir noch immer ihren Sohn zu sehen, den gefallenen Jesus, dem sie Oralsex verpassen will: I’m down on my knees, I’m gonna take you there, und so dünstete unser Sex den Ruch des Verbotenen aus, ohne dass dieses Ketzertum mich auch nur im Geringsten kickte. Bald erkannte ich auch die alte Frau unter mir, das Fleisch nun doch weicher und labbriger unterm Zugriff, die Masken alle gefallen, die Krähenfüße vom vielen Lachen tief in die Haut gezogen. Die Masken alle gefallen, ja: bis auf dieses wölfische Grinsen, das mir schon in der Fensterreflexion des Buchladens entgegengestrahlt hatte. Madonna bleckte ihre langen Zähne. Wir hatten die Bücher in der Auslage betrachtet, unsere Blicke hatten sich getroffen, ein Erkennen auf meiner, ein Schmunzeln auf ihrer Seite, und ohne ein weiteres Zeichen waren wir in meine zerschossene Wohnung am Kottbusser Tor geeilt, der nasse Teer ein dunkler Spiegel unter unseren Füßen. Sie kam einfach mit. Ich weiß noch, dass ich anfangs staunte, wie gut in Schuss sie war, fast so wie auf den Aktbildern aus den frühen Achtzigern, muss aber auch eingestehen, dass mir ihre Brüste bald viel übersichtlicher vorkamen als angenommen, als von den Medien oder von ihr selbst regelrecht vorgetäuscht. Mindestens zwei Körbchengrößen musste man abziehen, dann stimmte es in etwa. Doch wer war ich, jetzt kleinlich zu urteilen, auch wenn Madonna sozusagen unter meinem Blick zerfiel? Oder vielmehr: Wer war ich, sie zu enttäuschen? Beide hatten wir seit Jahrzehnten auf diesen Moment gewartet. Weitere Gedanken und Bewertungen ließ ich also sein und gab ihr, was sie sich nahm. Am nächsten Morgen war sie standesgemäß verschwunden, ohne ihre Telefonnummer hinterlassen zu haben. Madonna halt. Ich hatte sie nicht anders eingeschätzt.
Dass die Stars plötzlich aus allen Löchern gekrochen kamen, kannte ich schon. Es war immer dasselbe. Kaum war ich mir wieder meiner unaussprechlichen Funktion bewusst, kaum begann ich, die richtigen Signale auszusenden, umschwärmten sie mich wie Sterne ihr schwarzes Loch. Und ich fraß sie alle. Bevor ich mit Madonna abstürzte, war MCA um mich herumgestromert, der gute, inzwischen leider tote MC der Beastie Boys, um abzuchecken, was ich so tat in dieser gottverlassenen Nacht. Im Gegensatz zum ständig und überall lauernden Werner Herzog war MCA eine reine, integre Seele. Er bedeutete mir kurz mit gerecktem Daumen, dass alles okay sei, und so konnten Madonna und ich reinen Gewissens loslegen. Denn MCA war selbst das personifizierte Gewissen des Pop, und was er abnickte, war politisch wie moralisch korrekt, egal, was die Dragqueens vor dem Roses uns hinterherzischten oder die jungen Türken vor dem Oregano, die die Dragqueens skeptisch beäugten und maulfaul dissten. Sollten sie ihre Verachtung intern regeln; mit uns hatte das nichts zu tun. Wiewohl, wer weiß – hatte ich den Dragqueens doch Wochen vorher geholfen, indem ich mich zwischen sie und aggressive, bullige Gangsterrapper gestellt und schließlich, als die Schläger dennoch losprügelten, die Polizei gerufen hatte. Ich, die Polizei! Eine Farce. Aber die Türken verstanden meine Haltung und krümmten mir nicht ein Haar. Schließlich war ich mit ihnen aufgewachsen. Das prägte. Mich, aber vor allem sie. Und die Dragqueens küssten mich in Dankbarkeit.
Als Madonna weg war, war sie weg, und nichts war geschehen. So war es meist zu jener Zeit: Ich hatte ein Erlebnis, das in vorbewussten Phasen für eine Menge Wirbel und Skandal gesorgt hätte – jetzt aber verpuffte jeder mögliche Eklat im Nichts, ob ich nun in Handschellen «sistiert» oder von Madonna verführt wurde. Ich erzählte ja auch niemandem davon, oder höchstens Wochen später, völlig whiskeyzerstört in einem aufs Neue fremdzerwühlten Bett. Die Ereignisse waren intensiv, aber folgenlos. Jeder Tag war wie eine Reinkarnation, und ein neuer, schärferer Reiz musste her, um das Bewusstsein zu befrieden. Und das Gestern war verdrängt wie ein kürzlich verlorener Krieg.
3
Allein das Wort: bipolar. Das ist einer jener Begriffe, die andere Begriffe verdrängen, da sie der Sache angeblich gerechter würden, indem sie der Benennung das diskriminierende Element nähmen. Getarnte Euphemismen, die ihrem Gegenstand durch Umtaufung den Stachel ziehen sollen. Letztendlich passt der alte Begriff «manisch-depressiv» aber, jedenfalls in meinem Fall, viel besser. Erst bin ich manisch, dann depressiv: ganz einfach. Erst kommt der manische Schub, der bei den meisten ein paar Tage bis Wochen, bei wenigen bis zu einem Jahr dauert; dann folgt die Minussymptomatik, die Depression, die völlige Verzweiflung, solange sie nicht von fühlloser Leere aufgelöst und ins dumpf Amorphe verformt wird. Auch diese Phase kann, je nach Erkranktem, wenige Tage bis zwei Jahre dauern, vielleicht noch länger. Ich bin einer derer, die die Jahreskarte gezogen haben. Wenn ich abrutsche oder hochfliege, dann für eine lange Zeit. Dann bin ich nicht mehr zu halten, ob nun im Flug oder im Fall.
Dem Wort «bipolar» ist, neben den durchaus vorhandenen positiven Effekten, die die Umbenennung mit sich brachte – etwa die Einbeziehung gemischter und milderer Krankheitsformen –, eine gewisse Technizität mitgegeben, die den wahren, katastrophalen Gehalt des Begriffs abdämpft und ins Aktenkundige rubriziert: das Desaster als verbraucherfreundlicher terminus technicus. Das Wort ist so lasch, dass manche noch immer nicht wissen, was es eigentlich bedeutet. Und die Unkenntnis spricht Bände. Der gebildete Bürger kann mit dem Begriff «Bipolarität» wenig anfangen – wie erst mit dem Krankheitsbild. Solche Dinge sind, und das soll kein Vorwurf sein, den Menschen noch immer völlig fremd und zutiefst unheimlich. Das Wort ist billig, der Sachverhalt aber erschütternd. Hier die Normalen, selbst von Neurosen, Phobien und echten Verrücktheiten durchzogen, aber alle liebenswert, alle mit einem Augenzwinkern integrierbar, während dort die Verrückten mit ihren Unverständlichkeiten hadern, schlichtweg nicht mehr einzuordnen sind, nicht zu ironisieren oder durch Humor kommensurabel zu machen. Das ist das Fatum der Irren: ihre Unvergleichbarkeit, der Verlust jeglichen Bezugs zum Leben der restlichen Gesellschaft. Der Kranke ist der Freak und als solcher zu meiden, denn er ist ein Symbol des Nichtsinns, und solche Symbole sind gefährlich, nicht zuletzt für das fragile Sinnkonstrukt namens Alltag. Der Kranke ist, genau wie der Terrorist, aus der Ordnung der Gesellschaft gefallen, gefallen in einen feindlichen Abgrund des Unverständnisses. Und er ist sich sogar selbst nicht verständlich, grausamerweise. Wie soll er sich den anderen verständlich machen? Er kann die eigene Unverständlichkeit nur akzeptieren und versuchen, mit ihr weiterzuleben. Denn nichts ist ihm mehr transparent, nicht sein Innenleben, nicht die äußere Welt. Die medizinischen Erklärungen sind Modelle der ärztlichen Ratio, die einen Sinnzusammenhang stiften wollen, um dem Kranken über den Schock des Selbstverlusts hinwegzuhelfen: Diese Neuronen haben also zu stark gefeuert; jener Stress war demnach kontraproduktiv. Mit der tatsächlichen Erfahrung der Krankheit haben solche Ersatzerklärungen aber in etwa so viel zu tun wie die Funktionsbeschreibungen eines Bremssystems mit der Tatsache einer Mehrfachkarambolage. Man steht mit der Gebrauchsanleitung vor dem Unfall und sucht in den schematischen Zeichnungen die Wrackteile zu finden, die doch so plastisch vor einem liegen. Aber man findet nichts. Die Fakten sprengen die Erklärung. Der Unfall ist in der Konstruktion nicht vorgesehen.
Am besten wäre es wohl, man ließe sich als psychisch Kranker, so man den Schub denn überhaupt überlebt hat, ein für allemal stillstellen und versuchte im Weiteren, ohne große Reflexion und Grübelei bis zum Ende durchzuvegetieren. Verloren ist eh das Meiste. Sich mit der eigenen Erkrankung aktiv und analytisch auseinanderzusetzen, strengt an und schmerzt, und es ist gefährlich.
Ich bin zu einer Gestalt aus Gerüchten und Geschichten geworden. Jeder weiß etwas. Sie haben es mitbekommen, sie geben wahre oder falsche Details weiter, und wer noch nichts gehört hat, dem wird es hinter vorgehaltener Hand kurz nachgereicht. In meine Bücher ist es unauslöslich eingesickert. Sie handeln von nichts anderem und versuchen doch, es dialektisch zu verhüllen. So geht es aber nicht weiter. Die Fiktion muss pausieren (und wirkt hinterrücks natürlich fort). Ich muss mir meine Geschichte zurückerobern, muss die Ursachen, wenn sie schon nicht abbildbar sind, wenn sie sich in den Konstruktionszeichnungen nicht finden, durch exakte Beschreibung der Unfälle emergieren lassen.
Ursachen, Ursachen, Ursachen. Nimm zehn Therapeuten, und du hast hundert Ursachen. Gesetzt ist jedenfalls immer wieder die sogenannte Vulnerabilität: eine, wörtlich, Verletzbarkeit, die zwar erst einmal nur die Anfälligkeit für psychische Krankheiten meint, aber durchaus auch als Dünnhäutigkeit zu lesen ist, als eine Art überempfindliche Rezeptivität, welche die Alltagswelt schnell zur Überforderung werden lässt. Zu viele Wahrnehmungen, zu viele Blicke, und die Denke des anderen wird stets miteinberechnet, so dass die Außenperspektive den Innenblick dominiert. Zum Beispiel überfordert das Betreten eines öffentlichen Raumes, eines Theaters oder einer Bar, das Eintauchen in das soziale Spannungsfeld, das dort herrscht, den solchermaßen Vulnerablen sofort. Die Möglichkeiten der Gefahr, die sich in diesem Feld auftun, sind vielfältig. Da wird der Smalltalk zur Falltür, die Blicke der Anwesenden erscheinen wie Attacken, Gesprächsfetzen irritieren die Konzentration, das bloße Rumstehen stößt einen in die größte Verlorenheit. Der Vulnerable muss sich immer wieder überwinden, will er nicht völlig in der eigenen Soziophobie verschwinden. Wenig widerstandsfähig und wirr von all dem Außen, meidet er das Soziale und verlernt es, wenn er es denn je gelernt hat. Oder desensibilisiert sich zwangsweise mit Alkohol und anderen Drogen. Und fängt so an, den Neuronenhaushalt durcheinanderzubringen und langsam kippen zu lassen. Vielleicht. Vielleicht ein Grund, eine Ursache.
So haben, eine Zahl, sechzig Prozent aller Bipolaren eine Vorgeschichte des Substanzenmissbrauchs. Bedingt nun die Krankheit den Missbrauch, der Missbrauch die Krankheit, oder ist das eine Wechselwirkung? Es ist nicht gut zu erkennen. Hält man Ursachen ins Licht, werden sie durchsichtig und fadenscheinig. Einerseits geben Ursachen einem Erklärmodule in die Hand, mithilfe derer man sich und die anderen beruhigen kann, und sei es anhand angeblicher Traumata. Andererseits ist gar nichts gewonnen, es sind Simplifizierungen, Zaubersprüche, mithin Lügen. Die Medizin ist noch immer eine tastende Wissenschaft, trial and error seit Jahrhunderten. Die Medikamente verdanken sich meist Zufallsfunden. Die Psychologie ist der Logik von Ursache und Wirkung verhaftet. Und am Ende ist selbst das Gähnen noch nicht erklärt.
Ich kann nur sagen: So und so ist es bei mir gewesen (und so wird es hoffentlich nie wieder sein). Was davon Ursache ist, was Folge und was von der Krankheit nicht betroffener Umstand, ist letztgültig nicht festzustellen. Also muss ich erzählen, um es begreifbarer zu machen.
1999
1
«Etwas stimmt nicht.»
Darauf konnten wir uns einigen. Lukas meinte es zwar anders als ich. Aber er war klug und hielt den Satz so allgemein, dass auch ich ihm zustimmen konnte. Etwas stimmte also nicht. Ich meinte: mit der Welt. Er meinte natürlich: mit mir.
Ein Hahn krähte. Es war ein Spaßobjekt in Form eines Hahns, das, wenn bewegt, blecherne Töne von sich gab. Andreas hielt das Plastiktier in der Hand und ließ es wiederholt aufkrächzen. Wahrscheinlich war das eine Art ratloser Scherz, eine Persiflage auf die Trigger meiner Paranoia: Da ist ein Signal, ein Zeichen, ein Krähen, ja. Es ist für dich. Und es ist nichts. Es ist ein Witz. Wach auf.
Die erste Nacht meines Wahns lag hinter mir. Ich erinnerte mich schon jetzt kaum mehr an sie. Gewiss hatte ich trotz aller Aufgescheuchtheit geschlafen. Ich hatte mich sicher auch mit Bier beruhigt, was die Mediziner tatsächlich als Selbstmedikation bezeichnen. So schnell ändern sich nämlich die Bewertungen: Was eben noch das Besäufnis eines Slackers war, ist einen Tag später die Selbstmedikation eines Kranken.
Ratlos saßen die Freunde um mich herum, morgens, am Küchentisch. So etwas war ihnen noch nicht untergekommen. Man hatte einmal von einer Jurastudentin erzählt, die am Tag vor dem Examen ausgerastet sei und sich am Telefon als ihre Großmutter ausgegeben habe. Das hatte mich natürlich aufhorchen lassen, denn ich war empfänglich für solche Geschichten. Jetzt war ich im Begriff, selbst eine solche Geschichte zu werden. Und die Freunde saßen erst einmal da und wussten nichts zu sagen. Sie blickten mich an, verstohlen bis irritiert.
Knut versuchte in einer Gefühlswallung als Einziger, den Fluch, die Ratlosigkeit zu durchbrechen. «Aber das stimmt doch alles gar nicht!», rief er mit rotem Kopf ins Schweigen. Ein guter, fast ein großer Versuch, der viel zu selten unternommen wird. Keinem Arzt würde ein solcher Satz über die Lippen kommen, ganz im Gegenteil, in den Patientengesprächen wird nichts bestritten, alles nur notierend wiederholt: «Und alle kennen Sie?» – «Ja, alle kennen mich.» – «Seit wann?» – «Seit, ich weiß nicht.» – «Aha.» – «Aha.» – «Und hören Sie Stimmen?» – «Was?» – «Stimmen? Hören Sie?» – «Ja, Ihre. Ganz deutlich.» – «Das meine ich nicht. Andere Stimmen?»
Ein «Ja» heißt dann automatisch «schizophren», ein «Nein» noch nichts, es lässt alle Optionen offen in diesem Multiple-Choice-Verfahren, das die Antworten des Erkrankten nie in Frage stellt, alles abnickt. Solche Praktiken werden ihren langbewährten Sinn haben, und die meisten Paranoiker sind natürlich kaum von ihren Überzeugungen abzubringen. Doch manchmal frage ich mich, ob ein Zwischenruf von berufener Instanz, ein schlichtes Negieren der Wahnvorstellungen, vielleicht en passant, im Ton der Nebensächlichkeit, nicht doch hilfreich sein könnte: «Was Sie denken, stimmt übrigens nicht, aber … –»
Knut jedenfalls versuchte es. Oder vielmehr brach der Versuch unkontrolliert aus ihm heraus, denn Knut war bisweilen ein Hitzkopf, der seinen roten Haaren alle Ehre machen zu wollen schien.
«Aber das stimmt doch alles gar nicht!»
Ich weiß noch, wie ich ihn anstarrte, wie sich ein Hiatus öffnete, in dem die Wirklichkeit aufschien, die normale Welt von vorgestern, die einigermaßen gefestigte Ordnung, die ich kannte. Ich weiß noch, wie ich ihm für ein paar Sekunden, während derer die anderen betroffen schwiegen, einfach glaubte, glauben konnte. Vielleicht waren meine Gedanken, die ja vor allem aus Empfindungen bestanden, einfach nicht wahr? Vielleicht stimmten sie tatsächlich nicht. Sie verwandelten sich ja eh minütlich, hatten keinen neuralgischen Punkt, keinen Anker irgendwo, keine Form. Doch was stimmte dann? Und was meinte er genau mit «alles»? Irgendetwas hatte sich doch ereignet, sonst säßen wir nicht hier. Und schon war der Augenblick möglicher Klarheit dahin, und ich verstrickte mich wieder in einen Wust aus wirren Mutmaßungen. Rein innerlich, unausgesprochen allerdings.
Denn die Angst ließ mich verstummen. Nicht nur waren meine Gedanken zu wild und neu, als dass ich sie auf irgendeinen Begriff hätte bringen können, sondern war es mir aus Furcht und Erschrockenheit kaum möglich, überhaupt den Mund zu öffnen. Ich war noch zu durchgerüttelt, zu fertig vom vergangenen Tag. Die Panik steckte dumpf in mir, und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten, wo innen und außen war. Ich sah die Freunde nur verständnislos an, dann senkte sich der Blick wieder auf die Tischfläche, wo er haften blieb. Der graue Himmel spiegelte sich matt im Lack. Im Kopf war glühender Matsch. Es waren doch dieselben Freunde von früher, dieselben sofort erkennbaren, vertrauten Gesichter und Gemüter, und doch war alles anders, eine große Fremdheit zwischen uns, eine Grenze aus Unaussprechlichem. Wieder krähte es. Ich war so allein wie nie.
The day the whole world went away. Man muss sich das vorstellen wie eine Pubertät im Zeitraffer, eine prompte Umwertung aller Werte und Ansichten, das Öffnen sofort geblendeter Augen, den Verlust der Unschuld, und das eben nicht über Jahre, sondern innerhalb eines Tages, in Stunden, fast mit einem Wimpernschlag. Die ganze Welt ist plötzlich anders strukturiert als bisher angenommen. Die Prinzipien und Gesetze sind noch nicht durchschaut, aber schmerzlich spürbar, bis in die alarmierten Nerven hinein. Der Novize taumelt, hadert, rast und schweigt. Er versteht nicht und verstummt. Dann brüllt er los, aus Trotz und aus Angst. Das Gewohnte gibt es nicht mehr, alles besteht aus Unbekannten, man selbst ist ein Fremdkörper im Fremdkörper Welt. Das Bewusstsein hat jeden Halt verloren.
«Die Leute verhalten sich so seltsam», stammelte ich.
«Natürlich verhalten sie sich seltsam. Weil du dich seltsam verhältst!»
Ja? Wieder dieser kurze Augenblick einer möglichen Umkehr, dieses Aufscheinen der Normalität, Hebelgriff des gesunden Menschenverstands: Stimmt, ich verhalte mich abstrus und seltsam, ich bin durch die Stadt gerannt und habe fremde Leute angesprochen. Bizarr, was ist da los? Doch dann sofort der Gedanke: Sie sind ja nicht fremd. Sie kennen mich. Seit wann?
Als alles nichts half, fing Lukas mich wieder ein: «Etwas stimmt nicht.» Da nickte ich, dem konnte ich zustimmen. Etwas stimmte nicht, und zwar grundlegend, bis in die Basis, bis ins Wesen der Dinge hinein. Dieses Wesen der Dinge musste ins Krankenhaus, nicht ich, wie es meine Freunde vorschlugen. Sie überredeten mich dazu, erst einmal die Wohnung zu verlassen.
2
Die Straßen durchquerte ich wie bekifft. Der Beton schien, wenn ich mich nicht drauf konzentrierte, unter meinen Füßen nachzugeben; wurde ich mir dieser Empfindung aber bewusst, verschwand sie sofort wieder. Alles wirkte künstlich ausgeleuchtet, die Häuserfassaden standen da wie Filmkulissen. Die Atmosphäre war aufgeladen und scharf, ein Rauschen drängte sich aus der Ferne auf, nicht hörbar, aber physisch drängelnd, eher Druck als Geräusch. Selbst die Luft schien zur Oberfläche geworden zu sein. Gestern noch hatte es keine Grenzen mehr zwischen mir und der Welt gegeben, totale Auflösung im Rausch der Zeichen; jetzt war ich völlig isoliert von allem um mich herum. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu orientieren in diesen Straßen, dabei kannte ich mich doch eigentlich sehr gut aus hier. Aber es gab nichts Eigentliches mehr.
In einer türkischen Restaurantkantine namens «Deutsches Haus» aßen wir Linsensuppe und Köfte. Es war das Erste, was ich seit Tagen zu mir nahm. Das Essen fiel mir schwer, weil ich mir beobachtet vorkam, Angst vor den Blicken der anderen Gäste hatte. Als ein Kamerateam die Räume betrat, um den Anwesenden Reaktionen auf das Erdbeben abzunötigen, das die Türkei am Tag zuvor erschüttert hatte, wollte ich fast wieder alles ausspeien. Natürlich bezog ich die laufende Kamera gleich auf mich, auch wenn sie nicht einmal in meine Richtung filmte. Das hieß in meiner Einbildung: Man wollte mich, von oberster Stelle angeordnet, auf meine neue Rolle vorbereiten. Knut musste ob der Absurdität der Situation lachen, denn er merkte sofort, wie das Kamerateam meine Paranoia befeuerte.
Erste Monologe schossen aus mir hervor. Ein Kommilitone von Andreas und Lukas war zu uns gestoßen, und seine Hornbrille sowie die spitzbübische Süffisanz, die er ausstrahlte, machten mich gleich aggressiv. Ich hatte einen neuen Feind gefunden, dabei tat er gar nichts Böses. Er redete lediglich von irgendeiner Gastfamilie, die ihm nach einer Magenverstimmung eine Banane gereicht hätte. Das habe geholfen. Vorher musste ich also selbst berichtet haben, wie oft ich in den letzten Tagen gekotzt hatte, und die Bananengeschichte war wohl als Ratschlag gemeint. Obwohl diese «Banane» immerhin eines der ersten Wörter war, die ich nichtmetaphorisch nehmen konnte, torpedierte ich seine Einlassungen, setzte ein paar schnittige Kommentare ab und nannte die um mich speisenden Türken obendrein noch «Börekzuhälter». Andreas prustete ein «Spasti» hervor, worauf ich breit grinsen musste. Doch kam es mir vor, als würde ich dieses Grinsen nur spielen, als hätte ich jedes Grinsen bisher nur gespielt, mein ganzes Leben lang. Dann hielt ich mich wieder zurück, um den Hornbrillenträger erkennbar zu ignorieren, gleichzeitig das Kamerateam mit Blicken in Schach zu halten und meine kruden Gedanken zu ordnen, die heiß liefen. Das Erdbeben, dessen verheerende Folgen auf einem kleinen Fernseher zu sehen waren, hielt ich für inszeniert. Einen Augenblick lang wollte ich wieder weinen, dann durchfuhr mich ein unverhältnismäßig lautes und völlig untypisches, mir wesensfremdes Gelächter, da ich einen Witz des Hornbrillentypen, der mir plötzlich doch sympathisch war, urkomisch fand. Wieder fühlte ich mich wie bekifft, nur schärfer, konturierter, überbelichteter, ohne die ganze Dumpfheit, die das Kiffen sonst mit sich bringt. Meine Augen sahen alles und doch nichts.
Abends war ich wieder allein in der Wohnung und übergab mich drei-, viermal. Die Zeichen, mit denen ich bis obenhin voll und vergiftet war, mussten aus mir raus. Aber es half nichts. Sie blieben in mir drin. Alles blieb drin.
3
«DRIN ‹das ist ja einfach›
14.32 Uhr: Jeder Tod, den ich sterbe, ist ein weiterer Verrat an der Wahrheit. Die Surpriseparty für Lukas endet also vorerst mit meiner Einweisung in die Geschlossene. Wenn man pinkelt, ist die Klotür in der Regel auf. Ein normaler Platz wie jeder andere, eine nicht neue Erfahrung. Unseltsam. Ich würde gerne draußen mitschreiben, nicht hier drinnen bei den Ausgeschlossenen. Wer hat diese Leute kaputtgemacht?
Dr. Mabuse: rock on. Gestern ausgetickt. Keine Griffe hier. Ich habe: ‹keinen Ausgang›. Herr Melle (auch ‹Mehle›) hat heute keinen Ausgang, können Sie ihm vielleicht Zigaretten mitbringen, Herr Noeres. Herr Noeres ist nämlich zuverlässig.
15.12 Uhr: Die Verschwörung meiner Freunde und Freundesfreunde. Donnerstagabend wurde eine konspirative Versammlung bei Lukas einberufen, Informationen wurden über mich zusammengetragen, was weiß wer von welcher neuerlichen Aktion, wohin soll das führen.
Magda war wohl auch dabei: der Magda-Verrat. Leider ist einem natürlich nicht ganz so ersichtlich, warum für die anderen ein Witz ins Kranke ablappt, wo für einen selbst ja noch der normale alte Witz besteht. So wird eine lässige Flugblattaktion ohne auffordernden Charakter zum Anlass für die automatische Einweisung in die Geschlossene. Die krasse Asymmetrie von Sendung und Empfang. Eine nette Geste wird da zum plötzlichen Würgegriff. Welche Mechanismen sind am Werk?
Don’t cry a river for me.
11.30 Uhr: Auch hier bin ich also plötzlich in der Führerrolle, allein durch meine Präsenz. Grotesk. Und so spiele ich Arzt, gebe Ratschläge. Sogar wenn ich schweige, bin ich der Punkt der Vermittlung, ein Freund aller. Gestern kam ein tattriger General alten Schlags, von Gustroff oder so, gleich nach dem Essen zu mir, wurde vom lächelnden Sympatho-Zivi Schritt für winzigen Schritt an meinen Tisch geleitet und nuschelte dann trotz erkennbar luzider und ordentlicher, syntaktisch einwandfreier Struktur des Satzbaus einen größtenteils unverständlichen Monolog in mein Ohr, redete von der Tischordnung und von möglichen, wenn nicht sogar notwendigen Beratungen über diese, man könnte eine Vollversammlung der Patienten, er entschuldige sich für die Störung beim Dessert, einberufen; dann wieder sonderte er leise, kleinteilig genuschelte Wortkaskaden aus seinem fast starren Mund ab. Ich sagte, ich verstehe seine Vorschläge, heiße sie gut (will ihn dabei auf keinen Fall verarschen), ich sage, über diese Anregungen würde ich nachdenken. ‹Herr Gustroff, wir gehen›, interveniert der Zivi entschieden-freundlich zum dritten Mal, wir bedanken und verabschieden uns, Gustroff versetzt, jetzt eher deutlich, man werde sich bald sicherlich über den Weg laufen.
Ich lese: ‹Lichte Gedichte›, ‹Abfall für alle›, ‹Preacher›, Catull und Horaz, wenig Wittgenstein. Wittgenstein ist mir gerade zu verrückt. Luhmannvervollständigung: Die Gesellschaft der Gesellschaft das Gesellschaft.
Zusammenrottung um mich im Raucherzimmer. Ende dieser Notizen.
17.32 Uhr: Gestern die Sehnsucht. Nicht unbedingt, nein, eigentlich gar nicht: nach Sex, sondern nach konkret zwei weiblichen Personen, deren Haut und Nähe. Mehr nicht. Unverständnis. Warum Alleingelassenwerden? Wem soll das nützen?
So traurig.
Wobei, wenn die Sehnsucht ständig erfüllt würde, das Ersehnte plötzlich verschwände. Das Ende der Beziehung: Klammern und Unfreiheit. Gewäsch.
Tee und Kakao in rauen Mengen, und qualmen tu ich, wie der irre Olaf Gemeiner (zu ihm später), Filterzigaretten. Die Romantik der Irren, etwas Besonderes zu sein: Wurzel allen Irrsinns. Ich dagegen immer wieder, in jedem Satz, der Versuch zu sagen: Ich bin ein normaler Mensch. Fresst das und lasst mich endlich in Ruhe mit euren Blicken. Aus euren Blicken bau ich mir ein Haus, sage ich, und ihr, baut euch eure Welt doch alleine. Kommt jemand in den Raum, fällt sein Blick zuerst auf mich, instinktiv gewittert. Schlieren vor dem Auge – weshalb ich auch nichts mehr mit F. zu tun haben will. Schon der Sex war bei ihr Voyeurismus. Schauen wir ihm mal zu, unserem Pornostar. ‹Lost Highway› war nichts dagegen. Jetzt ist sie lesbisch, war klar.
Nicht offen: zu.
Ein Zirkelschluss: die ganze Ethik. Die neue Perspektive ist nicht neu.
Und die Gemeinheiten geschehen ungewollt, im Ironischen, Distanzierten, lakonisch Schmunzelnden. Das nehme ich immer als fies wahr. Warum gibt es hier eigentlich keine Pissoirs auf den Toiletten? Es sind doch nur Männer hier. Es ist dies doch die Männer-Geschlossene, oder habe ich das falsch verstanden?
9.02 Uhr: Der Che-Hippie-Goa-Nettie spielt mir Massive Attack und Funny van Dannen vor (ohne es zu sagen). Ein Beau mit Drogenpsychose seit April malt ein Fadenkreuz an die Tafel, ein anderer hat einen skizzierten Penis zur Pflanze verschnörkelt. Ich zum Beispiel denke ja gar nicht daran, auch nur einen Kreidestrich auf die komische Tafel da zu setzen. Nicht meine Bühne.
Der Drogenbeau fragt mich nach einer Urinprobe. Ich verneine.
Ins Auge schießen: Kreide, Tafel, Fadenkreuz (Zeichnung)
11.00 Uhr:SAUNA UND DOCH SO FERN
13.45 Uhr: Nur kurze Nachfrage: Wie soll man da eigentlich noch Vertrauen haben in die engsten Freunde, wenn noch die kleinsten, vielleicht schrägere-als-sonst Aktionen sofort konspirativ kolportiert und letztendlich wirklich gegen einen verwandt werden? Was sagt die Sprache denn da? ‹Verwandt?› Was, bitte, wer und womit?
Dieser Moment der Entfremdung, ein Zeitblitz im Bewusstsein –
22.34 Uhr: Abends Unruhe. Der General ruft alle Leute mit großem Hallo zusammen und spricht von einer Feuerpolice. Er ist auf der Suche nach seiner Hose. Alle sind wieder bekloppt.
Magda war da, schön. Auch die anderen, Konrad, Lukas, Andrea, Isa, Knut, Andreas: kurz. Ein Brettspiel namens Kuhhandel wurde gespielt. Der Generaldirektor umarmt mich. Olaf Gemeiner (zu ihm später) sagt: ‹Du hast Schübe von Anal in dir.›
Der Direktor dagegen: ‹Darf ich Sie Herr Direktor nennen?›
Wir machen das militärisch: Nachtruhe
Nachtruhe im Direktoratsbett, so machen wir das
Dichter dicht, laut und flüssig inzwischen:
‹7 Freunde›, beschimpft er mich –
‹Und keiner regt sich auf› (ich beim Kuhhandel)
17.47 Uhr: Ulrich Janetzki kontaktieren, gleich nächsten Monat. Rauchen und Schauen. Warten auf Entlösung, mit -t-. Entschuldigung, ich wollte nix Böses. Ich gut. Gut und krank, in Heilanstalt. Wo ist der Grund? Wo ist der Grund?
18.34 Uhr:MÖGLICHE SEMINARE UND DISSERTATIONSTHEMEN
Wittgensteins Nacktheit
Der Schlaf in der Literatur
Eine analytische Philosophie der Literatur
Geschosse in der Literatur des XX. Jahrhunderts
Paranoia in der Literatur des XX. Jahrhunderts
Pynchon und das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus
Ekel bei Brinkmann und Goetz
Drastik des Dramas – Sarah Kane und Werner Schwab
Kritik der Psychoanalyse
Cyberpunk und Neurobiologie
Bernd Alois Zimmermann – die Zeit als Kugel und Depression
Mind the Surface: Kreatiefes Schreiben
ha, haha, haha
haháhahahahá
0.01 Uhr: Wache, automatisch?
im Exil
4.03 Uhr: schlaflos
Ausflug ins Jahr 2008
Leider seh ich Dich nicht, wie Du mich nicht siehst»
(Aus meinen Aufzeichnungen, 17. bis 21. September 1999)
4
Der erste Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik ist meist traumatisch. Die Grenze ist überschritten, die Türen schließen sich. Hier hilft kein Foucault, kein Durchbuchstabieren der diskursiven bis handfesten Machtverhältnisse und Ausschlussmechanismen: Theorie und Geschichte des Wahnsinns gehen keinen mehr etwas an. Hier ist man mit der Praxis konfrontiert, nein, man ist Teil und Objekt einer Praxis, die sich jeglichem subjektiven Einfluss entzieht. Lasse also, der du eintrittst, alle Selbstbilder fahren. Du bist jetzt dort, wo nichts mehr stimmt. Schreie und Schlurfgeräusche begrüßen dich. Und eine aufgeladene Stille, die Art von Stille, die herrscht, wenn schweigende Leute schon zu lange auf etwas warten. Nur warten die Patienten auf nichts Bestimmtes. Auf die nächste Dosis höchstens, auf den ersten Ausgang, eher aber auf die ferne Erlösung. Sie warten ohne Ziel. Es ist eine fremde und durchregulierte, eine bis in die bürokratischen Details unheimliche Welt, gleich neben der normalkranken Welt angesiedelt, ein Haus weiter nur vom Röntgeninstitut gelegen, ein Stockwerk über der Orthopädie.
Mit einem Schlag betritt man das Reich des Wahns, seine Gerüche, Gesichte, Gesichter und Phänotypen. Ich erinnere mich an ein Aufnahmegespräch mit einem kernigen, managerhaften Arzt, der mir in seinem maskulinen Pragmatismus sympathisch war. Ich denke, ich willigte sofort in einen stationären Aufenthalt ein, wohl aus Spaß, Interesse oder zur Beruhigung der Freunde, die neben mir saßen. Sie hatten mich dementsprechend bearbeitet und regelmäßige Besuche versprochen. Ich war nicht bei Sinnen, hatte noch immer nicht begriffen, dass ich den Verstand verloren hatte, was mich gegen die befremdlichen Eindrücke einigermaßen immunisierte. Als Rechercheaufenthalt sah ich es an, fügte mich schmunzelnd, lachte vielleicht heimlich. Teilweise sprach ich in den folgenden Tagen mit meinen Mitpatienten, als wäre ich der behandelnde Arzt. Es hatte also noch nichts Traumatisches; das kam erst später, in der Depression. Ich war einfach zu psychotisch, um zu erkennen, was wirklich Sache war.
Erstmal eine rauchen, dachte ich und ging den langen, mit dunklem Kunstmarmor ausgelegten Gang hinunter. Im Raucherraum spürte man die jahrealte, zeitschwere Routine. Neuankömmlinge wie ich wurden lasch begrüßt oder misstrauisch angestarrt. Ich sagte erst einmal nichts und rauchte mit den anderen, in diesem Taubenschlag aus Nikotin und angespannter Lähmung. Aggression lag in der Luft. Die Leute kamen, rauchten und gingen, Tür auf, Tür zu, ohne viele Worte zu wechseln. Nach zwei Zigaretten stand ich auf und stampfte in mein Zimmer, setzte mich aufs Bett. Mein Zimmernachbar spielte dilettantisch auf seiner Gitarre, nachdem er verkündet hatte, ein Star zu sein. Seine Selbstüberschätzung erkannte ich im Gegensatz zu der meinen sofort. Ich hörte kurz zu, wunderte mich, wie seine verzerrte Eigenwahrnehmung zustande kommen konnte, sprang wieder auf, eilte über den Gang, blickte ins unordentliche Aufenthaltszimmer, checkte die Gesellschaftsspiele und Bücher durch, war sofort gelangweilt und stolzierte zurück in den Raucherraum. Damit hatte ich den Parcours für die nächsten Tage in fünf Minuten abgesteckt.
5
Entgegen der Aussage eines Chefarztes, der ein Jahrzehnt später mein nicht sehr hilfreicher Gutachter werden sollte, nachdem ich mich monatelang in seiner Klinik aufgehalten und ihn dabei nur einmal zu Gesicht bekommen hatte, erinnert der Maniker sich eben nicht an alles. Ganz im Gegenteil: Er erinnert sich an nur wenig. Die Manie sei, was die Erinnerung angeht, eine gnädige Krankheit, schreibt Kay Redfield Jamison, eine Professorin für Psychiatrie, die selbst an einer bipolaren Störung leidet. Die Manie, stellt sie fest, löscht die Erinnerungen größtenteils aus. Mit Abstrichen stimmt das. Jedoch weiß ich nicht, ob ich dies wirklich als Gnade ansehen soll. Der fehlende Zugriff auf die eigenen Taten und Erlebnisse stellt einen weiteren, nachträglichen Kontrollverlust dar, der sich neben all den anderen Kontrollverlusten, die die akute Erkrankung mit sich bringt, zwar sanft ausnimmt, aber gleichzeitig die eh angegriffene Identität des Erkrankten noch weiter in Frage stellt. Ich persönlich wüsste nämlich gerne, was ich während der Schübe alles so gemacht habe, und das möglichst lückenlos. Geht aber nicht. Momentaufnahmen der besonders krassen und einschneidenden Ereignisse sind abrufbar, auch unspektakuläre Augenblicke, einzelne Begegnungen mit Menschen, Fragmente. Vieles, was ich über mein Verhalten währenddessen weiß, weiß ich von anderen. Vieles wissen andere an meiner Stelle. Und doch sind manche Bilder und Situationen so scharf und grell konturiert da, dass der Versuch, auch die Verbindungsstücke zwischen ihnen zu rekonstruieren, nicht ganz hoffnungslos erscheinen will.
6
1999. Der Sommer war ein wilder und doch bedrückender gewesen. Mit meinen neuen Freunden war ich viel ausgegangen, hatte die Euphorie genossen, die Alkohol und Musik mir manchmal täglich bescherten. Es war die Zeit des Cookie’s, des Eimers und des Kunst und Technik. Es war die Zeit von Berlin, eines fast noch größeren Versprechens, als die Universität eines gewesen war, des Versprechens der Großstadt, die uns seit Jahren unüberhörbar rief, mit ihrem Chaos, ihren Clubs, ihrem Beat und dem ganzen Geist, der sich dort versammelt hatte, der Kultur, die uns umtrieb, den Exzessen, die wir wollten. Wir, schreibe ich, als spräche ich für andere und nicht nur für mich; aber ich war ja auch einer von ihnen, einer von uns. Ich war dabei und ließ mich treiben, durchs Nacht- und Tagleben, durch die neuen, heißen Bücher, durch die Zeitungen und Gedanken, durchs noch junge Internet, durch die Seminare, die Stadt. Ich sah mich als Teil von etwas.
Endlich hier, endlich unterwegs – und doch schon von Anfang an eine Bedrückung, die Brust, Atem und Blick verengte. Ich kam mir vor wie ein Slacker, hing manchmal nur herum, soff und war dennoch ein hyperfleißiger Student. Wie konnte das zusammengehen? Es ging. Eine Fernbeziehung, in der anfangs viel Romantik steckte, zerbrach lautlos. Die Tage wurden blasser, die U-Bahn-Fahrten länger. Die Freie Universität war ein echter, kalter Apparat in einem verwunschenen, weit draußen gelegenen Dahlem. Die Seminare gerieten zur Last, aber ich biss mich durch und las alles, manchmal doch wieder gierig. Gegen die Trägheit, die Verlorenheit arbeitete ich offensiv an, eigentlich schon völlig desorientiert, ob nun in den anonymen Menschenmengen draußen oder in den inneren Kontinenten des Nichtwissens, die desto monströser anwuchsen, je mehr ich lernte und wusste. Eine Hausarbeit über Musil schrieb ich so besessen und genau, als hinge mein Leben davon ab, doch nach der zugegebenermaßen schmeichelnden Frage der Professorin, woher ich das könne, war die Arbeit für immer vergessen. Wieso suppte so etwas einfach weg? Wieso hatte ich mich überhaupt derart angestrengt? Die Anonymität an der Universität tat ihr Übriges, die Kontaktangst der Studenten war geradezu absurd, zumal in dem elitär angehauchten Institut, an dem ich studierte. Und ich, der Ängstlichste, war bald ganz auf mich zurückgeworfen.
Träge hing ich manchmal in den Seilen, wusste nicht ein noch aus, wollte es nicht wahrhaben, sprang dann ziellos auf, geisterte durch die Straßen, die Supermärkte, auf der Suche nach der Punica-Oase, nach irgendeinem Produkt, das etwas bringen könnte, fand nichts und schlich zurück in die unbelebte, abweisende Wohnung. Dort saß ich dann ratlos am Küchentisch, schmierte mir ein Brot, das ich nur halb aß, und versuchte, zurück in die Lektüre zu finden. Noch gelang es.
Diese Zustände gab es nicht erst seit Berlin. Es hatte sie schon immer gegeben, in der Kindheit, der Jugend, der Adoleszenz: dieses hartnäckige Gefühl, aus der Bahn geworfen zu sein und ständig einen Abstand zwischen der Welt und mir überwinden zu müssen, und zwar nicht nur für ein paar Stunden oder Tage, sondern grundsätzlich. Und immer, nach irgendeiner Begeisterung, auch ihre verhasste Rückseite: die Nichtigkeit, die Schalheit, die Leere. Hatte mich etwas erfreut und gepackt, wurde es bald tot, faul und ungenießbar. Die Überfülle wich immer einem Vakuum.
So bereits in Tübingen. Dort hatte ich, aufgeheizt und angemacht von einem großen Lernenwollen, 1994 mein Studium mit einem derartigen Elan, einer Energie aufgenommen, dass es manchem wohl befremdlich war. Die Universität ist für den Schulabgänger ja ein Versprechen. Endlich kann der junge Geist seine wahren Interessen vertiefen, unbelästigt von einer teilweise doch recht frustrierten und also einengenden Lehrerschaft, fern von der Familie und den, in meinem Falle, kleinbürgerlichen und zerrütteten Verhältnissen. Sich im Studium neu erfinden, sich weiterfinden, das Wissen mehren, die Fähigkeiten schärfen, das war mein Ziel. Ich wollte ein Streber sein und meinen Bildungsroman leben.
Morgens um acht stapfte ich freiwillig in das Evangelische Seminar, um mit den Theologiestudenten Altgriechisch zu pauken, tatsächlich zu pauken, auf die altmodischste Weise. Dann ging es weiter, in die Seminare und in die Bibliothek, Unerschöpflichkeiten taten sich auf, und was ich früher als gewichtige Literatur gelesen hatte, diente mir jetzt, so überspannt war ich tatsächlich, als Relaxans zwischen den Theorieblöcken. So dachte ich es mir jedenfalls und las Enzensberger und Broch in den Pausen. Ich war begeistert von der Lehre und beseelt vom unbewussten Glück, noch unsichtbar, noch nicht festgeschrieben zu sein.
Ein paar Freundschaften mit analytischen Philosophen entstanden, die meine Lernisolation gegen Ende des ersten Jahres auflockerten. Oft gingen wir etwa nach freitäglichen Videoabenden ins «Depot», einen Houseclub im Industriegelände, und schüttelten uns die Körper frei. Bestimmte Tracks versetzten mich, everybody be somebody, in euphorische Zustände, die ich liebte.
Doch die Dinge bekamen schnell einen Graustich. «TEMPO» wurde eingestellt, was mich seltsam berührte, ich wollte dem Zeitschriftenhändler die Nachricht kaum glauben und dachte, meine Jugend sei nun endgültig vorbei. Die Seminare wurden anstrengender und doch auch langweiliger; ich verlor die Motivation und machte trotzdem weiter. Aber ich merkte, dass etwas grundsätzlich falsch lief. Tief im Inneren hatte ich die Gewissheit, eigentlich nicht studieren zu können, ja, lebensunfähig zu sein. Das tägliche Pensum aus Aufstehen, Anziehen, Losgehen, Griechischunterricht, Seminaren, Nahrungsaufnahme, Bibliothek, Rückweg und Nachtruhe langweilte und frustrierte mich. Ich war es aus Internatszeiten gewohnt, mich in einem sozialen Raum voller Ähnlichgesinnter zu bewegen, so fremd sie mir auch waren. Es hatte da eine Dynamik gegeben, die mich mitgetragen und die ich selbst vorangetrieben hatte; und diese Dynamik gab es nun nicht mehr. Das neue Leben, das losgehen sollte, kam nicht recht von der Stelle. Das Abendbrot, das ich an meinem Schreibtisch aß, schmeckte mir nicht. Die Küche auf meinem Stockwerk des Studentenwohnheims mied ich, aus Scheu vor den BWL- und Lehramtsstudenten, die mich misstrauisch ignorierten. Ich hing durch, die Stimmung wurde schal, auch zwei kurze Liebschaften konnten nichts dagegen ausrichten. Im dritten Semester ließ ich den Griechischunterricht schließlich sein, schwänzte manches Seminar, ging stattdessen auf einen Hügel über der Stadt, um mir das dachziegelrote Elend von oben anzusehen, dieses schwäbische, überhitzte Nest des Idealismus, oder gleich ins Kino, um mich wieder daran zu erinnern, was ich eigentlich machen wollte: Fiktion, nicht Theorie. Wieso war meine Stimmung so schlecht? Wo war ich hier überhaupt gelandet?
Nachts, vor dem Grab Hölderlins, wurde mir bewusst, dass ich mir das alles auf eine perfide, komplizierte Weise nur vorspielte. Dann streunte ich weiter zur Nachttanke und kaufte den Billigwein «Le Patron», mit dem ich Lektüre und Schreibversuche trotzig gegen diese lähmende Erkenntnis aufwiegelte. Aber jeder Morgen, jeder Tag begann mit einer Niedergeschlagenheit, die sich erst am Abend zerstreuen sollte. Ein Jahr Vollgas war Tübingen erst gewesen, und dann ein Jahr Zweifel und Tristesse.
Später, in Berlin, wurde mir klar: Auch wenn sie sich nicht namentlich als solche vorgestellt hatte, hatte ich Bekanntschaft mit einer echten Depression gemacht.
7
In den Wochen vor der Einweisung war ich mir und den anderen langsam, aber sicher abhandengekommen. Ich weiß noch, wie die Hitze mir zusetzte, in jenem Berliner Sommer, wie die Leere nach dem Roman, den ich in der ersten Jahreshälfte geschrieben hatte, mich ratlos machte. Er hieß «Samstagnacht» und spielte auch gänzlich in einer solchen. Fünf Personen erlebten eine unglückliche Partynacht, in der sich die falschen Grundlagen ihrer jungen Leben wie unter dem Brennglas offenbarten: Trauerspiele am Rand der Tanzflächen. Es war als Gegenstück zur damals grassierenden Popliteratur gesetzt, derselbe Hintergrund, aber Negation statt Affirmation, Depression und Aufbegehren statt Saturiertheit. Ich stresste die vierhundert oder fünfhundert Seiten in ein paar Monaten auf den nikotingelben Bildschirm und war danach so fertig wie glücklich. Es war geschafft, und es war, so hoffte ich, gut. Ich schickte das Manuskript an ein paar Verlage und ans Literarische Colloquium Berlin. Die Lawine konnte kommen.
Doch es passierte nichts, der Sommer ging einfach weiter und wurde dünner. Dass es bei der Literatur sehr lange dauern konnte, bis man irgendwelche Reaktionen erhielt, kam meiner angeborenen Ungeduld nicht gerade entgegen. Und das Schreiben des Buches, das nie gedruckt werden sollte, hatte mir einen Kick verpasst, mit dessen Ausläufern ich nun kämpfte. Noch immer war ich aufgescheucht und angespannt von der Anstrengung, die ich unternommen, und der Beglückung, die sich dabei eingestellt hatte. Gleichzeitig fand sich nichts, das meinen erregten Zustand besänftigen oder in eine friedliche Produktivität umleiten konnte. Die Perzeptoren machten zu, die Stimmung ebbte ab.
Ich hatte es ja plötzlich eilig gehabt. Stuckrad-Barre, mein Jahrgang, hatte ein Jahr zuvor sein erstes Buch herausgebracht, dann kam Benjamin Lebert, noch ein Kind, und räumte mit einer Internatsgeschichte ab. Das war mir sympathisch, ich verfolgte und las es alles neidlos, und dennoch setzte es mich unter Druck. War ich nicht der, der diese Zeit mit allen Mitteln der Kunst längst hätte auf den Begriff bringen müssen? Waren es nicht meine Wahrnehmung, meine Sprache, die in dieser ganzen Diskurs-, Text- und Gedankenlandschaft gerade bitter fehlten? Natürlich war das verstiegen und eitel, natürlich war ich mir dessen auch bewusst, aber dennoch nicht imstande, von dieser fixen Idee zu lassen: den Roman zu schreiben. Eigentlich hatte ich nur studiert, um genügend lesen und begreifen zu können und dann bald mit den erlernten und verfeinerten Mitteln die Schönheit der Schande dieser Zeit zu fixieren. Und schon überholten mich die ersten Lockertexter, während ich mit Derrida haderte und mir die Nächte zu Aphex Twin um die Ohren schlug.