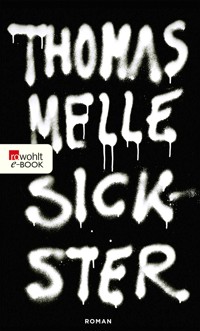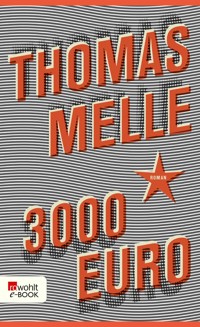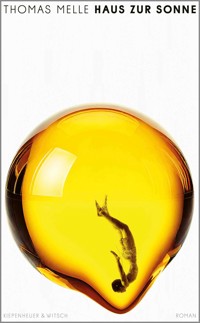
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach seinem weltweit beachteten Buch »Die Welt im Rücken«, in dem er sein Leben mit bipolarer Störung literarisch brillant verarbeitet hat, legt Thomas Melle nun einen Roman vor, der die Grenzbereiche zwischen Autobiografie und Fiktion, zwischen Sehnsucht und Depression und letztlich zwischen Leben und Tod weiter auslotet. Wie viel Selbstbestimmung ist möglich, wenn das Leben von einer psychischen Krankheit fremdgesteuert ist? Wonach sehnt sich einer, der nichts mehr zu verlieren hat? Und wie könnte es aussehen, das letzte Glück? Willkommen im »Haus zur Sonne«, einer Institution, die zugleich Wunscherfüllungsmaschine wie Abschaffungsapparat ist. Lebensmüde und todkranke Menschen liefern sich in diese vom Staat finanzierte Klinik ein, um jeden nur erdenklichen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen und dann – ohne großes Aufsehen – aus dem Leben zu scheiden. Aber will, wer nicht mehr leben will, wirklich sterben? Thomas Melle geht unseren Sehnsüchten und Todestrieben auf den Grund und liefert so eine radikale Skizze der Conditio humana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thomas Melle
Haus zur Sonne
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Thomas Melle
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Thomas Melle
Thomas Melle ist Autor vielgespielter Theaterstücke und übersetzte u. a. William T. Vollmann ins Deutsche. Sein Debütroman »Sickster« (2011) war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Franz-Hessel-Preis ausgezeichnet. 2014 folgte der Roman »3000 Euro«, 2016 »Die Welt im Rücken«, die beide auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis standen. 2022 erschien sein Roman »Das leichte Leben«. Thomas Melle lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wie viel Selbstbestimmung ist möglich, wenn das Leben von einer psychischen Krankheit fremdgesteuert ist? Wonach sehnt sich einer, der nichts mehr zu verlieren hat? Und wie könnte es aussehen, das letzte Glück? Willkommen im »Haus zur Sonne«, einer Institution, die zugleich Wunscherfüllungsmaschine wie Abschaffungsapparat ist. Lebensmüde und todkranke Menschen liefern sich in diese vom Staat finanzierte Klinik ein, um jeden nur erdenklichen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen und dann - ohne großes Aufsehen - aus dem Leben zu scheiden. Aber will, wer nicht mehr leben will, wirklich sterben? Thomas Melle geht unseren Sehnsüchten und Todestrieben auf den Grund und liefert so eine radikale Skizze der conditio humana.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Die Arbeit des Autors am vorliegenden Werk wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert.
© 2025 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Nurten Zeren, zerendesign.com
ISBN978-3-462-31143-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motti
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
Gott, wenn er in unsre Seelen geblickt hätte,
hätte dort nicht sehen können,
von wem wir sprachen.
Ludwig Wittgenstein
Protect me from what I want
Jenny Holzer
1
Die Zusage steckte in einem bläulich schillernden Umschlag. Ich riss ihn auf, warf ihn achtlos auf den Boden, wo er beleidigt vor sich hin schimmerte, und las, dass mein Antrag angenommen sei. Die Nachricht wühlte mich nicht auf, noch ließ sie mich kalt. Selbstverständlich freute ich mich. Aber ich freute mich auch über die Selbstverständlichkeit, mit der ich die Nachricht hinnahm. Meinem Status wurde schlichtweg entsprochen, so empfand ich es. Und mein Leben war vorbei.
Ein Nachbar huschte grußlos hinter mir ins Treppenhaus, auch auf mein »Hallo« antwortete er nicht. Wieso die Bewohner dieser Stadt, zumal in ihren ärmlicheren Vierteln, so gnadenlos unfreundlich waren, hatte sich mir noch nie erschlossen. Ich hob den Umschlag wieder vom Boden auf, hielt ihn ins Licht und betrachtete das matte, funkelnde Blau, das im Rhythmus meines Pulses zitterte. Dann schloss ich den Briefkasten.
Oben in der zerstörten Wohnung mit den zugezogenen Vorhängen und den farbbeschmierten Wänden setzte ich mich hin und nahm erst einmal einen lauwarmen Schluck Cola zu mir. Lange Zeit war ich nicht nur von den Medikamenten, sondern auch von Cola abhängig gewesen. Jetzt war ich ganz ohne mein Zutun entwöhnt von dem schwarzen Gift, die Sucht war einfach eingeschlafen, und ich kaufte es nur hin und wieder aus bloßer Ratlosigkeit und Entscheidungsschwäche. Die Cola, die ich jetzt trank, schmeckte wie eine fade, verblassende Erinnerung an meine dunkelsten Zeiten: klebrig, chemisch, charakterlos.
Erneut nahm ich den Brief zur Hand und betrachtete ihn: klare, serifenlose Lettern auf geriffeltem Papier. Beigelegt war ein kleinformatiger Umschlag mit einer Internetadresse und einem Zahlencode darin. Dort, so schrieb man, seien alle weiteren Instruktionen hinterlegt, samt eines ausführlichen Fragebogens, den ich innerhalb der nächsten zwei Tage ausfüllen möge. Ich wollte mindestens drei, vier Stunden warten, bis ich dieser Aufforderung nachkommen und ins Internet gehen würde. Denn gewiss würden sie meine IP mitloggen. Und ich wollte nicht zu bedürftig oder begeistert wirken.
Sonst rauchte ich so, wie andere atmeten: ohne darüber nachzudenken, pausen- und gedankenlos, automatisch. Die Zigarette, die ich mir jetzt ansteckte, war anders. Sie rauchte ich mit einer gewissen Feierlichkeit und Schwere, würdigte jeden Zug an ihr, so als wäre er mein letzter. Durch den sich verteilenden Rauch schaute ich mich um wie mit fremden Augen. Die Wohnung war vom Rauch längst völlig vergilbt, nicht nur von den manischen und depressiven, sondern auch von den normalen Jahren zuvor; in den Ecken hingen nikotinverklebte Spinnweben. Überall klebte Farbe. Manche Kartons hatte ich noch immer nicht ausgepackt – wobei das »noch« sich auf einen Zeitpunkt bezog, der nie eintreten würde, zumal jetzt, nach der Zusage. Die Kartons waren und blieben einfach zu. Es gab ja auch nicht mehr allzu viele davon. Mein Hab und Gut war in den letzten Jahren erneut verkauft und verstreut worden, und zwar von mir, und zwar unfreiwillig. Ich hauste hier auf Abruf, zwischen den paar Kartons, die ich so, wie sie waren, einfach wieder mitnehmen würde, wohin auch immer, zur nächsten Station. So hatte ich es bisher angenommen.
Aber jetzt war klar, die Kartons würden hierbleiben, vereinsamt in der Ecke stehen und irgendwann einfach entrümpelt werden. Ihr Besitzer wäre nicht mehr aufzufinden.
2
Denn die Katastrophe war wieder passiert, und zwar intensiver und länger denn je. Ich hatte nicht für möglich gehalten, dass das geschehen könnte, und dann auch noch schlimmer, noch zerstörerischer als die Male davor. Jede Manie nimmt einem etwas, nimmt einem sogar sehr viel, aber diese, die letzte Manie, sie hatte mir wirklich alles genommen.
Ich hatte gehofft, mit meinem damaligen Buch über die bipolare Störung auch für mein Leben nachhaltig etwas geordnet und abgeschlossen und dieses Monstrum von Krankheit vielleicht auf irgendeine Weise domestiziert zu haben. Wer sich derart mit den Symptomen und Vorzeichen auseinandergesetzt hatte, sprachlich und reflexiv, der konnte doch darauf hoffen, auch im realen Leben auf besondere Weise sensibilisiert und gefeit zu sein? Nein? Ich hatte mich bei der Niederschrift des Buches noch einmal mit aller Kraft gegen die Krankheit gestemmt – und verloren. Mein Talent kam gegen die Krankheit nicht an, sie war stärker gewesen, am Ende. Sie hatte einfach wieder zugeschlagen, wie sie wollte, trotz aller Medikamente. Und ich? Ich hatte da gar nichts zu melden. Ich war übergangen und überfahren worden. Es hatte mich erneut weggeflutet.
Über zwei Jahre hatte diese Manie gedauert. Zwei Jahre, innerhalb derer ich meine Freundschaften und mein Geld verlor, meinen Ruf erneut ruinierte, meine Wohnung zerstörte, Straftaten beging. Alles dasselbe wie früher, alles noch ein paar Nummern schlimmer. Die Vernichtung hatte gewütet im Kostüm eines bösen Clowns. Wenn man bedenkt, dass Manien meist nur Wochen dauern, kann man sich schon fragen, wieso ausgerechnet ich dieses absurde Jahreslos gezogen hatte. War ich dran, dann immer einmal länger und krasser als die anderen. Die Katastrophe war diesmal so vollkommen, dass ich zumeist die Augen vor ihr verschließen musste. Die Details waren zu schmerzhaft.
Die Farbe allein. Ich muss selbst einmal voller Farbe gewesen sein, über Tage vielleicht. Ich hatte angefangen zu malen, bescheuerte, wilde Bilder, als Künstler, der ich plötzlich war, hatte dabei die Wohnung mehr und mehr zugekleckst. Und dann muss ein Impuls dazu geführt haben, mich selbst anzumalen. Die Farbe am Kopf, rot oder braun: wie ein Psycho aus irgendeinem Psychofilm. Natürlich hatte ich wohl auch versucht, die Farbe abzuspülen, denke ich, aber nur oberflächlich, gehetzt, der Rastlosigkeit im Kopf entsprechend. Sicherlich bin ich auch hinaus auf die Straße gestürmt und fand dann diese Färbung, diese Markierung nur natürlich, natürlicher als alles vorher und sonst. Ich war von Geburt an markiert gewesen, dachte ich wohl, und jetzt sah man es mir auch von außen an, und das mit der entsprechenden Grellheit. Seht her, der wahrhaft Markierte! Gewiss hatte ich bald vergessen, dass ich so aussah, und war umso auffälliger und verrückter durch die Straßen gelaufen.
Der Unglaube, manchmal, dass wirklich ich das war. Dass es mich wieder erwischt hatte, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, und dass ich diese Krankheit überhaupt hatte. Tausendmal mit auseinandergesetzt, und doch wieder geflogen und gestürzt. Zwei Jahre, und wieder die schlimmsten.
Dann folgten zwei weitere Jahre als depressives Elend, voller Scham und Schande, eigentlich unfähig zu leben: eben doch Bewusstwerdung der Verluste und der unzähligen Scherben, ohne sie aufsammeln zu können, Atemnot im Schuldenberg und absolute Todesnähe. Große Lähmung, Kollaps der Neuronen, monatelang, jahrelang. Der Unglaube, die Demütigung. Alles zu Ende, wieder alles zu Ende.
Es war ein jahrelanges Warten auf nichts. Der Januar war vom langsamen, sich über Wochen dahinziehenden Zusammenbruch der Manie geprägt. Der Februar war ein bloßes Verharren gegen den Selbstmord in tiefster, sprachloser Depression. Der März war Trauer. Der April war graue Indifferenz. Im Mai wollte ich noch immer sterben, konnte es aber nicht. Dann ging ein Jahr vorbei, amorph und grau, und ich lebte noch immer. Dann ein weiteres, zäh und mit einer Distanz zu allen Dingen. Ich hatte die Phase der Umsetzung verpasst. Und doch hatte der Entschluss ja gestanden, und ich war bereits tot, verhielt mich jedenfalls so, völlige Passivität, keine Aktion mehr, keine Handlung, wirkliche Lähmung. Eine Pseudoform, eine innere Variante vom Cotard-Syndrom vielleicht: fälschlicherweise annehmen, man sei schon tot.
Die sonstige Rhetorik war auch verloren. Wenn ich versuchte zu schreiben, kam nichts mehr heraus, was den alten Rhythmus hatte oder die alte Wucht; diese angeblich gut geschriebenen Sachen kamen mir eh wie eine Lüge vor und ewig weit weg, wie von einer anderen Person – was ja auch der Wahrheit entsprach.
Und es war mir auch noch völlig egal, weil ich mir völlig egal war, weil ich sterben würde, weil ich schon tot war, so lautete der Beschluss von irgendwo innen oder oben, längst besiegelt.
3
Jetzt, da der Brief vom Haus zur Sonne kam, war die Depression jedoch nicht mehr ganz so drückend und scharf und dunkel, sondern nüchterner, ja rationaler. Und immerhin schien ich mit meiner letzten Manie einigermaßen Frieden geschlossen zu haben. Oder ich hatte, um im Bild zu bleiben, kapituliert, und sie, die Siegerin, ließ mich nun für kurze Phasen in Ruhe, da sie eh gewonnen hatte. Ich versuchte, es alles in einer mittleren Unschärfe zu belassen, versuchte, mich nicht ständig zu erinnern. Die Scham brannte nicht mehr ganz so heiß und vernichtend wie vorher. Jedenfalls nicht minütlich.
Aber was hatte ich dafür verlieren müssen? War ich überhaupt noch eine Person? Oder einfach nur ein von der Krankheit gedemütigtes und von sich selbst traumatisiertes, vernarbtes Bündel, das sich diesen sogenannten Frieden mit der eigenen Stumpfheit erkauft hatte, weil es einfach nicht mehr auszuhalten gewesen war?
Die totale Verbindungslosigkeit hielt ebenfalls weiter an. Ich war wirklich mit niemandem mehr verbunden, höchstens mit Ella, und der Zeitkanal nach vorne, die Perspektive in eine Zukunft, innerhalb derer sich das ändern könnte, war verschüttet. Ich war einsam und würde es bleiben. Ich wollte so einsam eigentlich nicht sein, konnte aber auch nicht mehr viel mit Menschen zu tun haben, zumal die meisten einfach weg waren, weg aus meinem Leben, und manche waren sogar mit einem gehässigen Grinsen gegangen. Ich hatte so viel verloren, dass es keinen Sinn mehr hatte, etwas zurückgewinnen zu wollen. Wenn ich mich mit jemandem traf, spielte ich ihm eine Rumpfversion des Menschen vor, der ich einmal gewesen war. Mehr ging nicht. Wer ich wirklich war (oder eben nicht mehr war), blieb im Verborgenen. Irgendwo, da im Dunkeln, da gab es wohl jemanden, aber wen, das wusste ich selbst nicht mehr. Und er war sich und mir absolut nichts mehr wert.
Der Tod war mir zur zweiten Natur geworden. Ich war eigentlich schon weg, obwohl ich doch endlich wieder ein kleines, zartes Licht zu sehen begann, obwohl der Schmerz nicht mehr ganz so erbarmungslos brannte. Je besser es mir aber ging, desto rationaler und nüchterner traten paradoxerweise die suizidalen Gedanken hervor. Sie waren nicht mehr nur der Verzweiflung gedankt, sondern auch der Vernunft.
4
Die nächsten Tage vertrödelte ich wachsam. Mir war aufgegeben worden, mein Umfeld über eine baldige »Rehabilitationsmaßnahme« in Kenntnis zu setzen und einen Aufenthalt in einem projektgestützten Sanatorium anzukündigen. Das war schnell getan, so übersichtlich, wie mein Umfeld war. Nach der Rückenoperation war mir von den Ärzten eh eine Reha-Maßnahme nahegelegt worden, so dass sich der kommende Aufenthalt von selbst in die Logik der Ereignisse einfügte. Ich ließ die Neuigkeit im Gespräch beiläufig fallen und kommentierte sie gleichzeitig mit dem skeptischen Missfallen, das alle meine Aktionen und Auslassungen begleitete. Daniel und Laura, zu denen ich noch Kontakt hatte, und vor allem Ella unterstützten mich in diesem Vorhaben und sprachen mir gut zu. Jede Aktion, jede Maßnahme war ihnen willkommen, Hauptsache, es änderte sich etwas, nach dieser bleiernen, viel zu langen und siechen Zeit.
Ansonsten übte ich mich im Verschwinden und begann, die verbliebenen Sachen zu ordnen, um bald hoffentlich nur noch das Nötigste zu besitzen.
So sah es also in den Kartons aus: ein paar Kabel, ein paar Restbücher, die keiner haben wollte, am wenigsten ich, Kleiderbügel, Papiere, unnütze Geräte und diverses Geschirr. Messie ohne Masse. Was sollte ich da noch ordnen? Die Schritte hallten in der zerstörten Wohnung. Am besten alles einfach wegwerfen, dachte ich. Aber dazu war ich noch zu feige. Ich begann, wenigstens den Papierkram irgendwie in Form zu bringen, alte Mietverträge auszusortieren, unnütze Kontoauszüge wegzuwerfen, in die Jahre gekommene psychiatrische Gutachten noch einmal durchzulesen und dann endlich zu zerreißen. Langsam wurde es weniger, ohne dass sich eine Ordnung einstellen wollte. Es sah alles nach einem wertlosen, von niemandem gewollten Nachlass aus.
Als dead man walking hinkte ich pro forma manchmal noch durch die Straßen. Mit einem solchen todesnahen Bewusstsein zu leben, war eine seltsame Erfahrung, weil sich alle Erfahrungen, die ich machte, letztendlich unwirklich anfühlten, fast schon wie vergangen. Ich sammelte eigentlich keine echten Erfahrungen mehr, denn die Stelle, um die herum sich die Erfahrungen hätten ansammeln sollen, war schon vakant. Es gab diese Person nicht mehr, die da etwas erfahren sollte, und ihr Körper war nur noch auf Abruf da. Es gab da nichts, was die Erfahrungen festhalten konnte oder wollte. Innerlich war die Person schon gegangen, und äußerlich war der tatsächliche Abgang nur noch eine Frage der Zeit.
5
»Und ich soll dich da wirklich nicht besuchen?« Ella rührte verdrießlich ihren Yogi-Tee um. Teetrinker waren mir eigentlich suspekt, aber bei Ella mochte ich es, weil ich Ella eben mochte.
»Nein, es gehört wohl zum Konzept, dass man die erste Zeit über ohne Besuche bleibt. Das ist in Altersheimen auch so.«
»So alt bist du noch nicht.«
»Aber bald. Man soll sich eben ganz dem Programm widmen und einleben können. Die Außenwelt irritiert da nur.«
»Und das hilft bei Depressionen? Ist das eine Therapie, oder was ist das?«
»Ein therapeutisches Gesamtpaket. Heißt es. Ich weiß es doch auch nicht so genau.«
»Ich will vorher mit den Ärzten sprechen.«
»Nein. Ich möchte das diesmal alleine durchziehen.« Fast hätte ich angefügt: Du musst mich nicht mehr retten.
»Ich mag es nicht, wenn du mich ausschließt«, sagte sie. »Nimmst du deine Medikamente?«
»Zum zehnten Mal: Ich nehme sie immer«, sagte ich. »Ich habe sie auch vor der Manie genommen. Wieso glaubt mir das keiner? Wieso wollen die Leute mich zu meinem eigenen Sündenbock machen?«
»Will ich doch gar nicht.«
»Doch, dieses Er-ist-selbst-schuld immer. Ihr wollt eine einfache Erklärung, und ich soll schuld sein. Bin ich aber nicht.«
»Ich glaube dir ja. Wer ist ›ihr‹?«
»Ach, ihr alle da draußen«, sagte ich und machte eine diffuse Handbewegung durch die Luft, über die wir lachen mussten. »Und ich schließe dich nicht aus«, fügte ich hinzu, »das sind einfach die Regeln.«
»Okay. Also alleine. Aber nach drei, vier Wochen kann ich dich besuchen?«
»Ja, so was. Aber ein Bruch muss her, eine Zäsur. Man muss völlig aus seinem alten Leben herausgenommen werden. Ach«, seufzte ich, »ich hoffe einfach, der Aufenthalt wird mir endlich wieder Struktur geben. Innere und äußere.«
»Das wäre schön. Du bist eh schon auf dem besten Weg.«
»Ich tu, was ich kann«, sagte ich und kam mir vor wie beim Therapeuten, dem ich irgendwelche vorgestanzten Phrasen anbot, um ihn zufriedenzustellen. Ella schien das zu spüren.
»Ist damit denn eine längerfristige Psychotherapie verbunden, also, über den Aufenthalt hinaus?«
»Ja, wenn ich will.«
»Paar Wochen Therapie bringen gar nichts.«
»Schon klar.«
»Bitte nimm das wahr.«
»Ich bin doch dabei.«
»Du weißt, was ich meine. Und das ist körperlich? Körperlich und seelisch?«
»Ja, der Ganzheitsgedanke. Das volle Programm.«
»Wird dir guttun. Den Rücken stärken, den Bauch schrumpfen lassen. Obwohl ich deinen Bauch mag.«
»Danke. Und meine Glatze?«
»Das ist noch lange keine Glatze. Aber ich liebe sie sehr.«
»Eigentlich bist du nur froh, dass ich keine Chance mehr bei anderen habe.«
Sie musste lachen, und ich lachte still mit. Mit ihr konnte ich noch auf leichte, manchmal beschwingte Weise reden, egal, wie schwer es mir ums Herz war. Dass dies vielleicht unser letztes Treffen sein könnte, versuchte ich zu verdrängen, aber es gelang mir nicht. Ich würde sterben, und ich würde Ella höchstwahrscheinlich nicht eingeweiht haben. Die Schuld pochte in meiner Brust.
»Hoffentlich verliebst du dich da nicht«, sagte sie.
»Ich kann mich doch gar nicht mehr verlieben.«
»Vielen Dank, sehr charmant.«
»Neu, meine ich. Neu kann ich mich nicht verlieben.«
»Na, das will ich auch hoffen.«
Es wurde Zeit zu zahlen. Der Punkkellner warf uns mit schnoddriger Attitüde die Rechnung hin. Ich gab reichlich Trinkgeld. Wir standen auf, wobei ich mich anstrengen musste, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Dann schlossen wir unsere Räder auf und küssten uns zum Abschied.
»Ich werde dich vermissen, übrigens«, sagte sie.
»Ich dich auch«, sagte ich. »Wie immer.«
Und das stimmte sogar. Wir vermissten einander ständig und sofort nach jedem Abschied. Dennoch war die Zeit zusammen nie unbeschwert. Wir gingen uns sekündlich auf die Nerven, blieben jeweils in der Defensive und atmeten auf, sobald wir wieder auseinandergingen. Und dann vermissten wir einander. With or without you, letztendlich, genauso, wie es in der alten Schnulze von U2 beschrieben wurde.
Ich wartete noch, bis sie die von gelangweilten Touristen belagerte Brücke überquert und mir eine Kusshand zugeworfen hatte, dann fuhr ich selbst los, erleichtert und ratlos wie immer. With or without me, so müsste es eigentlich heißen, dachte ich. Mit mir konnte ich unmöglich leben, aber ohne mich (denn was anderes waren Phasen der Manie und Depression als Ichverluste?) auch nicht. Ich kann einfach nicht leben, dachte ich und trat in die Pedalen.
6
Ella war lange Zeit mein einziger Halt gewesen. Ich hatte mich an ihr festgehalten, innerlich, und sie sich oft auch an mir. Sie wusste gewiss noch immer, was wir sein könnten, was als Möglichkeitswelt in uns angelegt war. Ich wusste es jedoch nicht mehr. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste es objektiv, als Vorstellung, aber ich glaubte kaum daran, weil ich nicht mehr an mich glaubte.
Und dennoch war sie meine Freude, der Blick in ihr Gesicht ließ mich kurz aufatmen. Unser Humor war manchmal noch da, kleine Witze, winzige Erleichterungen. Und auch ich konnte sie erfreuen, ihr Zärtlichkeit zeigen und Liebe. Aber es konnte nicht sein, dass sie das Einzige war, was übrig blieb. Und doch war es so.
Wofür harrte ich aus? Ich wollte nicht, dass sie litt. Und ich harrte vielleicht aus minimaler Hoffnung aus, vielleicht aus bloßer Angewohnheit. Aber ich war doch schon tot. Ich war einfach immer tot, egal, was die anderen sagten. Diesmal gab es keinen Neuaufbau, ich stand nun ganz am Rande der Gesellschaft und konnte nicht mehr zurück.
Oder doch? Manchmal dachte ich, es könnte doch noch gelingen, ein letztes Mal, zurück in irgendeine Form des Lebens, die nicht nur aus Aushalten und Schmerz bestünde. Es könnte gelingen. Es musste alles nicht so schlimm sein. Und doch kam es mir vor, als hätte ich genau diese Sätze zu oft gesagt oder geschrieben und als hätten sie diesmal keine Bedeutung mehr.
7
Bestrafte ich mich, in dem ich nicht lebte? Ich gestand mir nicht einmal einen Kinobesuch zu, und die Sozialphobie tat ihr Übriges. Ich konnte es auch alles nicht. Kein feines Mahl mehr, kein kleines Gespräch, nichts mehr zu genießen. Ich kam nicht heraus aus diesem zähen Strudel. Etwas Schönes, etwas Schönes, sagten die anderen, die Übriggebliebenen, etwas, was dir gefällt, aber ich sah es einfach nicht mehr. Ich durfte nicht, und ich konnte nicht.
Die angebliche Unhintergehbarkeit der Depression, ihre Nichtdarstellbarkeit: es stimmt nicht. Ich schrieb eine Art Tagebuch und hätte immer weiterschreiben können, Tausende von Augenblicken, in denen noch die kleinsten Aktionen einem großen, trüben Widerstand abgerungen waren. In der Summe ergab das einen monströsen Katalog vollkommener Leere, absolut traurig, tödlich langweilig. Darstellbar war es schon, nur lesbar nicht.
Ich hatte meinen Tod schon oft durchgespielt, ihn mir vorgestellt, und dazu auch, leider, die kleinen Reaktionen darauf: die Trauer von manchen, das Abwinken von anderen, das kurz von einem nostalgischen Impuls durchzuckte Desinteresse wohl auch ehemaliger Freunde. Dann weiter im Text des Lebens, es ist halt so, verloren, vergessen, nichts zu machen.
Immer, wenn ich meine Medikamente nahm, dachte ich: Aha, noch ein Tag. Er hat sich zu noch einem Tag Leben entschieden. Kleine Verlängerung, die aber täglich für Monate. Dabei, wenn ich die Medikamente nahm: kurze Erleichterung. Es musste jetzt noch nicht sein. Er machte da noch ein bisschen rum.
8
Sie beachtete mich zunächst nicht, als ich den Raum betrat. Gedankenverloren blickte sie aus dem Fenster, massierte sich die Schläfe mit dem Stabilo-Stift, schien einem Tagtraum nachzuhängen. Ich war zu Fuß aus einem anderen Stadtteil hierhergegangen, um mich gegen alle Schmerzen wenigstens einmal wieder etwas zu bewegen und so der Muskelatrophie entgegenzuwirken, und hatte mich dann über die strahlende, makellose Fassade des Zielortes gewundert, ein prächtiges Haus inmitten einer ziemlich abgehalfterten und rußverschmierten Gegend. Beide Klingeln, oben wie unten, waren bloße Türöffner. So stand ich nach zweifachem Summen und ein paar Stufen also im Vorraum, ohne angekündigt worden zu sein.
Als sie mich bemerkte, war das Lächeln, das sie mir schenkte, dann umso professioneller. Ich hatte seit jeher eine Schwäche für den androgynen Kleidungsstil der Bürgerlichen, und das irgendwie Französische ihrer Erscheinung, die Eleganz im gestärkten Hemdskragen unter dem Kaschmirpullunder nahmen mich für sie ein. Eine interesselose, unterkühlte Schönheit, wie von François Ozon in Szene gesetzt. Sie hieß Sophia und war absurderweise promoviert, das behauptete jedenfalls das Namensschild auf dem Schreibtisch. Nach all den zahnlosen und bösartigen Drachen, männlichen wie weiblichen, die mir auf meinem langen, elenden Marsch durch die Institutionen begegnet waren, war sie durchaus eine kurzzeitige Wohltat für Sinne und Gemüt.
Sophia sagte nichts, und ich beeilte mich auch nicht, das angenehme Schweigen zu stören. Dann legte sie den Kopf schräg.
»Na?« Kein Hallo oder Guten Tag, ein Na?, wie unter alten Bekannten.
»Na«, antwortete ich überrascht.
Sie ordnete beiläufig ein paar schlanke Akten und blickte dabei auf den noch schlankeren Monitor.
»Wir sind froh, Sie bei uns begrüßen zu dürfen«, sagte sie. »Fast hätte ich endlich gesagt. Sie endlich bei uns begrüßen zu dürfen.« Sie lächelte noch immer, ohne Rätsel, ohne Falsch.
»Wieso endlich?«, fragte ich.
»Nur ein Gedanke. Manche finden schneller den Weg zu uns. Und wenn Sie jetzt erst hier sind, wird es für Sie und uns genau der richtige Zeitpunkt sein.«
»Verstehe«, sagte ich, ohne es wirklich zu verstehen.
»Professor von Radowitz wird gleich für Sie da sein. Sie können inzwischen Platz nehmen, wenn Sie möchten. Einen Kaffee, vielleicht?«
»Gerne.«
»Bin sofort wieder da. Bitte.«
Sie verschwand in ein Hinterzimmer. Ich setzte mich auf die schwarze Ledergarnitur an der gegenüberliegenden Wand. Coffee Table Books lagen aus, Kunstbände und großformatige Biografien bedeutender Schriftsteller und Filmemacher, viele Bilder, wenig Text. Darunter Hochglanzhefte. Bevor ich zugreifen und mir einen der Bände anschauen konnte, kam Sophia zurück und stellte mir den Kaffee hin, mit viel Milch und Zucker, so wie ich es tatsächlich mochte. Dann zog sie sich wieder hinter ihren Schreibtisch zurück und tippte fast geräuschlos auf ihre Tastatur ein.
Ich nahm einen Bildband über Lars von Trier zur Hand und blätterte durch die Seiten. Die Tatsache, dass es überhaupt einen Bildband über Lars von Trier gab, überraschte mich. Er war zum größten Teil in Schwarzweiß gehalten, was mir logisch vorkam, auf dieselbe Art, wie es nur logisch war, dass Bildbände über David Lynch in den grellsten Farben leuchteten. Die Bilder enttäuschten mich jedoch in ihrer Fadheit, so als könnten sie den traumatischen Terror, der von den Filmen ausging, nicht verlustfrei transportieren. Aber meine Aufmerksamkeit war eh schon woanders. Über den Buchrand hinweg beobachtete ich Sophia, die jetzt eine luzide Ernsthaftigkeit ausstrahlte. Eine Strähne gleißte im Halogenlicht ihres Schreibtischstrahlers auf, und sie steckte sie selbstvergessen hinters Ohr. Ihr Blick war ganz verwaschen vor lauter Konzentration.
»Lars von Trier, das ist also Ihr Format?« Herr von Radowitz stand vor mir und grinste breit. Er hatte das Gesicht eines gealterten Schönlings.
Ich wusste nichts zu sagen und zuckte mit den Schultern. »Wenn Sie meinen …«
»Ich meine«, sagte er laut und grinste noch breiter.
»Weiß nicht«, sagte ich geistesabwesend, während ich versuchte abzuwägen, ob das, was er da sagte, überhaupt stimmen könnte. Aber wahrscheinlich hatte ich wieder einmal nicht verstanden, dass es hier um bloßen Smalltalk und um ein paar oberflächliche Schmeicheleien ging und nicht um irgendwelche diskutierbaren oder gar wahrheitsfähigen Aussagen. Ich dagegen nahm es wieder wörtlich und blieb stecken.
»Kommen Sie, wir werden jetzt kurz das weitere Prozedere besprechen.« Ich wachte auf aus meiner Absence, stand auf und folgte ihm. Sophia lächelte mich an, und ich lächelte so wenig gequält wie möglich zurück.
Sein Büro war hell und aufgeräumt, mit einem Konferenztisch, der viel zu groß und lang für uns beide war.
»Der Deal«, sagte von Radowitz nun, »ist ein totaler. Dessen müssen Sie sich bewusst sein.«
»Dessen bin ich mir bewusst«, sagte ich entschlossen.
»Das ist gut. Das ist sehr gut«, freute er sich. Er saß mir diagonal versetzt gegenüber und kam mir sehr münchnerisch vor, im Leben stehend, sonnengegerbt, rational, verwurzelt. »Es ist eine große Chance, ins Haus zur Sonne zugelassen zu werden. Die Chance aber kann es nur geben, wenn man sich ihr mit allen Konsequenzen überlässt.«
»Das hört sich final an.«
»Das ist final. Sie werden Kunde einer Traumfabrik, deren Gesetzen Sie sich aber hundertprozentig beugen müssen. Ich sage das so deutlich, um sicherzustellen, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen.«
»Ich kann es gerade nur erahnen.«
»Nein, Sie wissen es schon ziemlich gut. Und Sie wissen, dass Sie sich bereits entschieden haben, Ihr Leben in unsere Hände zu geben, um zu erfahren, was es noch sein kann.«
»Ist das so?«, fragte ich.
»Hier handelt es sich jedoch nicht um ästhetische Projekte oder dergleichen. Das muss Ihnen klar sein. Das hier betrifft Sie geradewegs als Mensch. Das betrifft Ihr Leben und hat mit nachträglichen Spiegelungen in postmodernen Weiten nichts zu tun. Es gibt hier kein Als-ob. Wir sind Meister der Ästhetik, zielen aber weit darüber hinaus.« Er holte kurz und tief Luft. Sie sind ein wertvoller Mensch«, fuhr er mit ernstem Ton fort, »so wird es Ihnen jedenfalls von tausend Seiten zugesichert. Der Einzige, der das nicht glaubt, sind Sie.«
»Und der Staat«, ergänzte ich.
»Der Staat? Vom Staat brauchen Sie Bestätigung? Das wäre mir neu.«
»Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Ich habe meinen Platz in der Gesellschaft noch nicht gefunden, und das mit fünfzig Jahren. Und der Staat hat es mir nicht erleichtert.«
»Alles, was Sie sind, verdanken Sie dem Staat. Eine absurde Tatsache, nicht wahr? Ihre Ausbildung, Ihre Stipendien, Ihre Not-OPs, alles. Was wir Ihnen anbieten, ist ein staatliches Programm. Der Staat will Sie ein letztes Mal retten.«
»Um mich abzuschaffen.«
»Es ist eine Option. Und, im Übrigen, Ihr größter Wunsch.«
»Ich hasse solche Szenarien.«
»Welche Szenarien?«
»Hier, das leicht«, ich machte die mir eigentlich verhasste Geste, die Anführungszeichen andeutete, »Kafkaeske, dieses Dystopische, dieses Orwellhafte in der schönen, neuen Welt. Ich verabscheue es.«
»Sie denken noch immer in literarischen Kategorien. Das hier ist kein Text. Das ist Ihr Leben.«
»Gesetzt den Fall, dass ich mitmache. Dann ist es mein Leben.«
»Ihre Entscheidung. Doch ich käme mir wie ein Heuchler vor, wenn ich so täte, als wüsste ich nicht, dass diese Entscheidung längst gefallen ist. Sie wollen nicht mit Ihrer Krankheit leben. Sie können es nicht. Die Krankheit hat Ihnen wieder alles geraubt. Und Sie haben den Verdacht, dass diese Krankheit, die letzte Manie, Ihnen überdies nun auch Ihre kreativen und intellektuellen Fähigkeiten genommen hat.«
»Das stimmt. Das habe ich ja auch in diesen ellenlangen Fragebogen hineingeschrieben. Es ist kein Wunder, dass Sie das wissen.«
»Aber wir sind die, die solche Aussagen ernst nehmen. Ich weiß, dass es genügend Studien darüber gibt. Manien lassen graue Hirnmasse schwinden, und die kognitiven Fähigkeiten können dauerhaft und stark beeinträchtigt werden. Depression und Medikation tun ihr Übriges. Wir können das auch testen bei uns. Sie werden bei uns Realisten finden, keine Beschwichtiger und Faktenverdreher.«
»Und wer zahlt das alles?«
»Tatsächlich der Staat, wie gesagt. Was er nicht mehr an jahrzehntelanger Sozialhilfe beisteuern muss, investiert er in den letzten Traum. Es ist zwar ein Modellprojekt. Aber es wird sich zeigen, am Ende kommt er billiger weg, und die Klienten finden ihr Glück.«
»Aber nur für kurz.«
»Aber immerhin tun sie es überhaupt. Im normalen Leben ist das selten der Fall. Es ist eine Win-win-Situation.«
»Dieser Begriff«, seufzte ich.
»Sie müssen meine Begriffe nicht mögen, nur meine Konzepte.«
»Und bis wann muss ich mich entschieden haben?«
»Sie haben sich doch schon entschieden. Unterschreiben sollten Sie den Vertrag innerhalb der nächsten zwei Wochen.« Er beugte sich herüber. Sogar seine Stirnfalten, die ich nun studieren konnte, wirkten geschmackvoll drapiert. »Ich weiß um Ihren Todeswunsch. Und ich weiß um seine Unbedingtheit – und, dass Sie ihn früher oder später sowieso umsetzen werden. Wieso vorher nicht noch einmal echte Glücksmomente erleben?«
Als ich das Büro verließ, meinte ich einen Anflug von Mitleid in Sophias wässrigen Augen zu sehen. Aber vielleicht war es auch nur Müdigkeit. Sie lächelte gekonnt, sagte »bis dann« und wandte sich wieder ihrem Monitor zu, nicht ohne kurz zu nicken, als ich mich noch einmal nach ihr umdrehte.
9
Tatsächlich hatte ich mich schon lange aufgegeben, und zwar aus guten Gründen. Mein Leben war immer wieder von der Krankheit zerstört worden, doch jedes Mal hatte ich mich, trotz aller Verluste, einigermaßen wiederhergestellt. Und dieses Mal hatte mich die Krankheit sogar zehn Jahre lang in Ruhe gelassen, was mich zu der Hoffnung verleitet hatte, vielleicht auch für den Rest meines Lebens verschont zu bleiben. Die Episode, die schließlich doch kam, war dann so krass und zerstörerisch, dass ich wusste, ich würde nie mehr derselbe sein; nein, ich wusste sogar, ich würde nie wieder sein.
Die Krankheit war unheilbar. Das hatte ich als Fakt angenommen, und doch war die Enttäuschung, als sie wieder zuschlug, riesig. Ich hatte doch stets meine Medikamente genommen, dachte ich, hatte mich mit der Krankheit exzessiv auseinandergesetzt, hatte auf mich und etwaige Symptome geachtet, hatte mich über die Jahre auch aus allen Schulden herausgearbeitet, wieder im Theater Fuß gefasst, eine anstrengende, teils internationale Lesereise hinter mich gebracht, ein für meine Verhältnisse ansehnliches finanzielles Polster geschaffen durch die verschiedenen Aufträge, die ich zuverlässig erfüllte, hatte eine neue Wohnung bezogen, den Aufbruch in eine Beziehung mit Ella gewagt. Es war ein echtes Leben, das ich lebte. Bald hätte sich meine letzte Episode zum zehnten Male gejährt, und ich schien stabil wie nie.
Aber es kam anders. Die Manie kam und riss alles um. Ein kontroverser Artikel über den Nobelpreis an Peter Handke und das Medium Twitter warf mich aus der Bahn. Ich hatte den Artikel in drei, vier Stunden geschrieben, noch schnell vor einem Kurzurlaub. Der Artikel, ebenso schnell veröffentlicht, hatte einen Unteraufruhr im eh aufgerührten Diskurs, vor allem dem der sozialen Medien, zur Folge. Da begann es. Ich fühlte mich missverstanden und wollte noch einmal interpretativ nachschärfen, wollte eine weitere Aussage machen, ohne von meiner Gesamtkritik des Mediums Twitter abzulassen, sah dabei während des Kurzurlaubs zu oft auf mein Handy, las Bescheuertes, Überforderndes, Attackierendes, stand unter Stress. Ich hätte mich nicht äußern sollen, denke ich heute.
Jemand hatte zudem wie zur Rache meinen Wikipedia-Eintrag ins Negative verändert, hatte Vorfälle aus meinen Manien, die ich im Buch veröffentlicht hatte und die in den Rezensionen nacherzählt worden waren, hineingeschrieben. Einen Menschen, dessen Trauma darin besteht, in bestimmten Phasen keine Kontrolle mehr über sein Leben zu haben, treffen solche Eingriffe besonders empfindlich. Er möchte alles, was passiert ist, erklären und kontextualisieren. Ich brach nachts eine Diskussion vom Zaun und wehrte mich mit Händen und Füßen gegen die tendenziösen Änderungen. Da war es fast schon zu spät.
Diesmal ist die Erinnerung zerschossener denn je. Einen Twitter-Account hatte ich wohl, zurück in der Heimatstadt, schnell angelegt, da manche Twitterer behaupteten, ich wüsste nicht, wie Twitter funktioniert; dort fand ich es allerdings genauso vor, wie ich es mir gedacht hatte. Doch anstatt es damit auf sich beruhen zu lassen und den Mund zu halten, musste ich wohl aktiv und immer aktiver werden, denn der Stress hatte mich in ein Nebenreich des falschen Denkens und Fühlens versetzt, und so begann ich plötzlich, Wittgenstein’sche Unverständlichkeiten zu posten und nebenbei herumzuschimpfen, statt mich vernünftig zu vernetzen wie alle anderen auch.
So auch im echten Leben: Plötzlich rissen alle Verbindungen ab, und der Boden unter meinen Füßen wurde brüchig, der Grund meines Denkens bald ein Abgrund. Erneut ergriff mich eine fiese Paranoia, ich war nicht mehr zu berechnen, die Welt war wieder die fremdeste, und dennoch hatte ich viel zu viel Energie in mir, die ich in falsche, nichtige Kanäle und Aktionen pumpte, und das für Monate und, anschwellend und abschwellend, für mehr als zwei Jahre. Ich wurde wieder verrückt und blieb es, und die Grundfesten meines Lebens waren weg, das Geld, die Beziehungen, der Ruf, das Leben. Das war mir aber nicht bewusst. Eine Front aus Unheil zog sich ständig über mir zusammen, die ich, manisch entbrannt, kaum bemerkte, auch wenn sie regelmäßig auf mich niederregnete. Die Psychose war fatal, war so verrückt, so albern und destruktiv wie nie, und sie brach mir schließlich endgültig das Genick.
10
Das Erwachen dauerte länger als sonst, es ging über mehrere Tage, ja Wochen. Und es war kein echtes Erwachen, sondern sofort, nach der dämmernden Einsicht, wieder verrückt geworden zu sein, die drückende Sehnsucht nach ewigem Schlaf. Ich konnte mir gar nicht all die Details vor Augen führen, es waren zu viele, es war zu peinigend und peinlich. Deshalb schlief ich, so viel ich konnte, denn wenn das Bewusstsein aussetzte, hatte ich kurz meine Ruhe vor dem Übel. Aus dem Bett kam ich kaum mehr, und die Wohnung, deren desaströser Zustand sich mir erst jetzt eröffnete, verließ ich selten. Ella brachte mir manchmal etwas zu essen und sorgte dafür, dass ich überhaupt ein paar Worte sagte. Das war wieder die altbekannte, schreckliche Depression, aber es war auch die Erkenntnis der tausend Konsequenzen meines Wahns, die bereits eingetreten waren und noch eintreten würden, es war die Demütigung, die die Krankheit mir zugefügt hatte, der Ichverlust, die Scham, die Schuld.
Es brannte, es schmerzte, es war nicht auszuhalten. Ein Wrack war ich, dem ständig speiübel war und das in Trauer erstickte.
Das dauerte ein Jahr, ohne dass sich etwas besserte. Jeden Morgen die Sekunde beim Aufwachen, in der mir alles wieder einfiel, die Schulden, die Verluste, die Taten, der Wahn. Es herrschte totale Schwärze, jeder Schritt war schwer, das Herz krank, und immer wieder kam Sehnsucht nach dem früheren, auf immer verlorenen Leben auf. Ich hatte jeden Tag zig Suizidgedanken, so viele und so lange, dass sie schon gefühlte Realität wurden. Ich sah mich dort an der Klinke hängen und wusste, ich würde es irgendwann auch tun. Es gab gar keine Alternative. Wenn ich es aber irgendwann sicher tun würde, müsste ich es nicht sofort tun. Der Fakt, dass es geschehen würde, reichte. Und es gab ja noch Ella, der ich das eigentlich nicht antun durfte. Jede Sekunde, die ich mich nicht umbrachte, war eine weitere Sekunde, in der Ella ohne dieses Trauma leben konnte.
Also hieß es: jetzt noch nicht, und jetzt auch nicht. Vielleicht morgen, vielleicht in einer Woche. Aber: auf jeden Fall irgendwann.
Ich hatte auch kleine Visionen von mir als zukünftigem Obdachlosen, immer wieder. Und ich wusste, dass sie wahr würden irgendwann, dass diese Visionen wirklich aus der Zukunft stammten, wenn ich die Zukunft als solche denn zulassen würde. Ich wusste nicht, wie ich dann weiterleben sollte, für ein Leben auf der Straße war ich doch gar nicht gewappnet. Zum Beispiel: Wohin gingen Obdachlose, wenn sie auf Toilette mussten? Urinieren mochte ja noch gehen, aber alles andere? Ich hoffte, diese Frage bitte nie praktisch beantworten zu müssen. Wenn ich den Clochard von gegenüber sah, auf der anderen Straßenseite, fiel mir auf, dass man sich über solche Dinge nie Gedanken machte. Der saß einfach da in seinem kaputten Bürostuhl und sang und schimpfte. Wie aber kam er mit den Grundfunktionen des Lebens zurande? Er aß manchmal etwas, okay, einen halben Döner, ein erbetteltes Brot. Wie wurde er es wieder los, ohne zu einem Ärgernis zu werden?
Ich wollte kein Ärgernis mehr sein. Und selbst, als es mir dank eines ambulanten Programms eines Krankenhauses und eines Medikamentenwechsels von Valproat auf Lithium minimal besser ging – der Gedanke, schon tot zu sein, verließ mich nicht mehr. Der Lebensfunke war erloschen. Ich war Asche. Ich war Asche, ich war unheilbar krank, und ich könnte nur durch meinen Tod geheilt werden.
11
Es war während einer besonders zerfetzten Lebensphase gewesen, als ich zum ersten Mal mit dem Haus zur Sonne in Berührung kam. Ich saß auf einer Hartplastikschale im Jobcenter, mit der Existenz und den Nerven völlig am Ende, schon dumpf vor Trauer und Schmerz, und wartete darauf, dass meine Nummer aufgerufen würde. Es hieß, dieses Jobcenter sei noch besonders freundlich zu seinen Kunden, zumal zu Künstlern. Ich konnte das nicht unbedingt bestätigen. Meine letzte Bearbeiterin, eine junge, strenge Gouvernante, hatte mich schroff darauf hingewiesen, dass »das alles« ja anscheinend nichts mehr würde mit mir und der Kunst, weshalb wir uns jetzt etwas anderes überlegen müssten. Gegen mein Attest konnte sie allerdings nichts ausrichten. Skeptisch beäugte sie erst den Schrieb und dann mich, als würde ich »das alles« nur vortäuschen.
Jetzt saß ich wieder hier und blickte mich um im Wartebereich. Ich konnte nicht fassen, was passiert war. Wirklich, noch einmal, nach allem? Wieder hier, wieder verrückt gewesen? Es war zu viel. Wo ich auch hinging, wenn ich überhaupt wo hinging, schleppte ich mich gegen hundert Widerstände hin, den Schock in den Gliedern und mit trauerschwarzem Gemüt, und wenn ich wieder zurück im Bett war, blieb ich dort und redete nicht mehr, so erzählte Ella es mir später. Nach der manischen Logorrhö herrschte nun Sprachlosigkeit, nach dem irren Aktionismus totale Lähmung. Und Ella versuchte, jetzt irgendwie da zu sein, auch wenn unsere Beziehung von der Manie im Grunde zerstört worden war. Sie kümmerte sich, so weit sie konnte. Ich war so dankbar und konnte es doch kaum ausdrücken oder gar spüren, denn die Trauer und die Scham überdeckten jedes andere Gefühl sofort.
12
An der Wand im Wartebereich hingen verschiedene städtische Motive, Brunnen, Brücken und Bauten, deren Ansicht mich nur weiter runterzog. Ich ließ den müden Blick weiterschweifen, über Aushänge und Plakate, Ausbildungsangebote, Blockseminare, Weiterbildungsstellen. Der Gedanke, ein Gameprogrammierer zu werden, glomm wieder auf. Auf den kleinen Gittertischen lagen Flyer in wirren Haufen aus, und bevor ich meinen Blick weiter zwanghaft davon abhalten müsste, das mir gegenübersitzende, völlig heruntergekommene Paar anzustarren, nahm ich einige der Flyer in die Hand und las.
Verarschung, Verarschung, Verarschung, so sortierte ich einen nach dem anderen aus: Rechtsanwälte, die einem angeblich beim Bürgergeld helfen wollten, Weiterbildungsstätten, die nur die Zuschüsse absahnen würden, Köder nach Köder für die Verzweifelten, und die größte Verarschung war schließlich, so schien es, der letzte Flyer.
»So nicht weiter?«, stand da in fetten Lettern, und darunter gleich: »Wir machen es anders!«
Ja, was denn, fragte der deprimierte Leser sich da natürlich sofort, was genau macht ihr denn anders?
»Das Pilotprojekt zur Lebensverbesserung, Traumverwirklichung, Selbstabschaffung«.
Klang passend. In kleinerer Font wurden die Texter dann genauer, wenn auch nicht unbedingt verständlicher: »Auf unserem Wellness-Gelände können Sie in aller Abgelegenheit Ihre Lebensträume verwirklichen. Gefragt sind lediglich Sie als Person, mit allem, was Sie mitbringen – und mit allem, was Sie hinter sich lassen wollen. Sprechen Sie einfach Ihren Fallmanager an.« Und als wäre das alles nicht genug, wurde schließlich noch mit offizieller Unterstützung geprahlt: »In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit«.
Ich hatte es hier offensichtlich mit einer Satire-Aktion zu tun, vielleicht von einer Witzzeitschrift, vielleicht von einem Geschwader der Spaßguerilla, vielleicht von einem sozialkritischen Kunststudenten. Das Wort »Selbstabschaffung« war es, das diesem Quatsch die nötige Schärfe verlieh, um aus den sonstigen Neppereien hervorzustechen und zu einer Kuriosität zu werden. Ich steckte den Flyer ein. Er würde Ella sicherlich erheitern. Vielleicht würden wir sogar dort anrufen, Ella und ich. Vielleicht würden wir auf einen ominösen Anrufbeantworter sprechen und vordergründig Spaß haben.
Schritte hallten heran, präzisierten und verlangsamten sich. Meine Bearbeiterin kam endlich um die Ecke und nannte sogar freundlich meinen Namen. Ich zerknüllte den Zettel mit der Nummer und trottete ihr hinterher, so wie man eben hinterhertrottet, wenn man nichts mehr zu melden hat.
13
»Ich müsste checken lassen, ob Sie die Bedingungen erfüllen«, sagte die Bearbeiterin, nachdem ich ihr den Flyer hingeschoben hatte. »Die würden sich dann bei Ihnen melden.«
»Also ist das kein Witz?«
»Dachte ich auch zuerst. Und so richtig kann ich es noch immer nicht glauben. Aber nein, es ist kein Witz. Machen wir hier Witze?«
»Weiß ich nicht.«
»Machen wir nicht.«
»Wissen Sie mehr darüber?«
»Nein. Ich habe nur oben bei der Leitung nachgefragt, und die meinten, das ist tatsächlich ein offizielles Programm. Wenn man das so liest«, grinste sie, »sehr seltsam. Aber auch verlockend.«
»Und ich würde dann – was machen? Meine Wohnung aufgeben? Dort leben?«
»Ich weiß es nicht. Aber ich leite die Anfrage weiter. Das geht dann seinen Weg.«
»Ja, machen Sie das mal.«
»Und jetzt geht es Ihnen um eine Soforthilfe?«
»Ja. Einen Vorschuss.«
»Sie sind also mittellos. Sie wollen einen Abschlag.«
»Ja. Hier ist der Kontoauszug.«
»Sie sind also mittellos«, wiederholte sie. »Wie viel bräuchten Sie denn?«
»Zweihundertfünfzig.«
»Ich kann Ihnen hundert geben. Und das nächste Mal käme es zu Sanktionen.«
»Ach.«
»Ja. Das entscheide nicht ich. Das kommt von selbst.«
»Natürlich. Nur hundert?«
»Ja.«
»Was soll ich sagen. Also gut.«
»Gut. Ich mache Ihnen die Karte fertig, damit können Sie es unten am Automaten abheben.«