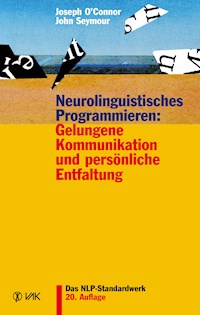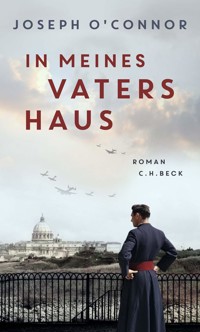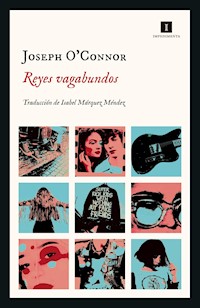9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein großer Roman über Freundschaft und versäumter Liebe - »funkelnd vor Leben« Bob Geldof Robbie und Fran kennen sich schon seit der Schule. Sie hängen rum, machen Musik und gründen eine Band, The Ships. Als sie von einer unglamourösen Tour durch die Collegebühnen des Landes zurückkehren, verändert eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter alles. Auf den kometenhaften Aufstieg folgt der bittere Fall, der die Band auseinanderreißt und den Gitarristen Robbie zu Boden ringt. Jahre später berühren sich die Lebengeschichten der vier Bandmitglieder zu einem finalen Comeback.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Ähnliche
Joseph O’Connor
Die wilde Ballade vom lauten Leben
Roman
Aus dem Englischen von Malte Krutzsch
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Philip Chevron1957–2013
In Vorträgen sage ich, Künstler hätten den sinnvollen Auftrag, den Menschen wenigstens ein bisschen Lust am Leben beizubringen. Dann werde ich gefragt, ob ich Künstler kenne, denen das gelungen ist. »Die Beatles«, antworte ich.
Kurt Vonnegut
Vorwort
Mein Name ist Robbie Goulding. Ich war Musiker. In den 1980er Jahren habe ich fünf Jahre lang bei den Ships Gitarre gespielt. Der vorliegende Erinnerungsband ist mir nur schwer von der Hand gegangen.
In den ersten Monaten des einundzwanzigsten Jahrhunderts in Auftrag gegeben, erscheint er mit – mindestens – zehn Jahren Verspätung. Die Zeit ist ein Redakteur, sie ändert Perspektiven, hebt bestimmte Erinnerungen hervor, korrigiert andere, gräbt zeitliche Zusammenhänge aus, die einem beim Erleben nicht bewusst waren. Und wie der Autor hat sich auch das Buch mit den Jahren verändert, ist dicker geworden, dann wieder schlanker, hat die Neujustierungen und unbemerkten Entwicklungen überstanden, die man gemeinhin Schicksal nennt. Irgendwann zwischendurch war es zorniger, es wollte ein paar Rechnungen begleichen, dann hat es sich in die Dokumentation einer verlorenen Freundschaft verwandelt. Mir scheint, es ist das Buch geworden, das ich gern von jemandem geschenkt bekommen hätte, als ich mit dem Rock ’n’ Roll anfing. Wäre das passiert, wäre es ein völlig anderes Buch geworden.
Aus Gründen, die noch ersichtlich werden, erinnere ich mich nicht an jeden einzelnen Teil der Geschichte. Hier und da habe ich deshalb auf Reminiszenzen meiner ehemaligen Bandgefährten zurückgegriffen, hauptsächlich auf Interviews, und lasse sie selbst zu Wort kommen. Ihre Erinnerungen weichen zwangsläufig in manchen Punkten von meinen ab, doch das Leben wäre arm, wenn wir alle dasselbe Lied sängen und alle das gleiche Geschehen wahrnähmen. Ich danke dem Kunstsender von Sky Television für die Erlaubnis, Trez Sherlock zu zitieren, Seán Sherlock dafür, dass er bereit war, sich (von meiner Tochter) für dieses Projekt interviewen zu lassen, und BBC Television/Lighthouse Music Ltd für die Erlaubnis, aus Fran Mulveys letztem Interview zu zitieren. Einen kurzen Abschnitt, der die Sicht meiner Tochter wiedergibt, habe ich auch mit aufgenommen. Sie hat das aus persönlichen Gründen festgehalten, im Prinzip als Tagebuch, und es ist im Winter 2012 als Blog auf mehreren Musik-Webseiten erschienen. Wir leben in einer Zeit, in der alles öffentlich ist, auch und gerade das Private. Als ich jung war, war es umgekehrt. Bowie hat vor einem Publikum gesungen, das nichts über ihn wusste. »Geheimnisvoller Nimbus« nannte man das damals.
Einige Personen, denen Sie auf diesen Seiten begegnen, sind nicht mehr unter uns. Meine verstorbene Mutter, Alice Blake aus Spanish Point im County Clare, hat mir zum vierzehnten Geburtstag eine Gitarre gekauft. Ein lebensveränderndes Geschenk, aber nicht nur das, sie ertrug auch die endlosen Hinschlachtungen von Johnny B Goode, die das bei uns daheim zur Folge hatte. Niemand liebt mehr als eine Frau, die zwei Jahre lang von morgens bis abends Stairway to Heaven aushält, neben House of the Rising Sun, The Sound of Silence (»schön wärs«, meinte Dad) und anderen Glanzlichtern aus dem Lehrlingsrepertoire. Mum überstand auch den aufkommenden Punk. Ich erinnere mich an den Septemberabend, wo ich am Küchentisch die Akkorde von Anarchy in theUK einübte, während sie meine Fußballsachen für die Schule bügelte. Neben ihr unter den Engeln der Nachsicht steht der edle Schatten eines stolzen Brooklyners, Eric Wallace, Gründer der Urban Wreckage Records, dessen Glaube die Ships vor dem Untergang bewahrt hat.
Ich danke meiner Tochter Molly Goulding für ihre redaktionelle Hilfe und ihrer Mutter Michelle O’Keeffe aus Athens, Tennessee, für mehr, als irgendein Lovesong vermitteln könnte. Ich hätte hier gerne ausführlicher über Michelle geschrieben, doch sie möchte ihre Privatsphäre, die ihr schon immer viel bedeutet hat, gewahrt wissen, und ich respektiere und verstehe ihren Wunsch. Mein Vater Jimmy und mein Bruder Shay sind großartig. Ich danke ihnen für unzählige Solidaritätsbeweise.
Alle Irrtümer und Fehler – na ja, die meisten – sind meine. Nichts an diesem Buch ist erfunden.
Engineers Wharf,
Grand Union Canal, London,
Winter 2012
Erster Teil:Schiffe in der Nacht
1981–1987
Eins
Lassen Sie mich von jemandem erzählen, den ich im Oktober 1981 zum ersten Mal gesehen habe, als wir beide siebzehn waren. Einem nervigen, charmanten und strotzintelligenten Jungen, dem besten Gefährten überhaupt, wenn man einen Tag vertrödeln und verdisputieren will. Er hieß Francis Mulvey.
Im Lauf der Jahre sind so viele Sinfonien der Halbwahrheit über Fran hinaustrompetet worden, dass ich zögere, mich dem Geschnatter anzuschließen. Unautorisierte Biographien, eine Doku in Spielfilmlänge, Profile, Fanzines, Blogs und Newsgroups. Laut meiner Tochter ist eine Filmbiographie mit dem Thai-Schauspieler Kiatkamol Lata als Fran im Gespräch, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Sie fragt sich, wer dann ihren Daddy spielt. Lass mal, sage ich ihr. Fran würde mich in seiner Lebensgeschichte nicht mehr haben wollen. Und er hat die entsprechenden Anwälte, wie ich aus teurer Erfahrung weiß.
Heutzutage lebt mein ehemaliger Glimmertwin zurückgezogen, für die Medien ein »einsiedlerischer Songschreiber und Produzent«, als gehörte »einsiedlerisch« zum Berufsbild. Man kennt das neueste Foto von ihm – es ist unscharf und fünf Jahre alt. Er wohnt mit seinen Kindern Obamas erster Amtseinführung bei und scherzt mit der First Lady. Ich erkenne ihn kaum. Er sieht fit, gepflegt und wohlhabend aus, sein Smoking wird mehr gekostet haben als mein Hausboot.
Aber der junge Fran war im Herzen ein Halbweltler, er fühlte sich wohler in Jacken aus einem Secondhandladen in Luton, der Stadt, wo das Schicksal uns miteinander bekanntgemacht hat. Dreißig Meilen von London entfernt, im leichtindustriell geprägten Bedfordshire, besaß Luton einen Flughafen, Autofabriken und ein permanent im Bau befindliches Einkaufszentrum, verfügte aber auch, so mein Bruder im Scherz, über eine eigene Zeitzone – »um die zweite Mondlandung herum sind die Uhren stehengeblieben«. Für mich ist es mein Heimatort, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, doch genau genommen waren wir Zuwanderer. Geboren bin ich in Dublin als zweites von drei Kindern. 1972, als ich neun wurde, zogen wir im Anschluss an eine Familientragödie nach England. Die Nachkriegs-Wohnsiedlungen in Luton waren zwar Fertigbau, aber es gab Parks und dahinter Felder, wo mein Bruder und ich uns gern aufhielten. Meine Eltern verstanden sich mit den Nachbarn in der Rutherford Road, die ich als taktvoll und freundlich in Erinnerung habe. Zugegeben, es war kein heißes Pflaster, aber jedes Land hat seine Lutons: Orte mit unbestreitbaren Attraktionen, unbestreitbar vor allem dadurch, dass im Umkreis von dreißig Meilen sonst nichts ist. Man findet sie in Deutschland, Nordfrankreich, Osteuropa und tausendfach in den Vereinigten Staaten. Aus Italien kenne ich sie nicht, aber es gibt sie bestimmt auch dort. Ganze Landstriche Belgiens sind ein einziges Luton. Für unser Luton gilt vor allem, dass es ein gutes Luton war, besser als zum Beispiel Malibu es je hingekriegt hätte. Mir brachte es schöne und schwierige Zeiten. Es gab viel Leerlauf, während wir nach unserer selbstgebastelten Pfeife tanzten. Ich neige dazu, meine Jugend in die Zeit vor und nach Fran aufzuteilen. Vor ihm war es eine Reihe Schwarzweißbilder. Mit ihm bekam Luton Farbe.
Ich habe gehört, er schminkt sich nicht mehr, legt noch nicht mal mehr Rouge auf. Als ich Francis in den achtziger Jahren am College kennenlernte, trug er bei den Vorlesungen mehr Lippenstift und Wangenrot als Bianca Jagger im Studio 54. Außer im Fernsehen hatte ich noch nie einen Mann mit Lidschatten gesehen, ein unheimliches Rotviolett, das er auf Streifzügen durch Bühnenbedarfsläden aufgetan hatte. »Das nehmen die für Mörder und Huren«, erklärte er mit der Unbekümmertheit desjenigen, dem beide vertraut sind.
Er fiel mir im ersten Monat am College auf. Klar, er war auch schwer zu übersehen. Eines Morgens bekam ich mit, wie er im Oberdeck des 25er Busses die Schaffnerin bat, ihm ihren Handspiegel zu leihen – eine ernst blickende Jamaikanerin um die fünfzig, die von lockerem Umgang mit Lutons Studenten wenig hielt. Nach dem Spiegel wurde sie dann noch um ein Kleenex gebeten, auf das er einen Lippenstiftkuss drückte, bevor er ihr beides zurückgab. Es ist bezeichnend für Frans als Verletzlichkeit zum Ausdruck kommende Treuherzigkeit, dass ihm niemand die Zähne einschlug.
Wer war dieses Gespenst? Wo kam er her? Unter meinen Kommilitonen kursierten Theorien über sein Geburtsland. China war dabei, ebenso Laos und Malaysia. Merkwürdigerweise erinnere ich mich nicht, dass jemand Vietnam vorgeschlagen hätte, sein vor langer Zeit verlassenes, tatsächliches Heimatland. Fest stand, dass er als Kind von Leuten in Südyorkshire adoptiert worden war, fabelhaft aussah und nicht viel redete. Viele deuteten seine Schweigsamkeit als Sucht nach Aufmerksamkeit und ignorierten ihn bewusst. Bei uns gab es wie an jedem College im Umkreis einer größeren englischen Stadt Studenten und Lehrer unterschiedlicher ethnischer Herkunft, doch Fran war in mehr als einer Hinsicht ungewöhnlich. Man hatte das Gefühl, er wusste, dass es ihn nur einmal gab, ein bedrohliches Signal für jede Gruppe. Ich nehme an, es ist auch für den Signalgeber stressig. Der Pfau prunkt vielleicht aus Angst oder purer Langeweile und wünscht seine Betrachter sonst wohin. Fran hatte kein Selbstbewusstsein. Vom Showabziehen war er himmelweit entfernt. Das Passendste, was mir einfällt, ist »Würde«. Und mit Würde muss man in England vorsichtig sein, sonst sieht es noch aus, als ob man sich ernst nimmt.
An beleidigende Bemerkungen erinnere ich mich nicht. So lief das selten. Aber es gab ein bestimmtes leises Lachen und verdrehte Augen, besonders bei den Jungs; sie waren nicht direkt feindselig, sie wollten nur klarstellen, dass Fran nicht so aussah wie man selbst, falls jemandem das wider alle Wahrscheinlichkeit entgangen war. Fran sah aus wie niemand sonst.
Er hatte ein Zimmer, und keiner wusste, wo. Vielleicht in Leagrave. Farley Hill. Es hieß, er hätte Freunde an der Universität Reading, und das allein verlieh ihm die Exotik des Großstädters. Wir in der windgezausten Abgeschiedenheit der Fachhochschule meiner kleinen Stadt fühlten uns von Readings Himmelhunden in den Schatten gestellt. Sie soffen Rheinwein, gingen ins Puff und schossen sich – hussa! – mit Vorderladern die Doktorhüte vom Kopf, während wir am Ufer des Lea vor uns hin schäumten.
Theater, Film und Englisch waren Frans Fächer am College. Meine waren Soziologie und Englisch. Dad warf mir vor, Soziologie hätte ich belegt, um ihn zu ärgern, und ganz unrecht hatte er nicht. Zusätzlich hatte ich mich für griechisch-römische Zivilisation eingeschrieben, da alle Erstsemester drei Fächer »brauchten« und ich mich, nachdem ich zweimal Ben Hur im Fernsehen gesehen hatte, im Besitz hinreichender Grundkenntnisse wähnte. Außerdem fiel mir nichts anderes ein. Das College bot auch Musikwissenschaft an, aber auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich hämmerte seit meinem vierzehnten Geburtstag auf einer spanischen Ibanez-Gitarre herum und brachte ein oder zwei anständige Beatles-Riffs zustande, aber die Geheimnisse der Musik zu studieren erschien mir sinnlos, Knallkopf, der ich damals war. Ich schwärmte für die Patti Smith Group. Nicht ein Studierter dabei. Schwer vorstellbar, dass Patti Smith dasaß und dachte, cis-Moll wird mit vier Kreuzen geschrieben. Wozu hätte sie das wissen müssen?
Fran zu beobachten wurde mein Hobby. Es gibt schlimmere Beschäftigungen. Ich sehe ihn noch da im Hörsaal mit den dreihundert Plätzen, immer irgendwo hinten, oft mit Zigarette im Mund. Eine Zeitlang gab es eine Freundin, eine traurig schöne Punkfrau. Nachmittags schauten sie sich in der Studentenbar – für uns »The Trap« – wortlos Kunstbücher an und bestellten Crème de Menthe Frappé, kein übliches Studierendengetränk in Luton. Paddy, der nette Barmann, produzierte das dafür nötige gestoßene Eis, indem er die Brocken aus dem Gefrierfach in eine Plastiktüte packte und sie mit seinen Nagelschuhen platttrat. Vor Weihnachten war das Mädchen aber nicht mehr da, zumindest wurde sie nicht mehr vorgeführt. Nach Neujahr war dann eine andere an Frans Seite, ein Soulgirl, das angeblich Technisches Zeichnen studierte. Man sah sie abends Hand in Hand auf den Sportplätzen, zwei Schwarzdrosseln im Schnee, der wochenlang den Campus bedeckte. Dann kam ein Junge. Das Getuschel war vorauszusehen. Meiner Erfahrung nach können junge Leute ausgesprochen konservativ und leicht zu beunruhigen sein, weit weniger tolerant als die Alten. Fran war nicht ganz freiwillig ein Einzelgänger. Und das anzuprangern steht mir nicht zu, denn ich habe selbst keinen Kontakt zu ihm gesucht, sondern mich lieber aus der Ferne faszinieren lassen.
Er schrieb Beiträge für die Zeitung der Studentengewerkschaft. Die fand ich sonderbar, ansprechend und sehr, sehr gewagt. Joy Division hatten kurz nach dem Selbstmord ihres Sängers Ian Curtis die Compilation Still herausgebracht. Fran nannte das Cover des Albums in seiner Besprechung »leichengrau«. Für mich war das nah an der Grenze, aber auf der falschen Seite. Zum Glück nur vorübergehend zeichnete er seine Beiträge mit »Franne«, wohl wegen der elisabethanischen Note. Offenbar gefielen ihm die melancholischen Balladen von Downland und Walter Raleigh, denn ein Artikel dazu erschien unter seinem Namen. Dieser ungewöhnliche, intelligente Junge hatte eine brutale Kindheit durchgemacht. Ich weiß nicht, wie er das überlebt hat. Viele Jahre nachdem wir uns kennenlernten gab er – in seinem, wie sich zeigen sollte, letzten Fernsehinterview – einige biographische Details preis.
Yeah, ich würde lieber übers Boxen reden, nicht nur heute Abend … Ich liebe Herol, Mann … Das ist mein Idol … Herol »Bomber« Graham … aus meiner Ecke der Welt und aus Ihrer … Sheffield.
Wo ich herkomme? Aus Yorkshire, wie gesagt. Davor … na ja … Vietnam. Da bin ich in einem Ort namens Dau Tieng geboren. Eine ländliche Gegend in der Provinz Song Be … Wahrscheinlich spreche ich das nicht richtig aus … Also, ich habe mich da an die Behörden gewendet. Und die waren sehr hilfsbereit. Aber an die Akten ist schwer ranzukommen … Schönes Land, Vietnam, ich war voriges Jahr dort, sehr sanfte Menschen, und neugierig, und gastfreundlich, aber alles ist noch kaputt. Mein Dad war vielleicht Soldat. Amerikaner, ja … Wie auch immer, mich haben sie ausgesetzt. Ein Findelkind … das sag ich ohne Selbstmitleid, ich kam ja zurecht … Aber so wars … Nicht gerade ideal.
Klar, es war noch Krieg. Aber na ja, als Kind … man begreift nicht, dass da ein Krieg abgeht, man kennt ja nichts anderes. Es ist wie das Wetter. Gewalt? Aber ja. Ich hab sehr schlimme Sachen gesehn. Darüber rede ich aber nicht … Es wäre nicht angebracht. Wir unterhalten uns hier im Fernsehen, das ist schön, und Sie persönlich habe ich schon immer geachtet. Aber ich hab meine Grenzen … Das ist das Besondere an mir.
Ich weiß nur, dass ein Bauer mich als Baby in ein Kloster in der Stadt Tay Ninh gebracht hat … Und offenbar war ich dort, bis ich vier wurde … Das untersuche ich noch. Denn da wüsste ich schon gern Näheres … Das ist ganz natürlich, oder? Man fragt sich, wo man herkommt … Jetzt habe ich eine Rechercheurin beauftragt, das geht besser, sie spricht die Sprache. Und es gibt unglaublich viele Leute, in den Staaten wie in Vietnam, die versuchen, diese ganzen Geschichten auf die Reihe zu kriegen. Tausende in Vietnam geborene Kinder haben ja eine ähnliche Vergangenheit wie ich. In Kanada, in den Staaten, in ganz Europa. Man denkt so leicht, man ist allein. Aber das stimmt nicht.
Das Erste, an was ich mich erinnere, ist die Hitze. Es ist ja so heiß in Indochina. Feuchtheiß. Dann höre ich Französisch. Denn die Nonnen, die sich um uns gekümmert haben, kamen aus Frankreich. Komisch, ich weiß noch, dass zwei von ihnen den gleichen Namen hatten, Schwester Anna. Oft kam ein Priester zu Besuch, Pater Lao, ein Vietnamese. Soldaten waren auch da. Große, Englisch redende Yanks. Ein riesiger Gummibaum – man konnte ihn vom Fenster aus sehen. Und die Glocke auf dem Hof … und Tiere und Leute, die Sachen verkauften. Bauernhoftiere meine ich, Hähne und so kleine schwarze Dickbauchschweine. Mit den Schweinen haben wir gespielt. Ich und die anderen Kinder. Und oft überlege ich, was wohl aus den anderen geworden ist. Bricht einem das Herz, die zu sehen. Bricht einem das Herz.
Eines Tages kam eine Europäerin und gab uns einen Becher Milch. Irgendeine Diplomatenfrau. Man merkte, dass sie uns nicht anfassen wollte. Nichts gegen die Frau, sie hat ihr Bestes getan, aber das werde ich nie vergessen. Sie konnte es nicht ertragen, uns zu berühren. Genau das ist der Westen. Eine Mischung aus Freundlichkeit und Herablassung. Und Angst. Denn Mitleid ist mit Angst verwandt. Und diese ganzen Hilfen … ich finde, das muss sich ändern. Umfassender werden. Ein Becher Milch für die Leutchen? Ihr macht euch was vor, Mann. Die Krümel von euerm Teller genügen nicht.
Was immer dann passiert ist, keine Ahnung, aber sie haben uns nach Saigon gebracht. In so ein riesiges Waisenhaus, etwa acht Meilen außerhalb, mit fünfzehnhundert Kindern. Furchterregend. Wie ein Alptraum. Arme Kinder, die verstümmelt, entstellt und blind waren. Zwei Monate war ich da, und eines Abends haben sie uns weggebracht, mich und ein Dutzend andere. Wir wurden in einen Bus gesetzt und bekamen ein Paket vom Roten Kreuz, Flasche Saft, Tüte Bonbons. Und du als Kind denkst nur, Gott, was ist denn jetzt wieder? Dann sind wir am Flughafen. Steigt in das Flugzeug, heißt es. Eine Adoptionsorganisation der katholischen Wohlfahrt soll uns nach England bringen. Ob wir dahin wollen, wird nicht gefragt. Aber wir steigen ein. Die Entscheidung ist getroffen.
Ein Flugzeug, Mann. Stellen Sie sich vor! Und ich hab richtig Angst vor Fliegern. Ein Flugzeug ist für mich etwas, das Bomben vom Himmel wirft. Ich will in kein Flugzeug … Achtzehn Stunden, dann stehe ich wieder auf dem Boden, in England. Kalt. Neblig. Mir war noch nie kalt gewesen. Und Schnee liegt. Was ist das denn? Du hast noch nicht mal ein Wort dafür … Und es gibt keinen, den du fragen kannst. Also hast du Angst.
Eine Frau und ein Mann haben mich abgeholt. Mir gesagt, dass ich jetzt ein englischer Junge bin. »Hör mit dieser Sprache auf.« Das waren herzlose Dreckschweine. Basta. Unmenschen. Ihre Namen sage ich nicht. Will mir nicht den Mund schmutzig machen. Bestien. Verbrecher. Ich hoffe, sie verrotten.
Mit sieben wurde ich vom Sozialdienst abgeholt und in ein Heim gesteckt. Dann, mit neun, kam ich als Pflegekind zu einem irischen Ehepaar nach Rotherham … Wohin genau, möchte ich nicht sagen. Ist einfach privat … In der Boulevardpresse wurde verbreitet, sie hätten mich schlecht behandelt. Das stimmt nicht. Die Leute waren grundanständig. Wir kamen nur nicht miteinander aus. Haben uns zerstritten, als ich ein Teenager war. Mit sechzehn bin ich weg. Das ging aber nicht gegen sie, gar nicht. Sie hatten ihre Grenzen. Wer auch nicht? Ich werfe Ihnen nicht vor, dass sie nicht mit mir umgehen konnten, ich war innerlich kaputt. So kaputt, dass man es nicht mehr hinkriegt. Man kann nur versuchen, damit klarzukommen. Wiedersehen möchte ich sie nicht, nein – außerdem ist mein Pflegevater vor ein paar Jahren gestorben –, aber ich wünsche ihnen, dass sie sich nichts vorwerfen. Sie haben sich wirklich bemüht, verstehen Sie? Das ist schon was. Und von ihnen habe ich meinen Namen. Francis Xavier Mulvey. So hieß mein irischer Pflegevater. Gott schenke ihm Frieden. Hört sich nach einem Boxer an, oder? Francis X. Mulvey. Nicht so cool wie Herol Graham. Aber es gefällt mir. Er hat achtundzwanzig Kämpfe gewonnen, Mann. Ich noch nicht einen. Aber na ja, ich bin zuversichtlich. Für einen Pessimisten.
Hier ist nicht der Ort, um weiter auf Frans Kindheit einzugehen. Als ich ihn kennenlernte, sprach er das Thema nie an, obwohl es natürlich Hinweise gab – wenn man sie sehen wollte –, aber als viele Jahre später dann alles ans Licht kam, war ich genauso schockiert wie die meisten Revolverblattleser. In seiner Studentenzeit verstand Fran es, sich hinter einer Nebelwand aus Ironie und Gleichgültigkeit zu verstecken, auch vor denen, die ihn gernhatten. Man nahm das nicht persönlich. Im Gegenteil, man bewunderte eher den von seiner Anziehungskraft so schillernd eingefärbten Nebel. Es fiel zwar auf, dass er still wurde, wenn das Thema Familie zur Sprache kam, aber man dachte eben, er habe es nicht mitbekommen oder vielleicht falsch verstanden oder er sei einfach mit den Gedanken woanders. Im Gespräch stellte er viele Fragen, was immer darauf hindeutet, dass man selbst lieber nicht gefragt werden möchte. Aber das ist mir erst im Nachhinein klargeworden.
In der Erinnerung sehe ich ihn durch die zugigen Gänge des Kunstinstituts zockeln oder in einer der kahlen Backsteinnischen dieses ungastlichen Gebäudes ein Nickerchen machen. Am College gab es einen Haufen irischer Studenten vom Land, die einen Doktor oder ein Diplom in Agrarwissenschaft anstrebten, und ich war überrascht, Fran in einer ihrer Discos zu sehen. Nicht, dass er lange geblieben wäre. Er war schon damals schön, noch ehe er ganz in seine Schönheit hineingewachsen war, dürr und zum Küssen, wie das bei manchen Teenagern so ist, einen zerfransten Organzaschal um den Hals am winterkalten Morgen, ein Judy-Garland-Hütchen auf dem Kopf. In meinem ganzen Leben habe ich keinen dünneren Menschen gesehen. Jeder Kartoffelchip hat mehr Fett.
Dass er, wie zu lesen stand, in einem »Kleid« zum College kam, stimmt nicht. Die Kleiderzeit kam später. Ungewöhnlich war sein Look allerdings schon damals, zwischen dem zerlumpten Denim und dem kragenlosen Käseleinen, dem wir konventionellen Gemüter frönten. An seinen langen, schlanken Fingern steckte eine Vielzahl von im städtischen Trödel ergatterten Ringen. Er blätterte in Büchern, als ob ihn jemand beobachtete, und meistens traf das auch zu. Er hatte etwas Altes an sich. Seine Augen waren kalte Seen. Er erinnerte einen an die Kapellenruinen, die man in nördlichen Regionen findet, verwittert, aber standhaft. Er hatte einen Teilzeitjob als Tellerwäscher in der Kantine. Manchmal sah man ihn durch das Gitter an der Ablage fürs schmutzige Geschirr – Fran mit dem einzigen sternenbesäten Haarnetz, das je kreiert wurde. Niemand wäre darauf gekommen, dass die Professoren, die ihn kaum wahrnahmen, eines Tages Seminare über sein Werk anbieten würden.
Es war, als hätte ein sarkastisch grinsender Gott ihn aus der Dreigroschenoper entführt und ans Stanton Polytechnic & Agricultural College verpflanzt. In einem seiner Artikel schrieb er, die gesellschaftliche Wertschätzung von Leistung sei »brutal, mörderisch«, »der Künstler hat die PFLICHT zu scheitern«. Das ging über das studentenübliche Geseich und Gegeifer hinaus, das wir in jener unschuldigen Zeit alle nachplapperten. Er schien wirklich daran zu glauben.
Der Mann, bei dem er damals Drogen kaufte, fragte immer: »Einfach oder retour? Ich hab beides.« Für Fran als Student kamen nur leichte Sachen in Frage. Seltsam fand ich, dass er es nicht haben konnte, wenn andere Drogen nahmen. Er regte sich auf, wenn eine Kunststudentin im Trap an einem Joint zog. Sogar wegen Alkohol, den die meisten von uns tranken, er selbst auch, konnte er missbilligend die bemalten Lippen verziehen. Auf Partys stand er meist irgendwo in der Ecke und sah aus dem Halbdunkel zu, wie Stickluft und Biergeruch die sich ergebenden Zuckungen aller Art heiligten. Ich war verblüfft, als er mir sagte, er gehe jeden Sonntag zur Messe. Es hätte mich nicht zu wundern brauchen.
Dieses Gespräch, unser erstes, kann ich datieren, denn ich weiß, dass es nachmittags am Karfreitag 1982 stattfand, der auf den 9. April fiel. Der Feiertag versetzte die Studentenschaft in panischen Schrecken, denn es war einer von nur zweien im ganzen Jahr, an denen das von einem katholischen Wirt betriebene Trap geschlossen blieb oder zumindest früher schloss. Mehrere Kneipen in der Stadt fielen aus dem gleichen Grund aus. In anderen waren Studenten nicht willkommen. Die Unruhe setzte zu Beginn der Osterwoche ein und steigerte sich bis Karmittwoch zu heilloser Hysterie. Es würde nichts zu trinken geben. Was sollten wir machen? HERRGOTT, WIR KRIEGEN NICHTS ZU TRINKEN. In der Sphäre des Unvergänglichen stand das Scheiden unseres Herrn aus der körperlichen Welt bevor, aber uns machten unmittelbarere Katastrophen zu schaffen. Am Abend des Gründonnerstags hätte man für ein Sechserpack Harp jeden am College sodomisieren können. Üblicherweise kaufte man auf Vorrat und verschanzte sich bei jemandem in einem der vielen baufälligen alten Häuser, die in möblierte Zimmer für Studenten oder Nicht-ganz-Mittellose aufgeteilt worden waren. Dort heulte der Bleizeppelin, und die Tapete schälte sich von der Wand. Jesu Tränen sprenkelten die Fenster, hinter denen sich nach Ansicht der ländlichen Steuerzahler die intelligente Jugend zu Hause fühlen konnte. Eine nette BWL-Studentin landete weinend auf dem Etagenklo und spuckte wie ein Spielautomat, während ein von Poe erdachter Unhold ihr die Haare hochhielt und die andere Hand in ihre Strumpfhose schob. In einem Dielenschrank knutschten sich Studierende unter feuchten Mänteln ab. Die Cordbuxe des Mieters oder seines Cousins trocknete am Elektroofen. Irgendein Waldschrat fing eine Keilerei an und flog achtkant die Treppe hinunter, nur um eine Stunde später mit Vergebung heischenden Blicken wieder aufzutauchen und sich mit einer im 24-Stunden-Minimarkt geklauten Flasche Blue Nun die Rückkehr ins Vergnügungszentrum zu erkaufen.
Kampfgeschrei, benebeltes Getaste. Weinerliche Reden. Fummeln im Hinterzimmer, verwehrte Aufsprünge, Paranoid von Black Sabbath, im Morgengrauen altes Brot im Toaster. Das Fegefeuer wird für mich ein tausendjähriger Karfreitag sein, circa 1982, mit dem Geruch von Kartoffelchips, altem Teppichboden, zerstörten sexuellen Hoffnungen und ungewaschenen Nylon-Bettlaken, auf denen ein Student der Agrarwissenschaft Brut Aftershave verspritzt hat. Traurige Songs sagen so vieles, wie uns Elton mal erklärt hat, aber der Studentenbuden-Blues ist schlimmer.
Bei dieser ersten trostlosen Verschanzung unterhielt ich mich zum ersten Mal mit Fran, ermutigt durch den halben Liter Snake Bite, den ich zu genießen vorgab. Er trug einen Schottenrock und eine Sonnenbrille mit scharlachroten Gläsern. Einen jungen Mann im Kilt sah man selten in Luton – vielleicht am St.-Patricks-Tag, aber dann ohne Netzstrümpfe und Sonnenschirm, und die kamen bei Fran unübersehbar dazu. Sein Polohemd war in den Farben des AS Rom gehalten, nach seinem Bekunden der einzige Sportclub, für den er sich jemals erwärmt hatte. Der von ihm selbst aufgestickte Slogan war im Zusammenhang mit Karfreitag entweder bewusst aggressiv oder eine grobe Taktlosigkeit. »Römer vor!«
»Scheißschwuchtel«, meinte im Vorbeigehen ein Junge, der später Berater der New Labour Party wurde. »Hättest du wohl gerne«, gab Fran zurück und trat eine Kippe auf dem Linoleum aus. Mit Mühe machte ich einen Schritt auf ihn zu.
»Ich bin Robbie«, sagte ich.
Er nickte.
Ich wartete.
Er schob die rote Sonnenbrille hoch, als wäre er neugierig. Es kann wohl nicht sein, dass er mich anderthalb Minuten ohne zu blinzeln ansah, aber so kam es mir vor. Dann griff er in seine Felltasche und holte ein Fläschchen klaren Inhalts heraus, öffnete es, ohne den Blick von mir abzuwenden, nahm einen Schluck wie ein Hafenarbeiter, wischte den Flaschenhals am Ärmel ab und hielt es mir ohne zu lächeln hin. Ich probierte. Es gab jetzt Abbeizer mit Gingeschmack. Sieh mal an. Ich bediente mich.
Der allererste Satz, den er mir zulallte, war Gälisch: »Abair ach beagan abus abair gu math e«, ein Sprichwort, das jeder ehemalige Schüler der Christlichen Brüder Irlands kennt. »Sprich wenig, und was du sagst, sag gut.« Es war schlau von ihm, mich auf Gälisch anzusprechen, mit ausgestreckten Fühlern. Auf Chiffren und aufs Abklopfen verstand sich Fran. Dass ich auf Gälisch antwortete, schien mir die Tür zum Club zu öffnen. Er war nicht mehr ganz so auf der Hut.
Und er ging zum Englischen über, besser gesagt, zu seiner Version des Englischen. Die Party sei ein »Sabbelfest«, meinte er. Unser Gastgeber war ein »Scheißvogel«, die Gäste ein »Querbeetgespuck«, das eine »seelische Leistenzerrung« bei ihm hervorrief. Unsere Fachhochschule war ein »Analphabetikum«, in dem »Flachköpfe« zu »Mietlingen« und »Couchcowboys« herangebildet wurden. Ein paar Bomben darauf würden den IQ-Durchschnitt der Gruftschaft Bedfordshire nicht unwesentlich erhöhen. Die meisten Dozenten gehörten viviseziert, aber wegen mangelnder Labormausqualitäten sei das sinnlos. Ich war verblüfft über seinen Dialekt, der sich als viel Yorkshire mit etwas Connaught entpuppte, denn ich hatte ein gelangweiltes Poetengeleier erwartet. Fran hörte sich an, als käme sein Vater aus Mayo, was, wie ich erst später erfuhr, in gewisser Weise auch zutraf. Seine Rede war mit sprachlichen Eigenwilligkeiten durchsetzt, aber man verstand immer, was er meinte. Der Student da, »ein kackiger Waschlappen«, hatte eine Freundin, »ein Taschentuch«. Zusammen bescherten sie einem »Arschkrämpfe«. Der Typ, der gerade in den Spülstein pisste, war ein »Stonewash Jerry«, Frans Ausdruck für einen, dessen Mutter ihm die Jeans kaufte. Das Problem der meisten Leute sei, dass sie »sich niemals selbst anrufen«, eine Wendung, die ich mir mit »sie handeln, ohne nachzudenken« übersetzte. Ich gab mir alle Mühe, mich als weltgewandten und unermüdlichen Selbstanrufer zu präsentieren. Wie gut mir das gelang, weiß ich nicht.
Schwer zu verbergen war das Unbehagen an seinen Diffamierungen unserer Dozenten und der Collegegemeinschaft überhaupt. Die einen wurden der Trunksucht und unreiner Praktiken bezichtigt, die anderen jedweder schauerlichen Unkeuschheit und Unmäßigkeit. Professor X war »ein aalgesichtiger Sadist«, Dr. Y ein »pickelwarziger Trottel«, die Dekanin der Geisteswissenschaftlichen Fakultät, in Wahrheit die netteste Frau der Welt, »eine leere Wundertüte«. Pater Z, der katholische Kaplan, war »wandelnder Hüttenkäse«, sein Vikar »ein Liliputaner auf Stelzen«. Groß war Frans Zorn über die drei alten Scholaren, die dem Institut für Vergleichende Religionswissenschaft vorstanden. Ein triefäugiger, schimmerloser, autoflagellierender Tropf, ein eselsohriger Kackspecht und ein Mönchslutscher. Ihre Faulheit, Bosheit und Verschlagenheit ließ ihre Gelehrsamkeit weit hinter sich. Der Writer-in-residence war eine »Ratte im Rollkragenpulli«, der Pförtner »ein ausgebuddelter Höhlenmensch«. Der Assistenzprofessor für Architektur verband Gropius mit grobem Grapschen, und einen Aufzug, in dem nur der Ethikdozent stand, durfte man nicht betreten. Die Leseliste für die Bachelor-of-Arts-Kandidaten (Englische Literatur, Hons.) war »sortiertes Klopapier für entartete Schimpansen«.
Boxte ich? Warum nicht? »Solltest du.« In seiner Jugend in Yorkshire hatten drei Poster seine Zimmerwand geschmückt: Jean Genet, Grace Kelly, Herol Graham. »Ein Junge, der auffällt, muss boxen«, sagte Fran. »Typ wie ich im Norden? Wenn du da nicht boxt, bist du angeschissen.« Er hatte viele Stunden in Brendan Ingles Boxhalle in Wincobank bei Sheffield zugebracht. »Hatte nicht die Hände. Aber kämpfen konnte ich ein bisschen. Kein Vergleich mit Herol. Du siehst kräftig aus.«
Ich fiel weder auf, noch sah ich kräftig aus. Aber so grundlegende Komplimente hört man gern, selbst wenn man es nicht für bare Münze nimmt.
Über Musik verloren wir an diesem Abend kein Wort. Wir tauschten Klischees und Dummheiten über die frühen Romane von John Banville aus, dessen Werken Fran Relevanz attestierte, weil sie damals noch kaum in den Bestsellerlisten auftauchten. Anaïs Nin und Brendan Behan erwähnte er ebenso gnädig, jedenfalls schien es mir gnädig, vielleicht war es auch nur der Alkohol. Elias Canetti, der Literaturnobelpreisträger von 1981, war »passabel, wenn man sich gern langweilen lässt«. Jane Austen? »Nein.« Dickens? »Ein Perverser.« George Bernard Shaw? »Ein angefressener Pfarrer.« Die drei Brontë-Schwestern trieben einen in den Selbstmord, nur ihr Bruder nicht, der versoffene Branwell. Czesław Miłosz’ Schreibe kannte ich ja wohl? Ich kannte sie nicht, sagte aber ja. In meiner Verfassung war es schon schwierig, »Czesław Miłosz« auszusprechen. Versuchen Sies mal, wenn Sie das nächste Mal einen in der Krone haben.
Dann rasselte er auch schon eine Reihe von Namen herunter, ohne dass ich danach gefragt hätte – die Autoren, die er gelten ließ. Rimbaud, Verlaine, Kathy Acker (wer?), Kerouac, Neal Cassady, die Lake-District-Dichter »außer dem verlogenen Billy Wordsworth«. Elizabeth Bishop war nicht übel; sie hatte mit sich telefoniert. Keats und Camus hörten kaum jemals auf damit. Aber Dylan Thomas, »die verkackte Suppenschüssel«, wurde wahnsinnig überschätzt; »der brauchte schon drei Anläufe, um ›Schwanz‹ an eine Scheißhaustür zu schreiben«. Ein Groschenporno mit dem Titel Heiße Ladies, kalter Marmor war der einzige bedeutende amerikanische Roman seit Die Schönen und Verdammten. Hier in England natürlich verboten. Verbotene Autoren schätzte Fran immer besonders, weil er wusste, dass man sie nicht gelesen hatte.
Wenn ich ehrlich bin, war ich an dem Abend etwas enttäuscht von ihm, er schien mir albern, ein bisschen durchsichtig und auf Streit aus zu sein, weder so geistreich noch so düster, wie ich ihn mir aus der Ferne vorgestellt hatte. Im Subterranean Homesick Blues rät Bob Dylan, keinen Führern zu folgen. Aber wen interessiert mit achtzehn schon Rat? Und bitte verurteilen Sie mich nicht. In jungen Jahren waren Sie auch manchmal zu sehr von sich selbst überzeugt. Und wenn nicht, dann haben Sie jemanden geliebt, der es war. Es handelt sich auch nicht einfach darum, dass Gegensätze sich anziehen, eher erkennt man sich halb wieder. Freundschaft ist ein Venn-Diagramm, keine deckungsgleiche Übereinstimmung, und der Philosoph Montaigne hats erfasst: »Wenn man in mich dringt, zu erklären, wieso ich ihn liebte, so kann ich dazu eigentlich nur sagen: Weil er es war, weil ich es war.«
Ungefähr zwei Wochen lang sahen wir uns nicht. Ja, ich weiß noch, dass ich dachte, er hätte das Studium aufgegeben, um sich besser auf die Zerstörung des Colleges mit thermonuklearen Mitteln konzentrieren zu können, da er nicht zu den wöchentlichen Übungen erschien. Ich hielt eigens nach ihm Ausschau. Ende April entdeckte ich ihn dann aber in einer Vorlesung, wie gewohnt allein, hinten in Hörsaal L. Leise Spottlaute entfuhren ihm, als vom Podium herab behauptet wurde, Gerald Manley Hopkins zu studieren lohne sich und könne Vergnügen bereiten. Studenten drehten sich erbost nach seinem ungerührt kaugummikauenden Antlitz um, eine Osterinselstatue in Herzanfallrosa. Einem antwortete er mit der sexuell gefärbten Schmähgebärde, bei der man den Mittelfinger der rechten Hand einsetzt. Bald darauf stellte er sich schlafend oder schlief tatsächlich, die Stirn auf dem Holzpult. Nach dem Vortrag kam er zu mir, und mit Staunen sah ich, dass er einen schwarzen Plastikmüllsack dabeihatte, aus dem er eine Gitarre hervorzog.
Der Dozent wurde im Hinausgehen noch etwas unfair als »Harry, das sprechende Hämorrhoid« bezeichnet, dann kam die vorliegende Angelegenheit zur Sprache. Fran hatte sich einige Riffs der Stranglers beigebracht, erklärte er zögernd. Die Gitarre war ein Bass. Er hatte ihn in einem Container in der hiesigen Gordon Street gefunden. Ein Höfner »Violin« aus den Siebzigern. Von einem Nichtfachmann grün, weiß und golden lackiert, so dass vereinzelt das alte Schwarz durchkam. Die Original-Pickups fehlten, und die Saitenlage war so schlimm, dass einem Handgelenk und Finger wehtaten, wenn man weiter oben ein H greifen wollte. Arme Keule, sie sah aus, als wäre sie zum Türeneinschlagen verwendet worden. Einen neuen Satz Saiten hatte Fran gestohlen, aber er hatte keinen Verstärker. Wusste ich, wie man billig an so was rankam?
Ehrlich, ich fühlte mich so unerhört geschmeichelt, mit der Frage beehrt zu werden, dass ich bis zum Zahnfleisch errötete. Es ist das einzige Rotwerden in meinem ganzen Leben, an das ich mich erinnere. Ein paarmal hat es sich in meine Träume geschlichen.
Zufällig war mein Bruder Shay kurz vorher aus einer Band ausgestiegen, eine lange Geschichte, die etliche Leute in Verlegenheit bringen würde, wenn ich näher darauf einginge. In der Staubwüste seines Zimmers lagerte ein Marshall JCM800 Bassverstärker. Er war so groß wie eine Waschmaschine, und Shay hatte nicht nur all seine Hoffnungen in ihn gesteckt, sondern zehn Monate lang jeden roten Heller, den sein Teilzeitjob als Kloreiniger auf dem Lutoner Flughafen ihm einbrachte. Er hatte einen Abschluss in Englisch und Politik, aber danach schauten die Arbeitgeber von Bedfordshire nicht. Wegen einer Freundin wollte er die Stadt nicht verlassen. Außerdem war er, auch wenn er es bestritt, ziemlich sesshaft. Gut Bass gespielt hatte er nie, aber dafür hatte er sich entschlossen, laut zu sein, ein bewundernswerter und keinesfalls einmaliger Kompromiss.
Ich hatte nichts, was ich Shay zum Tausch hätte anbieten können, aber ich wollte Fran beeindrucken. Ich hätte den Verstärker gern ausgeliehen, doch das lehnte mein Bruder strikt ab, denn obwohl das Ding nichts als die stumme Erinnerung an ein brutales Scheitern war, wollte er sich nicht davon trennen. Diesen merkwürdigen Starrsinn habe ich bei vielen Menschen irischer Herkunft beobachtet. Wir erhalten uns gern die Beweise, dass etwas nicht gut gelaufen ist: Hochzeitsfotos, eine Wundermedaille, einen Reisepass.
Unerschrocken fragte ich ihn, ob wir den Verstärker vielleicht auf Pump kaufen könnten, mit wöchentlicher Rückzahlung plus Zinsen. Das lief darauf hinaus, bei meinem Bruder einen Kredit aufzunehmen, um ihm eine Ware abzukaufen, die ich nur wegen des Status brauchte, den sie mir verleihen würde. Weder ein kluges noch ein gesundes Geschäftsmodell, könnte man meinen, doch Jahre später, in den Zeiten der Einheitswährungskrise, wurde ganz Europa auf dieser Firmenladenbasis regiert. Ich dachte, wenn ich freitagabends im Trap ein Opfer brächte und auf ein Bier oder auch vier verzichtete, wäre alles geritzt. Von Shay gefragt, was ich ihm als Sicherheit zu geben gedächte, war ich ratlos, überrumpelt. Ich wusste nicht genau, was Sicherheit bedeutete, hatte aber den Verdacht, sie nicht bieten zu können.
Er wies darauf hin, dass ich zweiundsiebzig Jahre brauchen würde, um den mir vorschwebenden Kredit zurückzuzahlen, dass er aber vorhabe, bis dahin tot zu sein. Daraus wurde ein bizarrer Wettstreit zwischen uns, eine Frage des Stolzes – sogar ein ideologisches Geplänkel. Shay war in jenen Jahren bekennender Trotzkist, hart, verbissen, ohne jedes Zugeständnis an die tatsächlichen Gegebenheiten der menschlichen Natur, wie es sich für Glaubensbekenntnisse gehört. Eigentum war Diebstahl, die Arbeiterrepublik würde es abschaffen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, lautete sein Credo, jedem nach seinen Bedürfnissen. Bat man ihn mit diesem Argument aber um den Verstärker, kam er mit einer eiskalten Abfuhr und seiner Verteidigung des Privateigentums thatchertreuer als die Daily Mail daher. »Das Teil gehört verdammt nochmal mir, du blöder, arbeitsscheuer Spasti!«, brüllte er dann, und seine Stirnader schwoll zu einer pulsierenden blauroten Raupe an. Noch schlimmer war es, wenn er mich wortlos wegscheuchte, ohne von Lenins gesammelten Reden auch nur aufzuschauen, während ich mich in die Monstergrube meiner Wut verkroch.
Unser Gerangel zog sich quälende zwei Wochen hin, zur Belustigung meines Dubliner Dads und zum Kummer meiner Mum. Als einzige Tochter eines Bauern aus der schönsten Gegend des Countys Clare fand sie Streit im Haus beunruhigend. Ihre eigene Familie war die freundlichste und innigste, die ich kenne, geprägt von der sensiblen und intelligenten Höflichkeit, die man bei Landbewohnern manchmal findet. Shay und ich pfiffen darauf. Wir kämpften weiter. Schon wie er mich weckte, war grausam. Er stahl sich vor Tagesanbruch in mein Zimmer, setzte mir die jetzt an den Verstärker angeschlossenen Kopfhörer auf, KNALLTE mir den brutalen Dreierriff aus Smoke on the Water von Deep Purple ins Ohr und flüchtete, bevor ich mich hinreichend erholt hatte, um ihn zu erwürgen. Später im Leben hatte ich einmal die Ehre, mit Jon Lord, dem unvergleichlichen Keyboarder der Purples, sprechen zu dürfen, einem Paderewski der Hammondorgel, und dem Mann die Hand zu geben, der das unwiderstehliche Bluessolo auf Lazy spielte, aber damals, als Teenager, teilte ich den Standpunkt meiner Clique: Deep Purple waren schwerfällige Dinosaurier, die in leerem Gepränge versanken und den Untergang verdienten. Sie würden sich im Hades der zwanzigminütigen Drum-Soli wälzen, wo Maulesel und Affen tollten. Shay behauptete, ich läge falsch, sie würden alle Moden überdauern. Mit einem Anhänger des Punk und New Wave wolle er nichts zu tun haben. Es wäre eine Beleidigung der dunklen Lords des Rock ’n’ Roll. Elvis Costello, den ich bewunderte, »sieht aus wie ein Buchhalter, der vier Jahre wegen Unterschlagung absitzt«. Siouxsie Sioux war offensichtlich »verrückt im Kopf«. Adam and the Ants? »Ich werd nicht mehr.« Mir seinen Verstärker zu leihen, das sei, als ob man einem kleinen Kind eine Flinte in die Hand drückt. Die Folgen wären schrecklich, nein, fatal.
Wenn ich vom Trap nach Hause wankte, feilte Shay bereits an seinen Diffamierungen, denn seine Taktik bestand darin, mir den wilden Schwinger seines NEIN zu versetzen, ehe ich überhaupt dazu kam, die Frage noch mal zu stellen. Er nannte mich einen Schnorrer. Ich nannte ihn einen Contra. Die Konterfeis von Che und Fidel blickten finster auf sein Bett, über das Regal mit den Airfix-Kampfbombern und Kriegsschiffen hinweg, die er als Kind gesammelt hatte, aber sein käufliches kleines Herz, schimpfte ich, gehörte dem weißen Establishment. »Scheiß doch die Wand an!«, gab er zurück. Den Gipfel erreichte meine Empörung eines denkwürdigen Tages um Mitternacht, als ich mich, fast heulend vor Wut darüber, dass mein Wunschobjekt mir so lange verwehrt wurde, zu voller Zornesgröße aufrichtete und schrie: »Was würde wohl Nelson Mandela machen?« Die Wunde, die sein Gelächter schlug, brennt immer noch.
Meine Schwester Molly war einige Jahre vor diesen Ereignissen unverhofft bei einem Autounfall im Dubliner Viertel Glasvenin ums Leben gekommen, wo wir in jener längst vergangenen Zeit wohnten. Der Fahrer war betrunken. Molly hatte die Straße überqueren wollen. Die Geschenke für ihren siebten Geburtstag waren im Kleiderschrank meiner Mutter versteckt, und dort blieben sie noch viele Monate nach dem Begräbnis, da es niemand über sich brachte, sie wegzuwerfen. Sie können sich die Trauer vorstellen. Mir fehlen die Worte dafür. Wer sieht, wie eine Frau ein letztes Mal den Körper ihrer sieben Jahre alten Tochter wiegt, ein Vater weinend am Rand eines Grabes kniet, der weiß, dass es unverdient grausame Schicksalsschläge gibt, die man niemals verwinden, sondern nur überleben kann. Mein Dad arbeitete als Wärter in Dublins schönem viktorianischen Zoo, ein Beruf, den er liebte, aber ausüben konnte er ihn nicht mehr. Eine Zeitlang war es ihm nicht möglich, das Haus zu verlassen; er konnte der Straße nicht verzeihen und auch nicht der Stadt. In England wurde eine ähnliche Stelle frei. Meine Mutter zögerte. Aber mein Vater hatte das Gefühl, ihm bliebe jetzt nur noch England. Der Vertrauensmann seiner Gewerkschaft, die inselübergreifend organisiert war, legte ein gutes Wort für ihn ein, und wir zogen um. Dads Brüder waren in England und drei Schwestern meiner Mutter. Achtundzwanzig meiner dreißig Cousins und Cousinen waren dort geboren. Meine von Schmerz und versehrter, schiffbrüchig gewordener Liebe zu ihm betäubte Mutter willigte ein, obwohl sie Angst davor hatte. Molly war für meine Eltern und auch für meinen Bruder und mich nicht verschwunden – wie hätte das gehen sollen? –, sondern hielt sich in der Luft, die unsere Familie atmete, wie der Tau auf den Äpfeln im Herbst. Wir brachten es kaum auch nur über uns, ihren Namen auszusprechen. Doch ihre Abwesenheit begleitete uns bei jeder Mahlzeit, jedem kleinen und großen Ereignis, in der Stille eines Sonntagmorgens ebenso wie am Weihnachtsabend. Sie regnete an unsere Fenster und stieg aus den Nelken und dem Mädesüß auf, die Dad in unserem neuen Garten pflanzte. Meine Eltern hatten das schlimmste Leid auf Erden durchgemacht. Molly muss uns aus den Augen geschaut haben.
Was ich erzählen will, ist lächerlich, aber die Tatsache bleibt. Etwas an dem Gerangel um den Verstärker war nicht lustig. Das jüngste Kind ist oft der Angelpunkt einer Familie. Um ein so objektiv hinreißendes und spitzbübisches Kind, wie die kleine Molly es war, müssen Geschwister, insbesondere Brüder, einfach kämpfen. Immer wenn Shay und ich uns stritten – und wir stritten andauernd –, hatte ich das Gefühl, dass wir noch um die Anerkennung unserer Schwester rangen, dass einer von uns den Preis gewinnen und der andere beschämt sein würde. Vielleicht war es ein Mittel, um sie nicht zu vergessen, während wir von ihr Abschied nahmen, eine Erkenntnis, der ich mich in dem Monat näherte, als ich Fran kennenlernte. Auch das ein Beispiel dafür, wie sein Auftauchen in meinem Leben etwas sichtbar machte, das schon lange da war.
Schließlich klaute ich das Dreckding an einem verregneten Sonntagnachmittag, als Shay in Cambridge war, um auf einer Versammlung des Universitätsverbands der Sozialistischen Arbeiterpartei eine Rede zu halten. (Ja, ich weiß.) Sie sympathisierten beim Häppchenessen mit der Arbeiterklasse von El Salvador oder verabschiedeten Resolutionen mit der Aufforderung an Präsident Reagan, jetzt aber wirklich mal zurückzutreten oder so, während der rostige Einkaufswagen, den ich in Dads Gartenschuppen aufgetan hatte, schwer beladen von unserem Haus wegrollte. Als Agatha-Christie-Fan hatte ich das Küchenfenster eingeschlagen, um einen Einbruch vorzutäuschen, aber Shay, nicht dumm, ließ sich nicht für dumm verkaufen. Trotzkisten können eigen sein, auch wenn die Lage noch so klar scheint. Siehe die Geschichte der britischen Labour-Partei in den 1980er Jahren. Shay sprach fast zwei Monate kein Wort mit mir und rächte sich schließlich, indem er mit dem Feuerzeug Löcher in meine Buzzcocks-Alben brannte. Später gelang es uns, den Kampf in einen Waffenstillstand umzumünzen, der Raum für Scherze ließ, jedoch ebenfalls nicht ohne Tränen abging. 1991 nach Neuseeland ausgewandert, kommt er nur noch selten nach Hause. Er ist wissenschaftlicher Referent des neuseeländischen Gewerkschaftsbunds, war Redenschreiber für Premierministerin Helen Clarke und hofft, sich im nächsten Jahr selbst zur Wahl zu stellen. Aber wann immer ich Smoke on the Water höre, ist mein Bruder da, der witzigste und liebenswerteste Mensch, den zu kennen mir vergönnt ist, und auch einer der gescheitesten. Auf seiner Weihnachtskarte vor zwei Jahren kam aus der Krippe des Jesuskinds eine improvisierte Sprechblase mit dem Text: »Deep Purple rockt, du diebischer Torybock.« Meine Tochter heißt »Molly Shay« nach meiner Schwester und meinem Bruder, deren hochmütiges iberisches Aussehen sie hat, wie viele mit westirischem Blut.
Verzeihen Sie. Ich greife vor.
Es wäre unfair, zu behaupten, Fran hätte mir den Eindruck vermittelt, ein brillanter Musiker zu sein. Seltsamerweise hatte ich aber genau diesen Eindruck. Oscar Wilde schreibt irgendwo: »Ich habe mich zu Musik gemacht«, und ich nahm an, auch Fran sei ganz Musik oder bemüht, es zu sein. Als ich aber den geklauten Verstärker enthüllte, wirkte er nervös und gereizt, weil er ja jetzt was zeigen musste. Nachdem er so lange gesucht hatte, widerstrebte es ihm, zu finden: ein wiederkehrendes Motiv im Leben nervenstrapazierender Leute. Frans Verhalten ließ sich so wenig voraussagen, wie man den Himmel in Stein meißeln kann. Das Naheliegende zu tun war ihm nicht gegeben. Stattdessen sagte er mir, er sei »querös« gewesen, ein von ihm erfundenes Adjektiv, das »nervös« und »verquer« zusammenwarf. Der Bass sei nicht sein Instrument, habe er festgestellt. Er telefoniere in dieser Angelegenheit mit sich.
Er verhökerte den Bass, kaufte sich eine billige Akustikgitarre – eine Takeharu-Kopie –, und ich versenkte eines Abends den Verstärker im künstlichen See auf dem Campus, bestürmt von Schuldgefühlen und Angst. Ich war überzeugt, wenn ich ihn zu verkaufen versuchte, würde ich festgenommen und vor Gericht gestellt, und die grauenhafte Folge der dann fälligen Vorstrafe wäre, dass ich niemals in die USA einreisen dürfte. Fran hatte mir das erzählt, und er half mir auch, den Verstärker zu entsorgen. Auszuwandern war damals mein einziger Ehrgeiz – jedenfalls der einzige, den ich öffentlich hätte kundtun wollen. Wir Gauner mit Vergangenheit mussten die Beweise loswerden. Das College wurde vor einigen Jahren abgerissen, aber der See ist noch da, jetzt umgeben von einem Gewerbegebiet mit viel Grün. Ich frage mich, ob der See schon jemals abgelassen worden ist. Vielleicht finden die Archäologen des siebenundzwanzigsten Jahrhunderts einen Verstärker dort im Schlamm und staunen über die absonderlichen Riten jener Völker.
Nach der Verstärkerversenkung gab Fran mir die ersten Kostproben seiner Songtexte, überlange, schwülstige und unzusammenhängende Phrasendreschereien, die sich, wenn ich ganz ehrlich bin, nach gutgemeinter Werbung anhörten. »Die Hoffnung ist nur einen Atemzug entfernt«, »Liebe ist ein Zuhause«. Unbedenkliches Geplapper, aber doch ein bisschen eurovisionär, nicht gerade die Ergüsse eines Rebellen. Bestenfalls stellte man sich vor, wie Rick Wakeman mit geschlossenen Augen sie am Synthesizer begleitete, oder sonst jemand von der Moog-Bruderschaft. Wäre es um die Vermarktung von Zahnpasta, Lebensversicherungen oder Cholesterinsenkern gegangen, hätten Frans strahlende Visionen von Hand in Hand im Regen durch Mohnblumenfelder laufenden Pärchen für herrliche Gewinnprognosen gesorgt. So aber erschienen sie mir hohl und seltsam abgeschmackt für einen Jungen mit eigenhändig gepiercter Brustwarze, der angeblich auf flotte Dreier fixiert war. Man fragte sich, wen er da beeindrucken wollte. Sich selbst vielleicht.
Wie ich es damals sah, gab es auf der Welt ein Meer von Songs. Wir schipperten mit unserem schmuddeligen Kahn ohne bestimmtes Ziel darüber hin, gönnten uns ein wenig Spaß und warfen ab und zu die Angel aus. Jedenfalls will man von Straßenmusikern nichts Selbstgeschriebenes hören. Das ist, als ob man den Kindern anderer Leute beim Musizieren zusieht: nett, sogar bewundernswert, man schwingt auch, wenn man soll, das Tamburin dazu, aber eigentlich würde man lieber Stevie Wonder hören. Je eher Fran diese Phase hinter sich lässt, dachte ich, desto besser. Natürlich sagte ich es ihm nicht. Er war mein Freund, also hörte ich zu. Weitere geisttötende Nichtigkeiten entströmten seiner Feder. Bis eines Tages eine kleine, bedeutsame Änderung eintrat. Ein Text von Fran brachte mich zum Lachen.
Es war keineswegs Cole Porter. Trotzdem hatte es was. Nennen Sie es Pep, Charakter, Selbstgefühl. Es war so ähnlich, wie wenn man sich an der Bushaltestelle mit ihm unterhielt, hatte etwas Ironisch-Alltägliches, das mich ansprach, und drückte eine bestimmte Haltung aus. Es war in Verse umgesetzter Fran und wenig mehr. John Lennon hat mal gesagt, beim Songschreiben gäbe es kein Geheimnis: Sag, was du sagen willst, und bring es in einen Rhythmus. Fran las mir den Text vor und ich musste lachen.
Ich rief mich an.
Der AB sprang an.
Das Telefon schrie.
Ich war querös und zu.
Mami war nicht da.
Ich war unsicher und verdreht.
Ich rief mich an.
Das Vieh, das abnahm, warst du.
»Um wen gehts da, Fran?«
Er sah mich komisch an.
»Manchmal, Robert Goulding, offenbart deine Oberflächlichkeit verborgene Tiefen. Komm – du darfst mir Fritten kaufen.«
Zwei
Die geisteswissenschaftliche Fakultät des College, inzwischen längst abgerissen, war ein Magenstoß der 1960er Moderne. Irgendein Architekt, der in Perugia oder einem umgebauten Pfarrhaus in den Grafschaften wohnte, hatte sich gedacht, ein neostalinistisches Betonsilo sei genau das richtige Ambiente, um die Kreativität der Jugend freizusetzen. Überall standen brutal abstoßende und angsteinflößende abstrakte Skulpturen, an denen die Studenten ihre Mützen und Mäntel aufhängten. Die Aufzüge funktionierten nicht. Die Toilettenspülung selten. Bestimmt hat der Bau viele Preise eingeheimst. Frans Spitzname dafür – »Flughafen Bukarest« – gibt Ihnen einen ungefähren Eindruck.
Im neunten Stock war der Fachbereich Ethik, Vergleichende Religionswissenschaft und Theologie untergebracht, aus naheliegenden Gründen ein wenig besuchtes Terrain. Nur ganz gelegentlich wurden die durch den Gang treibenden Riesenstaubmäuse von gottesfürchtigen Studenten gestört, schon damals eine gefährdete Spezies, oder von Studentenpärchen, die keinen anderen Austragungsort für ihre Leidenschaft wussten als diese Flure mit ihren Postern von Päpsten, Michelangelos David und der Möwe Jonathan in hehrem Flug.
Fromme Leser werden den Kreuzweg kennen, eine bildnerische oder plastische Darstellung vierzehn bedeutender Augenblicke in den letzten Erdenstunden unseres Erlösers. Leider muss ich sagen, dass sich die Studenten die Sprache des Kreuzwegs in frevlerischer Weise angeeignet und sie auf die erotische Schiene übertragen hatten. In B9 bedeutete »die erste Station« Händchenhalten beim Zungenkuss. Die fünfte hieß manuelle Stimulation durch die Unterwäsche (vorzugsweise von jemand anderem). Die sechste hieß Reißverschluss runter bzw. Höschen aus. Auf die siebte möchte ich nicht eingehen. Die achte Station erreichte, wer seinen Mitverschwörer von der alten biblischen Devise überzeugen konnte, dass Geben seliger ist denn Nehmen. Gelangte man über die neunte hinaus, war man dem Himmel zutiefst dankbar. Nicht, dass ich jemals so weit gekommen wäre. Höchstens bis vier, auf dieser Wallfahrt. Der Einzige, mit dem ich je ins Bett gegangen war, war ich selbst. Am besten hätten wir uns wohl darauf beschränkt, Freunde zu sein. Aber die Trennung fiel uns schwer.
Fast beeindruckend war der Blick auf die Autofabrik, wenn man aus den deckenhohen Fenstern schaute, die seit ihrem Einbau noch niemand geputzt hatte. Von außen vogeldreckbestirnt, waren sie von innen mit obszönen Graffiti übersät: Gotteslästereien, Flüche, Diffamierungen Unschuldiger, derbe Bilder, rückblickende Prahlereien. Hinter der Stadt sah man die Viadukte, den Flughafen und das Gewerbegebiet, in dem die Mehrzahl meiner Schulfreunde arbeitete oder Kinderwagen schob. Kein Ausblick, bei dem einem das Herz aufging. Wenn man aber bereit war, das Seufzen in Kauf zu nehmen, die aus dem Augenwinkel gewahrten Verhedderungen, die gemischten Schlabber- und Schluckgeräusche gemeinschaftlichen Schleckens, den ganzen bitzeligen Soundtrack jugendlicher Erogenität, dann konnte B9 für arme Jungen eine Oase sein.
Fran und ich fingen an, in den Pausen zwischen den Vorlesungen dort hinzugehen, bewaffnet mit unseren Gitarren, meiner speckigen Ausgabe von Bert Weedons Monster-Notenbuch und Frans Textentwürfen. Inzwischen konnte ich in den meisten Dur-Tonleitern herumzupfen, ausgenommen vielleicht B. G, C und D sind gute Tonarten für den werdenden Gitarristen, ihre Akkordfolgen einfach und die Mollparallelen leicht spielbar, ihre Dominanten und Subdominanten bekommt jeder mit normalen motorischen Fähigkeiten begabte Mensch hin, und wenn das Vertrauen in den Fingern wächst, kann man auch mal einen kleinen Blueslick oder eine jazzig-elegante Sexte anbringen. B ist ein Alptraum, weil es ohne Dis oder ein Kapodaster nicht geht und ich Letzteren immer vergaß oder rätselhafterweise nicht fand, oft, weil Shay ihn mir geklaut hatte. Frans natürliche Tonart war B.
Sein Bariton war zaghaft, als bäte er dafür um Entschuldigung. Damals konnte man ihn nicht kraftvoll nennen. Das kam alles später. Aber wie sich das Ungeschminkte darin mit dem Zaghaften verband, das hatte ich noch nie gehört, außer vielleicht in Aretha Franklins tollen frühen Aufnahmen für Atlantic, von denen mein Dad zu seiner Enttäuschung mal eine Auswahl erhalten hatte, als er seine gesammelten Green-Shield-Marken einschickte. Die Christniks kamen und gingen, blieben aber immer öfter, während Fran durch den reizlosen Flur mit Blick auf den Parkplatz der naturwissenschaftlichen Fakultät tigerte und die Fäuste Richtung See und neuerbaute Sporthalle (»Asbestsilo«) schüttelte, als würde die Existenz beider ihn erzürnen. Er zitterte beim Singen. Harkte nach der Luft. Fuhr sich mit den Händen durch den Pony, das große Luder. Ich wusste nicht, dass ich ihn eines Abends auf der Bühne der Hollywood Bowl erleben würde, auf den Knien wie James Brown, die Scheinwerfer anflehend, während meine Finger hektisch über gefühlte zehn Meilen Griffbrett rasten und das Publikum im Sprechchor seinen Namen brüllte. Sie wollten, dass er das Mikrophon an der Schnur herumwirbelte, es wie ein Lasso warf, es heulen ließ, ein Tamburin am Boden zerschmetterte. All das würde passieren. Aber noch nicht. Er war ein paar Monate über achtzehn, als er zum ersten Mal in meinem Beisein sang. Man sollte meinen, der Augenblick hätte sich in mein Gedächtnis eingebrannt, aber nein. Ich weiß nur noch, dass ich hoffte, er würde singen wie ein Held. Und Jesusmaria, das hat er getan. Ja, die Röhre hatte Fran schon immer. Es dauerte nur ein Weilchen, bis er sie fand.
Gitarre spiele ich ziemlich gut, aber als Sänger finde ich mich nicht besonders. Ich kriegs hin, Punkt. Viel ist das nicht. Beim Singen gehts nicht ums Singen, sondern darum, was du zu sagen hast. Oder was du siehst. Singen heißt einfach sehen. Wer sprechen kann, kann singen … Elvis war nicht so der Sänger wie Sinatra. Der Kontext machts. Die Leute sagen, Dylan kann nicht singen. Für mich ist das Quatsch. Seine Diktion ist perfekt. Seine Wortwahl. Seine Atmung. Dylan führt zu Patti Smith, führt zu John Lydon. Und so weiter. Ich bin technisch gesehen ein ganz durchschnittlicher und limitierter Sänger. Ich wäre gern Roy Orbison geworden. Bin ich aber nicht. Da tut man eben, was man kann. So auch ich. Ich hab getan, was ich konnte, ja? Und noch mehr … Und sagt man mir nicht immer nach, ich hätte hart daran gearbeitet, beim Publikum anzukommen? Komplimente hört man gern, aber das stimmt nicht. Die Leute halten einen für sonst was. Dabei ist es nur die Atmung. Ich hab immer die Augen zugemacht und mich in mich selbst zurückgezogen. Weiter nichts. Billie Holiday kann singen. Etta James. Johnny Cash. Townes Van Zandt. Tim Hardin. Die Folksängerin Odetta – die finde ich genial. Aber der Gesang ist nur ein Teil des Spiels, und noch nicht mal der wichtigste. Lou Reed kann überhaupt nicht singen. Aber kann er singen? Und ob. Perfektion ist zu einfach. Ich habs gern fehlerhaft.
Singen kann etwas verändern. Es öffnet Schranken. Sie haben sicher schon erlebt, dass Sie in der Dusche trällern wie Ol’ Blue Eyes, im Auto grölen, während die Ampel zusieht, oder vor der Background-Spülmaschine Ihren Jagger geben, wenn das Haus leer ist. Aber die Einladung, vor einem Haufen freundlich-erwartungsvoller Gesichter ein Lied anzustimmen, kann vielen von uns gestohlen bleiben. Am schwierigsten ist es, in einem Raum vor einer einzigen Person zu singen. Liebende wagen es vielleicht, oder auch Eltern und Kinder, aber wenn Ihr Kollege im Büro zu Ihnen sagt: »Kommen Sie schon, singen Sie mir was vor«, würden Sie mit einem angespannten Lächeln rückwärts zur Tür schleichen. Vielleicht weil Gesang die einzige Musik ist, die allein vom Körper ausgeht, bedarf es einer gewissen Unbefangenheit, wenn ein Erwachsener vor einem anderen singen soll. Und haben Sie erst gesungen, sehen Sie ihr Gegenüber merkwürdigerweise anders als vorher, besonders wenn Sie einen ganzen Song durchgestanden haben. Drei Minuten sind eine unerhört lange Zeit für den Zuhörer. Nicht einmal Ehepartner hören drei Minuten ununterbrochen zu. Täten sie es, hätten wir wesentlich mehr Scheidungen. Sie haben etwas Intimes getan. Und der Zuhörer ebenfalls. Sie haben gezeigt, wer Sie sind – vielleicht auch, wer Sie sein möchten. So war es bei Francis und mir.
Meine Tochter hat mich einmal gefragt, ob man es irgendwie erkennen kann, wenn ein Junge insgeheim unehrlich ist. Lass ihn dir was vorsingen, sagte ich ihr. Lehnt er ab, taugt er nichts. Sonst vielleicht schon. So simpel es klingt, es ist kein schlechter Prüfstein. Wer nicht singen will, verbirgt etwas.
Ich hatte nur selten mal vor jemandem gesungen. Fran ebenfalls. Aber dass ich es nicht gut konnte, änderte nichts an den Möglichkeiten. Ich erinnere mich an seine Sanftheit, an diesen seltsamen neuen Ton. »Sing, Rob. Es ist nichts dabei. Du fühlst dich sieben Jahre jünger. Sing, als ob keiner zuhört.« Meine Stimme war ein Krächzen, doch das besserte sich mit der Übung. Zitternd tönte es aus meiner Brust herauf und hatte, zugegeben, noch mit der Luft zu kämpfen, auf die es traf, aber es war meine Stimme. Dazu kam, was das Singen bei meinem Freund bewirkte. Schwierig, dafür ein Bild zu finden. Sagen wir, es nahm ihm die Maske ab. Fran wurde möglich.
Vertrauen. Verlass. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Das Gegenteil von nein ist nicht ja, sondern vielleicht. Songs endeten, fingen an, wurden aufgegeben, umgemodelt, und irgendwo in der neuen Wetterlage gab Fran dann auch etwas von seiner Kindheit preis. Die ersten Jahre bei seinen Adoptiveltern in England waren grauenhaft. Nachdem er ihnen weggenommen worden und in ein Heim gekommen war, war er »still und las Bücher« in der Hoffnung, »für immer da leben zu können«. Er erzählte mir mehr von dem Ehepaar in Rotherham, das ihn mit neun aus dem Heim geholt und in Pflege genommen hatte. »Westiren« von der Landenge zwischen den Loughs Corrib und Mask, wo der Film Der Sieger gedreht wurde. Sie zeigten ihm Fotos und Ansichtskarten und brachten ihm kleine Lieder auf Irisch bei. Sie wollten freundlich sein. Es verwirrte ihn. Seit langem an Terror gewöhnt, machte Stille ihm Angst. Bis er begriff, dass er keine Schläge bekommen würde, wenn er etwas sagte, dass er kein Essen zu stehlen und sich zum Schlafen nicht zu verstecken brauchte, hatten sich andere Sorgen und Schwierigkeiten ergeben. Seine Pflegeeltern waren gläubig und kamen mit dem Teenager, der aus ihm wurde, einfach nicht zurecht: den Klamotten, seinen Gefühlen, den Schriftstellern, die ihn interessierten, der Musik, für die er schwärmte, »dem Sexkram«. Sein Pflegevater, Nachtwächter in der Zeche Maltby, war »ein guter Mensch, aber wir konnten uns nicht leiden«. Die Streitigkeiten arteten aus. Mit sechzehn haute Fran ab, trampte nach Süden, schlief im Freien und schlug sich in der Gegend von Boston in Lincolnshire mit Betteln und Klauen durch, bis er schließlich nach Bedfordshire kam, wo er Gelegenheitsarbeit auf einem Bauernhof zu finden hoffte. In der Stadtbücherei Luton erwischte ihn die Bibliothekarin beim Klauen eines Buchs. Aus Mitleid rief sie nicht die Polizei, sondern gab ihm Geld für eine Mahlzeit, half ihm, Sozialhilfe zu beantragen, und ermutigte ihn, sich am College einzuschreiben. Sie hätte auch gern gehabt, dass er wieder Kontakt zu seinen Pflegeeltern in Rotherham aufnahm, aber das wollte er nicht. Mir hat er nie ein böses Wort über sie gesagt, aber er hat immer in der Vergangenheitsform von ihnen gesprochen. Sie kamen aus der Ortschaft Cong in Mayo und waren in dem Jahr, als er zwölf wurde, in den Ferien einmal mit ihm dort. Cong sei schön, sagte er mir. Die Leute »redeten leise«. Sie waren freundlich zu dem verängstigten Jungen, der nicht wie einer von ihnen aussah, aber einen irischen Namen trug. Sie ließen ihn Kühe melken. Nahmen ihn mit aufs Moor. »Gott liebt dich, großer kleiner Mann.« Die Kinder von Cong hätten ihn manchmal neugierig angesehen, aber nie böse, nicht ein einziges Mal. Offensichtlich waren Fran diese Ferientage wichtig, eine kostbare Erinnerung an unkomplizierten Frieden, für die er dankbar und auf die er eigenartig stolz war. Wenn ihn Jahre später verwirrte Journalisten nach seiner Nationalität fragten, antwortete er manchmal: »Viet-Cong.«
An dieser Stelle möchte ich mich bei den Lehrern entschul