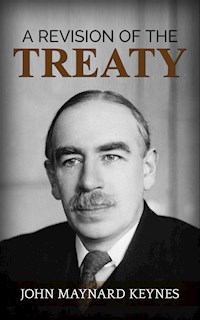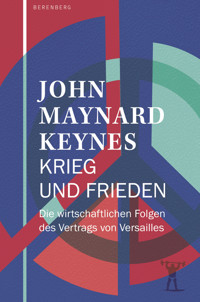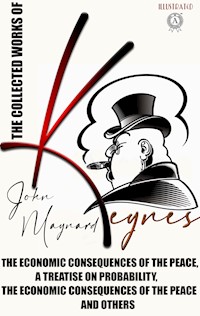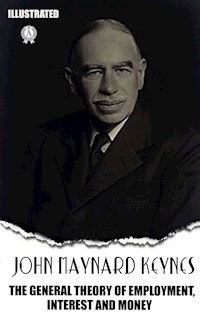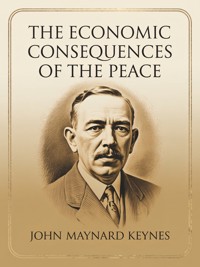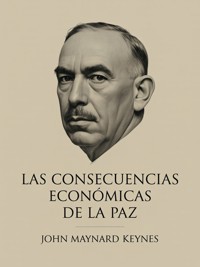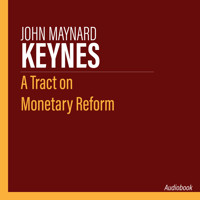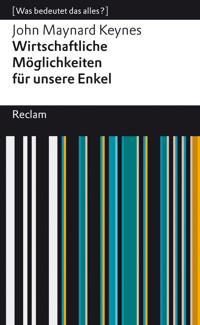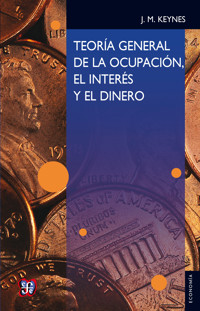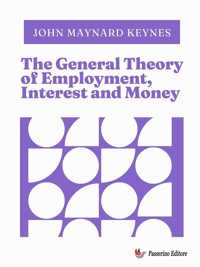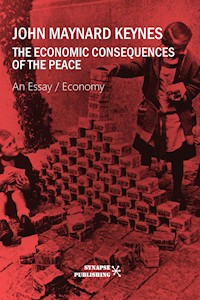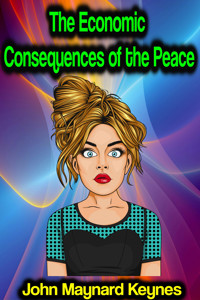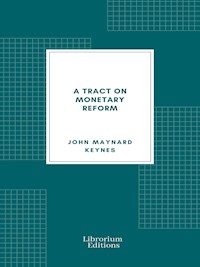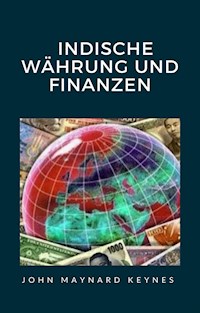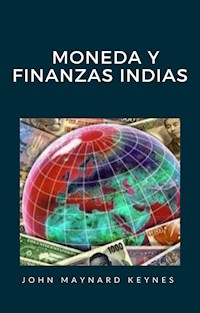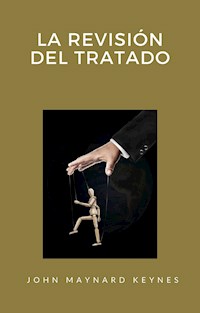1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: David De Angelis
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wirtschaftlichen Folgen des Friedens wurde von John Maynard Keynes geschrieben und veröffentlicht. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm Keynes als Delegierter des britischen Finanzministeriums an der Versailler Konferenz teil und plädierte für einen wesentlich großzügigeren Frieden. Das Buch war weltweit ein Bestseller und trug entscheidend dazu bei, die allgemeine Meinung zu etablieren, dass der Versailler Vertrag ein „karthagischer Frieden” sei. Es trug dazu bei, die amerikanische Öffentlichkeit gegen den Vertrag und die Beteiligung am Völkerbund zu mobilisieren. Die Wahrnehmung eines Großteils der britischen Öffentlichkeit, dass Deutschland ungerecht behandelt worden sei, war wiederum ein entscheidender Faktor für die öffentliche Unterstützung der Beschwichtigungspolitik. Der Erfolg des Buches festigte Keynes' Ruf als führender Ökonom. Als Keynes 1944 eine Schlüsselrolle bei der Einrichtung des Bretton-Woods-Systems spielte, erinnerte er sich an die Lehren aus Versailles und der Weltwirtschaftskrise. Der Marshall-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein ähnliches System wie das von Keynes in „The Economic Consequences of the Peace“ vorgeschlagene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Einleitung
Europa vor dem Krieg
Fußnoten:
Die Konferenz
Fußnoten:
Der Vertrag
Fußnoten:
Reparationen
I. Vor den Friedensverhandlungen gemachte Zusagen
II. Die Konferenz und die Vertragsbedingungen
III. Zahlungsfähigkeit Deutschlands
1. Sofort übertragbares Vermögen
2. Eigentum in abgetretenen Gebieten oder im Rahmen des Waffenstillstands abgetretenes Eigentum
3. Über mehrere Jahre verteilte jährliche Zahlungen
V. Die deutschen Gegenvorschläge
Fußnoten:
Europa nach dem Vertrag
Fußnoten:
Abhilfemaßnahmen
1. Die Revision des Vertrags
2. Die Begleichung der Schulden zwischen den Alliierten
3. Ein internationaler Kredit
4. Die Beziehungen Mitteleuropas zu Russland
Die wirtschaftlichen Folgen des Friedens
John Maynard Keynes
VORWORT
Der Verfasser dieses Buches war während des Krieges vorübergehend dem britischen Finanzministerium zugeordnet und bis zum 7. Juni 1919 dessen offizieller Vertreter bei der Pariser Friedenskonferenz; außerdem war er als Stellvertreter des Schatzkanzlers Mitglied des Obersten Wirtschaftsrats. Er trat von diesen Ämtern zurück, als klar wurde, dass keine Hoffnung mehr auf eine wesentliche Änderung des Entwurfs der Friedensbedingungen bestand. Die Gründe für seine Ablehnung des Vertrags, oder vielmehr der gesamten Politik der Konferenz gegenüber den wirtschaftlichen Problemen Europas, werden in den folgenden Kapiteln dargelegt. Sie sind ausschließlich öffentlicher Natur und basieren auf Fakten, die der ganzen Welt bekannt sind.
J.M. Keynes.
Einleitung
Die Fähigkeit, sich an seine Umgebung zu gewöhnen, ist ein ausgeprägtes Merkmal der Menschheit. Nur sehr wenige von uns sind sich der äußerst ungewöhnlichen, instabilen, komplizierten, unzuverlässigen und vorübergehenden Natur der Wirtschaftsordnung bewusst, unter der Westeuropa seit einem halben Jahrhundert lebt. Wir halten einige der eigenartigsten und vorübergehendsten unserer jüngsten Vorteile für natürlich, dauerhaft und verlässlich und legen unsere Pläne entsprechend fest. Auf diesem sandigen und falschen Fundament schmieden wir Pläne für soziale Verbesserungen und gestalten unsere politischen Programme, verfolgen unsere Feindseligkeiten und besonderen Ambitionen und glauben, über genügend Spielraum zu verfügen, um den Bürgerkrieg in der europäischen Familie zu schüren, anstatt ihn zu besänftigen. Bewegt von wahnsinniger Selbsttäuschung und rücksichtsloser Selbstbezogenheit hat das deutsche Volk die Grundlagen, auf denen wir alle gelebt und aufgebaut haben, zerstört. Aber die Sprecher des französischen und britischen Volkes sind das Risiko eingegangen, den von Deutschland begonnenen Ruin durch einen Frieden zu vollenden, der, wenn er umgesetzt wird, die empfindliche, komplizierte Organisation, die bereits durch den Krieg erschüttert und zerbrochen ist und durch die allein die europäischen Völker sich beschäftigen und leben können, noch weiter beeinträchtigen wird, anstatt sie wiederherzustellen.
In England lehrt uns der äußere Aspekt des Lebens noch nicht im Geringsten, dass eine Ära vorbei ist. Wir sind damit beschäftigt, die Fäden unseres Lebens wieder aufzunehmen, wo wir sie fallen gelassen haben, mit dem einzigen Unterschied, dass viele von uns jetzt viel reicher zu sein scheinen als zuvor. Wo wir vor dem Krieg Millionen ausgegeben haben, haben wir jetzt gelernt, dass wir Hunderte von Millionen ausgeben können, ohne offenbar darunter zu leiden. Offensichtlich haben wir die Möglichkeiten unseres Wirtschaftslebens nicht bis zum Äußersten ausgeschöpft. Wir streben daher nicht nur nach einer Rückkehr zu den Annehmlichkeiten von 1914, sondern nach einer immensen Erweiterung und Intensivierung derselben. Alle Klassen schmieden daher ihre Pläne: Die Reichen wollen mehr ausgeben und weniger sparen, die Armen wollen mehr ausgeben und weniger arbeiten.
Aber vielleicht ist es nur in England (und Amerika) möglich, so unbewusst zu sein. In Kontinentaleuropa bebt die Erde, und niemand ist sich des Grollens nicht bewusst. Dort geht es nicht nur um Extravaganz oder „Arbeitsprobleme”, sondern um Leben und Tod, um Hunger und Existenz und um die furchtbaren Erschütterungen einer sterbenden Zivilisation.
Für jemanden, der den größten Teil der sechs Monate nach dem Waffenstillstand in Paris verbrachte, war ein gelegentlicher Besuch in London eine seltsame Erfahrung. England steht immer noch außerhalb Europas. Die lautlosen Erschütterungen Europas erreichen es nicht. Europa ist getrennt, und England ist nicht Teil seines Fleisches und Blutes. Aber Europa ist in sich geschlossen. Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und Holland, Russland und Rumänien und Polen pulsieren gemeinsam, und ihre Struktur und Zivilisation sind im Wesentlichen eins. Sie sind gemeinsam aufgeblüht, sie sind gemeinsam in einem Krieg erschüttert worden, an dem wir trotz unserer enormen Beiträge und Opfer (wenn auch in geringerem Maße als Amerika) wirtschaftlich nicht beteiligt waren, und sie könnten gemeinsam untergehen. Darin liegt die zerstörerische Bedeutung des Friedens von Paris. Wenn der europäische Bürgerkrieg damit endet, dass Frankreich und Italien ihre momentane Siegesmacht missbrauchen, um das nun am Boden liegende Deutschland und Österreich-Ungarn zu vernichten, laden sie ihre eigene Zerstörung ein , das durch verborgene psychische und wirtschaftliche Bindungen so tief und untrennbar mit seinen Opfern verflochten ist. Auf jeden Fall musste ein Engländer, der an der Pariser Konferenz teilnahm und in diesen Monaten Mitglied des Obersten Wirtschaftsrats der Alliierten Mächte war, für ihn zu einer neuen Erfahrung werden, zu einem Europäer in seinen Sorgen und Ansichten. Dort, im Nervenzentrum des europäischen Systems, mussten seine britischen Sorgen weitgehend in den Hintergrund treten, und er musste von anderen, schrecklicheren Gespenstern heimgesucht werden. Paris war ein Albtraum, und jeder dort war morbide. Ein Gefühl der bevorstehenden Katastrophe lag über der frivolen Szene; die Sinnlosigkeit und Kleinheit des Menschen angesichts der großen Ereignisse, mit denen er konfrontiert war; die gemischte Bedeutung und Unwirklichkeit der Entscheidungen; Leichtfertigkeit, Blindheit, Unverschämtheit, verwirrte Schreie von außen – alle Elemente der antiken Tragödie waren vorhanden. Inmitten der theatralischen Kulisse der französischen Staatssalons sitzend, konnte man sich fragen, ob die außergewöhnlichen Gesichter von Wilson und Clemenceau mit ihrer festen Farbe und unveränderlichen Charakterisierung wirklich Gesichter waren und nicht die tragikomischen Masken eines seltsamen Dramas oder Puppenspiels.
Die Verhandlungen in Paris hatten alle diesen Anschein von außerordentlicher Wichtigkeit und Bedeutungslosigkeit zugleich. Die Entscheidungen schienen voller Konsequenzen für die Zukunft der menschlichen Gesellschaft zu sein; doch die Atmosphäre flüsterte, dass das Wort nicht Fleisch geworden war, dass es sinnlos, unbedeutend, wirkungslos und losgelöst von den Ereignissen war; und man hatte den starken Eindruck, den Tolstoi in Krieg und Frieden oder Hardy in The Dynasts beschrieben haben, dass die Ereignisse ihrem schicksalhaften Ende entgegenmarschierten, ohne von den Überlegungen der Staatsmänner im Rat beeinflusst oder beeinträchtigt zu werden:
Der Geist der Jahre
Beachte, dass alle Weitsicht und Selbstbeherrschung
Verlassen diese Menschenmassen, die nun vom Dämonischen getrieben werden
Durch das immanente Unberechnete. Nichts bleibt
außer Rachsucht hier unter den Starken
Und dort unter den Schwachen eine ohnmächtige Wut.
Geist der Mitleidigen
Warum veranlasst der Wille so sinnlos geformtes Handeln?
Der Geist der Jahre
Ich habe dir gesagt, dass es unbewusst wirkt,
wie jemand, der besessen ist und nicht urteilt.
In Paris, wo diejenigen, die mit dem Obersten Wirtschaftsrat in Verbindung standen, fast stündlich Berichte über das Elend, die Unordnung und den Verfall der Organisation in ganz Mittel- und Osteuropa erhielten, sowohl von Verbündeten als auch von Feinden, und aus dem Munde der Finanzvertreter Deutschlands und Österreichs unwiderlegbare Beweise für die schreckliche Erschöpfung ihrer Länder erfuhren, trug ein gelegentlicher Besuch in dem heißen, trockenen Raum im Haus des Präsidenten, wo die Vier ihr Schicksal in leeren und trostlosen Intrigen erfüllten, verstärkte nur das Gefühl eines Albtraums. Doch dort in Paris waren die Probleme Europas schrecklich und drängend, und eine gelegentliche Rückkehr in die große Gleichgültigkeit Londons war ein wenig beunruhigend. Denn in London waren diese Fragen sehr weit entfernt, und nur unsere eigenen kleineren Probleme beschäftigten uns. London glaubte, dass Paris seine Angelegenheiten sehr durcheinander brachte, blieb aber uninteressiert. In diesem Sinne nahm das britische Volk den Vertrag an, ohne ihn zu lesen. Aber dieses Buch wurde unter dem Einfluss von Paris und nicht von London geschrieben, von jemandem, der sich zwar als Engländer, aber auch als Europäer fühlt und sich aufgrund seiner allzu lebhaften jüngsten Erfahrungen nicht von der weiteren Entfaltung des großen historischen Dramas dieser Tage distanzieren kann, das große Institutionen zerstören, aber auch eine neue Welt schaffen wird.
Europa vor dem Krieg
Vor 1870 hatten sich verschiedene Teile des kleinen Kontinents Europa auf ihre eigenen Produkte spezialisiert, aber insgesamt war er weitgehend autark. Und seine Bevölkerung hatte sich an diesen Zustand angepasst.
Nach 1870 entwickelte sich in großem Umfang eine beispiellose Situation, und die wirtschaftliche Lage Europas wurde in den nächsten fünfzig Jahren instabil und eigenartig. Der Druck der Bevölkerung auf die Nahrungsmittelversorgung, der bereits durch die Verfügbarkeit von Lieferungen aus Amerika ausgeglichen worden war, kehrte sich zum ersten Mal in der Geschichte eindeutig um. Mit steigenden Zahlen wurde es tatsächlich einfacher, Nahrungsmittel zu beschaffen. Größere proportionale Erträge aus einer steigenden Produktionsskala wurden sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie Realität. Mit dem Wachstum der europäischen Bevölkerung gab es einerseits mehr Auswanderer, die den Boden der neuen Länder bewirtschafteten, und andererseits standen in Europa mehr Arbeitskräfte zur Verfügung, um die Industrieprodukte und Investitionsgüter herzustellen, die die Auswanderer in ihrer neuen Heimat versorgen sollten, und um die Eisenbahnen und Schiffe zu bauen, die Europa mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus fernen Quellen versorgen sollten. Bis etwa 1900 brachte eine Arbeitseinheit in der Industrie Jahr für Jahr eine Kaufkraft für eine steigende Menge an Nahrungsmitteln. Es ist möglich, dass sich dieser Prozess um das Jahr 1900 herum umkehrte und sich ein Rückgang des Ertrags der Natur für die Arbeit des Menschen wieder bemerkbar machte. Die Tendenz zu steigenden realen Kosten für Getreide wurde jedoch durch andere Verbesserungen ausgeglichen, und – als eine von vielen Neuerungen – kamen damals erstmals die Ressourcen des tropischen Afrikas in großem Umfang zum Einsatz, und ein reger Handel mit Ölsaaten begann, eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Menschheit in einer neuen und billigeren Form auf den Tisch Europas zu bringen. In diesem wirtschaftlichen Eldorado, in dieser wirtschaftlichen Utopie, wie die früheren Ökonomen es wohl bezeichnet hätten, sind die meisten von uns aufgewachsen.
Dieses glückliche Zeitalter verlor den Blick für eine Weltanschauung, die die Begründer unserer politischen Ökonomie mit tiefer Melancholie erfüllte. Vor dem 18. Jahrhundert hegte die Menschheit keine falschen Hoffnungen. Um die Illusionen zu zerstören, die gegen Ende dieses Zeitalters populär wurden, enthüllte Malthus einen Teufel. Ein halbes Jahrhundert lang hielten alle ernsthaften wirtschaftswissenschaftlichen Schriften diesen Teufel klar im Blick. Im nächsten halben Jahrhundert wurde er angekettet und aus dem Blickfeld entfernt. Jetzt haben wir ihn vielleicht wieder freigelassen.
Was für eine außergewöhnliche Episode im wirtschaftlichen Fortschritt der Menschheit war doch dieses Zeitalter, das im August 1914 zu Ende ging! Der größte Teil der Bevölkerung arbeitete zwar hart und lebte unter bescheidenen Verhältnissen, war aber allem Anschein nach mit diesem Los recht zufrieden. Aber für jeden Menschen mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten oder Charakterzügen war es möglich, in die Mittel- und Oberschicht aufzusteigen, wo das Leben ihnen zu geringen Kosten und mit minimalem Aufwand Annehmlichkeiten, Komfort und Bequemlichkeiten bot, die selbst die reichsten und mächtigsten Monarchen anderer Epochen nicht hatten. Der Einwohner Londons konnte, während er morgens im Bett seinen Tee trank, per Telefon verschiedene Produkte aus aller Welt in beliebiger Menge bestellen und davon ausgehen, dass sie bald an seine Haustür geliefert würden. Er konnte im selben Moment und auf dieselbe Weise sein Vermögen in die natürlichen Ressourcen und neuen Unternehmen aller Teile der Welt investieren ( ) und ohne Anstrengung oder Mühe an deren voraussichtlichen Früchten und Vorteilen teilhaben; oder er konnte beschließen, die Sicherheit seines Vermögens mit dem guten Glauben der Bürger einer beliebigen größeren Gemeinde auf einem beliebigen Kontinent zu verbinden, die ihm aufgrund seiner Vorlieben oder Informationen empfohlen worden war. Er konnte sich, wenn er wollte, sofort eine günstige und bequeme Transportmöglichkeit in jedes Land und jedes Klima ohne Pass oder andere Formalitäten sichern, seinen Diener zur nächsten Bankfiliale schicken, um sich mit den ihm zweckmäßig erscheinenden Edelmetallen zu versorgen, und dann ins Ausland reisen, ohne etwas über die dortige Religion, Sprache oder Bräuche zu wissen, mit seinem Vermögen in Form von Münzen bei sich, und würde sich bei der geringsten Störung sehr gekränkt und überrascht fühlen. Vor allem aber betrachtete er diesen Zustand als normal, sicher und dauerhaft, außer in Richtung weiterer Verbesserungen, und jede Abweichung davon als abwegig, skandalös und vermeidbar. Die Projekte und die Politik des Militarismus und Imperialismus, der rassischen und kulturellen Rivalitäten, der Monopole, Beschränkungen und Ausgrenzungen, die die Schlange in dieses Paradies locken sollten, waren kaum mehr als die Unterhaltung seiner Tageszeitung und schienen fast keinen Einfluss auf den normalen Verlauf des sozialen und wirtschaftlichen Lebens zu haben, dessen Internationalisierung in der Praxis fast vollständig war.
Es wird uns helfen, den Charakter und die Folgen des Friedens, den wir unseren Feinden auferlegt haben, besser zu verstehen, wenn ich einige der wichtigsten instabilen Elemente, die bereits bei Ausbruch des Krieges im Wirtschaftsleben Europas vorhanden waren, etwas näher erläutere.
I. Bevölkerung
Im Jahr 1870 hatte Deutschland etwa 40 Millionen Einwohner. Bis 1892 war diese Zahl auf 50 Millionen gestiegen, bis zum 30. Juni 1914 auf etwa 68 Millionen. In den Jahren unmittelbar vor dem Krieg betrug der jährliche Zuwachs etwa 850.000, von denen nur ein unbedeutender Teil auswanderte.[1] Dieser große Zuwachs wurde nur durch eine weitreichende Umgestaltung der Wirtschaftsstruktur des Landes ermöglicht. Von einem agrarisch geprägten und weitgehend autarken Land verwandelte sich Deutschland in eine riesige und komplexe Industriemaschine, deren Funktionieren vom Gleichgewicht vieler Faktoren innerhalb und außerhalb Deutschlands abhing. Nur durch den kontinuierlichen Betrieb dieser Maschine auf Hochtouren konnte sie für ihre wachsende Bevölkerung Arbeit im Inland und die Mittel zum Kauf ihrer Lebensgrundlagen im Ausland finden. Die deutsche Maschine glich einem Kreisel, der, um sein Gleichgewicht zu halten, immer schneller und schneller drehen musste.
Im Österreichisch-Ungarischen Reich, dessen Bevölkerung von etwa 40 Millionen im Jahr 1890 auf mindestens 50 Millionen bei Ausbruch des Krieges angewachsen war, war dieselbe Tendenz in geringerem Maße zu beobachten, wobei die jährliche Überschusszahl der Geburten gegenüber den Todesfällen etwa eine halbe Million betrug, von denen jedoch jährlich etwa eine Viertelmillion Menschen auswanderten.
Um die gegenwärtige Situation zu verstehen, müssen wir uns lebhaft vor Augen führen, zu welchem außergewöhnlichen Bevölkerungszentrum sich Mitteleuropa durch die Entwicklung des germanischen Systems entwickelt hatte. Vor dem Krieg überstieg die Bevölkerung Deutschlands und Österreich-Ungarns zusammen nicht nur die der Vereinigten Staaten erheblich, sondern entsprach in etwa der gesamten Bevölkerung Nordamerikas. In diesen Zahlen, die sich auf ein kompaktes Gebiet verteilten, lag die militärische Stärke der Mittelmächte. Aber dieselben Zahlen – denn selbst der Krieg hat sie nicht nennenswert verringert[2] – bleiben, wenn ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird, eine kaum geringere Gefahr für die europäische Ordnung.
Das Bevölkerungswachstum in Europarussland war sogar noch größer als in Deutschland – von weniger als 100 Millionen im Jahr 1890 auf etwa 150 Millionen bei Ausbruch des Krieges[3]; und im Jahr unmittelbar vor 1914 lag der Überschuss der Geburten über die Todesfälle in Russland insgesamt bei unglaublichen zwei Millionen pro Jahr. Dieses übermäßige Bevölkerungswachstum in Russland, das in England kaum Beachtung gefunden hat, war dennoch eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten Jahre.
Die großen Ereignisse der Geschichte sind oft auf langfristige Veränderungen im Bevölkerungswachstum und andere grundlegende wirtschaftliche Ursachen zurückzuführen, die aufgrund ihres allmählichen Charakters von zeitgenössischen Beobachtern nicht wahrgenommen werden und daher der Torheit von Staatsmännern oder dem Fanatismus von Atheisten zugeschrieben werden. So sind die außergewöhnlichen Ereignisse der letzten zwei Jahre in Russland, dieser gewaltige Umbruch der Gesellschaft, der das scheinbar Stabilste – die Religion, die Grundlage des Eigentums, den Landbesitz sowie die Regierungsformen und die Klassenhierarchie – umgestürzt hat, möglicherweise eher auf den tiefgreifenden Einfluss der wachsenden Bevölkerungszahlen zurückzuführen als auf Lenin oder Nikolaus; und die zerstörerische Kraft übermäßiger nationaler Fruchtbarkeit könnte eine größere Rolle beim Aufbrechen der Fesseln der Konvention gespielt haben als die Macht der Ideen oder die Fehler der Autokratie.
II. Organisation
Die empfindliche Organisation, nach der diese Völker lebten, hing zum Teil von Faktoren innerhalb des Systems ab.
Die Beeinträchtigungen durch Grenzen und Zölle wurden auf ein Minimum reduziert, und nicht weit unter dreihundert Millionen Menschen lebten in den drei Reichen Russland, Deutschland und Österreich-Ungarn. Die verschiedenen Währungen, die alle in einem stabilen Verhältnis zum Gold und zueinander standen, erleichterten den Kapitalfluss und den Handel in einem Ausmaß, dessen vollen Wert wir erst jetzt erkennen, da wir seiner Vorteile beraubt sind. In diesem großen Gebiet herrschte fast absolute Sicherheit für Eigentum und Personen.
Diese Faktoren der Ordnung, Sicherheit und Einheitlichkeit, die Europa zuvor noch nie auf einem so großen und bevölkerungsreichen Gebiet oder über einen so langen Zeitraum hinweg genossen hatte, ebneten den Weg für die Organisation jenes riesigen Mechanismus aus Transport, Kohleverteilung und Außenhandel, der eine industrielle Lebensweise in den dicht besiedelten urbanen Zentren der neuen Bevölkerung ermöglichte. Dies ist zu bekannt, um eine detaillierte Untermauerung mit Zahlen zu erfordern. Es lässt sich jedoch anhand der Zahlen für Kohle veranschaulichen, die für das industrielle Wachstum Mitteleuropas kaum weniger wichtig war als für das Englands: Die deutsche Kohleproduktion stieg von 30 Millionen Tonnen im Jahr 1871 auf 70 Millionen Tonnen im Jahr 1890, 110 Millionen Tonnen im Jahr 1900 und 190 Millionen Tonnen im Jahr 1913.
Um Deutschland als zentrale Stütze gruppierte sich das übrige europäische Wirtschaftssystem, und der Wohlstand des restlichen Kontinents hing hauptsächlich vom Wohlstand und Unternehmertum Deutschlands ab. Das zunehmende Tempo Deutschlands bot seinen Nachbarn einen Absatzmarkt für ihre Produkte, im Gegenzug versorgte das deutsche Handelsunternehmen sie zu niedrigen Preisen mit ihren wichtigsten Gütern.
Die Statistiken zur wirtschaftlichen Verflechtung Deutschlands mit seinen Nachbarn sind überwältigend. Deutschland war der beste Kunde Russlands, Norwegens, Hollands, Belgiens, der Schweiz, Italiens und Österreich-Ungarns; es war der zweitbeste Kunde Großbritanniens, Schwedens und Dänemarks und der drittbeste Kunde Frankreichs. Es war der größte Lieferant Russlands, Norwegens, Schwedens, Dänemarks, Hollands, der Schweiz, Italiens, Österreich-Ungarns, Rumäniens und Bulgariens und der zweitgrößte Lieferant Großbritanniens, Belgiens und Frankreichs.
In unserem Fall exportierten wir mehr nach Deutschland als in jedes andere Land der Welt außer Indien, und wir kauften mehr von Deutschland als von jedem anderen Land der Welt außer den Vereinigten Staaten.
Es gab kein europäisches Land außer denen westlich von Deutschland, das nicht mehr als ein Viertel seines gesamten Handels mit Deutschland abwickelte, und im Falle Russlands, Österreich-Ungarns und Hollands war der Anteil sogar noch weitaus größer.
Deutschland versorgte diese Länder nicht nur mit Handelsgütern, sondern stellte einigen von ihnen auch einen Großteil des für ihre eigene Entwicklung benötigten Kapitals zur Verfügung. Von den deutschen Auslandsinvestitionen vor dem Krieg, die sich insgesamt auf etwa 6.250.000.000 Dollar beliefen, wurden nicht weit weniger als 2.500.000.000 Dollar in Russland, Österreich-Ungarn, Bulgarien, Rumänien und der Türkei investiert.[4] Und durch das System der „friedlichen Durchdringung” verschaffte sie diesen Ländern nicht nur Kapital, sondern auch das, was sie kaum weniger brauchten: Organisation. So geriet ganz Europa östlich des Rheins in den deutschen Industrieeinflussbereich, und sein Wirtschaftsleben wurde entsprechend angepasst.
Aber diese internen Faktoren hätten nicht ausgereicht, um die Bevölkerung zu ernähren, ohne dass auch externe Faktoren und bestimmte allgemeine Dispositionen, die ganz Europa gemeinsam waren, mitwirkten. Viele der bereits behandelten Umstände galten für Europa insgesamt und waren nicht nur auf die Mitteleuropäischen Reiche beschränkt. Aber alles, was folgt, war dem gesamten europäischen System gemeinsam.
III. Die Psychologie der Gesellschaft
Europa war sozial und wirtschaftlich so organisiert, dass eine maximale Kapitalakkumulation gewährleistet war. Zwar verbesserten sich die Lebensbedingungen der breiten Bevölkerung kontinuierlich, doch war die Gesellschaft so strukturiert, dass ein großer Teil des gestiegenen Einkommens in die Hände der Klasse gelangte, die am wenigsten dazu neigte, es zu konsumieren. Die Neureichen des 19. Jahrhunderts waren nicht zu hohen Ausgaben erzogen worden und zogen die Macht, die ihnen Investitionen verliehen, den Freuden des unmittelbaren Konsums vor. Tatsächlich war es gerade die Ungleichheit der Vermögensverteilung, die jene enormen Anhäufungen von festem Vermögen und Kapitalverbesserungen ermöglichte, die dieses Zeitalter von allen anderen unterschieden. Darin lag in der Tat die Hauptrechtfertigung des kapitalistischen Systems. Hätten die Reichen ihren neuen Reichtum für ihre eigenen Vergnügungen ausgegeben, hätte die Welt ein solches System längst als unerträglich empfunden. Aber wie Bienen sparten und sammelten sie, was nicht weniger zum Vorteil der gesamten Gemeinschaft war, weil sie selbst engere Ziele vor Augen hatten.
Die immensen Anhäufungen von Anlagekapital, die zum großen Nutzen der Menschheit in dem halben Jahrhundert vor dem Krieg aufgebaut wurden, hätten in einer Gesellschaft, in der der Reichtum gerecht verteilt war, niemals zustande kommen können. Die Eisenbahnen der Welt, die dieses Zeitalter als Denkmal für die Nachwelt errichtete, waren nicht weniger als die Pyramiden Ägyptens das Werk von Arbeitern, die nicht die Freiheit hatten, den vollen Gegenwert ihrer Anstrengungen in unmittelbarer Freude zu konsumieren.
So beruhte das Wachstum dieses bemerkenswerten Systems auf einer doppelten Täuschung oder einem doppelten Bluff. Einerseits akzeptierten die Arbeiterklassen aus Unwissenheit oder Machtlosigkeit oder wurden durch Gewohnheit, Konvention, Autorität und die etablierte Gesellschaftsordnung dazu gezwungen, überredet oder überredet, eine Situation zu akzeptieren, in der sie nur einen sehr kleinen Teil des Kuchens für sich beanspruchen konnten, den sie gemeinsam mit der Natur und den Kapitalisten hergestellt hatten. Andererseits durften die Kapitalisten den größten Teil des Kuchens als ihren Eigentum betrachten und ihn theoretisch frei verzehren, unter der stillschweigenden Bedingung, dass sie in der Praxis nur sehr wenig davon verzehrten. Die Pflicht zum „Sparen” wurde zu neun Zehnteln der Tugend und das Wachstum des Kuchens zum Ziel wahrer Religion. Um den Nichtkonsum des Kuchens herum entwickelten sich all jene puritanischen Instinkte, die sich in anderen Zeitaltern aus der Welt zurückgezogen und sowohl die Künste der Produktion als auch die des Genusses vernachlässigt hatten. Und so wuchs der Kuchen; aber zu welchem Zweck, wurde nicht klar überlegt. Die Menschen wurden weniger zur Enthaltsamkeit als vielmehr zum Aufschieben und zur Pflege der Freuden der Sicherheit und Vorfreude ermahnt. Sparen war für das Alter oder für die Kinder gedacht, aber das war nur in der Theorie so – die Tugend des Kuchens bestand darin, dass er niemals verzehrt werden durfte, weder von einem selbst noch von den Kindern nach einem.
Wenn ich dies schreibe, möchte ich damit nicht unbedingt die Praktiken dieser Generation herabsetzen. In den unbewussten Tiefen ihres Wesens wusste die Gesellschaft, was sie tat. Der Kuchen war im Verhältnis zum Konsumappetit wirklich sehr klein, und niemand, wenn er rundum geteilt worden wäre, wäre durch das Anschneiden besser dran gewesen. Die Gesellschaft arbeitete nicht für die kleinen Freuden des Augenblicks, sondern für die zukünftige Sicherheit und Verbesserung der Menschheit – tatsächlich für den „Fortschritt“. Wenn nur der Kuchen nicht geschnitten worden wäre, sondern in dem von Malthus für die Bevölkerung vorhergesagten geometrischen Verhältnis hätte wachsen dürfen, das aber nicht weniger für Zinseszinsen gilt, wäre vielleicht eines Tages genug für alle da gewesen, und die Nachwelt hätte an den Früchten unserer Arbeit teilhaben können. An diesem Tag würden Überarbeitung, Überbevölkerung und Unterernährung ein Ende haben, und die Menschen, die sich der Annehmlichkeiten und Notwendigkeiten des Körpers sicher wären, könnten sich den edleren Übungen ihrer Fähigkeiten widmen. Ein geometrisches Verhältnis könnte ein anderes aufheben, und das 19. Jahrhundert konnte die Fruchtbarkeit der Spezies vergessen, indem es über die schwindelerregenden Tugenden des Zinseszinses nachdachte.
Diese Aussicht barg zwei Gefahren: dass unsere Selbstverleugnung nicht das Glück, sondern nur die Zahlen förderte, da die Bevölkerung immer noch schneller wuchs als die Akkumulation; und dass der Kuchen letztendlich doch vorzeitig im Krieg verzehrt würde, dem Verbraucher aller derartigen Hoffnungen.
Aber diese Gedanken führen zu weit von meinem eigentlichen Anliegen weg. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das Prinzip der auf Ungleichheit basierenden Akkumulation ein wesentlicher Bestandteil der Vorkriegsordnung der Gesellschaft und des Fortschritts, wie wir ihn damals verstanden, war, und betonen, dass dieses Prinzip von instabilen psychologischen Bedingungen abhing, die möglicherweise nicht wiederhergestellt werden können. Es war nicht natürlich, dass eine Bevölkerung, von der so wenige die Annehmlichkeiten des Lebens genossen, so enorme Mengen anreicherte. Der Krieg hat allen die Möglichkeit des Konsums und vielen die Eitelkeit der Enthaltsamkeit vor Augen geführt. Damit ist der Bluff aufgeflogen; die Arbeiterklasse ist möglicherweise nicht mehr bereit, so große Entbehrungen auf sich zu nehmen, und die Kapitalistenklasse, die kein Vertrauen mehr in die Zukunft hat, könnte versuchen, ihre Konsumfreiheit so lange wie möglich in vollen Zügen zu genießen und damit den Zeitpunkt ihrer Enteignung beschleunigen.
IV. Das Verhältnis der Alten Welt zur Neuen
Die akkumulativen Gewohnheiten Europas vor dem Krieg waren die notwendige Voraussetzung für den größten der externen Faktoren, die das europäische Gleichgewicht aufrechterhielten.
Ein erheblicher Teil der von Europa angesammelten überschüssigen Investitionsgüter wurde ins Ausland exportiert, wo ihre Investition die Erschließung neuer Ressourcen für Nahrungsmittel, Rohstoffe und Transport ermöglichte und gleichzeitig der Alten Welt ermöglichte, Anspruch auf den natürlichen Reichtum und das unerschlossene Potenzial der Neuen Welt zu erheben. Dieser letzte Faktor gewann zunehmend an Bedeutung. Die Alte Welt setzte die jährlichen Tribute, zu deren Einziehung sie berechtigt war, mit großer Umsicht ein. Die Vorteile billiger und reichlich vorhandener Vorräte, die durch die neuen Entwicklungen ermöglicht wurden, die ihr überschüssiges Kapital ermöglicht hatte, wurden zwar genutzt und nicht aufgeschoben. Der größte Teil der Zinsen aus diesen Auslandsinvestitionen wurde jedoch reinvestiert und als Reserve (so hoffte man damals) für schlechtere Zeiten angesammelt, in denen die Industriearbeit Europas die Produkte anderer Kontinente nicht mehr zu so günstigen Konditionen erwerben konnte und das Gleichgewicht zwischen ihren historischen Zivilisationen und den sich vermehrenden Völkern anderer Klimazonen und Umgebungen bedroht sein würde. So profitierten alle europäischen Völker gleichermaßen von der Erschließung neuer Ressourcen, unabhängig davon, ob sie ihre Kultur im eigenen Land pflegten oder sich ins Ausland wagten.
Doch schon vor dem Krieg war das so entstandene Gleichgewicht zwischen alten Zivilisationen und neuen Ressourcen bedroht. Der Wohlstand Europas beruhte auf der Tatsache, dass es aufgrund des großen exportierbaren Überschusses an Nahrungsmitteln in Amerika in der Lage war, Nahrungsmittel zu einem günstigen Preis zu kaufen, gemessen an der Arbeit, die für die Produktion seiner eigenen Exporte erforderlich war, und dass es aufgrund seiner früheren Kapitalinvestitionen Anspruch auf einen beträchtlichen jährlichen Betrag hatte, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Der zweite dieser Faktoren schien damals außer Gefahr zu sein, aber aufgrund des Bevölkerungswachstums in Übersee, vor allem in den Vereinigten Staaten, war der erste nicht mehr so sicher.
Als die unberührten Böden Amerikas erstmals genutzt wurden, war der Anteil der Bevölkerung dieser Kontinente und damit auch ihr lokaler Bedarf im Vergleich zu Europa sehr gering. Noch 1890 hatte Europa dreimal so viele Einwohner wie Nord- und Südamerika zusammen. Bis 1914 näherte sich der heimische Bedarf der Vereinigten Staaten an Weizen jedoch ihrer Produktion, und es war offensichtlich, dass der Zeitpunkt nahe war, an dem es nur noch in Jahren mit außergewöhnlich günstigen Ernten einen exportierbaren Überschuss geben würde. Tatsächlich wird der derzeitige heimische Bedarf der Vereinigten Staaten auf mehr als neunzig Prozent des Durchschnittsertrags der fünf Jahre 1909-1913 geschätzt.[5] Zu dieser Zeit zeigte sich jedoch eine Tendenz zur Verknappung, die sich weniger in einem Mangel an Überfluss als vielmehr in einem stetigen Anstieg der realen Kosten äußerte. Das heißt, weltweit gesehen gab es keinen Mangel an Weizen, aber um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, musste ein höherer realer Preis geboten werden. Der günstigste Faktor in dieser Situation war das Ausmaß, in dem Mittel- und Westeuropa aus den exportierbaren Überschüssen Russlands und Rumäniens versorgt wurden.
Kurz gesagt, Europas Anspruch auf die Ressourcen der Neuen Welt wurde immer prekärer; das Gesetz des abnehmenden Ertrags machte sich endlich wieder bemerkbar und zwang Europa, Jahr für Jahr eine größere Menge anderer Rohstoffe anzubieten, um die gleiche Menge Brot zu erhalten; daher konnte sich Europa keinesfalls eine Störung einer seiner wichtigsten Versorgungsquellen leisten.
Es gäbe noch viel mehr zu sagen, um die wirtschaftlichen Besonderheiten des Europas von 1914 zu beschreiben. Ich habe mich entschlossen, die drei oder vier wichtigsten Faktoren der Instabilität hervorzuheben: die Instabilität einer übermäßigen Bevölkerung, deren Lebensunterhalt von einer komplizierten und künstlichen Organisation abhängt, die psychologische Instabilität der Arbeiter- und Kapitalistenklasse und die Instabilität des Anspruchs Europas auf die Nahrungsmittelvorräte der Neuen Welt, verbunden mit seiner vollständigen Abhängigkeit davon.
Der Krieg hatte dieses System so erschüttert, dass das Leben Europas insgesamt gefährdet war. Ein großer Teil des Kontinents war krank und starb; seine Bevölkerung überstieg bei weitem die Zahl derer, für die ein Lebensunterhalt zur Verfügung stand; seine Organisation war zerstört, sein Verkehrssystem zusammengebrochen und seine Nahrungsmittelversorgung stark beeinträchtigt.
Es war die Aufgabe der Friedenskonferenz, Verpflichtungen einzuhalten und Gerechtigkeit zu üben, aber nicht weniger, das Leben wiederherzustellen und Wunden zu heilen. Diese Aufgaben wurden ebenso sehr von Klugheit wie von Großmut diktiert, den die Weisheit der Antike bei Siegern gutheißen würde. Wir werden in den folgenden Kapiteln den tatsächlichen Charakter des Friedens untersuchen.
Fußnoten:
[1] 1913 gab es 25.843 Auswanderer aus Deutschland, von denen 19.124 in die Vereinigten Staaten gingen.
[2] Der Netto-Rückgang der deutschen Bevölkerung Ende 1918 durch Geburtenrückgang und übermäßige Sterblichkeit im Vergleich zum Beginn des Jahres 1914 wird auf etwa 2.700.000 geschätzt.
[3] Einschließlich Polen und Finnland, aber ohne Sibirien, Zentralasien und den Kaukasus.
[4] Die in diesem Buch genannten Geldbeträge in Dollar wurden aus Pfund Sterling zum Kurs von 5 Dollar pro Pfund umgerechnet.
[5] Selbst seit 1914 ist die Bevölkerung der Vereinigten Staaten um sieben oder acht Millionen Menschen gewachsen. Da ihr jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch an Weizen nicht weniger als 6 Scheffel beträgt, würde die Vorkriegsproduktion in den Vereinigten Staaten nur in etwa einem von fünf Jahren einen erheblichen Überschuss gegenüber dem aktuellen Inlandsbedarf aufweisen. Vorerst wurden wir durch die großen Ernten von 1918 und 1919 gerettet, die durch die Preisgarantie von Herrn Hoover ermöglicht wurden. Es ist jedoch kaum zu erwarten, dass die Vereinigten Staaten auf unbestimmte Zeit die Lebenshaltungskosten im eigenen Land erheblich erhöhen werden, um Europa, das dafür nicht bezahlen kann, mit Weizen zu versorgen.
Die Konferenz
In den Kapiteln IV und V werde ich mich eingehend mit den wirtschaftlichen und finanziellen Bestimmungen des Friedensvertrags mit Deutschland befassen. Es wird jedoch leichter sein, den wahren Ursprung vieler dieser Bestimmungen zu verstehen, wenn wir hier einige der persönlichen Faktoren untersuchen, die ihre Ausarbeitung beeinflusst haben. Dabei komme ich unweigerlich auf Fragen der Motive zu sprechen, bei denen Beobachter leicht Fehler machen können und nicht berechtigt sind, sich das Recht auf ein endgültiges Urteil anzumaßen. Wenn ich in diesem Kapitel jedoch manchmal die Freiheiten zu nehmen scheine, die für Historiker üblich sind, die wir trotz unseres größeren Wissens wir im Allgemeinen zögern, gegenüber Zeitgenossen zu übernehmen, möge der Leser mir verzeihen, wenn er sich daran erinnert, wie sehr die Welt, um ihr Schicksal zu verstehen, Licht braucht, auch wenn es nur teilweise und ungewiss ist, über den komplexen Kampf des menschlichen Willens und der menschlichen Absichten, der noch nicht beendet ist und der sich in einer beispiellosen Weise auf vier Personen konzentrierte und sie in den ersten Monaten des Jahres 1919 zum Mikrokosmos der Menschheit machte.