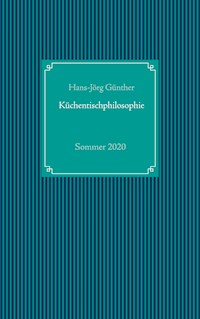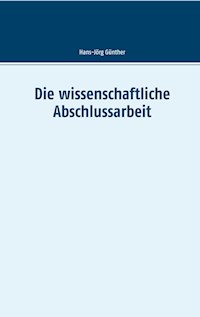
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kompakt und ergebnisorientiert führt dich dieses Büchlein durch den Prozess deiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit. Die Details mögen an den Hochschulen und in den Fakultäten verschieden sein. Das Grundschema ist immer dasselbe. Wissenschaftliches Arbeiten ist ein Handwerk, auf das die meisten Studierenden nicht oder unzulänglich vorbereitet sind. Der erste Teil bringt Grundbegriffe der Wissenschaftlichkeit in Erinnerung. Im zweiten Teil wirst du durch den Prozess von der Themenfindung bis zur Abgabe geleitet und am Ende findest du einen Beispielablauf, um einen ersten Eindruck einer möglichen Planung zu bekommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wissenschaft
ist eine ewige Suche nach Erkenntnis unter Anwendung von Arbeitsweisen, welche insbesondere die Objektivität, Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit von Erkenntnissen als höchste Wertmaßstäbe anlegen.
Dabei ist Wissenschaft frei von Moral, aber nicht frei von Verantwortung.
Keine Erkenntnis ist ewig und keine wirklich wahr. Manche Erkenntnis hält sich länger und wird dadurch wahrer. Was bleibt: der Zweifel am Bekannten und der Glaube an das Unbekannte und der Zauber der Erkenntnis.
Der Homo sapiens kann nicht viel wissen oder gar verstehen. Aber das Fragen, das Suchen, das Anklopfen an die Tür der Schöpfung – das ist das Tagwerk des Wissenschaftlers.
Meinen Studiosi zum Geleit HJG
Inhaltsverzeichnis
1.
Einleitung
2.
Wissenschaftlichkeit
2.1 Objektivität
2.2 Reproduzierbarkeit (Wiederholbarkeit)
2.3 Transparenz (Überprüfbarkeit)
2.4 Zuverlässigkeit (Reliabilität)
2.5 Statistische Unterlegung
2.6 Validität (Gültigkeit)
2.7 Präzision und Richtigkeit
2.8 Fundiertheit
2.9 Relevanz
2.10 Empirie
2.11 Begriffswelt
2.12 Relativität der Wahrheit
2.13 Redlichkeit, Ehre, Vertrauenswürdigkeit
3.
Strategie
3.1 Zieldefinition
3.2 Planungsphase
3.3 Themenfindung
3.4 Themenaufriss
3.5 Thesenformulierung
3.6 Theoriephase
3.7 Praxisphase
3.8 Anhübschen
3.9 Ausblick
3.10 Start
4.
Ziel und Abgrenzung
4.1 Strenge Wissenschaft
4.2 Nicht naturwissenschaftliche Fächer
4.3 Folgeprojekte
4.4 Akademische Nachnutzung
4.5 Karriereplanung
4.6 Checkliste Strategie
5.
Themenwahl
5.1 Themenfindung
5.2 Betreuerwahl
5.3 Checkliste Themenfindung
5.4 Themenformulierung
5.4.1 Titel
5.4.2 Untertitel
5.4.3 Keywords
5.4.4 Abstract
5.4.5 Aufgabenstellung
5.5 Checkliste Startformulierungen
5.6 Checkliste Themenrechtfertigung
5.7 Exposé
5.7.1 Begriffswelt
5.7.2 Themenaufriss
5.7.3 Themenabgrenzung
5.7.4 ToDo Liste
5.7.5 Thesenformulierung
5.8 Kolloquium
6.
Planung
6.1 Startphase
6.2 Drittelregel
6.2.1 Literaturarbeit
6.2.2 Checkliste Literaturarbeit
6.2.3 Praxisteil
6.2.4 Checkliste Praxisteil
6.2.5 Auswertung
6.2.6 Checkliste Auswertung
6.3 Planungsrichtwerte
6.4 Checkliste Zieldefinition
6.5 Projektmanagement
6.5.1 Timing
6.5.2 Team
6.5.3 Technik
6.5.4 Finanzierung
6.6 Formalien
7.
Gliederung
7.1 Einführung
7.2 Theorieteil
7.3 Praxisteil
7.4 Zusammenfassung
7.5 Fazit
7.6 Ausblick
7.7 Anlagen
7.8 Danksagungen
8.
Kommunikation
9.
Best Practice Collection
10.
Exemplarischer Durchlaufplan
10.1 Terminvereinbarung
10.2 Vorarbeiten
10.3 Praxis
10.4 Auswertung
10.5 Abschluss
10.6 Hoffnung
10.7 Spezielle Checklisten
1 Einleitung
Die Prüfungen sind geschafft. Das Ende des Studiums und der Karrierestart stehen vor der Tür. Die Abschlussarbeit ist nun die letzte Aufgabe vor einem erfolgreichen Studienende und sie sollte zugleich eine starke Basis für die Bewerbung und den beruflichen Einstieg sein. Dieses Büchlein führt immer wieder auf das Big Picture der Arbeit zurück und stellt immer wieder Grundsatzfragen, um auf den Kern der Arbeit zurück zu verweisen. Dem solltest du unbedingt folgen! Die scheinbare Redundanz mancher Fragen ist, bei tieferer Betrachtung, eine Abfolge von Entwicklungsständen und Perspektivwechseln. Sei gründlich und laufe immer am roten Faden entlang, es wird sonst schnell unübersichtlich!
Studenten finden in diesem Büchlein eine einfache, effiziente und leicht zu überblickende Guideline für das anspruchsvolle Projekt Abschlussarbeit. Hinweise zu Gliederung und Arbeitsweise werden durch Checklisten ergänzt. Im Intro finden sich ein paar Gedanken dazu, was Wissenschaftlichkeit ist.
Das Erfolgsgeheimnis guter Abschlussarbeiten liegt in Themenwahl, Strategie und Kontinuität. Dieses Büchlein liefert die Strategie, hilft bei der Themenwahl und unterstützt eine realistische Planung für kontinuierliches Arbeiten. Nur machen musst du es noch selbst.
Studierende aller Identitäten werden auf Augenhöhe und mit gleichem Respekt in diesem Text angesprochen. Lesbarkeit geht vor politischer Korrektheit.
Mit besten Wünschen für maximale Erfolge!
Hans J. Günther,
Dresden, 2021
2 Wissenschaftlichkeit
Wissenschaftliches Arbeiten wird in vielen guten Büchern ausführlich erklärt. Finde eines dieser Bücher, welches zu deiner Fachrichtung passt, und lies es, bevor du mit deiner Abschlussarbeit startest. Wissenschaftlichkeit definiert sich über Arbeitsweisen, Form der Darstellung von Voraussetzungen, Erkenntnisweg und Ergebnis sowie über einige weitere Kriterien, die daran als Bewertungsmaßstab angelegt werden müssen. Wissenschaftlichkeit entsteht ausdrücklich nicht durch korrektes Formatieren oder richtiges Zitieren! Beides ist wichtig, erzeugt aber keine Wissenschaftlichkeit. Man kann auch korrekt formatierten Unfug schreiben. Bedenke auch, dass akademisches und intellektuelles Getue keine Wissenschaftlichkeit ausmacht, sondern meistens eher peinlich ist! Klarheit und Einfachheit sind die Juwelen der Sprache.
Beachte, dass eine Arbeit in den exakten Wissenschaften, also in den MINT Fächern, anders aufgebaut wird als in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Die ausgeführten Aussagen und gefundenen Ergebnisse sollen auch eine andere Belastbarkeit im Inhalt aufweisen. Es ist ein Unterschied, ob man über methodische Varianten der Grundschulpädagogik im Fach Hauswirtschaft schreibt oder eine Rakete konstruieren will, die zum Mars fliegen kann. In den exakten Wissenschaften wird die Arbeit streng wissenschaftlichen Kriterien folgen, während in anderen Richtungen die Ansprüche an die Wissenschaftlichkeit aufgrund der eher „weichen Materie“ anders zu gestalten sind.
Dieses Büchlein fokussiert weitgehend auf wissenschaftliches Arbeiten im Sinne exakter Wissenschaftsdisziplinen. Für andere Fachrichtungen sind die dort empfohlenen und oft sehr weichen Kriterien besser geeignet und entsprechend anzuwenden. Es sei in diesem Kontext auf die Diskussionen um den Szientismus verwiesen, die keineswegs neu sind, aber bisher weder erschöpfend geklärt wurden noch hierhergehören. In diesem mini werden vordergründig Studierende der exakten Wissenschaften angesprochen, ohne andere Fachrichtungen auszuschließen. Es gibt nur eine Wissenschaft, aber es gibt auch eine Reihe von Kompromissen dazu, was alles als wissenschaftlich gelten solle. Zumindest deine erste wissenschaftliche Arbeit, in der Regel die Bachelor Thesis, sollte noch wissenschaftlichen Kriterien im belastbaren Sinne entsprechen.
Das wissenschaftliche Arbeiten und die Wissenschaft selbst bilden eine Form des Erkenntnisgewinns. Eine Reduktion aller Erkenntniswege auf die Wissenschaft wäre die Beanspruchung einer einzigen Wahrheit und das wiederum ist unwissenschaftlich. Dennoch ist es sehr wesentlich, die Erkenntniswege und die zu wählenden erkenntnistheoretischen Ansätze abzuwägen und der konkreten Fachrichtung entsprechend zu verwenden.
Wissenschaft ist ein Prozess. Was immer man an Erkenntnis hat, ist immer nur der aktuelle Stand in diesem Augenblick der Erkenntnis. Nicht mehr und nicht weniger. Andere Betrachtungsweisen sind vielleicht nicht wissenschaftlich, können aber dennoch sehr wertvoll sein! Wissenschaft muss offen bleiben für das Andersartige und gleichsam klar abgrenzen, was strenge, belastbare Wissenschaft ist und was eben nicht. Nur so besteht ausreichende Klarheit darüber, was belastbare Aussagen sind, die ggf. auch als Prämissen einer streng wissenschaftlichen Arbeit dienen können, oder was Betrachtungen sind, die zwar inspirierend, vielleicht innovativ oder grundsätzlicher Natur sein mögen und damit überaus wertvoll, aber eben nicht belastbar genug für exakte Wissenschaft. Deine Arbeit muss diese Abgrenzung von Anfang bis Ende leisten!
Die nachfolgend nur einführend oder erinnernd und mithin oberflächlich dargestellten Eigenschaften von wissenschaftlichem Arbeiten sind von „unverzichtbar“ zu „auch wichtig“ absteigend angeordnet. Die Reihenfolge ist in diesem Sinne willkürlich wertend angelegt und soll als Orientierung dienen.
2.1 Objektivität
Wissenschaftlichkeit fordert die Unabhängigkeit der Erkenntnis vom Betrachter. Ein Ergebnis muss von anderen Fachleuten genauso gefunden werden wie von demjenigen, der es zuerst notierte. Ist der Betrachter Teil der Erkenntnis, geht die Objektivität verloren und die Erkenntnis wird subjektiv, was wiederum nicht wissenschaftlich ist.
2.2 Reproduzierbarkeit (Wiederholbarkeit)
Ein Ergebnis muss jederzeit reproduzierbar sein. Man muss dieselbe Erkenntnis bei gleichem Vorgehen und gleichen Bedingungen immer wieder finden. Hierbei kann diskutiert werden, ob dieselbe Erkenntnis auch auf anderem Wege zu finden sein soll und wie die Rahmenbedingungen genau zu definieren und ggf. zu variieren sind. Grundsätzlich jedoch ist die Reproduzierbarkeit essenziell. Es muss unterschieden werden, wie groß die Menge an reproduzierten Ergebnissen sein soll. Eine Raumsonde kann ihren Weg zu Proxima Centauri nicht mehrere hundert Male wiederholen, um statistisch gesicherte Werte zu liefern. In solchen Fällen kann man jedoch auch andere Maßnahmen ergreifen, um ausreichend gesicherte Ergebnisse zu erhalten.
2.3 Transparenz (Überprüfbarkeit)
Eine Erkenntnis muss überprüfbar sein. Das bezieht sich vor allem auf die kleinschrittige Darstellung des Erkenntnisweges. Es muss für einen außenstehenden Fachmann nachvollziehbar sein, wie die Erkenntnis aus den Prämissen, Beobachtungen, Berechnungen, Messungen usw. entwickelt wurde. Dies betrifft die vollständige Darstellung belastbarer Prämissen ebenso wie die Darstellung jeder Entscheidungsfindung, jedes Gedankenganges, jedes Rechenschrittes und jeder Messung, eine Darstellung von Maschinen, Geräten, Experimentalaufbauten und sonstigen Details. Es darf an keiner Stelle der Darstellung die Frage „Wie kommt der Autor von Schritt A zu Schritt B?“ auftauchen und die Formulierung „wie man leicht sieht“ ist hierbei unzulässig. Man muss es wirklich leicht sehen können. Die Klarheit im Satz ist auch Zeichen der Klarheit im Kopf. Was du verstanden hast, kannst du auch verständlich ausdrücken und in klaren, einfachen Sätzen niederschreiben.
2.4 Zuverlässigkeit (Reliabilität)
Eine Erkenntnis muss ebenso zuverlässig sein wie der Weg, auf welchem sie gefunden wurde und die Prämissen, auf denen sie aufsetzt. Man kann die Reliabilität als statistisches Maß konkret bestimmen und sollte dies auch tun.
Reliabilität ist eine Voraussetzung für Validität1. Reliabilität lässt sich an drei Kriterien festmachen:
Stabilität
: siehe auch Wiederholbarkeit. Wann immer man die Betrachtung, Beobachtung, Messung usw. wiederholt, kommt man zu derselben Erkenntnis oder zumindest einem hinreichend nah dran liegenden Ergebnis (Statistische Streuungen sind meistens zu akzeptieren, wobei deren Streubreite ein wesentliches Maß für die Qualität der Erkenntnis ist). Stabilität beinhaltet auch
Robustheit
. Ein Ergebnis ist nur dann wissenschaftlich verwertbar, wenn es eine gewisse Mindesttoleranz gegen Störeinflüsse hat und eine gewisse
Persistenz
in seinem Dasein aufweist. So haben z.B. künstlich hergestellte chemische Elemente eine Mindestlebensdauer, unter welcher sie nicht mehr als Element gelten. Solche Definitionen verändern sich mit zunehmendem wissenschaftlich-technischem Fortschritt, aber sie sind notwendig, um sinnvolle, gesicherte, nachvollziehbare Ergebnisse, sozusagen Ergebnisse mit einer gewissen Mindestqualität, zu definieren.
Konsistenz
: Fasse nur das unter einem Begriff zusammen, was auch zusammengehört. Dies kann ein Merkmal, ein Messwert, ein Index, ein Mengenbezeichner usw. sein. Wichtig ist hier nur, dass inhaltliche Übereinstimmung gesichert wird und keine (zu starke) Überdeckung von Merkmalen verschiedener Begriffe akzeptiert wird. In diesem Falle schärfe deine Begriffe und differenziere deine Betrachtung!
Äquivalenz
: Messungen, Umfragen, Beobachtungen, Rechenwege können durchaus sehr verschieden sein und dennoch dasselbe Ergebnis liefern. In diesem Falle heißen die benutzten Untersuchungsmethoden äquivalent. Diese Äquivalenz muss unter Umständen explizit nachgewiesen werden.
2.5 Statistische Unterlegung
Dieser Parameter bezieht sich unter anderem auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit, soll aber separat genannt werden. Statistik kann zeigen, wie belastbar eine Erkenntnis ist. Das ist sehr wesentlich für Evidenzbetrachtungen und andere Merkmale wissenschaftlicher Arbeit. Statistische Betrachtungen liefern also Kennwerte, welche den Wert einer Erkenntnis, der ihrer Findung zugrunde liegenden Methoden sowie die Belastbarkeit der ganzen Betrachtung als Beitrag zur Wissenschaft allgemein bewertbar machen.
Sichere vor Beginn deiner wissenschaftlichen Arbeit, dass du genug statistische Basis herstellen kannst, um zu zeigen, wie weit dein Ergebnis als wissenschaftlich zu erkennen ist. Kannst du deine Betrachtungen nicht statistisch absichern, musst du entweder einen anderen Weg zur Absicherung finden oder du musst kenntlich machen, dass und in welcher Form und Menge dies eine der nachfolgenden Aufgaben sein muss, um diese Erkenntnis in Folgearbeiten genauer zu hinterfragen und/oder abzusichern. Hierfür ist im Ausblick am Ende deiner Arbeit der richtige Platz.
2.6 Validität (Gültigkeit)
Gütigkeit ist gegeben, wenn die beobachtete oder gemessene Tatsache mit der theoretisch begründeten Erwartung übereinstimmt. Dies geschieht in aller Regel durch Herleiten einer somit begründeten Erwartungshaltung, deren Formulierung als Thesen und nachfolgende Messung oder Beobachtung des Phänomens mit dem Ziel, diese Thesen zu widerlegen (falsifizieren im Idealfall) oder zu bestätigen (möglichst verifizieren und validieren).
Diese Übereinstimmung zwischen Vorhersage und Tatsache muss geprüft werden, um Trugschlüsse, Täuschungen, Fehlerfortpflanzungen, Interferenzeffekte usw. auszuschließen. Weiterhin muss bei fehlender oder zu ungenauer Übereinstimmung geprüft werden, ob Theorie oder Messung oder beides unzureichend ist. Wissenschaftlich ist es erst, wenn beides als zuverlässig erkannt wurde und die Übereinstimmung mit sachbezogen ausreichender Genauigkeit festgestellt werden konnte.
Validität bedeutet auch, dass die betrachtete Fragestellung einen praktischen Bezug haben muss. Validität entsteht in diesem Sinne aus dem Kontext bisherigen Wissens, indem unbekannte oder ungesicherte Erkenntnisse hinterfragt oder ganz neu nachgefragt werden. Diese Fragen entstehen in der Regel aus auftauchenden Problemen bei der Anwendung einer Theorie oder fehlendem Wissen zur Lösung eines lebenspraktischen Problems. Fragen, die ohne einen solchen Kontext sind, können durchaus auch wissenschaftlich bearbeitet werden, aber die Qualität einer solchen Erkenntnis darf in Frage gestellt werden.
2.7 Präzision und Richtigkeit
Richtigkeit ist ein mutiges Kriterium, weil sie sprachlich eine absolute Wahrheit einfordert, die es (je nach erkenntnistheoretischem Weltbild und wissenschaftstheoretischer Methode) nicht gibt. Vielmehr ist Richtigkeit der Abstand eines Ergebnisses von dem (vermuteten oder vorhergesagten, berechneten) wahren Wert. Wahrheit definiert sich hier meistens als Übereinstimmung von Beobachtung oder Messung und begründeter Erwartung.
Eine Erkenntnis wird statistisch abgesichert und dafür unter anderem oft wiederholt. Dabei entsteht eine gewisse Streuung der erhaltenen Werte. Die Streuung der Werte trifft eine Aussage über die Genauigkeit der Betrachtung. Je geringer die Streuung, umso präziser die Betrachtung. Mittelt man diese streuenden Ergebnisse oder bildet deren Schwerpunkt etc., wird dieser in gewissem Maße vom theoretischen und als richtig angenommenen Wert abweichen. Ist diese Abweichung im fachlichen Kontext gering, gilt die Erkenntnis als richtig. Wird ein aus sachlogischen Überlegungen begründetes Maß der Abweichung überschritten, gilt die Erkenntnis als ungesichert oder falsch. Bei zu großer Abweichung ist zu prüfen, ob die Erkenntnis nicht richtig oder die Vorhersage fehlerhaft ist. Bisweilen tritt beides ein.
2.8 Fundiertheit
Eine Erkenntnis gilt als fundiert, wenn ihr Fundament, also die zugrunde liegenden Annahmen, Voraussetzungen, gewählten Theorien und verwendeten Methoden, als solide und belastbar bekannt sind. Es soll keine Unsicherheit oder gar Unwahrheit in die Erkenntnis einfließen und es soll kein Fehler in den Erkenntnisweg eingetragen werden.
Insbesondere die zugrunde gelegte Literatur soll hochwertig sein. Wichtigstes Kriterium für die Fundiertheit der Literatur ist die Peer Review. Nur mittels Peer Review geprüfte Artikel sind zulässig, das benutzte Journal soll möglichst nicht im Ruf stehen, betrügerisch zu arbeiten.
2.9 Relevanz
Eine Erkenntnis ist wissenschaftlich