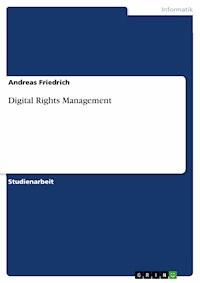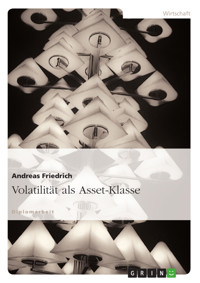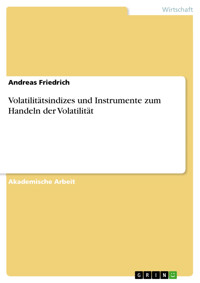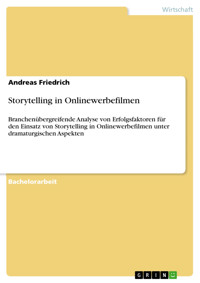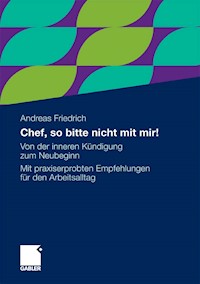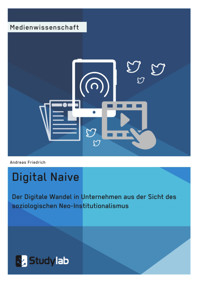
Digital Naive. Der Digitale Wandel in Unternehmen aus der Sicht des soziologischen Neo-Institutionalismus E-Book
Andreas Friedrich
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unternehmen kommen nicht mehr umher sich selbst zum Digitalen Wandel und den Herausforderungen, die dieser mit sich bringt, zu positionieren. Stakeholder aus allen Bereichern erwarten eine klare Positionierung, obgleich die Erwartungen an konkrete Maßnahmen diffus bleiben. Wie kommt es, dass ein solcher Druck entsteht, welche Mechanismen haben dazu geführt und wie reagieren Unternehmen in ihrer Kommunikation auf den Digitalen Wandel? Diese Fragen und entsprechende Hintergründe werden anhand des soziologischen Neo-Institutionalismus erforscht und knapp zusammengefasst. Aus dem Inhalt: - Theorieansätze des Neo-Institutionalismus, - Das Konzept des digitalen Wandels, - Prozesse und Akteure der Institutionalisierung, - Empirische Untersuchung und qualitative Inhaltsanalyse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis:
Zusammenfassung
Abstract
1. Einleitung
1.1. Relevanz des Themas
1.2. Stand der Forschung
1.3. Forschungsinteresse und -fragen
1.4. Aufbau der Arbeit
2. Theoretische Grundlage: Der soziologische Neo-Institutionalismus
2.1. Verortung des soziologischen Neo-Institutionalismus
2.2. Theorieansatz und Grundbegriffe
2.2.1. Makroinstitutionalistischer Ansatz
2.2.2. Umwelt und organisationales Feld
2.2.3 Institution
2.2.4. Rationalität und Legitimität
2.2.5. Rationalitätsmythos
2.2.6. Entkopplung
2.2.7. Isomorphismus
2.3. Begründung der Theoriewahl
2.4. Begriffsabgrenzung: Akteur, Organisation und Unternehmen
3. Forschungsgegenstand: Digitaler Wandel
3.1. Konzept des digitalen Wandels
3.2. Der Prozess der Institutionalisierung
3.2.1. Habitualisierung
3.2.2. Objektivierung
3.2.3. Sedimentbildung und Tradition
3.2.4. Verdinglichung
3.3. Akteure der Institutionalisierung
3.3.1. Wissenschaft
3.3.2. Beratungen
3.3.3. Medien
3.3.4. Politik und Verbände
3.3.5. Organisationales Feld und Umwelt
4. Empirische Untersuchung
4.1. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
4.2. Bestimmung des Ausgangsmaterials
4.3. Kategorien und Ergebnisse
4.3.1. Kategorie 1: Digitaler Wandel als Institution
4.3.2. Nicht zugeordnete Kodierungen in Kategorie 1
4.3.3. Kategorie 2: Hinweise auf Entkopplung
4.3.4. Nicht zugeordnete Kodierungen in Kategorie 2
4.3.5. Kategorie 3: Isomorphien
4.3.6. Kategorie 4: Prozess der Institutionalisierung
5. Interpretation der Ergebnisse
6. Diskussion und Implikationen
7. Anhang
7.1. Anhang I: Ablauf der Materialerstellung
7.2. Anhang II: E-Mail für Kontaktaufnahme
7.3. Anhang III: Einverständniserklärung Interviewpartner
7.4. Anhang IV: Kategoriesystem
7.5. Anhang V: Leidfaden für Experteninterviews
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis:
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht den digitalen Wandel aus der Sicht des soziologischen Neo-Institutionalismus. Dabei wird eingehender untersucht, wie Unternehmen mit den von außen an sie herangetragenen Erwartungshaltungen umgehen. Zu beobachten ist, dass von Unternehmen Maßnahmen auf den digitalen Wandel erwartet werden und diese ihr unternehmerisches Handeln in Bezug auf den digitalen Wandel legitimieren müssen. Unklar ist, ob Unternehmen diese vorherrschende Meinung zum digitalen Wandel und die Notwendigkeit von Maßnahmen als Reaktion unhinterfragt übernehmen.
Da die erwarteten Reaktionen nicht unbedingt der wirtschaftlichen Logik der Unternehmen folgen, werden Entkopplungsprozesse vermutet, bei denen kommunikative und unternehmensinterne Prozesse auseinanderfallen. Dies wäre insbesondere dann zu vermuten, wenn sich die Unternehmen der beschränkten Rationalität der erwarteten Maßnahmen bewusst sind.
Im Zentrum der Arbeit steht eine empirische Untersuchung, die die Argumentationsgrundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage liefert. Dabei wurden mittels leitfadengestützter Interviews fünf Kommunikationsentscheider aus Unternehmen befragt, die für die einzelnen Branchen eine Leuchtturm-Funktion erfüllen.
Die Auswertung der Interviews ergab, dass es einen deutlich spürbaren Legitimationsdruck in Bezug auf den digitalen Wandel gibt, der vor allem von den Medien ausgeht. Besonders in den Branchen, in denen ein hoher Druck auf den Unternehmen lastet, zeigt sich eine Institutionalisierung des digitalen Wandels. Jedoch finden die Reaktionen der Unternehmen vorwiegend bewusst statt und Entkopplungsprozesse werden gezielt in Kauf genommen, um dem Erwartungsdruck von außen gerecht zu werden.
Es zeichnet sich also ein Institutionalisierungsprozess ab, der bereits erste Phasen durchschritten hat. Ob sich der digitale Wandel im weiteren Verlauf als normativer Zwang etabliert und welche Erwartungen unter dieser Norm subsummiert werden, hängt jedoch auch von der Reaktion der Unternehmen in diesem Prozess ab. Vor allem jene Unternehmen, die aktuell unter hohem Druck stehen, stellen die Weichen für diesen Prozess.
Abstract
This research paper examines the digital transformation from the perspective of sociological neo-institutionalism and investigates how companies deal with external expectations. It can be observed that certain measures are expected of companies in regards to the digital transformation in order to legitimize their business activities in relation to the digital transformation. Thereby it is unclear whether companies adopt these prevailing opinions and measures as reactions to the digital transformation unquestioningly.
Since the expected reactions do not necessarily follow the economic logic of the company, decoupling processes are suspected where communication and operative processes fall apart. This might particularly be the case when businesses are aware of the limited economic rationality of the expected measures.
The core of the paper is an empirical study which provides the basis for an argumentation to answer the research question. Therefore five interviews were conducted with decision makers from companies which fulfill a lighthouse-function for their sectors. The analysis of the interviews showed that there is a clearly noticeable pressure - emanating mainly from the media - to justify business activities by relating to the digital transformation. Especially in industries where there is a high pressure on companies to adapt to expectations, institutional characteristics of the digital transformation are visible. These reactions and decoupling processes present as conscious and are specifically taken into account to meet institutionalized expectations.
An institutionalization process becomes apparent which has already passed through its first phases. Whether the digital transformation will be established itself as a normative constraint, and which expectations are subsumed under this norm, also depends on the reactions of the companies to this process. Especially those companies that are currently under high pressure, set the course for this process.
Topic for further investigations would be how the institution of digital transformation influences journalists and what their motivation is behind building up normative pressure. Also of interest would be a study of the current processes during the institutionalization and the role of individual decisions and motivations in this process.
1. Einleitung
1.1. Relevanz des Themas
Unternehmen verfolgen mit ihrem Handeln im Allgemeinen zwei fundamentale Ziele: Zum einen wollen sie ihren Unternehmenszweck erfüllen und damit ihre unternehmerischen Ziele erreichen, welche meist in ökonomischen Dimensionen gefasst sind, zum anderen wollen sie auch den Fortbestand der Organisation sichern.[1] Für beide Ziele sind Unternehmen vom Zugang zu Ressourcen abhängig (vgl. Pfeffer & Salancik, 2009).
Als Ressourcen werden jene Mittel verstanden, die ein Unternehmen benötigt, um die beiden grundlegenden Ziele zu erreichen. Im betriebswirtschaftlichen Verständnis werden darunter beispielsweise Rohmaterial, Arbeitsmittel, Arbeitskraft (tangible assets), aber auch immaterielle Güter wie Wissen und Reputation (intangible assets) gefasst (vgl. Wernerfelt, 1984, S. 172). Der Selbsterhalt sowie der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens ist vor allem in dynamischen Märkten schwierig, da dort der Produktlebenszyklus kürzer und der Wettbewerb um wichtige Ressourcen besonders hoch ist (vgl. Pahl, 2006, S. 3).
Eine tiefgreifende Veränderung erhöht nun zusätzlich in allen Branchen diese Dynamik. Die Möglichkeit, Information in diskreten Werten auszudrücken, legte den Grundstein für die digitale Informationsverarbeitung und löste damit weitreichende Veränderungen in praktisch allen Lebensbereichen, die Wirtschaft eingeschlossen, aus. Dieser Meta-Prozess wird in der vorliegenden Arbeit als der digitale Wandel bezeichnet und in Kapitel 3.1. eingehender erklärt.
Die Begeisterung über vereinfachte Prozesse im Zuge der Digitalisierung wurde schnell gedämpft durch die Erkenntnis, dass es neben Gewinnern auch Verlierer in diesem Veränderungsprozesses gibt. Angefangen bei der Musikindustrie, die zunächst digitale Techniken vorantrieb um Kosten für die Produktion ihrer Verkaufsgüter zu senken und sich anschließend vehement gegen illegale Kopien der Produkte im Internet wehrte (vgl. Mathei, 2009, S. 279ff.), über den Büchermarkt (vgl. Storost, 2013), der sich durch digitale Vertriebskanäle bedroht sieht, bis hin zur Verlagsbranche und dem Journalismus, der im Zuge sinkender Auflagen mit allen möglichen Akteuren um neue Erlösmodelle ringt[2] (vgl. Lübcke, 2013, S. 197ff.; vgl. pwc, 2014a).
Branchenübergreifend herrscht eine in den Medien beobachtbare Unsicherheit in Bezug auf die vielschichtigen und komplexen Veränderungsprozesse, die durch den digitalen Wandel angestoßen wurden (vgl. Amirkhizi, 2015). Die erhöhte Dynamik in den Märkten macht es vor allem für die traditionsreichen und altgewachsenen Unternehmen schwierig, neue Wettbewerber zu erkennen und schnell auf sich verändernde Umweltprozesse zu reagieren, während Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber durch die Digitalisierung wesentlich gesunken sind (vgl. Deloitte, 2015, S. 6). Dies schürt beispielweise die Angst etablierter Unternehmen von einem Startup, das vor ein paar Monaten noch aus zwei Gründern in einer Garage bestand, „disrupted“ zu werden, sprich, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens durch die Tätigkeit eines neuen Wettbewerbers angegriffen wird (vgl. Abolhassan, 2015; vgl. McKinsey, 2015, vgl. Schmiechen, 2015).
Im Zuge dieser Unsicherheit wird es für Unternehmen immer wichtiger zu zeigen und damit nach außen zu kommunizieren, dass sie wichtige Ressourcen für sich sichern, im dynamischen Wettbewerb bestehen und wirtschaftlich erfolgreich sein können. Die Frage, die Unternehmen sich stellen müssen, ist: Wie zeige ich, dass ich den Herausforderungen Herr werde und warum ist es eine gute Ideen für mein Unternehmen zu arbeiten, weiterhin meine Produkte zu kaufen oder Geld in mein Unternehmen zu investieren?
Doch der Zustrom vor allem von immateriellen Ressourcen kann erst dann erfolgen, wenn dem Unternehmen diese Fähigkeiten von außen zugeschrieben werden. Diese Legitimität des wirtschaftlichen Handelns kann nur dann erfolgen, wenn das Unternehmen entsprechend bestehenden kulturellen Ideen und Erwartungen folgt (vgl. München, 1992, S. 350).
Ob das Handeln eines Unternehmens als legitim gilt, wird auf Grundlage der Darstellung und der eigenen Erfahrung von Akteuren mit dem Unternehmen bestimmt. Auch deshalb steigen die Aufwendungen von Unternehmen für die Unternehmenskommunikation, um Legitimität aufzubauen und zu sichern (vgl. ebd., S. 351). Dies geschieht auch dann, wenn es keinen akuten Anlass für die Kommunikation gibt, wie z.B. in Unternehmenskrisen. Nichtsdestotrotz steigt die Notwendigkeit der Legitimation in Situationen, in denen ein Unternehmen unter besonderer Beobachtung z.B. im Zuge des digitalen Wandels steht (vgl. Sandhu, 2012, S. 1). Dennoch ist auffällig, dass gerade zuletzt Krisen, wie der Ausfall des Geldautomatennetzes bei der Sparkasse (vgl. Schreiber, 2015) oder der VW-Abgas-Skandal (vgl. Lobo, 2015), in der medialen Berichterstattung auch direkt auf das Versagen der Unternehmen im Zuge des digitalen Wandels und fehlende „digitale Kompetenz“ (Schreiber, 2015) zurückgeführt wird.
Doch wie ist es in diesem Zusammenhang zu bewerten, dass es kaum konkrete Aussagen über den Inhalt des digitalen Wandels und dessen konkreten Auswirkungen gibt, während von Unternehmen ganz konkrete Handlungen erwartet werden? Und wie lässt sich erklären, dass Unternehmen trotz dieser Unklarheiten branchenübergreifend konvergente Handlungsstrategien entwickeln. Daran schließt sich auch die Frage an, wie diese Unternehmen zu den konkreten Maßnahmen gekommen sind. Waren es interne rational-geleitete Diskurse, denen eine Handlung basierend auf eigenen Erfahrungen folgte oder haben Unternehmen gemäß der Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen gehandelt bzw. reagiert und etabliert, was sich bei anderen Unternehmen, die als erfolgreich wahrgenommen wurden, scheinbar bereits bewährt hat?
Der Neo-Institutionalismus stellt zu diesen Fragen einen theoretischen Rahmen zur Verfügung, der Handlungen von Akteuren, eingebettet in institutionalisierte Erwartungen von gesellschaftlichen Akteuren, betrachtet. Der neo-institutionalistischen Theorie zufolge etablieren Organisationen jene Strukturen, die als rational gelten, um eigene Handlungen gegenüber Anspruchsgruppen und in der Gesellschaft vorherrschenden institutionalisierten Normen und Werten zu legitimieren.
Wenn schlecht strukturierte Entscheidungssituationen vorliegen, in denen die Voraussetzungen für Handeln nach ökonomischer Rationalität (siehe Kapitel 2.2.4) nicht erfüllt sind, weil vorgelagerte unternehmensinterne bzw. -externe Entscheidungen oder Mechanismen nicht ausreichend Komplexität reduziert und Unsicherheit absorbiert haben, steigt die Wahrscheinlichkeit auf bereits von gesellschaftlichen Akteuren legitimierte Strukturen und Handlungsweisen zurückzugreifen (vgl. Berger, 1988, S. 117). Eine so strukturierte Entscheidungssituation mit den abgeleiteten Handlungsmustern ist bei Unternehmen im Zuge des digitalen Wandels zu vermuten.
Für Unternehmen ist es von großer Bedeutung, Legitimität und Ressourcen zu sichern. Es herrscht erkennbar ein Handlungsdruck auf Unternehmen und es ist durchaus von Interesse zu sehen, wie dieser zustande kommt, welche Akteure dabei eine Rolle spielen und welchen institutionalisierten Erwartungen dieser Handlungsdruck entspringt. Am Ende stellt sich auch die Frage, welche Implikationen ein institutioneller Charakter des digitalen Wandels für die Kommunikation der Unternehmen mit sich bringt und wie sie darauf reagieren können. Wie können oder sollten Unternehmen auf derartige Erwartungsstrukturen reagieren und wie können sie die Erwartungen unter Umständen selbst beeinflussen?
Die vorliegende Arbeit wird den digitalen Wandel als eine solche Erwartungsstruktur untersuchen und Einblicke in das Geflecht von Akteuren und den handlungsbestimmenden Strukturen zwischen ihnen geben. Auf das Konzept des digitalen Wandels wird in Kapitel 3.1 näher eingegangen. Für die Arbeit steht die inhaltliche Ausgestaltung des Konzepts jedoch nicht im Vordergrund, sondern das kommunikative Handeln der Unternehmen als Reaktion auf mögliche institutionalisierte Erwartungen, die an die Unternehmen über den Medienwandel hinaus gestellt werden.
1.2. Stand der Forschung
Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Neo-Institutionalismus keine in sich geschlossene Theorie, sondern eher einen praktischen Forschungsansatz darstellt (vgl. Hasse & Krücken, 1999, S. 51). Basierend auf diesem Ansatz wurde der Neo-Institutionalismus vor allem auf Grundlage empirischer Forschungsarbeiten weiterentwickelt. Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten, die sich mit dem Neo-Institutionalismus beschäftigen (vgl. Senge, 2011).
Eine genauere Verortung des Neo-Institutionalismus, insbesondere des für diese Arbeit zugrundeliegenden soziologischen Neo-Institutionalismus, erfolgt in Kapitel 2.2.
Der Neo-Institutionalismus diente bereits als Ansatz zur Untersuchung ähnlicher Phänomene, die Einfluss auf das unternehmerische Handeln nehmen. So war er Theoriegrundlage für empirische Arbeiten zu Konzepten wie der unternehmerischen Nachhaltigkeit (vgl. Hiß, 2006), Managementmethoden wie Diversity (vgl. Süß, 2009) oder der Balanced Scorecard (vgl. Wehmeier, 2006).
Der kommunikationswissenschaftliche Ansatz ist bei den zahlreichen Forschungsarbeiten zum Neo-Institutionalismus jedoch eher unterrepräsentiert und wurde als konzeptionelle Basis erst relativ später weiterentwickelt. Dies ist vor allem in Bezug auf den Neo-Institutionalismus in Bezug auf organisationale Legitimität (vgl. Sandhu, 2012, S. 8) der Fall.