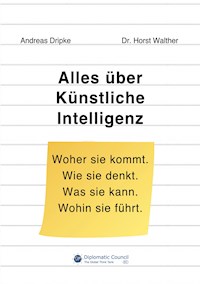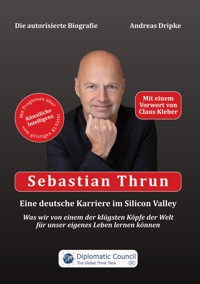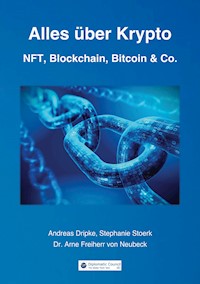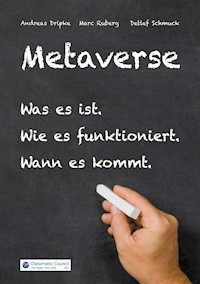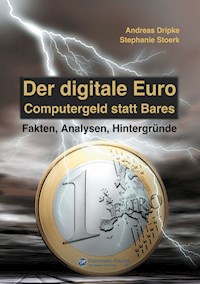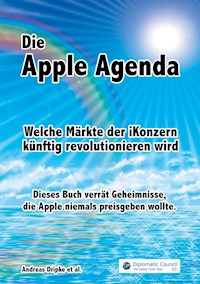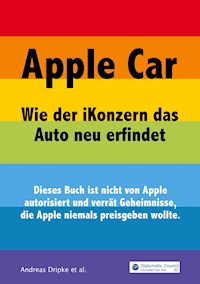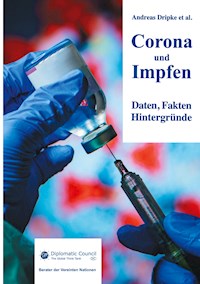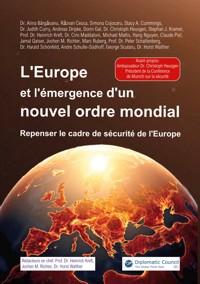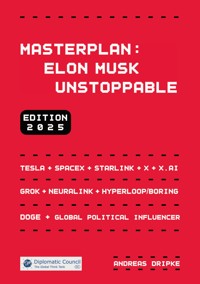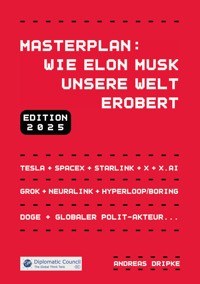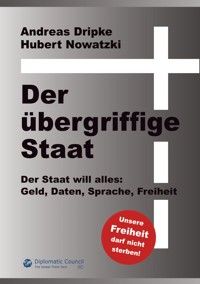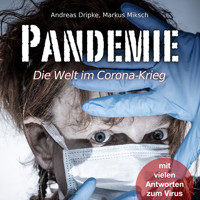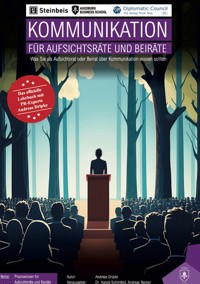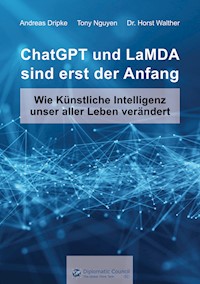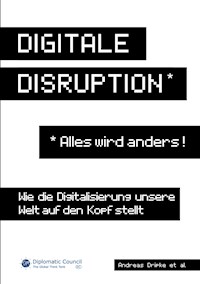
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft: Wir alle unterschätzen, wie fundamental der Umbruch ist, auf den wir zusteuern. Die Digitalisierung wird unser Leben auf den Kopf stellen. Ein Auto ohne Lenkrad markiert den Eintritt in ein völlig neues Konzept der Mobilität. Es ist gar kein Auto mehr im herkömmlichen Sinne. Ebenso wenig, wie es sich bei einer Smartwatch um eine Uhr handelt. Wenn wir von Androiden, also menschenähnlichen Robotern, hören, denken wir an Science Fiction. Dabei ist abzusehen, dass diese Geräteklasse künftig Einzug in unseren Alltag halten wird. Und bei Künstlicher Intelligenz sind die meisten von uns sicher, dass diese niemals den Menschen ersetzen kann. Ein fataler Irrtum, wie wir ihn auf vielen Feldern begehen. Alles, was denkbar ist, wird auch kommen! Und einiges dazu, an das wir heute noch gar nicht denken! Unser beruflicher und privater Alltag wird in 20 Jahren so grundverschieden von unserer Gegenwart sein wie unsere heutige Zeit verglichen mit der Welt vor 100 Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Von der Erfindung des Feuers zur Digitaltechnik
Besser heute als vor Hunderten von Jahren
Digitale Disruption
Viele Berufsgruppen sind akut gefährdet
Die Mittelschicht wird wegdigitalisiert
Digitales Nervensystem um die Welt
Das Internet wurde 1968 geboren
Das Internet gehört uns allen
Wer im Internet etwas zu sagen hat
USA: Die Daten im Internet gehören uns
Edward Snowden: Globaler Machtmissbrauch
Das Internet der Dinge umschlingt uns
Daten sind die neue Währung
Allianz aus IoT, Cloud und KI
Neue Gefährdungslage
Immer größere Datenzentren
Künstliche Intelligenz voraus
Menschliches Denken automatisieren
Turing-Test für Intelligenz
Google telefoniert mit KI
Menschheitstraum von den arbeitenden Maschinen
Computerleistung bis zur Singularität
Quantenphysik verändert die Welt
Generelle und Superintelligenz
Intelligente Ziele
Corona als Beschleunigungsfaktor für Digitalisierung
Digitalisierung kommt mit Macht
Neue Normalität: Home Office
Führung aus der Ferne
Der stationäre Handel stirbt
Digitales Bildungswesen
Mangelhaftes Gesundheitswesen
Sozialleben am Bildschirm
Internet mit Löchern aller Orten
Automobilindustrie in akuter Gefahr
Industrielle Erneuerung
Welche Branchen in welchem Umfang betroffen sind
Games Changer übernehmen die Spitze
Smart City – Traum und Albtraum
Intelligente Infrastrukturen
Der Wunschtraum von der lebenswerten Stadt
Big Step für Big Brother
Ausspähen ist strafbar
Datenschutz – was ist das?
Grundrecht auf eigene Persönlichkeit
Die NSA späht die Welt aus
Überwachung schneller als Virus
In Deutschland undenkbar?
Gewaltigstes Überwachungssystem der Welt
Apple und Google gegen die Bundesregierung
Social Scoring als Lösung?
Eine neue Menschheit
Staat und Wirtschaft arbeiten Hand in Hand
Zweckentfremdung vorprogrammiert
Die biometrische Vermessung der Menschheit
Fingerabdrücke von Verbrechern und Bürgern
Automatische Gesichtserkennung überall
„Ähnlich sehen“ wird zum Verbrechen
Den Bürgern auf der Spur
Gestensteuerung und Lippenlesen
Venen im Visier
Überwachung im Schlaf
Dr. Apple, Dr. Google und Dr. Amazon
Asoziale Medien regieren uns
Mainstream-Medien besser als ihr Ruf
Alternative Wahrheiten
Sternstunde der Storyteller
Dunning-Kruger und Social Bots
„Mit eigenen Augen gesehen“
Digitale Identität für alle Menschen
Digitale Identität auf Lebenszeit
Die UNO mischt mit
Impfnachweis für die Bevölkerung
Quantenpunkt-Tatoo
Das Projekt vom bekannten Reisenden
Horrorvision und Machtverschiebung
Wir werden zu Cyborgs
Wir werden gechipt
Neue Realitäten werden wahr
Die Welt jenseits 2030
Humanoide im Anmarsch
Kryptogeld – die neue Währung
Neue Währungswelt
„Riders on the Storm“
Kurzer Ausflug nach China
Europa wird China folgen
Nur Bares ist Wahres
Die digitale Pandemie bedroht uns
Welle der Cyberkriminalität
Liebesbrief mit Folgen
Warnung an die digitale Gesellschaft
Alarmstufe Rot für Deutschland
Kritische Infrastrukturen im Visier
Von Satelliten, Drohnen und Raketen
Drohnen umschwirren uns
Polizeidrohnen überwachen uns
Kampfdrohnen im Einsatz
Satelliten überwachen uns
Staatsschnüffelei im All
StarLink – digitaler Link zwischen Himmel und Erde
Private Raumfahrt auf dem Vormarsch
Wettrüsten im Weltraum
Digitale Souveränität in Europa
Weckruf für die Digitalgesellschaft
Facebook noch schlimmer als Google
Appell für die digitale Souveränität Europas
Von GSM zu 5G
Gaia-X – die europäische Datencloud
KI in Europa – viele Worte, wenig Taten
Die Welt in 100 Jahren
Über die Autoren
Bücher im DC Verlag
Über das Diplomatic Council
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Es stellt schon lange keine neue Erkenntnis mehr dar, dass die Digitalisierung in unseren privaten und unseren beruflichen Alltag Einzug gefunden hat. Es gibt kaum jemanden, der nicht ständig sein Smartphone bei sich führt.
Ebenso selbstverständlich erleben wir in der Wirtschaft, dass die Digitalisierung viele Branchen grundlegend verändert. Wir erledigen unsere Arbeit am Bildschirm, buchen unseren Urlaub online, lassen Roboter Geräte zusammenmontieren, vertrauen auf integrierte Logistikketten… die Liste ließe sich beinahe beliebig lang fortsetzen.
Doch die meisten unterschätzen, wie fundamental der Umbruch ist, auf den wir zusteuern. Die Digitalisierung wird unser Leben auf den Kopf stellen. Ein Auto ohne Lenkrad markiert den Eintritt in ein völlig neues Konzept der Mobilität, es ist im Grunde gar kein Auto mehr im herkömmlichen Sinne. Ebenso wenig übrigens, wie es sich bei einer Smartwatch um eine Uhr handelt. Wenn wir von Androiden lesen, denken wir an Science Fiction – dabei ist abzusehen, dass diese „Geräteklasse“ künftig Einzug in unseren Alltag halten wird. Und bei Künstlicher Intelligenz sind die meisten von uns sicher, dass diese „natürlich“ niemals den Menschen ersetzen kann. Wirklich nicht?
Von der Erfindung des Feuers zur Digitaltechnik
Damit sind wir beim Thema dieses Buches: Disruption bedeutet, dass etwas zerstört wird, damit Platz geschaffen wird für etwas völlig anderes. Es heißt nicht weiterentwickeln, nicht verbessern, sondern „plattmachen“. Eine wesentliche Grundlage für fundamentale Veränderungen bilden, seit die Menschheit existiert, neue Technologien. Der Homo erectus war der erste, der das Feuer für sich nutzte. Die damit verbundenen Umwälzungen waren disruptiv: Licht, Wärme, Schutz vor wilden Tieren und man konnte sogar Nahrung damit zubereiten. Das ist ungefähr 100.000 Jahre her. 1 Doch schon 200.00 Jahre früher wehrte sich offenbar der Urmensch mit Wurfspeeren aus Holz gegen seinen damals gefährlichsten Feind, die Säbelzahnkatze.2 Die Menschheitsgeschichte reicht indes viel weiter zurück: Die ältesten Werkzeuge werden auf etwa 2,6 Millionen Jahre zurückdatiert.3 Überspringen wir ein paar Millionen Jahre und landen in der Neuzeit, die zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert beginnt und bis in die Gegenwart reicht. In dieser Zeit stieg die Lebenserwartung enorm an, mit der Entdeckung Amerikas begann die Globalisierung, wissenschaftliche Erkenntnisse und kapitalistische Wirtschaftsstrukturen schufen Armut und Wohlstand zugleich, die Ideen vom Wert des Individuums und dem demokratischen Freiheitsstreben haben sich zumindest in Teilen der Welt durchgesetzt. Ermöglicht wurden diese Entwicklungen der Neuzeit durch gesellschaftliche Umbrüche, vor allem aber durch technologische Fortschritte. Stabilere Schiffe, bessere Navigationsgeräte, neue medizinische Erkenntnisse und Geräte, Flugzeuge, Automobile, modernere Kommunikationsmittel… auch diese Liste ließe sich beinahe beliebig fortsetzen.
1941 baute der Deutsche Konrad Zuse den ersten programmgesteuerten Computer der Welt.4 Er basierte auf der Anwendung der sogenannte Booleschen Algebra, die auf ein Logikkalkül des Mathematikers George Boole aus dem Jahr 1847 zurückging.5 Stark vereinfacht dargestellt kommen bei der darauf basierenden Computerisierung nur Nullen und Einsen zum Einsatz: Null bedeutet kein Strom, Eins steht für Strom – es gibt also nur genau zwei Zustände. Man spricht daher auch vom Zweier-, Dual- oder Binärsystem. Daraus entwickelte sich die Digitaltechnik, in der ein elektronisches Bauelement nur zwei Zustände kennt. Digitalisierung bedeutet, einen „normalen“ (analogen) Ablauf in sehr viele kleine Einheiten zu zerlegen, so dass jede einzelne Einheit als Null bzw. Eins dargestellt werden kann. Das Verb digitize tauchte im englischen Sprachraum erstmals 1953 auf, digitization im Jahr 1954.6 Spätestens seit Mitte der 1980er Jahre wurde der daraus abgeleitete Begriff der Digitalisierung in Deutschland verwendet.7
Ein integrierter Schaltkreis als kleinste Einheit eines Computerchips wechselt ständig zwischen Null und Eins, gesteuert durch ein Programm. Ein Computerprogramm ist also wiederum stark vereinfacht dargestellt nichts anderes als eine Abfolge von Anweisungen, die Schaltkreise von Mikrochips auf Null oder Eins zu stellen. Der erste in Serie gefertigte Mikrochip mit der Bezeichnung Intel 4004 enthielt intern rund 2.300 digitale Ein-/Ausschalter, auch Transistoren genannt.8 In einem heutigen modernen Mikroprozessor stecken Milliarden von Transistoren; ein handelsübliches Smartphone beherbergt über 150 Milliarden Transistoren in Computer- und Speicherchips.9 Diese dramatische Zunahme der Quantität ist längst in eine neue Qualität umgeschlagen: Ein heutiger Computer kann Aufgaben verrichten, die zuvor undenkbar erschienen. Dazu gehört beispielsweise die Künstliche Intelligenz, bei der – wiederum stark vereinfacht formuliert – die dem Menschen angeborene Intelligenz so gut simuliert wird, dass man gar nicht mehr merkt, dass man es mit einer Maschine statt mit einem Menschen zu tun hat. Das ist die Disruption, die grundlegende Veränderung.
Und so gelingt es mühelos, schon im Vorwort den Bogen vom ersten Menschen vor Jahrmillionen zur digitalen Disruption der nahen Zukunft zu schlagen. Die Betonung liegt dabei auf der „nahen Zukunft“, denn die Entwicklung der Menschheit beschleunigt sich exponentiell.10 Mit anderen Worten: In immer kürzeren Zeitabschnitten werden immer gewaltigere Fortschritte erzielt. Deshalb greift die auf den ersten Blick einleuchtende Frage „Was kümmert es mich, wo die Menschheit in weiteren 300.000 Jahren steht?“ nicht. Denn schon in wenigen Jahren soll der Zeitpunkt der sogenannten Singularität erreicht sein: Das bedeutet, dass die Computer dann in der Lage sein werden, selbstständig neue – bessere – Computer zu entwickeln, die wiederum immer bessere… undsoweiter. Dann galoppiert die Digitalisierung salopp gesagt davon. Und deshalb werden wir alle davon betroffen sein, alle, die wir heute leben, und zwar in wenigen Jahren, nicht erst in Hunderttausenden von Jahren.
Je nach Lebensalter mag sich der eine oder andere Leser noch an Telefonapparate mit Wählscheibe, Faxgeräte, Röhrenfernseher, Taschenrechner oder Mobiltelefone erinnern. Alle diese Geräte muten heute wie aus einer anderen Zeit an – und doch bildeten sie noch vor wenigen Jahrzehnten die Spitze der damaligen Technologie. Binnen eines Lebensalters sind sie obsolet geworden – ebenso wie sich das Internet in dieser Zeitspanne zur Selbstverständlichkeit entwickelt hat. Dieser Fortschritt wird indes nicht einfach so weitergehen, sondern er wird sich künftig beschleunigen.
Besser heute als vor Hunderten von Jahren
In dieser Entwicklung stecken enorme Chancen für jeden einzelnen und für die Menschheit insgesamt. Man muss sich nur die Errungenschaften der Neuzeit vor Augen halten, um zu erkennen, dass wir uns im Grunde genommen schnellen Schrittes auf das Paradies zu bewegen. Wer wollte schon seit heutiges Leben gegen eines im 15. oder 16. Jahrhundert eintauschen? Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass diese Entwicklung mit den beschleunigten Fortschritten der nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter voranschreiten wird. Aber es gibt auch damit verbunden unübersehbare Risiken.
Um Chancen und Risiken erkennen zu können, muss man sich allerdings erst einmal klarmachen, welche technologischen Fortschritte vermutlich auf uns zukommen. Einige davon sind trivial, wie beispielsweise die Vorhersage, dass sich die Leistungsfähigkeit von Smartphones immer mehr verbessern wird. Unendlich schwieriger ist es indes zu erkennen, dass uns Smartphones nicht mehr ewig begleiten werden, sondern künftig von einer neuen und völlig anderen Gerätekategorie abgelöst werden könnten. Und das ist nur ein Beispiel unter Dutzenden von Entwicklungen, die alle eines gemeinsam haben: Sie wirken disruptiv, sie beeinflussen unser Leben grundlegend und sie werden ebenso unaufhaltsam auf uns zukommen.
Es sei ergänzend angemerkt, dass die Digitalisierung sicherlich nur einen Teil der zu erwartenden disruptiven Entwicklung abdeckt. Auf anderen Gebieten sind ebenso gravierende Fortschritte zu erwarten, etwa in der Genetik, der Medizin, der Raumfahrt oder der Materialtechnik, um nur einige der herausragenden Felder zu nennen. Wollte man alle diese Themen mitberücksichtigen, wäre das vorliegende Werk fünf- oder zehnmal so dick geworden. Konzentrieren wir uns also auf die digitale Disruption.
Andreas Dripke et al.
Digitale Disruption
Die Politik ist sich mit dem größten Teil der Gesellschaft einig, wenn es um das Thema Digitalisierung geht: So schlimm wird es schon nicht kommen. Diese Einstellung verkennt den Unterschied zwischen linearer und exponentieller Entwicklung. Die lineare Betrachtung geht davon aus, dass sich die bisherige Welt Jahr für Jahr in kleinen Schritten voran bewegt. Das Smartphone wird immer etwas besser, der Akku hält immer etwas länger, bei den sozialen Netzwerken kommt immer mal wieder ein neuer Player hinzu. Die Politik überträgt ihre eigene Vorgehensweise der kleinen Schritte in die digitale Welt.
Diese Einstellung ist falsch und fatal. Sie verkennt, dass die digitale Entwicklung exponentiell verläuft und damit disruptiv auf alle Aspekte der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wirkt. Schlimmer noch: Sie ignoriert Machtverschiebungen und damit den Verlust der Macht, selbst zu gestalten.
Der Beruf des Hufschmieds wurde nicht abgelöst, weil sich die Pferde veränderten, sondern weil das Transportwesen mit der Erfindung des Automobils keine Pferde mehr brauchte. Nokia wurde nicht binnen weniger Jahre hinweggefegt, weil Apple die besseren Handys baute, sondern weil Apple grundlegend andere Geräte – Smartphones – auf den Markt brachte. Apple Glass, eine digitale Brille, die auf in den Gläsern eingebauten Minidisplays fortlaufend Informationen einblendet, ohne dass es jemand außer dem Brillenträger bemerkt, hat das Potenzial, eine ähnlich grundlegende Entwicklung wie das iPhone einzuläuten. 11 Bei selbstfahrenden E-Autos beschleicht derzeit viele Menschen eine Ahnung, dass dies zu ebenso disruptiven Veränderungen führen könnte, die eine ganze Branche an den Abgrund führen wird. Doch es wird nicht bei dieser einen Branche bleiben.
Viele Berufsgruppen sind akut gefährdet
Dass die Tage von Fahrern – Bus, Lastwagen, Taxi – sich dem Ende nähern, gilt längst als ausgemacht, weil sie bei selbstfahrenden Autos schlichtweg nicht mehr benötigt werden. Weniger offensichtlich scheint es zu sein, dass Berufe wie Makler, Verwaltungsangestellte, Allgemeinmediziner, Verkäufer, Bankangestellte, Journalisten, Händler oder Anwälte von der Digitalisierung akut gefährdet sind.
Überall dort, wo es um Rollenspiele nach festgelegten Regeln geht, sollte man sich Künstliche Intelligenz vorstellen, nicht wegdenken: Algorithmen statt Sachbearbeiter. Das heißt, der Großteil dieser Tätigkeitsfelder wird künftig von Software mit Künstlicher Intelligenz bearbeitet werden. Es sei beispielhaft auf die Oxford University verwiesen, die schon in einer Studie aus dem Jahr 2017 zu dem Schluss gelangte, dass über alle Branchen hinweg 47 Prozent aller Berufe durch Computer bzw. Software ersetzt werden können. In der Versicherungswirtschaft veranschlagt dieselbe Studie eine „Computerisierbarkeit“ von über 90 Prozent aller Jobs.
Wohlgemerkt: Es wird immer noch Ärzte, Makler oder Anwälte geben – aber deutlich weniger als heute, und mit anderen Kompetenzen, in einem anderen Umfeld und mit anderen Verdienstaussichten. Das World Economic Forum ging in seiner Studie „The Future of Jobs“ bereits 2018 davon aus, dass im Jahr 2025 mehr Aufgaben von Computern und Robotern erledigt werden als von Menschen. Man mag darüber spekulieren, ob es 2025 oder erst 2030 soweit ist, doch dass es dazu kommen wird, gilt als sicher.
Die Mittelschicht wird wegdigitalisiert
Die Digitalisierung wird Millionen von Arbeitsplätzen vor allem in der White-Collar-Schicht – in der Regel die Mittelschicht – betreffen, viele davon für immer vernichten und unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Der Begriff von der „Digitalen Revolution“ ist nicht übertrieben, er beschreibt schlichtweg unsere Zukunft, mit allen – und zwar enormen(!) – Chancen, aber eben auch mit Risiken. Doch die Politik bereitet sich und die Gesellschaft wenig bis gar nicht auf diese Zukunft vor. Die digitale Revolution kommt im Laufe der 2020/30er Jahre ebenso „überraschend“ auf uns zu wie die Viruspandemie 2020 – alle Warnzeichen wurden über Jahre hinweg ignoriert.
In der Pandemie wurden im Frühjahr 2020 in den USA binnen eines Monats mehr Jobs vernichtet, als in den elf Jahren seit der Finanzkrise 2008 neu entstanden waren. Die Arbeitslosenquote schoss inklusive Dunkelziffer auf rund 20 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in die Höhe.12
Ein Großteil dieser Jobs kommt nie mehr zurück, weil die ohnehin anrollende Digitalisierungswelle seit 2020/21 kräftig zugelegt hat. In Deutschland wird dieser Absturz in eine hohe Arbeitslosigkeit bis 2030 sicherlich sozial abgefedert erfolgen. Aber man muss sehr blauäugig sein, um diese Tendenz zu ignorieren. Die Digitalisierung kommt mit Macht. Die wesentlichen Grundlagen hierfür wurden bereits 1968 gelegt – so weit reichen die Wurzeln des Internet zurück.
Digitales Nervensystem um die Welt
Die Erfindung des Computers stellte die Grundlage für die Digitalisierung dar. Doch erst die Vernetzung der Rechner ermöglichte die weltumspannende Digitalisierung wie wir sie heute kennen. Den Schlüssel hierfür bildet das Internet, dessen Wurzeln 1968 gelegt wurden.
Das Internet wurde 1968 geboren
Im Jahr 1968 entwickelte eine kleine Forschergruppe unter der Leitung des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des US-Verteidigungsministeriums ein Advanced Research Projects Agency Network, kurz Arpanet. Ziel war die Errichtung eines Kommunikationsnetzes zwischen allen US-Universitäten, die für das Verteidigungsministerium forschten. Dabei handelte es sich um die University of Utah, die University of California Los Angeles und die University of California Santa Barbara.13
Das Arpanet enthielt von Anfang an die grundlegenden Aspekte und ist damit der direkte Vorläufer des heutigen Internets. Für damalige Verhältnisse war das Arpanet revolutionär, weil es erstmals das Konzept eines dezentralen Netzwerks realisierte. Statt eines zentralen Computers, über den die gesamte Kommunikation läuft, baute das Arpanet auf einem Geflecht von Computern auf. Der entscheidende Vorteil dabei lag in der Dezentralisierung: Wenn einer der Computer ausfällt, bricht nicht etwa das gesamte System zusammen, sondern seine Aufgaben werden automatisch von den anderen Computern übernommen. Die zweite maßgebliche Innovation war die Paketvermittlung. Jeder Datenstrom wird dabei in eine Vielzahl kleiner Datenpakete zerlegt, bevor er übertragen wird. So ist es möglich, dass beim Ausfall eines Computers die Datenpakete einfach über einen anderen Weg – also über andere Computer – ans Ziel übermittelt werden. Genau so funktioniert das Internet im Prinzip heute noch. Alle Daten werden in kleine Pakete zerlegt und finden ihren Weg zum Ziel über ein Netzwerk mit einer Vielzahl von Computern dazwischen. Natürlich sind die Internetknoten mittlerweile um ein Vielfaches leistungsfähiger. Auch die damalige Übertragung im Arpanet über Telefonleitungen mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Kbit pro Sekunde hat längst ein Ende gefunden.
Das Arpanet wurde am 28. Februar 1990 stillgelegt, doch es hat unsere Welt für immer verändert. Die dezentrale Netzstruktur, verbunden mit der Paketvermittlung der Daten, machten das Arpanet außerordentlich robust gegen Ausfälle einzelner Computer oder Datenleitungen. Selbst der Ausfall ganzer Teilnetze würde die Funktionalität der verbleibenden Netzinfrastruktur nicht lahmlegen. Das führte schon frühzeitig zu der Spekulation, dass das US-Verteidigungsministerium mit dem Arpanet eine Kommunikationsstruktur schaffen wollte, die selbst im Falle eines Atomkriegs noch funktionieren würde. Ob das richtig ist oder nur Spekulation, ließ sich im Nachhinein nicht mehr genau feststellen. Aber es ist eine sehr plausible Geschichte und vermutlich stimmt sie. Es gibt nämlich eine Studie der RAND Corporation („Research AND Development), einer US-Denkfabrik, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 14. Mai 1948 gegründet wurde, um die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zu beraten, die genau dieses Szenario anschaulich beschreibt. Die RAND-Organisation gibt es übrigens heute noch mit immerhin 1.600 Beschäftigten.
Auf jeden Fall lässt sich mit Fug und Recht behaupten, das heutige Internet entstand aus der Militärforschung der Vereinigten Staaten von Amerika. Übrigens markierte der 1. Januar 1983 den Übergang vom Arpanet auf das Internet, denn bis zu diesem Stichtag waren alle Netzwerkrechner auf das Internet Protokoll umgestellt. Mit dem 1984 entwickelten „Domain Name System“ (DNS) wurde es erstmals möglich, sämtliche Rechner im Netz mit Namen zu versehen, denn zuvor waren sie ausschließlich über – unübersichtliche – Ziffernkombinationen erreichbar. Im Jahr 1990 verkündete die US-staatliche National Science Foundation, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar machen zu wollen. Am 6. August 1991 veröffentlichte das Schweizer CERN – die Europäische Organisation für Kernforschung – die Grundlagen des World Wide Web, wie wir es heute täglich nutzen, wenn wir „www“ eintippen.14 Rasanten Auftrieb erhielt das Internet jedoch bereits, als im Jahr 1983 der erste grafikfähige Webbrowser mit Namen Mosaic angeboten wurde.
Heute lässt sich feststellen, dass das Internet die größte Veränderung des Informationswesens seit Erfindung des Buchdrucks herbei geführt hat. Im Jahr 2013 erklärte der Bundesgerichtshof, das Internet gehöre zur Lebensgrundlage von Privatpersonen.15 Parallel dazu entstand die Vorstellung des Internets als eine Art „rechtsfreier Raum“. Das ist es natürlich nicht, schließlich gilt das jeweilige nationale Recht, aber in der Tat führt die globale Struktur und die Anonymität des Internets den Gesetzgebern überall auf der Welt vor Augen, wie schwer es ist, in einem globalen Netz nationale Gesetze durchzusetzen. Hinzu kommt, viele Regierungen und Parlamente – und das darf man getrost auch für Deutschland behaupten – bemerkten sehr lange (und vielleicht zu lange) die Bedeutung des Internets überhaupt nicht. Nicht so in den USA: Die amerikanischen Behörden erkannten offenbar sehr früh, welche geradezu gigantischen Möglichkeiten ihnen das Internet bietet, um sich weltweit durchzusetzen.
Das Internet gehört uns allen
Die Vorreiterrolle der Vereinigten Staaten von Amerika bei der Nutzung des Internet hängt unmittelbar damit zusammen, dass die USA das Internet lange Zeit beherrschten. Dies war sowohl anderen Staaten als auch Teilen der globalen Zivilgesellschaft schon längst ein Dorn im Auge. Lange bevor durch die Enthüllungen von Edward Snowden 2013 der ganzen Welt klar wurde, wie rücksichtslos die USA ihre digitale Vormachtstellung missbrauchten, entwickelte sich die Vision eines „All Nations Internet“, also eines Internets aller Nationen.
Das Diplomatic Council, die „Denkfabrik“, in dem das vorliegende Werk erschienen ist, hat diese Entwicklung in fünf Punkten zusammengefasst und das „Internet aller Nationen“ wie folgt manifestiert:
Das Internet gehört allen Menschen überall auf der Welt. Jedermann hat das Recht auf den Zugang zu Informationen und zur Bereitstellung von Informationen im Internet, soweit dadurch die Rechte anderer nicht verletzt werden.
Die in der Charta der Vereinten Nationen festgeschriebenen Menschenrechte gelten immer und unveränderlich im Internet wie in der realen Welt.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit gilt länderübergreifend und uneingeschränkt im Internet, soweit dadurch die Rechte anderer nicht verletzt werden.
Das Recht auf eine Privatsphäre gilt unverrückbar im Internet. Es ist die Aufgabe der Staatengemeinschaft, dieses Recht dauerhaft zu schützen.
Alle Menschen und alle Staaten haben gleiche Rechte, sich an der Weiterentwicklung des Internets zu beteiligen.
Nun handelt es sich beim Internet um ein weitverzweigtes, diffiziles technisches Gebilde, das nicht so ohne Weiteres einem Staat entrissen und der Staatengemeinschaft oder Zivilbevölkerung übertragen werden konnte. Außerdem gewann das Internet mittlerweile eine derart umfassende Bedeutung, dass der reibungslosen Aufrechterhaltung der technischen Infrastruktur höchste Priorität zukommt, sogar noch vor der Ablösung von den USA. Vor diesem Hintergrund fordert das Diplomatic Council alle beteiligten Parteien („Stakeholder“) auf, das Internet gemäß folgenden Maßgaben weiter zu entwickeln:
Die Innovationskraft, die überhaupt erst zur Existenz des Internets in der heutigen Form führte, soll gefördert werden, um ein „Internet der Innovationen“ zu erhalten. Die Internet Governance muss weiterhin genehmigungsfrei Innovationen und Investitionen durch alle Beteiligte überall auf der Welt zulassen.
Das Internet muss ein weltweit einheitlicher Kommunikationsraum bleiben, in dem jeder mit jedem Informationen austauschen kann („end-to-end“), unabhängig vom Inhalt der Kommunikation, solange diese legal ist im Sinne der Charta der Vereinten Nationen. Die weltweite Kohärenz und Skalierbarkeit sowie der weltweit ungehinderte Informationsfluss stellen dafür wesentliche Voraussetzungen dar.
Die Sicherheit und Stabilität der Infrastruktur bilden die Grundlage für jedwede Zuverlässigkeit im Internet. Jede Weiterentwicklung darf die technische Funktionalität nicht gefährden. Vielmehr sind alle Beteiligten zur engen Zusammenarbeit aufgefordert, um diese Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.
Bei der Weiterentwicklung des Internets etwa durch neue Technologien, Angebote und Nutzungsmöglichkeiten muss der Grundsatz einer offenen und dezentralen Architektur unverrückbar erhalten bleiben (Netzneutralität).
Das Internet war niemals und darf niemals ein rechtsfreier Raum sein. Die Nutzung der mit dem Internet einhergehenden grenzüberschreitenden Kommunikation für Verbrechen muss in der internationalen Kooperation der Staaten und ihrer legitimen Gewalten bekämpft werden.
Wer im Internet etwas zu sagen hat
Regelungen für Internet Governance, also der Frage, wer im Internet etwas zu sagen hat, waren über Jahre hinweg die Themen einer teilweise hitzigen internationalen Debatte zwischen vielen unterschiedlichen Interessenvertretern. Lange Zeit gab es keine einheitliche Auffassung darüber, wie die Internet Governance international gehandhabt werden sollte.16
Im Kern ging es dabei um die Frage, wer die Aufsichtsfunktion über zentrale Ressourcen im Internet besitzt.
Während die Struktur des Internets grundsätzlich dezentral und nicht-hierarchisch angelegt ist, gibt es eine Ausnahme davon: Das Domain Name System (DNS), das strikt hierarchisch in einer Art Baumstruktur aufgebaut ist. Im DNS wird festgelegt, wie Internetnamen wie z. B. www.diplomatic-council.org in ihre Internet Protokoll (IP)-Adressen übersetzt werden. Die Verwaltung dieses DNS-Systems obliegt seit 1998 der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die aufgrund eines Memorandums of Understanding mit dem amerikanischen Handelsministerium unter kalifornischem Recht registriert ist. Bis 30. September 2016 durften Änderungen an den DNS-Einträgen nur mit Genehmigung des US-Handelsministeriums vorgenommen werden. Viele Länder meldeten Bedenken dagegen an, da Änderungen an ihren Länder-Domainnamen wie beispielsweise „de“ für Deutschland oder „.cn“ für China von der dazu erteilten Zustimmung der amerikanischen Regierung abhängig sind.
Die US-Regierung verpflichtete sich daher im Jahre 2005, keine Aktionen zu unternehmen, die einen nachteiligen Effekt auf das Internet haben, und zwar mit der Anerkennung und Begründung der Bedeutung des Internets für die Weltwirtschaft. Die USA erkannten die legitimen Interessen anderer Regierungen in Bezug auf das Management ihrer Länder-Domainnamen an und verpflichteten sich diesbezüglich zur Zusammenarbeit mit der internationalen Staatengemeinschaft. Im Kern lief dies allerdings auf die unveränderte und alleinige Führungsrolle der USA zur Kontrolle und Weiterentwicklung des Internets hinaus.
Für die Länder der Europäischen Union ebenso wie für viele Entwicklungs- und Schwellenländer war diese Position nicht tragbar. Daher legte die Europäische Union im September 2005 ein Diskussionspapier vor, das eine internationale Aufsicht über wesentliche Ressourcen des Internets vorsieht. Im Juni 2006 wurde vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ein sogenanntes Internet Governance Forum (IGF) einberufen. Im März 2016 einigten sich die Gremien auf ein Modell für die Weiterführung durch die ICANN ohne Aufsicht der US-amerikanischen Regierung.
Damit war ein fundamentaler Schritt auf dem Weg zu einem wirklich globalen Internet getan. Wird es die USA davon abhalten, das Internet weiterhin für ihre Zwecke zu missbrauchen? – wohl eher nicht! Pessimisten vertreten sogar die Auffassung, dass es jetzt für alle Staaten leichter geworden ist, das Internet für ihre – sagen wir nicht immer – guten Zwecke noch besser als bisher zu nutzen.
USA: Die Daten im Internet gehören uns
Wie wenig die Vereinigten Staaten von Amerika gewillt sind, das Internet der internationalen Staatengemeinschaft zu überlassen, zeigt die US-Gesetzgebung der letzten Jahre. Nach den Attentaten am 11. September 2001 (9/11) beschloss der US-Kongress unter Präsident George W. Bush unter der Bezeichnung Patriot Act umfassende Maßnahmen zur Terrorbekämpfung.17 Weite Teile davon sind nie mehr zurückgenommen worden bzw. wurden nach dem Auslaufen unmittelbar durch den US Freedom Act unter US-Präsident Barack Obama ersetzt.18 Seitdem dürfen US-Behörden, in erster Linie die Geheimdienste, die Telefon- und Internetkommunikation weitgehend ungehemmt überwachen. Der zuständige Richter muss zwar von einer Überwachung informiert werden, ist jedoch verpflichtet, die entsprechende Abhöraktion zu genehmigen. Telefongesellschaften und Internetprovider müssen ihre Daten offenlegen. Das FBI hat zudem seitdem das Recht, Einsicht in die finanziellen Daten von Bankkunden zu nehmen, ohne dass Beweise für ein Verbrechen vorliegen. Hausdurchsuchungen dürfen mittels Patriot Act ohne Wissen der betreffenden Person durchgeführt werden. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA, der im Gegensatz zum FBI keiner weitreichenden öffentlichen Kontrolle unterliegt, hat seit 9/11 das Recht, auch im Inland zu ermitteln. Doch am bemerkenswertesten an den Terrorfolgen vom 11. September 2001 war, dass sich die US-Regierung mit dem Patriot Act nicht nur mehr Rechte der eigenen Bevölkerung gegenüber herausnahm, sondern gegenüber der Weltbevölkerung rund um den Globus. Man könnte auch überspitzt formulieren: Die US-Regierung hat sich den Terror zunutze gemacht, um sich selbst eine digitale Weltherrschaft einzuräumen.