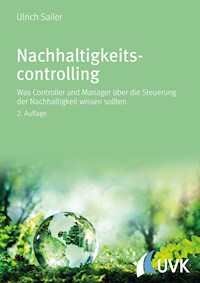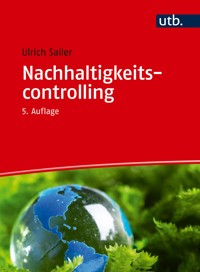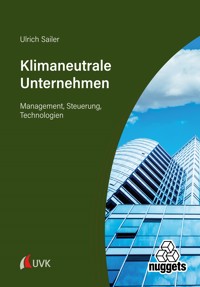49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt ist ein fundiertes Verständnis des digitalen Controllings unerlässlich für nachhaltigen Erfolg. Dieses Lehrbuch bietet einen umfassenden und praxisnahen Einblick in die effektive Nutzung der Digitalisierung im Controlling. Ausgehend vom aktuellen Umsetzungsstand in der Controllingpraxis werden die vielfältigen Handlungsfelder des digitalen Controllings detailliert beleuchtet und Wege aufgezeigt, wie die enormen Potenziale der Digitalisierung im Controlling ausgeschöpft werden können. Das Buch liefert einen fundierten und praxisnahen Überblick über zentrale Technologien und Methoden – von Business Intelligence und Cloud-Computing bis zu generativer Künstlicher Intelligenz. Es wird anschaulich dargestellt, wie diese im Controlling konkret eingesetzt werden können, ohne dass dafür tiefgreifende IT- oder Data-Science-Kenntnisse erforderlich sind. Von der Digitalisierung von Daten und Controllingprozessen über Self-Service-Reporting bis hin zu Predictive Planning und Machine Learning deckt das Buch alle relevanten Handlungsfelder ab und bietet innovative Lösungsmöglichkeiten und bewährte Vorgehensweisen. Die klare und wiederkehrende Struktur mit einer didaktisch übersichtlichen Aufbereitung macht die Inhalte sowohl für Studierende als auch für Praktiker:innen leicht zugänglich und verständlich. Anhand konkreter Digitalisierungsprojekte werden Herausforderungen, Erfolge und Learnings veranschaulicht, wodurch Leser:innen wertvolle Erkenntnisse für eigene Controlling-Projekte gewinnen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumVorwort1 Handlungsfelder des digitalen Controllings1.1 Digitale Transformation1.2 Digitales Controlling1.3 Handlungsfelder des digitalen Controllings1.4 Best Practices – Interview mit Maximilian Laturnus, Paul Hartmann AG2 Stand der Digitalisierung im Controlling2.1 Studien zum Stand der Digitalisierung im Controlling2.2 Ergebnisse des Status Monitoring2.3 Best Practices – Interview mit einer Leiterin Konzerncontrolling 3 Digitalisierung der Daten3.1 Datentypen3.2 Datenstrategie3.3 Datenkultur3.4 Data Literacy3.5 Datenprodukte3.6 Best Practices – Interview mit einem Director Controlling4 Business-Intelligence-Systeme4.1 Grundlagen der BI-Systeme4.2 BI-Prozess und Schichtenmodell4.3 BI-Tools4.4 Praktische Anwendung und Herausforderungen4.5 Best Practices – Interview mit Dr. Goran Sejdic, TRUMPF SE + Co. KG 5 Cloud-Computing5.1 Begriff und Inhalte des Cloud-Computings5.2 Cloud-Computing im Controlling5.3 Best Practices – Interview mit Daniel Meier und Gabriel Fechir, DYMATRIX GmbH 6 Digitalisierung von Controllingprozessen6.1 Prozess- und Workflow-Management6.2 Prozessanalyse: Process Mining und Task Mining6.3 Methoden der Prozessautomatisierung6.4 Robotic Process Automation6.5 Best Practices – Interview mit Malte Horstmann, OMM Solutions GmbH7 Self-Service-Reporting und Visual Analytics7.1 Grundlagen des Reportings7.2 Self-Service-Reporting7.3 Data Storytelling7.4 Visual Analytics7.5 Best Practices – Interview mit Kai-Uwe Stahl, reportingimpulse GmbH8 Shared Service Center und Reporting Factories8.1 Center-Konzepte im Controlling8.2 Reporting Factory8.3 Best Practices – Interview mit Dr. Goran Sejdic, TRUMPF SE + Co. KG 9 Predictive Planning9.1 Planung in einem dynamischen Umfeld9.2 Bausteine des Predictive Planning9.3 Best Practices – Interview mit Niko Hofmann, Horváth & Partners 10 Business Analytics und Machine Learning10.1 Grundlagen Künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens10.2 Business Analytics praktisch umsetzen10.3 Methoden des Machine Learning und deren Anwendung im Controlling10.4 Forecasting durch Predictive Analytics10.5 Best Practices – Interview mit Prof. Dr. Sebastian Moll, HfWU Nürtingen-Geislingen11 Generative KI11.1 Generative KI im Controlling: Aktueller Stand11.2 Grundlagen der Sprachmodelle11.3 Optimierung von Sprachmodellen11.4 Anwendung generativer KI im Controlling11.5 Herausforderungen und Zukunftsaussichten11.6 Best Practices – Interview mit Prof. Dr. Mathias Engel, HfWU Nürtingen-Geislingen 12 Kompetenzen und Kultur12.1 Zunehmende Anforderungen an den Controller12.2 Welche Kompetenzen benötigt der Controller?12.2.1 Fachwissen – Die Kernkompetenzen des Controllers12.2.2 Management – Die unternehmerischen Kenntnisse des Controllers12.2.3 Daten und Technologien – Das technologische Know-how des Controllers12.2.4 Data Science – Analytische und KI-Kompetenzen des Controllers12.2.5 Soft Skills – Persönliche und soziale Kompetenzen des Controllers12.3 Rollenprofile und der T-shaped, N-shaped und M-shaped Controller12.4 Kulturwandel im Controlling12.5 Best Practices – Interview mit Katja de Groot-Altrichter, Victorinox AG13 Data und KI-Governance13.1 Data Governance als Fundament des digitalen Controllings13.2 KI-Governance zur Steuerung und Kontrolle der KI im Controlling13.3 Best Practices – Interview mit Andrea Wuchner, Fraunhofer IRB Der AutorStichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6243-3
Bestell-Nr. 11484-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-6244-0
Bestell-Nr. 11484-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6245-7
Bestell-Nr. 11484-0150
Ulrich Sailer
Digitales Controlling
1. Auflage, August 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © KI-generiert mit Sora by OpenAI
Produktmanagement: Nora Valussi
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Vorwort
Controlling befindet sich im Wandel – sichtbar, dynamisch und unumkehrbar. Neue Technologien, datenbasierte Prozesse und KI-gestützte Systeme verändern nicht nur die eingesetzten Werkzeuge, sondern auch die Anforderungen an die Rolle und die Kompetenzen des Controllers. Wer heute im Controlling tätig ist – oder morgen Verantwortung übernimmt –, benötigt mehr als klassische Methodenkenntnis und Kennzahlenverständnis. Gefragt ist ein digitales Mindset, das Chancen erkennt, technologische Trends aufgreift, Strukturen hinterfragt und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beiträgt.
Dieses Buch richtet sich an Controller in der Praxis ebenso wie an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, die sich auf ein modernes, technologiegeprägtes Arbeitsumfeld vorbereiten möchten. Es bietet einen fundierten, praxisnahen Überblick über zentrale Technologien – von Business Intelligence und Cloud-Computing bis hin zu generativer Künstlicher Intelligenz – und zeigt, wie diese im Controlling konkret eingesetzt werden können, ohne dass dafür tiefgehende IT- oder Data-Science-Kenntnisse erforderlich sind. Zur Stärkung der praktischen Relevanz enthält jedes Kapitel ein Interview mit einem Controllingpraktiker oder einem Experten aus Beratung oder Wissenschaft. Mein herzlicher Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und -partnern für ihre wertvollen Beiträge.
Im Mittelpunkt steht kein theoretisches Zukunftsszenario, sondern das, was bereits heute möglich und relevant ist – mit praxisorientierten Konzepten, bewährten Methoden und einem klaren Fokus auf Umsetzbarkeit.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch das generische Maskulinum verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Imke Keimer von der Hochschule Luzern, die das zwölfte Kapitel zu Kompetenzen und Kultur verfasst hat.
Ein weiterer Dank geht an Nora Valussi, Petra Bandl und Dr. Angelika Schulz, Projektmanagerinnen beim Schäffer-Poeschel Verlag, für die sehr angenehme und professionelle Zusammenarbeit.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und viele Impulse für die eigene Controllingpraxis.
Über Fragen, Kritik und Anmerkungen zu diesem Buch freue ich mich – schreiben Sie mir gerne.
Ulrich Sailer
Prof. Dr. Ulrich Sailer
Professor für Controlling und Nachhaltigkeit
Leiter des Masterstudiengangs Controlling
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Sigmaringer Str. 25
72622 Nürtingen
www.hfwu.de
1 Handlungsfelder des digitalen Controllings
Leitfragen
Wie lässt sich die Digitalisierung in die Entwicklung des Controllings einordnen?
Was versteht man unter einem digitalisierten Controlling? Worin unterscheidet es sich vom traditionellen Controlling?
Welche Themenfelder und Inhalte sind bei der Digitalisierung des Controllings besonders relevant?
Welche wechselseitigen Abhängigkeiten bestehen zwischen den einzelnen Handlungsfeldern des digitalen Controllings?
Definitionen
Controlling
»Controlling ist ein Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems, dessen Hauptaufgabe die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche ist. Im Controlling laufen die Daten des Rechnungswesens und anderer Quellen zusammen.« (Weber 2019)
Digitalisierung
»Digitalisierung bedeutet die Verwendung von Daten und algorithmischen Systemen für neue oder verbesserte Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle.« (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz o. J.)
Digitales Controlling
Digitales Controlling nutzt digitale Technologien, um einen größtmöglichen Wertbeitrag des Controllings zu generieren.
Digitale Transformation
»Der Begriff Digitale TransformationDigitale Transformation bezeichnet erhebliche aktive Veränderungen des Alltagslebens, der Wirtschaft und der Gesellschaft durch die Verwendung digitaler Technologien und Techniken sowie deren Auswirkungen.« (Lexikon der Wirtschaftsinformatik 2019)
Industrie 4.0
»Industrie 4.0Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikation
stechnologie.« (Plattform Industrie 4.0 2019)
1.2 Digitales Controlling
Das Controlling hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel vollzogen – sowohl in seiner Rolle innerhalb des Unternehmens als auch in Bezug auf eingesetzte Methoden und Werkzeuge. Längst genügt es nicht mehr, ausschließlich als Zahlenlieferant zu agieren. Gefordert ist heute die RolleRolle des Business Partners, Business Partnerder eng mit dem Management zusammenarbeitet und aktiv an der Steuerung des Unternehmens mitwirkt. Die Digitalisierung beschleunigt diesen Wandel: Effizienzgewinne durch automatisierte Prozesse schaffen Freiräume für das Business Partnering, und die verbesserte Nutzung von Daten erhöht den Wertbeitrag des Controllings – zugleich aber auch die fachlichen und methodischen Anforderungen an Controller.
Controlling umfasst nach Definition des Internationalen Controller Vereins (ICV) den gesamten Prozess der Zielfestlegung, Planung und Steuerung. Dabei geht es nicht ausschließlich um finanzielle Kennzahlen aus dem Rechnungswesen, sondern ebenso um leistungswirtschaftliche Daten, die für die Steuerung des Unternehmens relevant sind. Die enge Verbindung des Controllings mit Daten führt zwangsläufig dazu, dass Informationstechnologie und spezialisierte Softwarelösungen zu zentralen Arbeitsmitteln der Controller werden.
Entwicklung hin zum digitalisierten Controlling
In den Zeiten zentraler Großrechner bestand eine starke Abhängigkeit des Controllings von der IT-Abteilung, insbesondere von deren verfügbaren Kapazitäten. Sämtliche Änderungswünsche mussten durch Experten der IT-Abteilung bearbeitet werden, wodurch eigene Gestaltungsspielräume im Controlling noch sehr begrenzt waren. Erst mit der Verbreitung personalisierter Computer ab den 1980er-Jahren eröffneten sich neue Möglichkeiten: Controller konnten neben den zentralen Softwarelösungen nun auch eigene Bearbeitungen vornehmen. Mit der Einführung der ersten grafischen Benutzeroberfläche durch Microsoft Windows 3.0 konnte sich das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft ExcelExcel, dezentral nutzbar auf PCs, rasch etablieren. Excel wurde von vielen Controllern als Befreiung von der Abhängigkeit zentraler IT-Strukturen empfunden. Nun konnten flexibel anspruchsvolle Datenanalysen und Berechnungen durchgeführt werden. Die Berichtserstellung wurde technisch unterstützt, einfache Simulationen und Prognosen ermöglicht. Bis heute spielt Excel in kleinen wie großen Unternehmen eine zentrale Rolle. Die Anwendung erlaubte eine Individualisierung und Flexibilisierung des Controllings, gleichzeitig zeigen sich jedoch auch Nachteile im praktischen Einsatz. Bei sehr großen Datensätzen stößt die Leistungsfähigkeit an Grenzen, manuell eingegebene Formeln sind fehleranfällig, Änderungen sind schwer nachvollziehbar. Das Fehlerpotenzial bei zeitgleicher Bearbeitung von Dateien sowie die zeitaufwendige Aktualisierung von Dateien, insbesondere bei Veränderungen in den Datenquellen, stellen weitere Schwächen dar.
ExcelEtwa zeitgleich mit der Verbreitung von Excel führten Unternehmen zunehmendERPERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) ein, wodurch Daten aus unterschiedlichen Funktionsbereichen in die Controllingprozesse integriert werden konnten. Planung und Reporting wurden hierdurch nicht nur umfangreicher, sondern auch effizienter. Im Laufe der 1990er-Jahre wurden die ersten BI-ToolsBI-Tool (Business IntelligenceBusiness Intelligence) eingeführt. Auch Excel bietet einige grundlegende BI-Funktionalitäten wie die Datenaufbereitung, Analysen und Visualisierungen. Durch Erweiterungen wie Power Pivot, Power Query oder Power BIPower BI kann Excel mittlerweile jedoch recht umfangreich BI-Anforderungen erfüllen. Ein Schwerpunkt von Excel liegt insbesondere bei individuellen Analysen und Berichten.
Leistungsfähige BI-Tools integrieren Daten aus unterschiedlichen Quellen, ermöglichen fortgeschrittene Analysen und unterstützen die Überwachung der Unternehmensleistung. Dabei gehen die Auswertungen über rein rückblickende Betrachtungen hinaus: Aus historischen Daten lassen sich Muster ableiten, die für Prognosen und Szenarien genutzt werden können. Zudem bieten moderne BI-Systeme eine weitgehend automatisierte Berichtserstellung – einschließlich Dashboards und Self-Service-Funktionalitäten, die dem Management entscheidungsrelevante Informationen in visualisierter Form bereitstellen. Skalierbare und leistungsstarke BI-Tools bilden damit heute das technologische Rückgrat des Controllings.
Seit den 2010er-Jahren wird die Entwicklung des Controllings maßgeblich durch technologische Fortschritte wie Cloud-Lösungen, Big Data und die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten beeinflusst. CloudCloud-Technologien ermöglichen den orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf Daten und Analysewerkzeuge. Sie sind flexibel skalierbar und reduzieren die Kosten für Aufbau und Wartung eigener IT-Infrastrukturen erheblich. Gleichzeitig werden zahlreiche Routinetätigkeiten – von der Datenintegration bis zur Berichtserstellung – automatisiert. Dadurch steigt nicht nur die Effizienz im Controlling, sondern auch die Reaktionsfähigkeit des Managements durch den schnellen Zugriff auf aktuelle Informationen.
Artificial Intelligence (AI)/Künstliche Intelligenz (KI)Mit Big Data, Cloud-Lösungen und zunehmenden Rechenleistungen hielt auch die Künstliche Intelligenz (KI) Einzug in die Unternehmen. Das Controlling gehörte jedoch nicht zu den frühen Anwendungsbereichen der KI. Zu den Vorreitern zählten vielmehr die Produktion, um Prozesse zu optimieren und die Qualität zu sichern, wie auch Marketing und Vertrieb, um das Kundenverhalten zu analysieren und Verkaufsvorhersagen zu treffen. Im Kundenservice wurden Chatbots eingesetzt und in der Entwicklung wurden mit KI große Datenmengen analysiert. Die frühe Nutzung der KI bezog sich insbesondere auf regelbasierte Systeme. Es bestehen klare, vordefinierte Regeln, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden. Später gewann Machine Learning (ML) Machine Learningan Bedeutung. Dabei werden nicht nur vorgegebene Regeln angewendet, sondern es werden aus Daten Muster und damit Regeln erlernt. Diese können für PrognosePrognosen, für Klassifikationen oder für die Erkennung von Anomalien genutzt werden. Für das Controlling sind besonders KI-gestützte Prognosen im Rahmen von Predictive Analytics von hoher Relevanz. Durch die Einbindung einer Vielzahl an Daten lassen sich weitgehend automatisiert Vorhersagen erstellen, die zumeist genauer sind als manuell erstellte Prognosen. Folglich wurden Forecasts für die Unternehmenssteuerung in den letzten Jahren immer wichtiger.
Generative KISeit wenigen Jahren hält die generative KI Einzug im Controlling. Basierend auf Deep LearningDeep Learning erweitert sie die Mustererkennung in den Daten um die Fähigkeit, neue Inhalte zu generieren. Hieraus entstehen beeindruckende Ergebnisse, wie sie etwa durch ChatGPT einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden sind. Die generative KI wird im Controlling beispielsweise für Chatbots genutzt, es werden automatisch Dokumente wie Berichte und Präsentationen generiert, es können Daten vervollständigt und simuliert werden und es können Analysen, statistische Auswertungen und Prognosen erstellt werden.
Die Digitalisierung des Controllings ist kein einmaliges Projekt, sondern eine kontinuierliche Herausforderung, die von hoher Dynamik geprägt ist. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich diese Entwicklung in absehbarer Zeit verlangsamen wird. Daher muss das Controlling dauerhaft so aufgestellt sein, dass digitale Chancen aktiv genutzt und potenzielle Risiken beherrscht werden können. Das erfordert entsprechende Kompetenzen, Ressourcen und eine hohe Lernbereitschaft im Umgang mit neuen Technologien. Gerade im Kontext der KI bestehen vielerorts noch Unsicherheiten und begrenzte Erfahrungswerte. Gleichzeitig ist das Interesse an der praktischen Nutzung groß – viele Controller suchen daher gezielt nach Lösungen und bewährten Vorgehensweisen. Besonders hilfreich sind in diesem Zusammenhang die Erfahrungen anderer Unternehmen, wie sie in praxisnahen Fachzeitschriften, Online-Beiträgen oder auf Konferenzen geteilt werden. Wertvolle Impulse bietet dabei auch der persönliche Austausch in Controllingnetzwerken und auf spezialisierten Plattformen.
Netzwerk Digitales Controlling
Im Jahr 2020 initiierte der Verfasser gemeinsam mit zehn größeren Unternehmen das Netzwerk Digitales Controlling, das mittlerweile auf über 30 Mitglieder angewachsen ist. In regelmäßigen Online-Treffen findet ein praxisorientierter Austausch zu vielfältigen Aspekten der Digitalisierung im Controlling statt. Die Themen entstehen direkt aus dem Arbeitsalltag der teilnehmenden Controller. Experten aus dem Netzwerk sowie externe Fachleute bringen Transparenz in digitale Konzepte, berichten über eigene Projekte und gewähren Einblicke in ihre Lösungsansätze – mit dem klaren Ziel des gegenseitigen Lernens.
Bei den ersten Netzwerktreffen stellte sich rasch die Frage nach den Inhalten eines digitalisierten Controllings. Wie der kurze zeitliche Abriss zuvor gezeigt hat, war das Controlling auf verschiedenen Ebenen seit jeher digital. Daher galt es zunächst, jene Themen zu identifizieren, die in der Controllingpraxis für die zukünftige Digitalisierung besonders relevant sind. Dabei wurden rasch auch die gegenseitigen Abhängigkeiten der einzelnen Themenfelder deutlich. Daraus entstand das Framework des digitalen Controllings, das in den Folgejahren kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst wurde. Das Framework ist in Abbildung 3 dargestellt. Der Aufbau und die Handlungsfelder werden im Folgenden erläutert.
Abb. 3:
Framework des digitalen Controllings (Quelle: eigene Abbildung)
1.3 Handlungsfelder des digitalen Controllings
Das Framework des digitalen Controllings besteht aus drei Segmenten: dem Fundament, den Säulen und dem Dach.
Das Dach
Das Dach »Digitales Controlling« steht über sämtlichen Handlungsfeldern. Es gibt die Inhalte, den Umfang und das Ausmaß der Digitalisierung vor. Es umfasst die Digitalisierungsstrategie und legt damit den grundsätzlichen Weg zur Digitalisierung des Controllings fest (vgl. Laturnus/Sailer 2020, S. 54 ff.; Sailer 2025, S. 6 ff.).
Das Fundament
Die vier Handlungsfelder, die das Fundament bilden, sind die Grundlage für die Digitalisierung des Controllings. Sie müssen solide ausgeprägt sein, um die einzelnen Maßnahmen zur Digitalisierung des Controllings – die Säulen – zu tragen. Mängel, wie eine schlechte Datenqualität, fehlende Kompetenzen oder eine zweifelhafte Umsetzung des Datenschutzes, erschweren die Nutzung von BI-Tools, behindern die automatisierte Erstellung von Forecasts oder führen zu fehlerhaften Datenanalysen. Data Governance Data Governanceschafft den Rahmen, wie Daten im Unternehmen genutzt werden. Richtlinien, Verfahren und Verantwortlichkeiten sollen zu verlässlichen, konsistenten und sicheren Daten führen. Data Governance befasst sich somit auf einer strategischen Ebene mit dem Umgang mit Daten. Datenmanagement Datenmanagementist hingegen stärker auf der operativen und technischen Ebene anzusiedeln, wie der Erfassung, Bereinigung und Speicherung von Daten. Data Governance und ein wirksames Datenmanagement sind die Basis einer datengesteuerten Organisation.
Digitale KompetenzWeitere Bestandteile des Fundaments sind digitale Kompetenzen und Kultur. KompetenzEine digitale KulturKultur eines Unternehmens umfasst die Werte, Praktiken und Normen bezüglich der Nutzung digitaler Technologien im Arbeitsalltag. Sie zeichnet sich durch Kollaboration, Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit aus und ist somit offen gegenüber neuen Technologien und digitalen Innovationen. Digitale Kompetenzen umfassen die Fähigkeiten und das Wissen einzelner Personen über die effektive Nutzung digitaler Technologien. Hierzu gehören der souveräne Umgang mit Software und digitalen Medien, Fähigkeiten zur Datenanalyse und Kenntnisse zur Künstlichen Intelligenz.
Cloud-Computing Cloudist eine technische Basis für die Digitalisierung des Controllings. Die Speicherung der Daten und die Nutzung von Software erfolgen über das Internet, also über die Cloud. Unternehmen greifen flexibel und leicht skalierbar auf diese Ressourcen zurück, ohne eigene physische Server zu beschaffen und Software auf eigenen Rechnern zu installieren. Damit stehen überall stets aktuelle Daten und Software-Tools zur Verfügung. Unternehmen können sich auf die Nutzung der Daten fokussieren, anstatt sich um die IT-Infrastruktur zu kümmern.
Die Säulen
Zwischen Fundament und Dach verortet das Framework die tragenden Säulen. Sie repräsentieren zentrale Tätigkeiten, Technologien und Konzepte, die maßgeblich zur digitalen Ausgestaltung der Controllingfunktion beitragen. Hierzu gehören die BI-Systeme. Diese sind ein Werkzeug des Datenmanagements, da Daten gesammelt und gespeichert werden. Sie bieten aber zusätzlich Möglichkeiten zur Analyse der Daten, erlauben den Zugriff auf Echtzeitdaten und enthalten Funktionalitäten zur Erstellung von Berichten.
Effizienzvorteile ergeben sich insbesondere durch Prozessautomatisierungen. Prozessautomatisierung Hierbei ist das Process MiningProcess Mining zu nennen, bei dem automatisiert Geschäftsprozesse aufgedeckt und visualisiert werden. Bedeutsam sind zudem die Robotic Process Automation (RPA)Robotic Process Automation (RPA), bei dem Software-Roboter, sogenannte Bots, repetitive manuelle Tätigkeiten übernehmen und somit Prozesse automatisieren. Daneben gewinnen in den letzten Jahren zunehmend weitere Automatisierungs-Tools an Bedeutung, wie etwa Microsoft Power Automate, Power Query oder Excel Macros.
ReportingEinen großen Leidensdruck verspüren viele Controller beim Reporting. Es handelt sich einerseits um eine zeitintensive Tätigkeit, andererseits zeigen sich Manager oftmals unzufrieden mit der Informationsversorgung. In den letzten Jahren haben daher zahlreiche Unternehmen von PDF-Berichten auf Dashboards umgestellt, in denen der Nutzer in einem vorgegebenen Umfang eigene Analysen vornehmen kann. Man spricht hierbei von Self-Service-Reporting.Self-Service
Ein weiterer Trend im Reporting ist die Zentralisierung der Berichtserstellung. Größere Unternehmen gehen zum Teil so weit, dass sie die Erstellung von Standardberichten konzernweit in sogenannten Reporting Factories zentralisieren. Neben Effizienzvorteilen kann durch einheitliche Standards und Kontrollen auch die Qualität gesteigert werden.
Eine zeitintensive Tätigkeit der Controller ist die Planung, insbesondere die operative Planung bzw. Budgetierung. Gerade in Zeiten vermehrter Unsicherheit gerät diese jedoch zunehmend in die Kritik. Ein ForecastForecast kann als Ausblick für die Erstellung von Plänen genutzt werden. Steuerungsimpulse, die sich aus einem Plan-Ist-Vergleich ergeben, verlieren an Bedeutung, wenn ein Plan aufgrund zwischenzeitlicher Veränderungen als nicht mehr sinnvoll erachtet wird. Im Zuge von Predictive Planning werden Plan-Ist-Vergleiche daher um Forecasts ergänzt. Der Vergleich des Forecasts mit dem Plan zeigt, ob die Ziele voraussichtlich erreicht werden oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind.
Um aus den umfangreichen Daten Erkenntnisse zu gewinnen, reicht es nicht aus, diese in Tabellenform oder als Visualisierungen zu betrachten. Hierfür sollte die Künstliche Intelligenz in Form des Machine Learning Machine Learninggenutzt werden. Diese selbstlernenden Algorithmen sind in der Lage, Modelle zu entwickeln, die nicht nur bei Trainingsdaten funktionieren, sondern auch auf unbekannte Daten angewendet werden können. Diese Generalisierung erlaubt es Controllern, Vorhersagen zu entwickeln, Szenarien zu erstellen, aber auch Anomalien, Risiken oder Prozessineffizienzen zu erkennen.
Generative KIAls jüngste und zugleich zukunftsweisende Säule des digitalen Controllings etabliert sich die generative KI. Große SprachmodelleSprachmodell (Large Language Models, LLM) Large Language Model (LLM)sind darauf ausgelegt, neue Inhalte und Erkenntnisse auf Basis natürlicher Sprache zu erzeugen. Die Interaktion erfolgt nicht über Programmiercode, sondern mittels sogenannter PromptPrompts – in Alltagssprache formulierten Anweisungen. Sprachmodelle lassen sich zudem um unternehmensspezifische Informationen erweitern. Im Controlling ist das Potenzial generativer KI bislang noch wenig erschlossen. Eine zentrale Rolle im künftigen Controlling ist jedoch absehbar – etwa bei der Durchführung individueller Analysen, der automatisierten Erstellung und Kommentierung von Berichten sowie bei der Entwicklung von Prognosen und Szenarien. Erste Anwendungen umfassen Chatbots mit umfassendem Unternehmens- und Controllingwissen und das automatische Auslesen und Erzeugen von Dokumenten.
Wechselseitige Abhängigkeiten der Handlungsfelder
Die Betrachtung der einzelnen Handlungsfelder verdeutlicht die Vielzahl wechselseitiger Abhängigkeiten innerhalb des digitalen Controllings. Technologien wie Business Intelligence, Self-Service-Reporting und Machine Learning setzen eine hohe Datenverfügbarkeit und -qualität sowie cloudbasierte Infrastrukturen voraus. Machine Learning wiederum bildet die methodische Grundlage für den Einsatz von Predictive Planning. In Reporting Factories kommen automatisierte Prozesse in großem Umfang zum Einsatz. Die Potenziale generativer KI lassen sich nur dann ausschöpfen, wenn eine offene Unternehmenskultur gegenüber digitalen Technologien besteht und entsprechende Kompetenzen vorhanden sind. All diese Ansätze bleiben jedoch isolierte Einzellösungen, wenn es an einer klaren, abgestimmten Zielvorstellung fehlt, wie das Controlling insgesamt digitalisiert werden soll. Das Framework des digitalen Controllings sollte daher als integriertes, systemisches Modell verstanden und im Unternehmen weiterentwickelt werden.
1.4 Best Practices – Interview mit Maximilian Laturnus, Paul Hartmann AG
1. Was bedeutet die Digitalisierung im Controlling für Dich persönlich?
Die Digitalisierung im Controlling markiert für mich den Beginn einer neuen Ära. Technologien wie Big Data, Künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung spielen eine zentrale Rolle und transformieren das Berufsbild nachhaltig. Controller sind nicht mehr nur Zahlenlieferanten, sondern werden zu strategischen Beratern, die Unternehmensentscheidungen aktiv vorbereiten, mitgestalten und nachverfolgen. Diese Entwicklung ist in der Praxis bereits deutlich spürbar.
Persönlich sehe ich die Digitalisierung als Chance, Informationen schneller und präziser verfügbar zu machen. Dadurch verschiebt sich der Fokus von operativen Tätigkeiten hin zu wertschöpfenden Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen und Wettbewerbsvorteile bieten. Ein Beispiel dafür ist die Automatisierung von Reportingprozessen: Während früher Berichte manuell erstellt und aktualisiert wurden, stehen heute Echtzeit-Dashboards zur Verfügung, die eine gezielte Analyse ermöglichen. Dies spart Zeit und ermöglicht strategische Diskussionen.
Neben dem technologischen Wandel sehe ich einen kulturellen und methodischen Change: Wir müssen lernen, agil und datengetrieben zu arbeiten und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln.
2. Welches sind die bedeutsamsten Unterschiede zwischen einem digitalisierten und dem traditionellen Controlling?
Das traditionelle Controlling war durch manuelle Prozesse, Retroperspektive, statische und reaktive Arbeitsweisen sowie hohe Latenzzeiten geprägt. Datenanalysen waren oft zeitaufwendig und erforderten spezifische Programmierkenntnisse.
Das digitalisierte Controlling hingegen steht für Effizienz, Agilität und Zukunftsorientierung. Die Rolle und das Toolset des Controllers haben sich stark weiterentwickelt. Beispielsweise ist es heute mit Low-Code-Lösungen oder generativer KI möglich, eine App zur Investitionsfreigabe eigenständig zu erstellen. Dies wäre vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Die Einstiegsbarrieren sind gesunken, und der Erfolg wird fast garantiert.
3. Welche grundlegenden Technologien spielen eine zentrale Rolle in der Digitalisierung des Controllings in Deinem Unternehmen?
Es gibt eine Vielzahl von wichtigen Technologien, aber ich möchte zwei aus meiner Sicht besonders relevante Technologien hervorheben. Für deren erfolgreichen Einsatz gilt es jedoch, vorab einige grundlegende Aufgaben wie beispielsweise die Datenbereinigung und die Prozessdefinition zu bewältigen. Hierfür benötigt es keine perfekte Umgebung, allerdings eine ausgereifte und etablierte Basis.
Dieses ist zum einen die Künstliche Intelligenz. KI-basierte Technologien, insbesondere Machine Learning und generative KI, helfen uns, Muster in Daten zu erkennen und automatisierte Vorhersagen zu treffen. Dies hat unsere Fähigkeit zur effizienten Szenarienplanung im Unternehmen erheblich verbessert.
Zweitens möchte ich die Prozessautomatisierung nennen. Robotic Process Automation (RPA) und Tools wie beispielsweise Microsoft Power Query oder Microsoft Power Automate übernehmen erfolgreich repetitive Aufgaben wie die Datenkonsolidierung aus verschiedenen Quellen und sind dadurch ein Hygienefaktor für die erfolgreiche Digitalisierung.
4. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung bei Euch bisher auf die täglichen Aufgaben und Prozesse im Controlling?
Die Digitalisierung hat die täglichen Aufgaben schrittweise, aber nachhaltig verändert. Routineaufgaben, wie die manuelle Datenaufbereitung, sind deutlich reduziert worden. Stattdessen liegt der Fokus auf der Datenanalyse und -interpretation. Die gewonnene Zeit nutze ich, um neue Technologien wie generative KI auszuprobieren und diese zu implementieren. Unterschiedliche Szenarien und Simulationen, die in der dynamischen Arbeitswelt notwendig sind, können effizienter erstellt werden.
5. Wie beurteilst Du die Bereitschaft und die Fähigkeiten des Controllingteams, sich auf digitale Veränderungen einzustellen?
Die Bereitschaft zur Veränderung ist grundsätzlich vorhanden, jedoch unterschiedlich ausgeprägt. Häufig scheitert es an der Frage: »Wie und womit beginne ich am besten?« Zusätzlich erschweren mangelnde Kapazität und fehlende Unterstützung den Einstieg. Insgesamt sehe ich jedoch großes Potenzial, das durch gezielte Schulungen, Praxiserfahrungen und eine innovationsfördernde Unternehmenskultur gestärkt werden kann.
Das Management als häufiger Nutzer des Controllings spielt hier eine wichtige Rolle und muss bereit für Veränderungen sein und ggf. in manchen Bereichen die Arbeitsweise adaptieren – Stichwort Self-Service-Reporting – oder Vertrauen in Predictive Forecasting aufbauen.
6. Welches sind die größten Herausforderungen in der Digitalisierung des Controllings aus Deiner praktischen Erfahrung?
Die größten Herausforderungen sind häufig organisatorischer und kultureller Natur. Viele Vorhaben verlaufen im Sand, weil sie nicht gestartet werden. Die Digitalisierung fordert Experimentierfreudigkeit, Machermentalität und den Mut, Neues zu wagen. Der perfekte Zeitpunkt wird nie kommen – die Datenstruktur wird nie perfekt sein, die Prozesse werden nie ganzheitlich auf die Digitalisierung zugeschnitten sein und die Lösung wird nie ideal zu allen Bedürfnissen passen. Der frühe Einstieg ist entscheidend, um schnell von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren. Gab es je einen perfekten Zeitpunkt für den Umstieg auf das Smartphone?
7. Wie wird der Erfolg von Digitalisierungsinitiativen im Controlling in Eurem Unternehmen gemessen?
Gemeinsam mit Studierenden aus dem Masterstudiengang Controlling an der HfWU in Nürtingen habe ich ein Tool zur Bewertung von Digitalisierungsprojekten im Controlling entwickelt. Dieses bewertet das Vorhaben anhand qualitativer und quantitativer Kriterien und überführt es in ein Scoringmodell und eine Gesamtbewertung.
Am Ende ist allerdings eines über den Erfolg von Digitalisierungsprojekten entscheidend – die Nutzerakzeptanz und die damit verbundene Frage »Wie gut wird die neue Technologie bei den Stakeholdern angenommen?«.
8. Welche Tipps würdest Du Controllern geben, die am Anfang ihrer Reise zur Digitalisierung stehen?
Die Reise beginnen und nicht warten: Wie bei jeder Reise gilt es loszulaufen und die ersten Erfahrungen zu sammeln. Die Technologien werden sich durchsetzen und erhebliche Verbesserungen bringen. Zögern führt zu Wettbewerbsnachteilen.
Gleichgesinnte suchen und nicht aufgeben: Wie bei jeder erfolgreichen Reise ist es von Vorteil, Gleichgesinnte dabeizuhaben und nicht aufzugeben. Digitalisierung ist ein kontinuierlicher Prozess, zu dem auch Rückschläge und Scheitern gehören. Die Digitalisierung ist kein einmaliger Prozess, sondern eine kontinuierliche Entwicklung, die im Team besser gelingt als allein. Der Austausch in Netzwerken ist ein hilfreiches Mittel, um Ideen zu sammeln und die Schwarmintelligenz der Teilnehmer zu nutzen.
Aussagekräftige Projekte mit agilen Methoden in kleiner Umgebung testen: Themen mit hohem Nutzenpotenzial sollten in kleinen, geschützten Umgebungen zeitnah getestet werden. Agiles Arbeiten mit schnellen Feedbackloops schützt vor unnötiger Arbeit.
Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden zentrale Grundlagen und Handlungsfelder der Digitalisierung im Controlling erläutert. Digitalisierung wird dabei nicht nur als technischer Fortschritt, sondern als tiefgreifender Wandel von Geschäftsmodellen und -prozessen verstanden – angetrieben durch Technologien wie Big Data, Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing, Blockchain und das Internet der Dinge. Diese Entwicklungen führen zu grundlegenden Veränderungen im Controlling: Sie steigern Effizienz und Effektivität und transformieren das traditionelle Controlling schrittweise zu einem daten- und technologiegestützten Steuerungssystem.
Für eine erfolgreiche Umsetzung digitaler Controllingstrategien ist ein belastbares Fundament erforderlich – bestehend aus hoher Datenqualität, digitalen Kompetenzen und einer offenen Unternehmenskultur. Das Framework des digitalen Controllings bietet eine strukturierte Orientierung für diese Transformation. Es zeigt die relevanten Handlungsfelder auf und macht zugleich deren wechselseitige Abhängigkeiten sichtbar.
Reflexionsfragen
Inwiefern verändert die Integration von Technologien wie KI und Big Data die Rolle des Controllers innerhalb eines Unternehmens?
Welchen spezifischen Herausforderungen könnte ein Unternehmen bei der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie im Controllingbereich begegnen?
Wie können traditionelle Controllingteams effektiv auf die Anforderungen neuer digitaler Technologien vorbereitet werden?
Welche langfristigen Auswirkungen könnte die Digitalisierung auf die Strategie und das Geschäftsmodell haben?
Wie kann man eine Balance zwischen den digitalen Technologien und dem Erhalt bewährter Controllingpraktiken herstellen?
Literaturverzeichnis
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (o.J.): Was ist Digitalisierung?, in: https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Lagebild/Was-ist-Digitalisierung/was-ist-digitalisierung.html, Abruf: 14.07.2024.
DIHK (2024): Digitalisierung weiter eher Werkzeug als Innovationsmotor. Die DIHK-Digitalisierungsumfrage 2023, in: https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaft-digital/digitalisierung/digitalisierungsumfrage-23, 2024, Abruf: 29.05.2025.
Gadatsch, A./Schreiber, D. (2021): Management von Big Data Projekten, in: Frick, D./Gadatsch, A./Kaufmann, J./Lankes, B./Quix, C./Schmidt, A./Schmitz, U. (Hrsg.): Data Science – Konzepte, Erfahrungen, Fallstudien und Praxis, Wiesbaden, S. 41–62.
Laturnus, M./Sailer, U. (2020): Digitalisierungsstrategie im Produktionscontrolling, Controller Magazin, 4, S. 54–61.
Lexikon der Wirtschaftsinformatik (2019): Digitale Transformation, in: https://wi-lex.de/index.php/lexikon/technologische-und-methodische-grundlagen/informatik-grundlagen/digitalisierung/digitale-transformation/, 2019, Abruf: 14.07.2024.
Plattform Industrie 4.0 (2019): Was ist Industrie 4.0?, https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/DE/Industrie40/WasIndustrie40/was-ist-industrie-40.html, 2019, Abruf: 14.07.2024.
Sailer, U. (2025): Digitalisierung des Controllings. Business Analytics und Künstliche Intelligenz im Controlling, in: Detscher, S./Hepp, M. (Hrsg.): Praxishandbuch Digitales Management, Wiesbaden, S. 1–19, https://doi.org/10.1007/978-3-658-46399-1_39-1.
Weber, J. (2019): Controlling, Gablers Wirtschaftslexikon, in: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/controlling-30235/version-370809, Abruf: 14.07.2024.
Weiterführende Quellen
Britzelmaier, B. (2025): Controlling. Grundlagen, Praxis, Handlungsfelder, 4. Auflage, München.
Sailer, U. (2023): Digitalisierung im Controlling – Transformation der Unternehmenssteuerung durch die Digitalisierung, München.
2 Stand der Digitalisierung im Controlling
Leitfragen
Wie weit ist das Controlling heute digitalisiert?
In welchen Aufgabenfeldern des Controllings ist die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten – und wo bestehen noch große Potenziale?
Welche Faktoren haben die Digitalisierung des Controllings bisher unterstützt, welche haben sie eher behindert?
Welche Erwartungen verbinden Controller mit der zukünftigen Entwicklung der Digitalisierung?
Definitionen
Digitale Kompetenz
Digitale KompetenzDigitale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Probleme in der Unternehmenspraxis mithilfe digitaler Technologien selbstorganisiert zu lösen und die digitale Transformation des Unternehmens zu fördern.
Digitales Mindset
Ein digitales MindsetMindsetDigitales Mindset beschreibt die grundsätzlich positive Haltung, das Interesse und die Neugier gegenüber der Digitalisierung und deren Auswirkungen. Dies setzt ein grundlegendes Verständnis über die Inhalte der Digitalisierung bezogen auf das eigene Unternehmen und die eigene Tätigkeit voraus.
Status Monitoring
Ein Status Monitoring stellt eine systematische Überprüfung des Fortschritts eines Projektes oder einer Transformation dar. Dies dient der Überwachung der Umsetzung, der Analyse von Abweichungen, der Identifikation möglicher Schwierigkeiten und Risiken und der Ableitung von Optimierungsmaßnahmen.
2.1 Studien zum Stand der Digitalisierung im Controlling
Die im deutschsprachigen Raum bekannteste, regelmäßig erscheinende Studie zum Status quo des Controllings wird von der WHU – Otto Beisheim School of Management, Institut für Management Accounting and Control, durchgeführt. Das WHU Controller Panel erscheint seit 2011 im dreijährigen Rhythmus in Kooperation mit dem Internationalen Controller Verein (ICV). Rund 1.000 Controller und CFOs werden dabei regelmäßig zu aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Controlling befragt (WHU 2023).
In der Ausgabe aus dem Jahr 2023 wurde ein Zukunftsthemen-Ranking erstellt, in dem die erwartete Relevanz verschiedener Controllingthemen mit Blick auf das Jahr 2028 abgefragt wurde. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die wichtigsten Zukunftsthemen eng mit der Digitalisierung verknüpft sind. Die Topthemen des Rankings zeigt Abbildung 4:
Abb. 4:
Rangfolge der Zukunftsthemen 2028, die Skala reicht von 1 (sehr gering) bis 7 (sehr stark), (Quelle: Schäffer/Reimer 2024, S. 55)
»Die Digitalisierung dominiert weiter die Agenda des Controllings. Unsere Liste der Zukunftsthemen ist somit stark von einem Themenfeld geprägt, das die befragten Controller und Finanzvorstände bei unseren ersten beiden Befragungen in 2011 und 2014 noch gar nicht auf dem Radar hatten, das aber wohl die Zukunft der Finanzfunktion prägen wird wie kein anderes. Gleichzeitig klafft zwischen der Einsicht in die Bedeutung der Digitalisierung und der Bereitschaft, auch entsprechend Zeit und Geld in die damit verbundene Transformation zu investieren, nach wie vor eine große Lücke.« (Schäffer/Reimer, 2024, S. 59)
Trotz der hohen Bedeutung, die der Digitalisierung im Controlling für die Zukunft beigemessen wird, zeigt das WHU Controller Panel einen vergleichsweise geringen Umsetzungsstand in der Praxis. Lediglich 21 % der befragten Unternehmen verfügen über eine umfassende Digitalisierungsstrategie für das Controlling. Nur 14 % verfolgen eine klare Strategie zur Förderung digitaler Kompetenzen, und lediglich 17 % erachten die bisherigen Investitionen in die Digitalisierung des Controllings als ausreichend. Der Einsatz Künstlicher Intelligenz befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium: Nur 3 % der Unternehmen setzen KI derzeit für Forecasts ein.
Besonders auffällig ist, dass gerade jene Kompetenzen, Kompetenzdie für die Digitalisierung des Controllings entscheidend sind, in den befragten Unternehmen häufig nur schwach entwickelt sind. Dazu zählen die Datenbeschaffung und -architektur, Kenntnisse zu Datensicherheit und Datenschutz, das Verständnis für digitale Technologien, Trends und Geschäftsmodelle sowie die Fähigkeit, statistische Modelle zu entwickeln und zu bewerten. Insgesamt zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen der erwarteten künftigen Relevanz der Digitalisierung im Controlling und dem derzeitigen Engagement vieler Unternehmen.
In Konferenzen, Veröffentlichungen von Softwareanbietern und Beratungsgesellschaften sowie in praxisnahen Controllingzeitschriften entsteht häufig der Eindruck, dass sich die Potenziale der Digitalisierung relativ leicht erschließen lassen. Dabei dominieren vor allem Erfolgsgeschichten – meist von Unternehmen, die bereits weit fortgeschritten sind. Berater und Softwareanbieter kommunizieren naturgemäß optimistisch, da dies Teil ihres Geschäftsmodells ist. Der Austausch mit weniger digitalisierten Unternehmen vermittelt hingegen ein differenzierteres Bild: Hier zeigt sich, dass die Digitalisierung oftmals mühsam ist, mit anderen strategischen Projekten konkurriert und nicht selten an fehlenden Kompetenzen oder mangelnder Überzeugung scheitert. Die digitale Transformation im Controlling ist damit keineswegs ein Selbstläufer, sondern erfordert Ausdauer, Ressourcen und einen klaren Veränderungswillen.
2.2 Ergebnisse des Status Monitoring
Im Jahr 2024 wurde im Rahmen des Netzwerks Digitales Controlling mit 18 Mitgliedsunternehmen eine kombinierte qualitative und quantitative Erhebung zum Stand der Digitalisierung im Controlling durchgeführt. Den Auftakt bildete ein Workshop mit Controllern aus fünf Unternehmen sowie zwei Vertretern der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Dabei wurde der Fragenkatalog einer früheren Befragung aus dem Jahr 2020 weiterentwickelt. Damals stand ein Readiness Check im Fokus, der die Bereitschaft zur digitalen Transformation im Controlling erfassen sollte. Digitale Transformation
Vier Jahre später lag das Interesse nun auf dem tatsächlichen Fortschritt: Welche Entwicklungen haben stattgefunden, welche Herausforderungen sind aufgetreten, und welche neuen digitalen Anwendungen wurden eingeführt? Der erweiterte Fragenkatalog erfasste den Status quo der Digitalisierung, die angestrebten Ziele sowie Hindernisse bei der Umsetzung. Nach Abschluss der Befragung und Auswertung fand ein zweiter Workshop statt, in dem die Ergebnisse gemeinsam interpretiert wurden. Besonders aufschlussreich war die Diskussion möglicher Ursachen für teils überraschende Erkenntnisse.
Die befragten Unternehmen stammen überwiegend aus dem südwestdeutschen Raum, mit einem leichten Schwerpunkt im produzierenden Gewerbe. Knapp zwei Drittel der Unternehmen erzielen einen Jahresumsatz von über 600 Mio. €, lediglich ein Unternehmen liegt unterhalb von 60 Mio. €. Bei den Netzwerkteilnehmern handelt es sich um Controller, die sich intensiv mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung befassen. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Controllingbereiche in ihren Unternehmen bereits besonders umfassend digitalisiert sind. Die Teilnehmenden repräsentieren unterschiedliche Hierarchieebenen, wobei der Großteil operativ tätig ist. Sie bringen praktische Erfahrung aus dem Tagesgeschäft mit und kennen die Herausforderungen der Digitalisierung auf der Arbeitsebene sehr genau. Mehrere von ihnen waren zudem aktiv an Digitalisierungsprojekten beteiligt.
Die bedeutsamsten Ergebnisse der Befragung sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Highs
Lows
• Business Partnering ist etabliert und soll noch weiter an Bedeutung gewinnen.
Das digitale Mindset des Managements ist stark ausgeprägt und fördert die Umsetzung der Digitalisierung im Controlling.
Im Controlling bestehen ein großes Interesse und eine große Offenheit gegenüber digitalen Technologien.
Self-Service-Reporting hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und findet sich bereits in den meisten Unternehmen.
Der größte Teil der Unternehmen hat das Berichtswesen zentralisiert, um die Effizienz zu steigern.
Erweiterungen bestehender Tools wie Excel Macros oder MS Power Automate werden zu Analysezwecken und zur Prozessoptimierung bereits stark genutzt.
Data Governance und das Datenmanagement haben in vielen Unternehmen eine hohe Bedeutung.
Das Topmanagement unterstützt den digitalen Wandel im Controlling und es besteht die Bereitschaft für notwendige Investitionen.
• In der Budgetierung wird die Digitalisierung bisher kaum genutzt, obwohl dort ein großer Handlungsbedarf besteht.
Treiberbasierte Steuerung und Simulationen spielen bei den meisten Unternehmen keine Rolle.
Moderne Tools zur Automatisierung von Forecasts werden kaum eingesetzt.
Excel wird intensiv genutzt, obwohl viele Unternehmen dies zukünftig begrenzen wollen.
Visual Analytics hat sich nur teilweise durchgesetzt. Bei tiefgehenden Analysen dominiert Excel.
Process Mining und RPAs sind wenig bedeutsam.
Die Erwartungen an die generative KI sind gering, da noch keine bedeutenden Einsatzfelder im Controlling bekannt sind.
Datenerfassung und -analyse erfolgen nur teilweise automatisiert, obwohl der Handlungsbedarf groß ist.
Es überwiegt eine leichte Unzufriedenheit mit dem Verlauf der Digitalisierung in den letzten Jahren.
Die Umstellung der bestehenden IT, personelle Engpässe und fehlende Mitarbeiterqualifikation hemmen die digitale Transformation im Controlling.
Tab. 1: Die wichtigsten Erkenntnisse des Status Monitorings 2024
Aus den einzelnen Themenfeldern aus dem Framework des digitalen Controllings ergaben sich folgende Erkenntnisse:
Digitalisierungsstrategie
Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen verfügen über eine unternehmensweite DigitalisierungsstrategieDigitalisierungsstrategie. Eine spezifische Strategie für das Controlling ist dagegen bislang nur in 11 % der Unternehmen vorhanden. Rund die Hälfte der Unternehmen beschreibt die Entwicklung ihrer Digitalisierungsstrategie als pragmatisch und wenig systematisch. Nur 17 % setzen ihre Strategie konsequent anhand messbarer Ziele um. Häufig fehlen klare Zielgrößen sowie eine laufende Überwachung der Umsetzung.
Auch bei der Genehmigung von Digitalisierungsprojekten zeigt sich eine Unsicherheit in der Bewertung: Ein belastbarer Business Case liegt oft nicht vor, weshalb Entscheidungen eher auf Basis qualitativer Einschätzungen getroffen werden. Gleichwohl wird die Bedeutung einer eigenständigen Digitalisierungsstrategie für das Controlling sowie deren systematische Umsetzung von den meisten Unternehmen erkannt – und für die Zukunft angestrebt.
Organisation
Business PartnerRund ein Drittel der Befragten berichtet, dass sich die Wahrnehmung des Controllings im Unternehmen durch die Digitalisierung verbessert hat. Diese Entwicklung wird insbesondere auf das verstärkte Business Partnering sowie den Einsatz von Self-Service-Tools und Dashboards zurückgeführt. In über zwei Dritteln der Unternehmen haben digitale Entwicklungen bereits zu partiellen organisatorischen Anpassungen im Controlling geführt. Eine grundlegende aufbau- und ablauforganisatorische Neuausrichtung wurde hingegen nur in einem Fall vorgenommen – mit dem Ziel, die Potenziale der Digitalisierung umfassend zu nutzen. In etwas mehr als der Hälfte der Unternehmen liegt die Entscheidungshoheit über Digitalisierungsmaßnahmen im Controlling bei der IT-Abteilung. In den übrigen Fällen erfolgt die Entscheidungsfindung gemeinsam oder liegt direkt beim Controlling. Die Unterstützung durch die IT wird jedoch häufig als begrenzt wahrgenommen – meist bedingt durch knappe personelle Ressourcen. Viele Controller streben daher den Einsatz praxisnaher, anwendungsbezogener Systeme an, die eigenständig betreut werden können.
Rollenbilder und digitale Kompetenzen
RolleBusiness PartnerDas Business Partnering hat bei über 60 % der befragten Unternehmen bereits heute eine große bis sehr große Bedeutung – mit der Erwartung, dass seine Relevanz in den kommenden Jahren weiter zunimmt. Besonders das volatile Geschäftsumfeld der letzten Jahre hat dazu geführt, dass das Management die Unterstützung durch Controller zunehmend schätzt. Zudem wird vielfach auf eine neue Generation von Führungskräften verwiesen, die kooperative Entscheidungsprozesse bevorzugt, datenbasierte Analysen einfordert und beratende Rollen ausdrücklich begrüßt. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die kommunikative Kompetenz von Controllern an Bedeutung und wird bei der Personalrekrutierung verstärkt berücksichtigt.
RolleWeitere differenzierte Rollenbilder im Controlling – wie sie etwa bei Großunternehmen wie BASF oder Bosch eingeführt wurden – sind in den befragten Unternehmen bislang kaum etabliert. Die Rollen Service Expert, Scorekeeper und Guardian wurden nur vereinzelt genannt und sind mehrheitlich nicht bekannt. Diese Rollenbilder lassen sich wie folgt beschreiben:
Service Expert: verantwortlich für die Durchführung, Koordination und Weiterentwicklung operativer Controllingprozesse;
Scorekeeper: übernimmt standardisierte Routineaufgaben im Controlling;
Guardian: überwacht die Einhaltung finanzieller Ziele, identifiziert Chancen und Risiken und stellt die Einhaltung von Richtlinien sicher.
Digitale KompetenzIn Bezug auf digitale Kompetenzen Kompetenzzeigt sich ein klares Defizit: Zwei Drittel der Unternehmen berichten von nur geringen digitalen Fähigkeiten in ihren Controllingabteilungen. Entsprechendes Know-how ist häufig in anderen Unternehmensbereichen oder internen Beratungseinheiten angesiedelt. Kein einziges Unternehmen gab an, über umfassende digitale Kompetenzen im Controlling zu verfügen. Ebenso waren in keinem Fall Data Scientists direkt im Controlling beschäftigt.
Digitales Mindset
Digitales MindsetMindsetIn rund zwei Dritteln der befragten Unternehmen ist ein digitales Mindset im Management weit verbreitet. Nur 18 % der Unternehmen wurden von den Controllern in dieser Hinsicht als unzureichend eingeschätzt. Mehr als drei Viertel der befragten Controller zeigen eine hohe Offenheit und starkes Interesse an digitalen Technologien. Dieser hohe Anteil dürfte auch dadurch beeinflusst sein, dass es sich bei den Teilnehmenden um Mitglieder des Netzwerks Digitales Controlling handelt, die sich von vornherein aktiv mit Digitalisierungsthemen auseinandersetzen. Gleichzeitig wird häufig ein Mangel an fachlichem Wissen zur effektiven Nutzung digitaler Technologien beklagt. Viele Controller tun sich schwer, die Vielzahl verfügbarer digitaler Lösungen fundiert zu bewerten und zu priorisieren – insbesondere vor dem Hintergrund begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen.
Change-ManagementIn etwa 40 % der Unternehmen wird die digitale Transformation im Controlling durch Maßnahmen des Change-Managements begleitet. Mehrere Befragte weisen allerdings darauf hin, dass dies häufig implizit innerhalb von Projekten erfolgt und nicht explizit als Change-Prozess bezeichnet wird. Zudem wird die Notwendigkeit eines gezielten Change-Managements aus Sicht vieler Controller nach wie vor unterschätzt.
Planung und Steuerung
In knapp über der Hälfte der befragten Unternehmen erfolgt die Planung nach dem Gegenstromverfahren, rund ein Drittel nutzt ein rein Top-down-orientiertes Vorgehen. Bottom-up-Ansätze werden hingegen nur selten angewendet. Der Trend zur stärkeren Nutzung des Top-down-Verfahrens lässt sich insbesondere auf die Vielzahl externer Krisen in den letzten Jahren zurückführen, die ein rasches, zentral gesteuertes Handeln erforderlich machten. Auch das Gegenstromverfahren wurde zur Effizienzsteigerung angepasst – etwa durch den Verzicht auf mehrfache Planungsiterationen. Bei etwa zwei Dritteln der Unternehmen hat die Digitalisierung bislang keine oder nur geringe Auswirkungen auf das Budgetierungsverfahren. Ein Drittel der Befragten berichtet hingegen von Veränderungen, insbesondere durch den Einsatz spezieller Planungswerkzeuge oder durch die Einführung von Treibermodellen.
Der Automatisierungsgrad in der BudgetierungBudgetierung ist aktuell noch gering – obwohl viele Controller hierin ein bedeutendes Potenzial sehen. Die zurückhaltende Umsetzung wird unter anderem damit begründet, dass gegenwärtig in vielen Unternehmen die Einführung von SAPSAP S/4HANA im Fokus steht. Weiterführende Digitalisierungsschritte – etwa zur Automatisierung der Planung – werden vielfach erst im Anschluss daran erwartet.
Nur etwa 20 % der Unternehmen nutzen derzeit Treiber und Treibermodelle aktiv zur Unternehmenssteuerung. Simulationen Simulationfinden noch seltener Anwendung. Kein befragtes Unternehmen setzt Simulationen systematisch ein; sie kommen allenfalls punktuell bei Einzelentscheidungen oder Worst-Case-Szenarien zur Anwendung. Als Gründe werden die als abstrakt empfundene Methodik und der begrenzte Nutzen im operativen Geschäft angeführt. ForecastsForecast hingegen haben eine deutlich größere Verbreitung. Etwa die Hälfte der Unternehmen führt diese in regelmäßigen Abständen durch, meist jedoch in manueller Form auf Basis von Befragungen. Nur ein Unternehmen nutzt bereits automatisierte Forecasts unter Einsatz von Machine Learning. Der Nutzen automatisierter Verfahren wird derzeit vielfach infrage gestellt – insbesondere vor dem Hintergrund eines volatilen Geschäftsumfelds. Zudem fehlt es in vielen Controllingabteilungen noch an den erforderlichen KI-Kompetenzen. Trotzdem besteht ein klares Zielbild: Die befragten Controller streben an, Forecasts künftig verstärkt zur Steuerung einzusetzen und diese Prozesse sowohl zu professionalisieren als auch zu automatisieren.
Reporting
Self-ServiceReportingDas Self-Service-Reporting hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Bei etwas mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen ist ein Managed-Self-Service-Ansatz etabliert: Die Anwender können in einem definierten Rahmen eigenständig Berichte erstellen und Analysen durchführen. Ein Unternehmen hat das Reporting vollständig auf Self-Service umgestellt, während zwei Unternehmen dieses Konzept bislang gar nicht nutzen. In der Mehrzahl der Fälle liegt eine Mischform vor, bei der traditionelles Reporting und Self-Service-Elemente parallel bestehen.
Die größte Herausforderung beim Übergang zum Self-Service-Reporting ist dabei nicht technischer Natur. Leistungsfähige Tools wie Microsoft Power BI, Tableau oder SAP Analytics Cloud (SAC) stehen in ausgereifter Form zur Verfügung. Die Hemmnisse liegen vielmehr bei den Nutzern: Manche stehen dem Self-Service skeptisch gegenüber, sehen keinen unmittelbaren Nutzen oder verfügen nicht über das erforderliche Know-how. Trotz dieser Herausforderungen gehen die meisten Unternehmen davon aus, dass die Bedeutung des Self-Service-Reportings in Zukunft weiter zunehmen wird.
Mit dem Ausbau von Self-Service-Ansätzen geht häufig eine stärkere Zentralisierung der Berichts- und Datenbereitstellung einher. Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen bezeichnen ihre Reportingprozesse bereits heute als stark zentralisiert.
Dabei wird der Bedarf an Flexibilität in dezentralen Einheiten – etwa in Tochtergesellschaften – durchaus erkannt. Die Unternehmen verfolgen hier überwiegend einen pragmatischen Ansatz: Einerseits profitieren sie von zentralen Standards, andererseits erhalten dezentrale Bereiche Spielräume für eigene Auswertungen. Auch in diesem Bereich wird mittelfristig eine weitere Zentralisierung der Reportingfunktion erwartet.
Analytics
Die Nutzung umfangreicher Daten zur fundierten Entscheidungsunterstützung – unter Einsatz geeigneter Tools und statistischer Methoden – ist in der Controllingliteratur seit Jahren etabliert. Entsprechend sind auch zahlreiche Praxisbeispiele dokumentiert, in denen Data Science im Controlling einen hohen Reifegrad erreicht hat. Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich eine Frage auf die konkret eingesetzten Analyse-Tools. Mehr als 75 % der befragten Controller gaben an, dass Excel nach wie vor das dominierende Analyseinstrument darstelle. Nur in knapp einem Viertel der Unternehmen werden andere Tools häufiger genutzt. In keinem Unternehmen liegt der Anteil von Excel jedoch unter 25 %. Mehrere Teilnehmende betonten, dass Excel insbesondere dann eingesetzt wird, »wenn es ins Detail geht« oder »kompliziert wird«.
ExcelEine bemerkenswerte Entwicklung der letzten Jahre ist die zunehmende Verbreitung von Excel-Add-ins. Über 80 % der Befragten bestätigen deren Einsatz bei einem beträchtlichen Teil der Analyseaufgaben. In knapp der Hälfte der Unternehmen stellen diese Add-ins inzwischen sogar das dominierende Werkzeug für Datenanalysen dar. Hierzu zählen Erweiterungen wie Power Query, Power Pivot, Power View oder Solver, die Funktionen für Datenaufbereitung, Analyse, Optimierung und Visualisierung bereitstellen. Die Integration solcher Add-ins erweitert die Anwendungsbreite von Excel erheblich. Als zentrale Vorteile werden neben der gesteigerten Leistungsfähigkeit und der vertrauten Arbeitsumgebung insbesondere die größere Unabhängigkeit von der IT-Abteilung genannt.
Kein Unternehmen nutzt Predictive Analytics Predictive Analyticsumfassend; lediglich ein Unternehmen gab an, dass dies schrittweise in die Regelprozesse integriert wird. Etwa die Hälfte der Befragten setzt keine prädiktiven Methoden ein, während 44 % diese lediglich in Einzelfällen verwenden. Auch für die Zukunft wird – trotz verfügbarer, niedrigschwelliger Tools wie KNIME oder RapidMiner – nur eine moderate Verbreitung erwartet. Die breite Nutzung dieser Technologien im Controlling steht damit weiterhin aus.
Prozesse
Process MiningProcess Mining spielt im Controlling der befragten Unternehmen bislang nahezu keine Rolle. 80 % der Unternehmen haben damit noch keinerlei praktische Erfahrungen gesammelt; lediglich 20 % berichten von ersten Pilotanwendungen. In keinem der Fälle erfolgt eine systematische Nutzung im Controlling. Process Mining wird überwiegend als komplex und kostenintensiv wahrgenommen, weshalb es auch für die nähere Zukunft keine Priorität genießt.
Robotic Process Automation (RPA)Auch Robotic Process Automation (RPA)