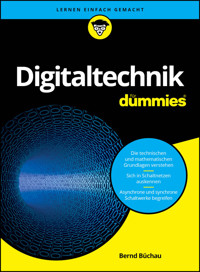
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Von den Grundlagen der Boole’schen Algebra bis zur Synthese digitaler Systeme
Die Digitaltechnik stellt heute praktisch für alle elektrischen und elektronischen Geräte des täglichen Lebens und in der industriellen Anwendung die Basis dar—deswegen ist sie so wichtig und unverzichtbar. Deshalb ist dieses Gebiet auf möglichst verständliche und vollständige Weise im vorliegenden Lehr- und Übungsbuch behandelt worden. Auch wenn es manchmal kniffelig wird, keine Angst, der Autor führt Sie sicher durch dieses Gebiet zum Ziel, mit fundierten Grundlagen und vielen Beispielen sowie Übungen. Als Interessierter wie auch als Studierender werden Sie mit den vielen Übungen zuverlässig auf die Praxis und anstehende Prüfungen vorbereitet – viel Erfolg.
Sie erfahren
- Was die Digitaltechnik in Theorie und Praxis ist
- Welche mathematischen Grundlagen Sie benötigen
- Wie eine Analyse durchgeführt wird
- Wie eine Synthese einer digitalen Schaltung erfolgt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Digitaltechnik für Dummies
Schummelseite
Digitaltechnik für Dummies
Bibliografische Informationder Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2026
© 2026 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book is published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren –in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: Alexey Novikov- stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-71866-5ePub ISBN: 978-3-527-83410-5
Über den Autor
Prof. Dr.-Ing. Bernd Büchau ist für Prozessrechentechnik an die Fakultät Elektrotechnik und Informatik der Hochschule Stralsund berufen und am 1. September 2023 nach einer 30-jährigen Tätigkeit als Hochschullehrer in den Ruhestand getreten. Er ist weiterhin Angehöriger der Hochschule Stralsund.
Nach einer zweistufigen Berufsausbildung von 1973 bis 1977 zum Elektrogerätemechaniker und Energiegeräteelektroniker hat er von 1979 bis 1983 ein Studium der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Regelungstechnik/Nachrichtentechnik an der FH Hamburg absolviert. Von 1984 bis 1988 war er als Entwicklungsingenieur bei den Firmen P+R Automation GmbH und C.H.F. Müller Unternehmensbereich der Philips GmbH in Hamburg tätig. Von 1987 bis 1990 absolvierte er ein Studium der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik an der Universität Bremen. Von 1990 bis 1993 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mikroelektronik und Bauelemente der Elektrotechnik der Universität Bremen bei Prof. Dr. D. Silber. Seit 1993 hat er die Professur für Prozessrechentechnik an der Hochschule Stralsund inne. 1994 erfolgte die Promotion an der Universität Bremen mit dem Thema »Modellbildung der bipolaren Leistungsbauelemente Diode und Transistor«.
Zuletzt angebotene Kurse: Automatisierungssysteme, Digitale Schaltungen, Industrielle Kommunikationssysteme sowie Software-Engineering in Bachelor- und Master-Studiengängen sowie Leitung des zugehörigen Labors Automatisierungstechnik.
Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung: Automatisierungssysteme, E-Learning, Industrielle Kommunikationssysteme sowie Modellbildung und Simulation.
Tätigkeit in der Hochschulselbstverwaltung: von 2007 bis 2017 wechselnd Prodekan und Dekan der Fakultät Elektrotechnik und Informatik der Hochschule Stralsund.
Gutachtertätigkeit in Förderprogrammen des Bundes und der Länder wie beispielsweise Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) und AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen Otto von Guericke e.V. Des Weiteren Gutachtertätigkeit in diversen Akkreditierungsverfahren für Studiengänge verschiedener Hochschulen.
Ehrenamtliche Tätigkeiten: von 1995 bis 2005 Vorstandsvorsitzender der Innovationsagentur Mecklenburg-Vorpommern e.V. Seit 1996 Mitglied in den Gremien K111 und K111.0.6 der DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE). Seit 2007 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des VFAALE e.V. (Verein für Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung an Hochschulen e.V.) und von 2012 bis 2024 dessen Sprecher und federführend in der Ausrichtung der im Regelfall jährlichen Fachkonferenz AALE (Angewandte Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung) und Mitausrichter des im Regelfall jährlichen Student Awards zur Nachwuchsförderung.
Seit 2021 als Fachbuchautor tätig.
Danksagung
Das Schreiben eines Buches ist eine Herausforderung und bedingt das notwendige Know-how, den Ehrgeiz, das Wissen und die eigenen Erfahrungen für ein interessantes Gebiet auf verständliche Weise dem Leser näher zu bringen, sodass dieser Schritt für Schritt einen Erkenntnisgewinn erzielt und somit auch jene Erfolgserlebnisse hat, die ihn motivieren, sich durch ein gesamtes Gebiet zu kämpfen und am Ende sagen zu können, ich habe das meiste verstanden und kann es auch auf relevante Aufgabenstellungen anwenden. Wenn es dann dazu führt, dass am Ende als Ergebnis eine bestandene Fachprüfung in einem Studium, in einer beruflichen Qualifikation oder einer weiterführenden beruflichen Ausbildung steht, ist das doppelt erfreulich. Wenn dies so ist, erfreut es den Autor, dass sein Buch sein Ziel erreicht hat, und wiegt all die Mühe auf, die er bei der Erstellung des Buches aufgebracht hat. Um das auf sich zu nehmen, sind zwei Dinge erforderlich. Dies ist zum einen die Unterstützung durch den Verlag samt den Lektoren und vielen kleinen Helfern und zum anderen viel Verständnis seitens der Familie für das Unterfangen.
Ich möchte hiermit ausdrücklich dem Wiley Verlag für die Möglichkeit der Anfertigung dieses Buches und die Unterstützung durch die Lektorin Petra Heubach-Erdmann, den Lektor Marcel Ferner vom Wiley Verlag und dem Fachlektor Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Peter Döge von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena für die reibungslose Unterstützung bei der Anfertigung dieses Buches danken. Zu den vielen kleinen Helfern sind neben anderen insbesondere Prof. Dr. Erik Jacobson bei der Durchsicht der Definitionen zu den Normen und Dipl.-Ing. (FH) Gerald Gröbe, der mich beim Kontrollieren diverser Abbildungen und Übungsaufgaben tatkräftig unterstützt hat, zu nennen. Nicht zuletzt, sondern an erster Stelle danke ich meiner Frau Heidi wegen des unbändigen Verständnisses während der Erstellung dieses Buches.
Für Fragen, Anregungen und Diskussionen können Sie sich gerne per E-Mail unter [email protected] mich wenden.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Annahmen über Sie, die Leserin beziehungsweise den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole in diesem Buch
Wie es weitergeht
Teil I: Einordnung der Digitaltechnik – Wo bin ich?
Kapitel 1: Basis der Digitaltechnik und Abgrenzung zur Analogtechnik – Zwischen den Fronten?
Definitionen zur Digitaltechnik
Analoge, digitale und binäre Signale
Digitaltechnik versus Analogtechnik
Teil II: Mathematische Grundlagen – Nur ein bisschen
Kapitel 2: Zahlensysteme – Jetzt gibt's Zahlen
Polyadische, Positions- und Stellenwertsysteme
Umwandlung von Zahlen bei unterschiedlichen Basen
Übungen: Zahlensysteme
Kapitel 3: Arithmetik in den polyadischen Zahlensystemen – Aus den Klassen 1 bis 4
Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Übungen: Arithmetik Zahlensysteme
Kapitel 4: Darstellung negativer Zahlen – Warum negativ, ich bin positiv eingestellt?
Darstellung nach Betrag und Vorzeichen
Einerkomplement
Zweierkomplement
Übungen: Negative Zahlen
Teil III: Codes und Codesicherung – Wie sage ich es meinem Kinde?
Kapitel 5: Codes und deren Eigenschaften – Die Sprache der Digitaltechnik!
Bewertungskriterien für Codes
Übungen: Codes
Kapitel 6: Binärcodes in der Digitaltechnik – Wofür sind die gut?
Numerische Codes
Alphanumerische Codes
Übungen: Binärcodes
Kapitel 7: Codesicherung – Fehler macht der Mensch
Fehlererkennung und -korrektur von Bit-Fehlern
Entwurf einfacher Codes zur Fehlererkennung und -korrektur
Das Paritätsbit als einfachste Maßnahme zur Codesicherung
Übungen: Codesicherung
Teil IV: Schaltalgebra als Basis der Digitaltechnik – Herr Boole und Herr Shannon lassen grüßen
Kapitel 8: Historisches und wichtige Festlegungen – So fing es an
Ein kleiner Rückblick – Back to the roots
Konstante, Variable (Schaltvariable) und Schaltfunktion – Drei Dinge braucht man
Die Wahrheitstabelle – Sag mir die Wahrheit
Mathematische Zeichen und Symbole der Schaltalgebra – Formalien, Formalien …
Kapitel 9: Schaltalgebra – Aufgepasst!
Rechenregeln der Schaltalgebra – Sind die kniffelig?
Benennungen der logischen Verknüpfungen – Wie heißen die denn?
Vorrangregeln der Schaltalgebra – wer kommt zuerst?
Übungen: Schaltalgebra
Kapitel 10: Logische Grundverknüpfungen und deren grafische Symbole – Warum das denn?
Allgemeines zu Benennungen der logischen Funktionen – Wie heißen die?
Die Grundverknüpfungen – im Grunde gut
Umformung der NAND- und NOR-Verknüpfungen in die Grundverknüpfungen – Zweckmäßig?
Gegenüberstellung der grafischen Symbole für Schaltpläne nach aktuellen und alten Standards - Aus alt wird neu
Übungen: Logische Grundverknüpfungen
Kapitel 11: Normalformen, Min- und Maxterme – Gute Umgangsformen
Disjunktive und konjunktive Normalformen, Min- und Maxterme – Welche denn?
Umwandlung der Normalformen – hin und her
Übungen: Normalformen
Teil V: Analyse von Schaltnetzen – Schauen wir mal
Kapitel 12: Methoden für die Analyse von Schaltnetzen – Wie geht das?
Ziele und Vorgehensweisen
Analyse mittels Vorgabe von Konstanten für die Variablen – Vorgaben machen Sie
Analyse mittels Einführung von Teilfunktionen – Ich will nicht teilen
Übungen: Analyse von Schaltnetzen
Teil VI: Synthese von Schaltnetzen – Wie soll es denn werden?
Kapitel 13: Methoden und Synthese mittels Regeln der Schaltalgebra – Einfach oder schwer?
Vorgehensweise und Methoden – Die richtige Strategie?
Synthese durch Anwendung der Schaltalgebra
Übungen: Synthese von Schaltnetzen
Kapitel 14: Synthese mittels Minimierung der Schaltfunktionen mit den Karnaugh-Veitch-Tafeln – Kann man darauf schreiben?
Ein Rückblick
Konstruktion einer KV-Tafel
KV-Tafel für zwei Variablen
KV-Tafel für drei Variablen
KV-Tafel für vier Variablen
KV-Tafel für fünf Variablen
KV-Tafel für sechs Variablen
Redundanzen
Konjunktive Minimalform (KMF)
Schaltnetze mit Mehrfachausgängen
Konforme Terme zur Vereinfachung von Schaltnetzen
Zusammenfassung der Vorgehensweise bei der Minimierung mit den KV-Tafeln
Übungen: Minimierung von Schaltfunktionen
Kapitel 15: Synthese mittels Minimierung der Schaltfunktionen mit dem Verfahren nach Quine und McCluskey – Ist das ein Pärchen?
Ein Rückblick
Das Verfahren nach Quine und McCluskey
Durchführung des Verfahrens nach Quine und McCluskey
Übungen: Minimierung nach Quine und McCluskey
Teil VII: Verwendete grafische Symbole und deren Systematik – Zum Nachschlagen
Kapitel 16: Grafische Symbole der Digitaltechnik – Strichzeichnungen, oder was?
Allgemeines zu den grafischen Symbolen der Digitaltechnik
Anwendungsbereich und verwendete Begriffe für die grafischen Symbole
Aufbau der grafischen Symbole
Kapitel 17: Weitere verwendete grafische Symbole – Was denn noch?
Teil VIII: Logische und physikalische Beziehungen in der Digitaltechnik, Technologien und Kenndaten der Logikfamilien
Kapitel 18: Zusammenhänge der logischen und physikalischen Eigenschaften in der Digitaltechnik – Logik trifft Physik
Logische Zustände und Logikpegel der Logik-Elemente bei positiver und negativer Logik
Polaritätsindikator (Logik-Polarität)
Ausgangsschaltungen
Wired-/verdrahtete Verknüpfungen
Übungen: Logische und physikalische Beziehungen
Kapitel 19: Halbleitertechnologien, Eigenschaften und Kennzeichnungen der Logik-Elemente – Kurz und gut
Halbleitertechnologien und deren Eigenschaften
Anforderungen an die Logik-Elemente und deren Entwurf
Interne Struktur der Logik-Elemente
Überblick über die Logikfamilien und deren Kennzeichnungen
Kapitel 20: Kenndaten der Logik-Elemente – Schnell und sicher
Stationäre Kenndaten
Dynamische Kenndaten
Störsicherheit
Kompatibilität der Logikfamilien
Auswahl geeigneter Logikfamilien
Teil IX: Standardschaltnetze, die immer wieder benötigt werden – Man nutze möglichst vorhandene Dinge
Kapitel 21: Code-Umsetzer – Zum besseren Verständnis
Was sind Standardschaltnetze?
Definition Code-Umsetzer
Beispiele für Code-Umsetzer
Entwurf eines Code-Umsetzers
Beispiel Code-Umsetzer SN74LS138
Anwendungsbeispiel des Code-Umsetzers SN74ACT138
Übersicht einer Auswahl verfügbarer Code-Umsetzer
Übungen: Code-Umsetzer
Kapitel 22: Multiplexer und Demultiplexer – Mal rein, mal raus
Multiplexer und Demultiplexer im Zusammenspiel
Multiplexer
Demultiplexer
Übungen: Multiplexer und Demultiplexer
Kapitel 23: Komparatoren (Vergleicher) – Jetzt wird verglichen
Aufgabe und Arbeitsweise eines Komparators
Entwurf von Komparatoren
Beispiel für einen 4-Bit-Komparator SN74LS85
Erweiterung der Komparatoren durch Kaskadierung
Übersicht einer Auswahl verfügbarer Komparatoren
Weitere Anwendung für Komparatoren
Übungen: Komparatoren
Kapitel 24: Arithmetische Logik-Elemente – Jetzt wird abgerechnet
Funktionen der arithmetischen Logik-Elemente
Halbaddierer
Volladdierer
Übersicht einer Auswahl arithmetischer Logik-Elemente
4-Bit-Volladdierer (Vollsubtrahierer) SN74LS283
4-Bit-Übertragsgenerator SN54S182
4-Bit-Arithmetisch-Logische-Einheit (ALU) SN54LS181
Übungen: Arithmetische Logik-Elemente
Teil X: Schaltwerke und deren Grundstrukturen – Takt für Takt geht es weiter
Kapitel 25: Beschreibungsmittel für Schaltwerke, deren Grundstrukturen und Betriebsarten – Wie geht das?
Zustandsdiagramm und Zustandsfolgetabelle als Beschreibungsmittel für zustandsabhängige Schaltsysteme
Grundstruktur der Schaltnetze versus Schaltwerke
Endliche Zustandsautomaten
Struktur eines Mealy-Automaten
Struktur eines Moore-Automaten
Asynchroner und synchroner Betrieb von Automaten
Teil XI: Bistabile, monostabile und astabile Elemente für spezielle Funktionen – Speicher braucht der Mensch, was sonst?
Kapitel 26: Flipflops (bistabile Kippglieder) – Stabiler geht es nicht
Unterschiede der bistabilen, monostabilen und astabilen Elemente
Klassifizierung der Flipflops (bistabile Kippglieder)
Zustandsgesteuerte Flipflops
Flankengesteuerte Flipflops
Ausführungsformen der Flipflops (bistabiler Kippglieder)
Zustandsfolge- und Synthesetabellen der Flipflops
Konvertierung von Flipflop-Typen
Übersicht einer Auswahl verfügbarer Flipflops
Übungen: Flipflops (Kippglieder)
Kapitel 27: Monostabile und astabile Elemente/Kippglieder – Mal so und mal so
Monostabile Elemente
Astabile Elemente
Teil XII: Synthese von endlichen Zustandsautomaten – Es läuft und läuft im Takt
Kapitel 28: Synthese von Automaten – Ablaufsteuerung oder Zähler?
Entwurf von Automaten
Übungen: Synthese von Automaten
Teil XIII: Zähler und Schieberegister – Alles im Takt
Kapitel 29: Asynchrone und synchrone Zähler – Jetzt geht es auf und ab
Anwendungsgebiete und Betriebsarten der Zähler
Asynchrone Zähler – Entwurf und Funktion
Synchrone Zähler – Synthese und Funktion
Übersicht einer Auswahl verfügbarer asynchroner und synchroner Zähler
Übungen: Zähler
Kapitel 30: Auffang- und Schieberegister – Jetzt wird gefangen und geschoben, ja bitte
Betriebsart und Anwendungsgebiete der Auffang- oder Schieberegister
Aufbau und Entwurf der Auffangregister
Aufbau und Entwurf der Schieberegister
Übersicht einer Auswahl verfügbarer Schieberegister
Übungen: Register
Teil XIV: Der Top-Ten-Teil
Top 1: Wichtige Grundlagen, die Sie verinnerlichen sollten
Top 2: Wichtige grundlegende Arbeiten der Väter der Digitaltechnik
Top 3: Besonders zu empfehlende Literatur zur Digitaltechnik – meine Lieblingsbücher
Top 4: Weiterführende Literatur
Top 5: Ein kostenfreies Simulationswerkzeug
Top 6: Ein Simulationswerkzeug für Profis
Top 7: Die wohl beste Internetquelle für Logik-Elemente
Top 8: Die wichtigste Norm für grafische Symbole der Digitaltechnik
Top 9: Weitere wichtige Normen
Top 10: Definitionen zur Digitaltechnik
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Sonderfälle der Umwandlung für Zahlensysteme
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Fallunterscheidung bei der Arithmetik zweier Variablen mit n-stellig...
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Zusammenstellung der Steuerzeichen des 7-Bit-Codes nach DIN 66003...
Tabelle 6.2: Zusammenstellung der Sonderzeichen des 8-Bit-Codes nach DIN 66303
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Mathematische Zeichen und Symbole in Anlehnung an DIN 66000:1985-11
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Häufig verwendete Abhängigkeitsnotationen nach DIN EN 60617 Teil 12...
Kapitel 19
Tabelle 19.1: Maßnahmen zur Optimierung der Eigenschaften einer Logikfamilie
Kapitel 20
Tabelle 20.1: Stationäre Kenndaten der Logikfamilien
Tabelle 20.2: Stationäre Ströme der Logikfamilien für ein 4-fach-NAND-Logik-Eleme...
Tabelle 20.3: Stationäre Kenndaten Fan-In und Fan-Out der Logikfamilien
Tabelle 20.4: Fan-Out einiger bipolarer Logikfamilien
Tabelle 20.5: Leistungsaufnahme der Logikfamilien für ein 4-fach-NAND-Logik-Eleme...
Tabelle 20.6: Umgebungs- und Lagertemperatur der Logikfamilien
Tabelle 20.7: Dynamische Kenndaten der Logikfamilien
Tabelle 20.8: Verzögerungszeiten der Logikfamilien für ein 4-fach-NAND-Logik-Elem...
Tabelle 20.9: Dynamische Kenndaten für Flipflops der Logikfamilien
Tabelle 20.10: Übersicht der Störspannungs- und Rauschabstände der Logikfamilien
Tabelle 20.11: Kompatibilität der 5-V-Logikfamilien TTL, LS, AHC/AHCT und ABT am ...
Kapitel 21
Tabelle 21.1: Beispiele einer Auswahl verfügbarer Code-Umsetzer Teil 1
Tabelle 21.2: Beispiele einer Auswahl verfügbarer Code-Umsetzer Teil 2
Kapitel 22
Tabelle 22.1: Übersicht einer Auswahl verfügbarer 2-, 4-, and 8-Kanal-Multiplexer...
Tabelle 22.2: Übersicht einer Auswahl verfügbarer 4-, 8- und 16-Kanal-Demultiplex...
Tabelle 22.3: Weitere Anwendungsfälle für Demultiplexer
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Übersicht einer Auswahl verfügbarer Komparatoren
Kapitel 24
Tabelle 24.1: Übersicht einer Auswahl verfügbarer arithmetischer Logik-Elemente
Kapitel 26
Tabelle 26.1: Klassifizierung der Flipflops (bistabile Kippglieder)
Tabelle 26.2: Übersicht einer Auswahl einiger verfügbarer RS-, JK- und D-Flipflop...
Kapitel 27
Tabelle 27.1: Übersicht einer Auswahl verfügbarer monostabiler Elemente
Tabelle 27.2: Übersicht einer Auswahl verfügbarer astabiler Elemente
Kapitel 29
Tabelle 29.1: Anwendungsgebiete von Zählern
Tabelle 29.2: Vor- und Nachteile der asynchronen und synchronen Zähler
Tabelle 29.3: Übersicht einer Auswahl verfügbarer asynchroner Zähler
Tabelle 29.4: Übersicht einer Auswahl verfügbarer synchroner Zähler
Kapitel 30
Tabelle 30.1: Anwendungsgebiete von Schieberegistern
Tabelle 30.2: Übersicht einer Auswahl verfügbarer Auffangregister mit 4 und 8 Kan...
Tabelle 30.3: Übersicht, Auswahl verfügbarer Auffangregister mit 8 und 16 Kanälen
Tabelle 30.4: Übersicht einer Auswahl verfügbarer Schieberegister mit 4, 8 und 16...
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Darstellung eines analogen (a) und digitalen Signals (b)
Abbildung 1.2: Darstellung eines binären Signals
Abbildung 1.3: Abgrenzung des Fachgebiets Digitaltechnik von der Analogtechnik
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Übersicht der gebräuchlichsten polyadischen Zahlensysteme und dere...
Abbildung 2.2: Algorithmus zur Zahlenumwandlung einer Dezimalzahl bei unterschied...
Abbildung 2.3: Umwandlung der Vorkommastellen einer Dezimalzahl in eine Dual- und...
Abbildung 2.4: Umwandlung der Nachkommastellen einer Dezimalzahl in eine Dual- un...
Abbildung 2.5: Umwandlung der Vorkommastellen einer Dual- und einer Sedezimalzahl...
Abbildung 2.6: Umwandlung der Nachkommastellen einer Dual- und einer Sedezimalzah...
Abbildung 2.7: Beispiel zur Umwandlung der Zahlensysteme Dual nach Oktal und umge...
Abbildung 2.8: Beispiel zur Umwandlung der Zahlensysteme Dual nach Sedezimal und ...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Addition natürlicher (a) und gebrochener Zahlen (b) im dezimalen u...
Abbildung 3.2: Subtraktion natürlicher (a) und gebrochener Zahlen (b) im dezimale...
Abbildung 3.3: Multiplikation natürlicher (a) und gebrochener Zahlen (b) im dezim...
Abbildung 3.4: Division natürlicher (a) und gebrochener Zahlen (b) im dezimalen u...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Darstellungsmöglichkeiten für negative Zahlen
Abbildung 4.2: Arithmetik im Zweierkomplement am Zahlenring eines vierstelligen d...
Abbildung 4.3: Überträge und Überlauf bei der Addition n-stelliger Dualzahlen
Abbildung 4.4: Überlauf bei der Addition vierstelliger Dualzahlen
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Darstellung eines vierstelligen Dualcodes mit Bewertungskriterien
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Übersicht zur Unterteilung der Binärcodes mit Beispielen
Abbildung 6.2: Beispiel für einen bewertbaren Wortcode
Abbildung 6.3: Darstellung des n-stelligen Dualcodes mit Bewertungskriterien
Abbildung 6.4: Beispiel für einen Anordnungscode
Abbildung 6.5: Konstruktion und Bewertungskriterien des Gray-Codes
Abbildung 6.6: Prinzip eines Codelineals (a) und einer Codierscheibe (b) am Beisp...
Abbildung 6.7: Beispiel für einen bewertbaren Zifferncode
Abbildung 6.8: Darstellung des 8-4-2-1-Codes (BCD-Code) mit Bewertungskriterien
Abbildung 6.9: Darstellung des Aiken-Codes mit Bewertungskriterien
Abbildung 6.10: Darstellung des BCD-Zählcodes mit Bewertungskriterien
Abbildung 6.11: Beispiel für einen Ziffernanordnungscode
Abbildung 6.12: Darstellung des Libaw-Craig-Codes mit Bewertungskriterien
Abbildung 6.13: Darstellung des Stibitz-Codes (Exzess-3-Code) mit Bewertungskrite...
Abbildung 6.14: 7-Bit-Code nach DIN 66003 (ASCII-Code)
Abbildung 6.15: 8-Bit-Code nach DIN 66303
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Entwicklung der Hamming-Distanz bei einem 3-stelligen Dualcode
Abbildung 7.2: Korrigierbarkeit eines Codes für eine ungerade Hamming-Distanz
Abbildung 7.3: Korrigierbarkeit eines Codes für eine gerade Hamming-Distanz
Abbildung 7.4: Entwicklung eines vierstelligen Codes mit einer Hamming-Distanz vo...
Abbildung 7.5: Codetabelle des 4-stelligen Binärcodes mit einer Hamming-Distanz d...
Abbildung 7.6: Wahrheitstabelle und KV-Tafeln für 2- bis 4-stellige Binärcodes
Abbildung 7.7: Entwurf eines 4-stelligen Codes mit einer KV-Tafel
Abbildung 7.8: Paritätsbitbildung am Beispiel des 8-4-2-1-Codes
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Wahrheitstabelle für zwei Variablen
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Regeln für logische Verknüpfungen mit Konstanten
Abbildung 9.2: Regeln für logische Verknüpfungen von Variablen und Konstanten
Abbildung 9.3: Gesetze (Regeln) für logische Verknüpfungen von Variablen
Abbildung 9.4: De Morgan'sche Theoreme
Abbildung 9.5: Mögliche Schaltfunktionen und Sprechweisen für eine Variable in An...
Abbildung 9.6: Mögliche Schaltfunktionen und Sprechweisen für zwei Variablen in A...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Gegenüberstellung grafischer Symbole für Schaltpläne in alten und...
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Mögliche Minterme einer Schaltfunktion mit drei Variablen am Beis...
Abbildung 11.2: Mögliche Maxterme einer Schaltfunktion mit drei Variablen am Beis...
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Gegebenes Schaltnetz für die Analyse zur Ermittlung der Wahrheits...
Abbildung 12.2: Schrittweise Ermittlung der Wahrheitstabelle für ein gegebenes Sc...
Abbildung 12.3: Analyse eines gegebenen Schaltnetzes durch Einführen von Teilfunk...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Wahrheitstabelle für die Ampel einer Tiefgaragenzufahrt
Abbildung 13.2: Schaltnetz (Schaltung) der Zufahrtskontrolle für eine Tiefgarage
Abbildung 13.3: Minimierte(s) Schaltnetz (Schaltung) der Zufahrtsk...
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Wahrheitstabelle und KV-Tafel für 2 Variablen, a) Wahrheitstabell...
Abbildung 14.2: Minimierung einer Schaltfunktion am Beispiel einer KV-Tafel mit 2...
Abbildung 14.3: Beispiel für einen 4er-Vereinfachungsblock bei 2 Variablen, a) Wa...
Abbildung 14.4: Wahrheitstabelle und KV-Tafel für 3 Variablen, a) Wahrheitstabell...
Abbildung 14.5: Minimierung für 3 Variablen mit einem 4er- und 2er-Vereinfachungs...
Abbildung 14.6: Beispiele für Vereinfachungsblöcke bei 3 Variablen, a) 8er, b) 4e...
Abbildung 14.7: Wahrheitstabelle und KV-Tafel für 4 Variablen, a) Wahrheitstabell...
Abbildung 14.8: Minimierung für 4 Variablen mit einem 8er-, 4er- und 2er-Vereinfa...
Abbildung 14.9: Beispiele für Vereinfachungsblöcke bei 4 Variablen, a) 16er, b) 8...
Abbildung 14.10: Wahrheitstabelle und KV-Tafel für 5 Variablen, a) Wahrheitstabel...
Abbildung 14.11: Beispiele für Vereinfachungsblöcke bei 5 Variablen, a) 16er und ...
Abbildung 14.12: Wahrheitstabelle und KV-Tafel für 6 Variablen, a) Wahrheitstabel...
Abbildung 14.13: Beispiele für Vereinfachungsblöcke bei 6 Variablen, a) 16er, 8er...
Abbildung 14.14: Nutzung der Redundanzen für die Schaltfunktion bei einem Beispie...
Abbildung 14.15: Bildung der KMF aus der DMF der negierten Schaltfunktion, a) Wah...
Abbildung 14.16: Mehrfachausgänge für eine Adressierung von Baugruppen an einem 8...
Abbildung 14.17: Entwurf eines Schaltnetzes ohne konforme Terme, a) Wahrheitstabe...
Abbildung 14.18: Entwurf eines Schaltnetzes mit einem konformen Term, a) Wahrheit...
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Beispiel einer Wahrheitstabelle für eine Schaltfunktion mit vier ...
Abbildung 15.2: Gruppenunterteilung der Minterme für das Verfahren nach Quine und...
Abbildung 15.3: 1. Zusammenfassung der Minterme beim Verfahren nach Quine und McC...
Abbildung 15.4: 2. Zusammenfassung der Minterme beim Verfahren nach Quine und McC...
Abbildung 15.5: Primimplikantentafel
Abbildung 15.6: Ermittlung der Kernprimimplikanten
Abbildung 15.7: Implikanten der Kernprimimplikanten
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Veranschaulichung logischer Zustände und Logikpegel
Abbildung 16.2: Grafische Grunddarstellung eines Symbols mit Kennzeichnungen
Abbildung 16.3: Konturen eines grafischen Symbols
Abbildung 16.4: Anordnungen der Konturen eines Elements (a–c) allgemein (d) für e...
Abbildung 16.5: Anordnung eines Steuerblocks und dessen Wirkung auf Elemente
Abbildung 16.6: Negation an Ein- und Ausgängen
Abbildung 16.7: Polaritätsindikatoren an Ein- und Ausgängen
Abbildung 16.8: Dynamische Eingänge
Abbildung 16.9: Interne Verbindungen
Abbildung 16.10: Retardierter Ausgang
Abbildung 16.11: Offene Ausgänge in verschiedenen Varianten
Abbildung 16.12: Ausgangsschaltungen für einen offenen Emitter (a) und offenen Ko...
Abbildung 16.13: Tri-State/3-State-Ausgang
Abbildung 16.14: Freigabeeingang
Abbildung 16.15: Flipflop-Eingänge
Abbildung 16.16: Schieberegistereingänge
Abbildung 16.17: Zählereingänge
Abbildung 16.18: Multibit/Mehrfache Ein- und Ausgänge
Abbildung 16.19: Eingänge von Komparatoren
Abbildung 16.20: Ausgänge von Komparatoren
Abbildung 16.21: Ein- und Ausgänge arithmetischer Elemente Teil 1
Abbildung 16.22: Ein- und Ausgänge arithmetischer Elemente Teil 2
Abbildung 16.23: INHALTS-Ein- und -Ausgänge
Abbildung 16.24: Kennzeichnung und Wirkung einer UND-Abhängigkeit
Abbildung 16.25: Beispiel für eine UND-Abhängigkeit
Abbildung 16.26: Kennzeichnung und Wirkung einer ODER-Abhängigkeit
Abbildung 16.27: Beispiel für eine ODER-Abhängigkeit
Abbildung 16.28: Kennzeichnung und Wirkung einer NEGATIONS-Abhängigkeit
Abbildung 16.29: Beispiel für eine NEGATIONS-Abhängigkeit
Abbildung 16.30: Kennzeichnung und Wirkung einer VERBINDUNGS-Abhängigkeit
Abbildung 16.31: Beispiel für eine VERBINDUNGS-Abhängigkeit
Abbildung 16.32: Kennzeichnung und Wirkung einer STEUER-Abhängigkeit
Abbildung 16.33: Beispiele für die STEUER-Abhängigkeit bei Flipflops
Abbildung 16.34: Kennzeichnung und Wirkung der SETZ- und RÜCKSETZ-Abhängigkeit
Abbildung 16.35: Beispiele für eine SETZ- und RÜCKSETZ-Abhängigkeit
Abbildung 16.36: Kennzeichnung und Wirkung der FREIGABE-Abhängigkeit
Abbildung 16.37: Beispiele für eine FREIGABE-Abhängigkeit
Abbildung 16.38: Kennzeichnung und Wirkung der MODUS-Abhängigkeit
Abbildung 16.39: Beispiele für eine MODUS-Abhängigkeit
Abbildung 16.40: Kennzeichnung und Wirkung der ADRESSEN-Abhängigkeit
Abbildung 16.41: Beispiele für eine ADRESSEN-Abhängigkeit
Abbildung 16.42: Symbole für Schaltnetze
Abbildung 16.43: Code-Umsetzer in allgemeiner Form
Abbildung 16.44: Beispiele Code-Umsetzer
Abbildung 16.45: Multiplexer und Demultiplexer in allgemeiner Form
Abbildung 16.46: Beispiele für einen Multiplexer und einen Demultiplexer
Abbildung 16.47: Arithmetische Elemente in allgemeiner Form
Abbildung 16.48: Beispiele für einen Addierer und Subtrahierer
Abbildung 16.49: Beispiele für einen Übertragsgenerator und einen Multiplizierer
Abbildung 16.50: Beispiel für einen Komparator (zum Beispiel SN 74/S/LS/HC CD74HC...
Abbildung 16.51: Beispiel für eine Arithmetisch-Logische Recheneinheit (zum Beisp...
Abbildung 16.52: Übersicht bistabile Elemente (Flipflops)
Abbildung 16.53: Beispiele für bistabile Elemente
Abbildung 16.54: Monostabile Elemente
Abbildung 16.55: Astabile Elemente Teil 1
Abbildung 16.56: Astabile Elemente Teil 2
Abbildung 16.57: Schieberegister und Zähler
Abbildung 16.58: Beispiele Schieberegister und Zähler
Abbildung 16.59: Speicher
Abbildung 16.60: Beispiele Speicher
Abbildung 16.61: Anzeigeelemente (Displays)
Abbildung 16.62: Beispiele Anzeigeelemente (Displays)
Abbildung 16.63: Bussymbole und Datenleitungen
Abbildung 16.64: Beispiele für Bussymbole und Datenleitungen
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Symbole für Masseanschlüsse
Abbildung 17.2: Symbole für Verbindungen und Anschlüsse
Abbildung 17.3: Symbole für passive Bauelemente
Abbildung 17.4: Symbole für Halbleiter Teil 1
Abbildung 17.5: Symbole für Halbleiter Teil 2
Abbildung 17.6: Symbole für Schalter
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Logische Zustände (Logikzustände) und Logikpegel der Logik-Elemen...
Abbildung 18.2: Arbeitstabelle für die positive und negative Logik am Beispiel ei...
Abbildung 18.3: Übersicht der logischen Verknüpfungen für positive und negative L...
Abbildung 18.4: Kennzeichnung der Negation logischer Zustände von Logik-Elementen
Abbildung 18.5: Kennzeichnung externer Logikpegel von Logik-Elementen mit einem P...
Abbildung 18.6: Beispiel für die Anwendung des Polaritätsindikators
Abbildung 18.7: Zulässige Kennzeichnung eines Logik-Elements mit dem Negationssym...
Abbildung 18.8: Varianten von Ausgangsschaltungen der Logik-Elemente mit Bipolart...
Abbildung 18.9: Tri-State/3-State-Ausgänge für Bussysteme und Datenleitungen
Abbildung 18.10: LOW-dominantes (L-Typ) Verhalten bei der Verbindung von offenen ...
Abbildung 18.11: Transistoren als Schalter für die Realisierung eines offenen Aus...
Abbildung 18.12: Symbole für die Kennzeichnung offener Ausgänge
Abbildung 18.13: Bildung der Wired-AND- und Wired-OR-Verknüpfungen
Abbildung 18.14: Wired-AND-Verknüpfung am Beispiel zweier 1/4 NAND-Verknüpfungsgl...
Kapitel 19
Abbildung 19.1: Übersicht Halbleitertechnologien
Abbildung 19.2: Interne Struktur der Logik-Elemente
Abbildung 19.3: Interne Schaltung des Standard-TTL-Logik-Elements SN 7400
Abbildung 19.4: Interne Schaltung ohne Eingangsschutzbeschaltung des CMOS-Logik-E...
Abbildung 19.5: Typisches Schema für die interne Schaltung eines BICMOS-Inverter-...
Abbildung 19.6: Bedeutung der Kennbuchstaben der wichtigsten Logikfamilien
Abbildung 19.7: Kennzeichnung der Logikfamilien Texas Instruments Teil 1
Abbildung 19.8: Kennzeichnung der Logikfamilien Texas Instruments Teil 2
Abbildung 19.9: Übersicht Logikfamilien
Abbildung 19.10: Übersicht einiger typischer Gehäusebauformen
Kapitel 20
Abbildung 20.1: Stationäre Spannungswerte der verschiedenen Logikfamilien
Abbildung 20.2: Übertragungskennlinien von TTL/CMOS/BICMOS-Logik-Elementen
Abbildung 20.3: Definitionen der maximalen Taktfrequenz, Verzögerungs- und Überga...
Abbildung 20.4: Vorbereitungs-/Setup- und Haltezeit/Hold Time von den Flipflops d...
Abbildung 20.5: Störspannungs- und Rauschabstände der Logikfamilien
Abbildung 20.6: Dynamische Störsicherheit am Beispiel von Standard 5 V TTL
Abbildung 20.7: Definitionen der Ein- und Ausgangsspannungen zur Kompatibilität d...
Abbildung 20.8: Treiberfähigkeit versus Verzögerungszeiten aktueller Logikfamilie...
Kapitel 21
Abbildung 21.1: Beispiele für Code-Umsetzer
Abbildung 21.2: Entwurf eines individuellen 3-stelligen tabellengesteuerten Code-...
Abbildung 21.3: Beispiel für einen Binär-Oktal-Code-Umsetzer/8-Kanal-Demultiplexe...
Abbildung 21.4: Anwendungsbeispiel für einen BIN/OCT-Code-Umsetzer in einem Mikro...
Kapitel 22
Abbildung 22.1: Schema von Multiplexer und Demultiplexer im Zusammenspiel
Abbildung 22.2: Symbole für Multiplexer und Demultiplexer und deren Zusammenwirke...
Abbildung 22.3: Entwurf eines 2-Kanal-Multiplexers
Abbildung 22.4: Beispiel für einen 8-Kanal-Multiplexer SN74LS151
Abbildung 22.5: Entwurf eines Schaltnetzes für drei Variablen mit einem 8-Kanal-M...
Abbildung 22.6: Entwurf eines Schaltnetzes für drei Variablen mit einem 4-Kanal-M...
Abbildung 22.7: Entwurf eines Schaltnetzes für vier Variablen mit zwei 4-Kanal-Mu...
Abbildung 22.8: Entwurf eines 2-Kanal-Demultiplexers
Abbildung 22.9: Beispiel für einen 8-Kanal-Demultiplexer SN74LS138
Kapitel 23
Abbildung 23.1: Symbol und Arbeitstabelle für einen 4-Bit-Komparator
Abbildung 23.2: Entwurf eines 2-Bit-Komparators
Abbildung 23.3: Beispiel für einen kaskadierbaren 4-Bit-Komparator SN74LS85
Abbildung 23.4: Serienerweiterung durch Kaskadierung eines Komparators SN74LS85
Abbildung 23.5: Parallelerweiterung durch Kaskadierung eines Komparators SN74LS85
Kapitel 24
Abbildung 24.1: Symbol und Entwurf eines Halbaddierers
Abbildung 24.2: Symbol und Entwurf eines Volladdierers
Abbildung 24.3: 4-Bit-Volladdierer durch Erweiterung mit Serienübertrag (Carry Ri...
Abbildung 24.4: Entwurf eines Übertragsgenerators
Abbildung 24.5: 4-Bit-Volladdierer mit einem Übertragsgenerator und Parallelübert...
Abbildung 24.6: 4-Bit-Volladdierer SN74LS283
Abbildung 24.7: 4-Bit-Übertragsgenerator SN54S182
Abbildung 24.8: 4-Bit-Arithmetisch-Logische-Einheit (ALU) SN54LS181
Kapitel 25
Abbildung 25.1: Grafische Darstellung von Zuständen eines Schaltsystems
Abbildung 25.2: Zustandsfolgetabelle und Zustandsdiagramm als Beschreibungsmittel...
Abbildung 25.3: Zustandsfolgetabelle und Zustandsdiagramm als Beschreibungsmittel...
Abbildung 25.4: Struktur eines Schaltnetzes
Abbildung 25.5: Struktur eines Schaltwerks
Abbildung 25.6: Struktur Mealy-Automat
Abbildung 25.7: Struktur Moore-Automat
Abbildung 25.8: Synchroner Betrieb eines Mealy-Automaten
Kapitel 26
Abbildung 26.1: Symbol eines Basis-RS-Flipflops
Abbildung 26.2: Analyse eines Basis-RS-Flipflops
Abbildung 26.3: Entwurf eines Basis-RS-Flipflops mit NAND-Verknüpfungen
Abbildung 26.4: Anwendungsbeispiel Entprellschaltung für einen Wechsler mit Unter...
Abbildung 26.5: Entwurf eines RS-Flipflops mit Setzvorgang
Abbildung 26.6: RS-Flipflops mit besonderen Eigenschaften
Abbildung 26.7: Entwurf eines einzustandsgesteuerten RS-Flipflops mit Taktsteueru...
Abbildung 26.8: Entwurf eines einzustandsgesteuerten RS-Flipflops mit Taktsteueru...
Abbildung 26.9: Einzustandsgesteuertes D-Flipflop mit Taktsteuerung
Abbildung 26.10: Anwendungsbeispiele für D-Flipflops
Abbildung 26.11: Kennzeichnung retardierter Ausgänge bei Flipflops mit Zwischensp...
Abbildung 26.12: Zweizustandsgesteuertes RS-Flipflop mit Taktsteuerung und Zwisch...
Abbildung 26.13: Zweizustandsgesteuertes JK-Flipflop mit Taktsteuerung und Zwisch...
Abbildung 26.14: Zweizustandsgesteuertes D-Flipflop mit Taktsteuerung und Zwische...
Abbildung 26.15: Zweizustandsgesteuertes T-Flipflop mit Taktsteuerung und Zwische...
Abbildung 26.16: Kennzeichnung dynamischer Eingänge
Abbildung 26.17: Einzustandsgesteuertes RS-Flipflop mit Taktflankensteuerung
Abbildung 26.18: Einzustandsgesteuertes JK-Flipflop mit Taktflankensteuerung
Abbildung 26.19: Einzustandsgesteuertes D-Flipflop mit Taktflankensteuerung
Abbildung 26.20: Einzustandsgesteuertes T-Flipflop mit Taktflankensteuerung
Abbildung 26.21: Zweizustandsgesteuertes RS-Flipflop mit Taktflankensteuerung und...
Abbildung 26.22: Zweizustandsgesteuertes JK-Flipflop mit Taktflankensteuerung und...
Abbildung 26.23: Zweizustandsgesteuertes D-Flipflop mit Taktflankensteuerung und ...
Abbildung 26.24: Zweizustandsgesteuertes T-Flipflop mit Taktflankensteuerung und ...
Abbildung 26.25: Mögliche Ausführungsformen der Flipflops
Abbildung 26.26: Zustandsfolge- und Synthesetabellen der Flipflops
Abbildung 26.27: Konvertierung eines JK-Flipflops in ein RS-Flipflop mit Rücksetz...
Kapitel 27
Abbildung 27.1: Benennung, Funktion und Symbole für monostabile Elemente
Abbildung 27.2: Beispiel Präzisionstimer xx555 und vereinfachter interner Aufbau
Abbildung 27.3: Beispiel für ein nicht retriggerbares monostabiles Element mit de...
Abbildung 27.4: Benennung, Funktion und Symbole für astabile Elemente
Abbildung 27.5: Beispiel für ein astabiles Element mit dem Präzisionstimer xx555 ...
Kapitel 28
Abbildung 28.1: Geeignetes zweizustandsgesteuertes D-Flipflop mit Taktflankensteu...
Abbildung 28.2: Definitionen der Zustände, Ereignisse/Übergangsbedingungen und Ak...
Abbildung 28.3: Zustandsdiagramm mit den Benennungen
Abbildung 28.4: Zustandsdiagramm mit den Kurzbezeichnungen
Abbildung 28.5: Codierung der Zustände, Ereignisse und Aktionen
Abbildung 28.6: Zustandsfolgetabelle mit den Benennungen
Abbildung 28.7: Zustandsfolgetabelle mit den Kurzbezeichnungen
Abbildung 28.8: Entwurf des Schaltnetzes der Überführungsfunktion
Abbildung 28.9: Entwurf des Schaltnetzes der Ausgabefunktion
Abbildung 28.10: Schaltung des Bonbonautomaten mit zweizustandsgesteuerten D-Flip...
Kapitel 29
Abbildung 29.1: Zustandsfolgetabelle und Zustandsdiagramm eines Modulo-8-Zählers
Abbildung 29.2: Konstruktion eines asynchronen Modulo-8-Zählers mit zweizustandsg...
Abbildung 29.3: Impulsdiagramm eines asynchronen Modulo 8-Zählers mit zweizustand...
Abbildung 29.4: Beispiel für einen asynchronen binären 4-Bit-Zähler (Modulo-16-Zä...
Abbildung 29.5: Anwendungsbeispiel eines asynchronen binären 8-Bit-Zählers durch ...
Abbildung 29.6: Arbeitsweise eines Modulo-5-Zählers
Abbildung 29.7: Einflankengesteuertes RS-Flipflop mit negativer Taktflankensteuer...
Abbildung 29.8: Entwurf der Überführungsfunktion eines Modulo-5-Zählers mit RS-Fl...
Abbildung 29.9: Entwurf der Ausgabefunktion (Übertragsschaltnetz) für einen Modul...
Abbildung 29.10: Untersuchung des Zählerverhaltens der Pseudozustände bei einem M...
Abbildung 29.11: Synchrones Schaltwerk eines Modulo-5-Zählers mit RS-Flipflops
Abbildung 29.12: Entwurf der Überführungsfunktion eines Modulo-5-Zählers mit JK-F...
Abbildung 29.13: Untersuchung des Zählerverhaltens der Pseudozustände bei einem M...
Abbildung 29.14: Synchrones Schaltwerk eines Modulo-5-Zählers mit JK-Flipflops
Abbildung 29.15: Entwurf der Überführungsfunktion eines Modulo-5-Zählers mit D-Fl...
Abbildung 29.16: Untersuchung des Zählerverhaltens der Pseudozustände bei einem M...
Abbildung 29.17: Synchrones Schaltwerk eines Modulo-5-Zählers mit D-Flipflops
Abbildung 29.18: Zustandsfolgetabelle, Zustandsdiagramm und Impulsdiagramm eines ...
Abbildung 29.19: Entwurf der Überführungsfunktion eines Modulo-8-Abwärtszählers m...
Abbildung 29.20: Synchrones Schaltwerk eines Modulo-8-Abwärtszählers mit JK-Flipf...
Abbildung 29.21: Symbol, Zählfolge und Zustandsdiagramm eines Modulo-6-Auf-/Abwär...
Abbildung 29.22: Impulsdiagramm eines Modulo-6-Auf-/Abwärtszählers mit zweiflanke...
Abbildung 29.23: Zustandsfolgetabelle eines Modulo-6-Auf-/Abwärtszählers mit der ...
Abbildung 29.24: Entwurf der Überführungsfunktion für einen Modulo-6-Auf-/Abwärts...
Abbildung 29.25: Entwurf der Ausgabefunktion für den Übertrag eines Modulo-6-Auf-...
Abbildung 29.26: Untersuchung des Zählerverhaltens der Pseudozustände bei einem M...
Abbildung 29.27: Synchrones Schaltwerk eines Modulo-6-Auf-/Abwärtszählers mit D-F...
Abbildung 29.28: Beispiel eines synchronen 4-Bit-Binärzählers (Modulo-16-Zähler) ...
Abbildung 29.29: Bespiel eines zweistufigen synchronen 8-Bit-Binärzählers mit Ser...
Kapitel 30
Abbildung 30.1: Anwendungsfall eines Auffangregisters
Abbildung 30.2: Symbol und Entwurf eines 4-Bit-Auffangregisters
Abbildung 30.3: Beispiel 8-Bit-Auffangregister SN74ALS573C
Abbildung 30.4: Symbol und Entwurf eines 4-Bit-Schieberegisters mit Impulsdiagram...
Abbildung 30.5: Entwurf eines n-Bit-Parallel-/Serienumsetzers
Abbildung 30.6: Entwurf eines n-Bit-Serien-/Parallelumsetzers
Abbildung 30.7: Allgemeine Form eines n-Bit-Schieberegisters mit Rückkopplung der...
Abbildung 30.8: Johnson-Zähler nach dem Libaw-Craig-Code mit einem 5-Bit-Schieber...
Abbildung 30.9: n-Bit-Schieberegister mit antivalenter Überführungsfunktion
Abbildung 30.10: Beispiel eines 3-Bit-Pseudo-Zufallsgenerators mit antivalenter Ü...
Abbildung 30.11: 3-Bit-Zähler mit einem 3-stufigen Schieberegister
Abbildung 30.12: Entwurf eines Modulo-8-Zählers mit einem dreistufigen Schiebereg...
Abbildung 30.13: Beispiel 4-Bit-Schieberegister SN54LS195A
Abbildung 30.14: Interner Aufbau des 4-Bit-Schieberegisters SN54LS195A
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
193
194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
Einführung
Es freut mich als Autor, dass Sie sich für mein Lehr- und Übungsbuch zum Fachgebiet der Digitaltechnik entschieden haben, und es möge Ihnen ein ständiger Begleiter auf dem Weg zum Entwurf digitaler Schaltungen sein. Sei dies nun aus Eigeninteresse oder als flankierende Literatur zu einer Vorlesung, einem Kurs oder dem Unterricht, oder um Ihnen eine etwas andere Sichtweise zu erschließen, um eine Prüfung für eine weiterbildende berufliche Ausbildung oder das Studium erfolgreich abzuschließen.
Alle reden heute von Digitalisierung, setzen täglich digitale Geräte ein, ohne es zu wissen, viele Menschen verstehen darunter sehr unterschiedliche Dinge – am Anfang stand aber die Digitaltechnik und noch früher die Mathematik, die das alles heute erst möglich macht. Ich möchte Sie mit auf eine Reise in die Digitalisierung nehmen, doch zuvor etwas zur Entstehungsgeschichte der Digitaltechnik.
Am Anfang stand die Mathematik – mal wieder. Als George Boole (1815 bis 1864) ab dem Jahr 1847 versuchte, einen algebraischen Weg zu finden, um logische Problemstellungen zu lösen, entwickelte er eine komplett neue algebraische Struktur – die Boole'sche Algebra. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hatte Augustus De Morgan, ein englischer Mathematiker des 19. Jahrhunderts (1806 bis 1871), der die sehr wichtigen De Morgan'schen Theoreme beisteuerte.
Damals konnte noch niemand ahnen, dass diese Entdeckung einmal ein Meilenstein für ein komplett neues technisches Gebiet – die Digitaltechnik – sein würde. Und dass sich aus der Boole'schen Algebra die wohl für unseren Alltag bedeutendste Errungenschaft – die Erfindung des Computers – entwickeln könnte, war damals noch undenkbar. Möglich wurde dies, als der junge Student Claude Elwood Shannon (1916 bis 2001) 1937 im Rahmen der Bearbeitung seiner Master-Thesis die Analogie der Boole'schen Algebra zu realen Schaltkreisen erkannte und somit ein neues Anwendungsgebiet für die Boole'sche Algebra erschloss.
Mit dieser Grundlage entstand auch die erste voll funktionsfähige programmgesteuerte und frei programmierbare Rechenmaschine der Welt, bestehend aus einer großen Zahl von Relais, die Zuse Z3, die Konrad Zuse im Jahr 1941 vorstellte. Diese Z3 konnte eine mathematische Grundoperation in einer Sekunde ausführen.
Bis in die 50er-Jahre wurden in digitalen Systemen in erster Linie Elektronenröhren eingesetzt, die eine Vervielfachung der Arbeitsgeschwindigkeiten gegenüber den bisher verwendeten Relais ermöglichten. Die ersten digital arbeitenden Messgeräte waren Frequenz- und Ereigniszähler.
Bedingt durch die mangelnde Fertigungsgenauigkeit der mechanischen Systeme und die sehr begrenzte Lebensdauer der Elektronenröhren waren diese digitalen Systeme nicht sehr zuverlässig – sie fielen sehr häufig aus.
In den 50er-Jahren erhielt dann auch die Halbleiterelektronik Einzug in digitale Systeme. Zunächst als diskret aufgebaute und in den 60er- und 70er-Jahren als monolithisch integrierte Schaltung (monolithisch – auf einem Substrat). Erste elektronische digitale Schaltungen entstanden auf der Basis von Germaniumdioden und später auch auf der Basis von Germanium- und Silizium-Transistoren. Neben verschiedenen proprietären digitalen Schaltungen entstand die RTL-Schaltkreisfamilie als erste Form digitaler elektronischer Schaltkreise, die in den 50er-Jahren von Texas Instruments entwickelt wurde. Der Meilenstein in der Entwicklung von Schaltkreisfamilien ist die Erfindung und Patentierung der TTL-Technik im Jahr 1961 von James L. Buie bei der Firma TRW.
In den 60er, 70er und den folgenden Jahrzehnten ging es dann rasant mit der Weiterentwicklung der Halbleitertechnologien weiter – und dieser Prozess dauert immer noch an. Es entstanden immer kompaktere Halbleitertechnologien, die immer komplexere Strukturen zuließen. Die Basis stellt nach wie vor die TTL-Schaltkreisfamilie und deren Abkömmlinge dar, die bis heute den gesamten Bereich der Digitaltechnik prägen. Aktuell sind über 30 Schaltkreisfamilien verfügbar – ein Ende ist nicht absehbar. Unabhängig von dieser Vielfalt ändert das nichts an der Theorie und den Entwurfsmethoden der Digitaltechnik, lediglich die Implementation der Entwürfe bedarf einer fortlaufenden Anpassung an die jeweils eingesetzte Technologie der jeweiligen Schaltkreisfamilie.
Auf diese Reise möchte ich Sie jetzt ohne große Umwege mitnehmen. Die Theorie so weit wie notwendig und wenn Sie Interesse daran haben, die daraus abgeleiteten Entwurfsmethoden und Vorgehensweisen werden an anschaulichen Beispielen angewendet. Zur Übung gibt es zu fast jedem Kapitel ausführliche Übungsaufgaben, zu denen im Anhang die Lösungen detailliert beschrieben werden.
Der Anhang mit ausführlich kommentierten Lösungswegen im Umfang von cirka 170 Seiten ist nicht diesem Buch beigefügt, sondern steht ausschließlich vom Wiley Verlag kostenfrei per download unter der URL http://wiley-vch.de/ISBN9783527718665 zur Verfügung.
Über dieses Buch
Dieses Buch lässt sich von der Grundidee der gesamten Digitaltechnik leiten, denn es werden kleine Detailprobleme in möglichst allgemeingültiger Form gelöst. Diese werden dann wiederum durch geeignete Kombinationen genutzt, um komplexere Problemstellungen zu lösen, so dass mit recht einfachen Mitteln, aufbauend auf vorhandenem Wissen, komplexe Sachverhalte bearbeitet werden können.
Dieses Buch führt in die grundlegenden Zusammenhänge der Digitaltechnik ein. Dabei wird darauf Wert gelegt, das nicht nur auf »das ist so«, sondern explizit auch darauf »warum das so ist« eingegangen wird. Sie können sich aber auch gerne nur auf das Faktenwissen konzentrieren. Falls Sie sich aber auch für die Hintergründe interessieren, so empfehle ich Ihnen auch die Herleitungen der einzelnen Methoden und Verfahren zu lesen und zu erarbeiten – hierzu werden Hinweise gegeben. Sie vermitteln ein tiefgründiges Basiswissen, welches logisch aufgebaut dargestellt ist, wobei nicht unbedingt notwendiges nicht behandelt, aber durchaus als Ausblick genannt wird.
Den Anhang mit den Lösungen zu sämtlichen Übungen im Umfang von mehr als 170 Seiten können Sie per download vom Wiley Verlag unter der URL http://wiley-vch.de/ISBN9783527718665 beziehen.
Nicht enthalten sind in diesem Lehr- und Übungsbuch ganz bewusst die Themen Speicher, Programmierbare Logik sowie Sprachen zur Modellierung und Simulation digitaler Schaltungen wie VHDL.
Der inhaltliche Umfang des Buches entspricht ungefähr einer dreistündigen Vorlesung inklusive einem Laborpraktikum, welches allerdings nicht in diesem Buch in der Tiefe behandelt wird. Ein Laborpraktikum kann man nicht im Rahmen eines Buches behandeln, die Themen dafür wurden aber aus dem Inhalt des Buches abgeleitet und stellen quasi neben den umfangreichen Übungen eine weitere Vertiefung des behandelten Stoffes dar – es geht Ihnen also nicht unbedingt etwas verloren.
Ein besonderes Anliegen war es mir, dass das Buch logisch aufgebaut und leicht verständlich und nachvollziehbar lesbar ist, damit Sie Schritt für Schritt Erfolgserlebnisse haben. Auf allzu ausschweifende Formulierungen wurde deshalb verzichtet. Wichtige Aspekte werden anschaulich anhand vieler Beispiele und Abbildungen erläutert beziehungsweise zusammengefasst und können sehr gut zum Nachschlagen und zum Anwenden genutzt werden, so dass Sie nicht erst etliche Seiten lesen müssen, um zum gewünschten Ziel zu kommen.
Für das Verständnis des Inhalts ist es nicht notwendig, die höhere Mathematik zu beherrschen – Sie kommen tatsächlich mit den Grundrechenarten aus, allerdings in bisher nicht vertrauten Zahlensystemen wie dem dualen Zahlensystem, das in der Digitaltechnik unbedingt erforderlich ist, um die Theorie und Praxis zu verstehen – das Wissen dazu wird Ihnen aber vermittelt.
Das Hauptziel des Buches beziehungsweise einzelner Teile und Kapitel besteht darin, dass Sie die Theorie auf eine Vielzahl von Fällen – von einer einfachen digitalen Schaltung bis zu einem endlichen Zustandsautomaten mittlerer Komplexität – anwenden und üben können.
Konventionen in diesem Buch
In diesem Buch werden einige Konventionen verwendet:
Variablen in Formeln, Gleichungen, Wahrheitstabellen und KV-Tafeln werden kursiv gestellt. Benennungen in Arbeitstabellen, Schaltsymbolen, Schaltungen und so weiter werden senkrecht, Vektoren kursiv und fett dargestellt.
Bei fast allen Darstellungen dualer Zahlen wird als Trennzeichen für 4-Bit-Gruppen, die auch als Nibble (alternativ Tetrade) bezeichnet werden, ein Punkt verwendet – ein Komma ist immer ein Komma zur Trennung der Vorkommastellen von den Nachkommastellen einer Zahl.
Grundsätzlich werden alle Definitionen, soweit vorhanden, entsprechend der Deutschen Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuchs (DA-IEV) verwendet. Sie sind für die angemeldete limitierte Auflage wiedergegeben mit Genehmigung 402.023 des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
Die Originaldatenbank des Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuchs ist kostenfrei nutzbar über www.dke.de beziehungsweise direkt unter https://www2.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx (letzter Zugriff am 30.04.2025).
Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe werden nach »DIN 1302:1999-12, Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe« verwendet.
Mathematische Zeichen und Symbole der Schaltalgebra werden nach »DIN 66000:1985-11, Mathematische Zeichen und Symbole der Schaltalgebra« verwendet.
Die Darstellung von grafischen Symbolen für Symbolelemente, Kennzeichen und andere Schaltzeichen für allgemeine Anwendungen in Schaltplänen entspricht »DIN EN 60617 Teil 2:1997-08, Graphische Symbole für Schaltpläne Teil 2: Symbolelemente, Kennzeichen und andere Schaltzeichen für allgemeine Anwendungen (lEC 60617-2:1996)«.
Die Darstellung von grafischen Symbolen für passive Bauelemente in Schaltplänen entspricht »DIN EN 60617 Teil 4:1997-08, Graphische Symbole für Schaltpläne Teil 4: Schaltzeichen für passive Bauelemente (lEC 60617-4:1996)«.
Die Darstellung von grafischen Symbolen für Halbleiter in Schaltplänen entspricht »DIN EN 60617 Teil 5:1997-08, Graphische Symbole für Schaltpläne Teil 5: Schaltzeichen für Halbleiter und Elektronenröhren (lEC 60617-5:1996)«.
Die Darstellung von grafischen Symbolen der binären Elemente in Schaltplänen entspricht »DIN EN 60617 Teil 12:1999-04, Graphische Symbole für Schaltpläne Teil 12: Binäre Elemente (lEC 60617-12:1997)«.
Die Darstellung von grafischen Symbolen der analogen Elemente in Schaltungsunterlagen entspricht »DIN EN 60617 Teil 13:1994-01, Graphische Symbole für Schaltpläne Teil 13: Analoge Elemente (lEC 60617-13:1997)«.
Für weiterführende Informationen und insbesondere für eine Vielzahl von Beispielen wird auf die Datenbücher und die URL https://www.ti.com (letzter Zugriff am 30.04.2025) des Halbleiterherstellers Texas Instruments verwiesen:
Über die Halbleitertechnologien und Bauformen der Gehäusung der digitalen Schaltkreise gibt es eine sehr umfassende Darstellung im »Logic Guide 2017 (SDYU001AB), Texas Instruments«.
Eine nahezu vollständige Ausgabe aller Datenblätter zu sämtlichen digitalen Schaltkreisen in sämtlichen Halbleitertechnologien ist im »Digital Logic Pocket Data Book 2007 (SCYD013B), Texas Instruments« zu finden.
In Ergänzung der zuvor genannten Quelle bietet sich das »The TTL Data Book Volume1 1984 (SDYD001), Texas Instruments« an, wo auch die grafischen Symbole der digitalen Schaltkreise angegeben sind.
Was Sie nicht lesen müssen
Die Teile dieses Buches sind so formuliert, dass Sie diese nicht hintereinander, sondern unabhängig voneinander lesen können. Die Herleitungen zu den Lösungen der gestellten Übungen sollten Sie nachvollziehen und verinnerlichen, falls Sie sich gerade auf eine Prüfung im Fach Digitaltechnik vorbereiten. Für die Prüfungsvorbereitung sind alle in den Kapiteln aufgeführten Übungen wichtig. Die detaillierten Lösungswege finden Sie stets im Anhang. Versuchen Sie bitte zunächst, die Übungen mithilfe der Theorie des zugehörigen Kapitels zu lösen, ohne den Lösungsweg im Anhang anzuschauen! Die detailliert kommentierten Lösungen sollten Sie erst dann nutzen, wenn Sie das im Anhang angegebene Ergebnis nicht herausbekommen, oder zur Kontrolle Ihres eigenen Lösungswegs. Die Übungen sind so angeordnet, dass Sie schrittweise von den einfachen zu den komplexeren Anforderungen geführt werden.
Annahmen über Sie, die Leserin beziehungsweise den Leser
Beim Schreiben dieses Buches bin ich von folgenden Annahmen über Sie, die Leserin beziehungsweise den Leser dieses Buches, ausgegangen:
Sie haben Interesse an Zusammenhängen und Erklärungen zur Theorie und praktischen Umsetzung der Methoden und Verfahren der Digitaltechnik.
Sie wollen etwas Neues lernen oder bekanntes Wissen festigen.
Sie beherrschen die Grundrechenarten der Mathematik.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch besteht aus 14 Teilen mit insgesamt 30 Kapiteln, wobei die Kapitel wiederum in Abschnitte unterteilt sind. Es enthält 631 Abbildungen, 38 Tabellen und 74 Übungsaufgaben mit 235 Teilaufgaben. Der Teil XIV ist der Top-Ten-Teil, der 10 wichtige Dinge wie Tipps, Regeln oder zu beachtende Aspekte, weiterführende Literatur, Quellen und Werkzeuge benennt, auf die Sie besonders achten sollten.
Grundsätzlich werden zu Beginn der Kapitel beziehungsweise Abschnitte, Definitionen zum jeweiligen Thema vorgenommen und soweit vorhanden, die internationalen Definitionen entsprechend dem Internationalen Elektrotechnischen Wörterbuchs (DA-IEV) angegeben. Wenn erforderlich, werden die Definitionen näher erläutert.
Sämtliche verwendeten Symbole entsprechen den aktuell gültigen Normen entsprechend der europäischen Norm DIN EN 60617 beziehungsweise internationalen Norm lEC 60617.
In der Folge fasse ich die Teile und Kapitel kurz zusammen, damit Sie eine Vorauswahl entsprechend Ihren Interessen vornehmen können.
Teil I: Einordnung der Digitaltechnik – Wo bin ich?
In Teil I werden zunächst die verschiedenen Signalarten beschrieben und darauf aufbauend eine Einordnung des Gebiets der Digitaltechnik an einem prägnanten Beispiel vorgenommen.
In
Kapitel 1
»Basis der Digitaltechnik und Abgrenzung zur Analogtechnik« werden zunächst die verschiedenen Signalarten bis hin zu den analogen und digitalen Signalen mit deren Eigenschaften behandelt. Digitale Signale stellen dabei die Basis digitaler Systeme dar. Des Weiteren wird an einem prägnanten Beispiel einer Temperaturmessung die Schnittstelle zwischen der Analog- und Digitaltechnik herausgearbeitet.
Teil II: Mathematische Grundlagen – Nur ein bisschen
In Teil II werden die mathematischen Grundlagen für die Schaltalgebra gelegt. Dies beginnt mit den Zahlensystemen und geht über die Arithmetik in den Zahlensystemen bis hin zu der speziellen Behandlung negativer Zahlen.
In
Kapitel 2
»Zahlensysteme« wird eine Einführung in die relevanten polyadischen Zahlensysteme der Digitaltechnik vorgenommen. Diese sind das duale, das dezimale und das sedezimale Zahlensystem. Insbesondere die Umwandlung von Zahlen der Zahlensysteme untereinander stellt einen Schwerpunkt dar.
In
Kapitel 3
»Arithmetik in den polyadischen Zahlensystemen« wird die Arithmetik im dualen Zahlensystem mit ihren Besonderheiten behandelt.
In
Kapitel 4
»Darstellung negativer Zahlen« wird das Zweierkomplement zur Darstellung negativer Zahlen behandelt, um die Subtraktion auf die Addition zurückzuführen.
Teil III: Codes und Codesicherung – Wie sage ich es meinem Kinde
In Teil III wird die Notwendigkeit von Codes als Sprache digitaler Systeme für die Übertragung von Information aufgezeigt. Hierzu werden die unterschiedlichen Eigenschaften von Codes angesprochen und die wichtigsten Codes behandelt. Da grundsätzlich davon ausgegangen werden muss, dass die Übertragung von Information fehlerbehaftet sein kann, werden einfache Methoden und Vorgehensweisen zur Codesicherung beschrieben.
In
Kapitel 5
»Codes und deren Eigenschaften« werden die typischen Eigenschaften von Codes wie beispielsweise die Hamming-Distanz und die Stetigkeit sowie typische Vertreter wie der Dualcode, der BCD-Code, der Gray-Code und der ASCII-Code behandelt.
In
Kapitel 6
»Binärcodes« werden relevante numerische und alphanumerische Codes vorgestellt, bewertet und deren mögliche Einsatzgebiete aufgezeigt.
In
Kapitel 7
»Codesicherung« werden Möglichkeiten der Erkennbarkeit und Korrigierbarkeit von Bit-Fehlern bei der Übertragung von Information aufgezeigt und wie mit einfachen Mitteln im Rahmen der Möglichkeiten Bit-Fehler erkannt und korrigiert werden können. Hierzu wird die einfachste Maßnahme, das Paritätsbit behandelt.
Teil IV: Schaltalgebra als Basis der Digitaltechnik – Herr Boole und Herr Shannon lassen grüßen
In Teil IV werden die Rechenregeln der Schaltalgebra behandelt, die die Basis für die Analyse und Synthese von Schaltnetzen und Schaltwerken darstellt. Es werden die grundlegenden logischen Funktionen und deren grafische Symbole behandelt. Des Weiteren wird eine Einführung in bestimmte Normalformen für den optimierten Entwurf von Schaltnetzen und -werken vorgenommen.
In
Kapitel 8
»Historisches und wichtige Festlegungen« wird kurz auf die Entstehungsgeschichte der Schaltalgebra und deren Väter eingegangen. Es werden die Festlegungen Schaltvariable, Schaltfunktion vorgenommen und deren Darstellung in einer Wahrheitstabelle gezeigt. Abschließend werden die standardisierten mathematischen Zeichen und Symbole der Schaltalgebra vorgestellt.
In
Kapitel 9
»Schaltalgebra« werden die Rechen- und Vorrangregeln der Boole'schen Algebra behandelt, die die Basis für die Analyse und Synthese von Schaltnetzen und Schaltwerken darstellen. Abschließend wird in die Benennung der logischen Verknüpfungen eingeführt.
In
Kapitel 10
»Logische Grundverknüpfungen und deren grafische Symbole« werden die logischen Grundverknüpfungen und deren standardisierte grafische Symbole für Schaltpläne vorgestellt. Hierbei werden die aktuelle internationale, die alte nationale sowie die amerikanische Norm vorgestellt, da insbesondere Letztere noch sehr häufig zum Einsatz kommt.
In
Kapitel 11
»Normalformen, Min- und Maxterme« werden aus der Wahrheitstabelle die disjunktive und konjunktive Normalform sowie die Min- und Maxterme abgeleitet, um eine standardisierte Formulierung der Schaltfunktionen für die Synthese von Schaltnetzen und -werken zu erhalten.
Teil V: Analyse von Schaltnetzen – Schauen wir mal
In Teil V werden die Ziele der Analyse eines Schaltnetzes formuliert und darauf aufbauend werden Vorgehensweisen zur Analyse von Schaltnetzen behandelt.
In
Kapitel 12
»Methoden für die Analyse von Schaltnetzen« werden die Ziele bei der Analyse eines Schaltnetzes benannt und zwei konkrete Methoden für die Analyse vorgestellt.
Teil VI: Synthese von Schaltnetzen – Wie soll es denn werden?
In Teil VI wird eine Einführung zur Synthese von Schaltnetzen vorgenommen und es werden drei Methoden anhand von prägnanten Beispielen vorgestellt.
In
Kapitel 13
»Vorgehensweise bei der Synthese von Schaltnetzen« wird die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Synthese mittels der Schaltalgebra behandelt und es werden die damit verbundenen Probleme aufgezeigt.
In
Kapitel 14
»Minimierung der Schaltfunktionen mittels Karnaugh-Veitch-Tafeln« wird die Synthese für bis zu sechs Variablen beschrieben.
In
Kapitel 15
»Minimierung der Schaltfunktionen mittels des Verfahrens nach Quine und McCluskey« wird die Synthese für eine beliebige Anzahl an Variablen beschrieben.
Teil VII: Verwendete grafische Symbole und deren Systematik – Zum Nachschlagen
In
Kapitel 16
»Grafische Symbole der Digitaltechnik« werden die in diesem Buch verwendeten genormten grafischen Symbole mit Beispielen erläutert.
In
Kapitel 17
»Weitere verwendete grafische Symbole« werden die grafischen Symbole, die sonst noch in den angegebenen Schaltungen des Buches Verwendung finden, zusammengestellt und erläutert.
Teil VIII: Logische und physikalische Beziehungen in der Digitaltechnik, Technologien und Kenndaten der Logikfamilien – Hardware, nein danke?
In Teil VIII werden die logischen und physikalischen Eigenschaften in der Digitaltechnik behandelt. Des Weiteren die eingesetzten Technologien in digitalen Schaltkreisen, wichtige charakteristische Kenndaten mit einer kleinen Übersicht wichtiger Schaltkreisfamilien.
In
Kapitel 18
»Zusammenhänge der logischen und physikalischen Eigenschaften in der Digitaltechnik« wird auf Zusammenhänge der logischen und physikalischen Eigenschaften in der Digitaltechnik eingegangen. Nach einer Definition der positiven und negativen Logik wird der Polaritätsindikator eingeführt, um Beziehungen zwischen internen und externen logischen Zuständen beziehungsweise Logikpegeln anzugeben. Des Weiteren erfolgt die Behandlung der möglichen Ausgangsschaltungen in ihrer Funktion und was bei deren Einsatz zu berücksichtigen ist. Hierbei werden auch sogenannte Wired-/Verdrahtete logische Verknüpfungen, die sich durch die Verschaltung von Ausgängen ergeben, berücksichtigt.
In
Kapitel 19
»Halbleitertechnologien, Eigenschaften und Kennzeichnungen der Logik-Elemente« werden die zum Einsatz kommenden grundlegenden Halbleitertechnologien wie die Bipolar-, MOS- und BICMOS-Technologie mit ihren Vor- und Nachteilen mit Beispielen behandelt. Abschließend wird eine Übersicht der Logikfamilien und deren Kennzeichnung gegeben.
In
Kapitel 20
»Kenndaten der Logik-Elemente« werden die wichtigsten stationären und dynamischen Kenndaten der Logikfamilien sowie deren Störsicherheit und deren Kompatibilität untereinander behandelt. Abschließend wird eine Übersicht zur Auswahl geeigneter Logikfamilien für die jeweilige Anwendung gegeben.
Teil IX: Standardschaltnetze, die immer wieder benötigt werden – Man nutze möglichst vorhandene Dinge
In Teil IX werden Schaltnetze (kombinatorische Elemente) behandelt, die immer wieder benötigt werden und in praktisch keinem digitalen System fehlen. Dies sind Code-Umsetzer, Multiplexer, Vergleicher (Komparatoren) und Rechenschaltungen in Form von Halb- und Volladdierern. Es wird gezeigt, wie diese eingesetzt werden können, um komplexere Aufgabenstellungen zu lösen. Zusätzlich werden auch Übersichten zu verfügbaren Logik-Elementen angegeben.
In
Kapitel 21





























