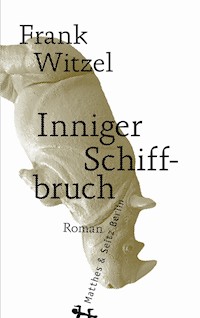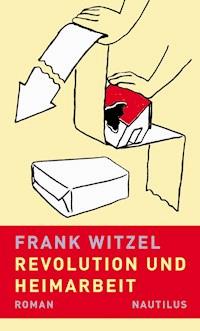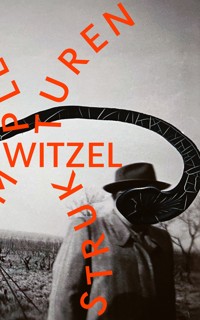Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es herrscht Krieg im Frieden, aller Umerziehung zum Trotz. Körperteilopferungen werden ausgestellt und das Waisenhaus brennt. Flugzeuge stürzen ab, Züge entgleisen, die Pläne zur Weltmechanik sind unauffindbar. Kinder gründen eine neue Religion und ersticken unter Lawinen. Der begabte Zögling Fählmann verlässt das Waisenhaus nicht mehr. Der Kretin hängt unter der Decke und beobachtet seine Eltern. Siebert steht am Fenster. Er wartet auf Marga. Doch Marga scheint verschwunden. Ihr Körper nicht mehr auffindbar. Ein Chor unterschiedlicher Stimmen fragt in diesem unheimlichen Buch von Frank Witzel unermüdlich nach dem, was wirklich geschah. Die Stimmen versuchen, Geschichte durch Geschichten zu erfassen. Sie tasten nach Gründen und werfen mit jeder Frage neue Fragen auf. Gewissheit wird zur Illusion, das Imaginierte zum letzten Zufluchtsort. So steigt der Leser immer tiefer in die Bodenlosigkeit von Geschichte und sieht hinab in das Grauen des Menschenmöglichen. Nominiert für den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2017.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Witzel
Direkt danach und kurz davor
Roman
I do not find the Hanged Man.Fear Death by water.
T. S. Eliot
Die Umgangssprache sagt: Jetzt.Der Physiker jedoch sagt: Vorbei.
C. A. van Peursen
Natürlich gab es einen Garten. Einen Garten, den wir nicht betreten durften. Nicht weit entfernt von der Stadt. Mit dem Rad eine halbe Stunde. Einen staubigen Weg entlang. An Telegraphenmasten vorbei. Manche mit, die meisten ohne Drähte. Im Gegenlicht meinte man, da hängt noch einer. Wir traten in die Pedale und hielten die Köpfe gesenkt. Aber es war nur ein vergessener Kittel. Verschlissen. Wir hielten an und blinzelten in die Sonne. Wir stellten uns vor, dort oben zu baumeln. Der Bach gurgelte. Der Körper schlackerte hin und her. Hin und her. Der Wind fuhr in die Nasenlöcher. Das Blut rauschte in den Ohren. Es waren die weit entfernten Stimmen der Mädchen, die in der Aula das Lacrimosa übten. Es war der Schiefer, der sich in dünnen Blättchen vom Felsen hinter dem Nahrthalerfeld löste und nach unten glitt. Bevor man stirbt, wird der Körper noch einmal heiß. Dann kalt. Dann wieder heiß. Man meint, ein Gesicht ganz nah vor dem eigenen zu sehen. Mit aufgerissenen roten Augen. Dann kommt der Tod.
Wir hatten das Zählen verlernt. Die Zahlen wollten uns einfach nicht mehr über die Lippen. Wir dachten immer nur: Eins und eins und eins. Weiter kamen wir nicht. Manche Einwohner erkannte man wieder. Andere nicht. Vieles blieb fremd. Gebräuche änderten sich unmerklich. Auch deshalb ging nichts mehr gedankenlos von der Hand. Selbst am Weihwasserbecken gab es ein unwillkürliches Zögern. Begann das Kreuzzeichen wirklich an der Stirn?
Ein Mädchen stand im Mittelschiff und rührte sich nicht. Es sind dünne Fäden, die der Herr von seinen Wundmalen zu unseren noch unversehrten Gliedmaßen führt und an denen er uns durch das Leben führt. Unsere Großväter hatten es noch erlebt. Unsere Väter hatten es noch gesehen. Wir kannten es nur vom Hörensagen. Das Mädchen im Mittelschiff trug ein weißes, frisch gestärktes Kleid. Zum ersten Mal sahen wir etwas makellos Reines vor uns. Wir zögerten. Überlegten, wie eine Kniebeuge ging, und machten sie dann. Wir stellten uns dahin, wo früher die Bänke gestanden hatten. Hielten die Hände, wie wir sie früher gehalten hatten. Schauten nach vorn, wie wir früher nach vorn geschaut hatten. Meinten, das Licht durch die schwarzen Löcher wie durch Glasfenster auf die zersprungenen Fliesen fallen und die Stelle markieren zu sehen, an der wir früher den Leib des Herrn empfangen hatten. Eins und eins und eins. Die Dreifaltigkeit hatte sich in uns in ihre Einzelteile zerlegt. Auf einem alten Stück Pflaster um unser linkes Handgelenk stand verwischt ein Name geschrieben. Natürlich hatte dieser Name eine Bedeutung. Es gab Bedeutungen und Dinge, so viel wussten wir. Aber beides blieb voneinander getrennt. Die Zuordnung wollte uns nicht gelingen. Auch deshalb waren wir so schreckhaft. Wir suchten überall nach einer Verbindung. »Ihr erschreckt vor eurem eigenen Schatten«, sagten die Erwachsenen und lachten. Sie selbst hatten keine Zähne, oft weniger Finger als zehn, zuckten mit dem Mund und zogen ein Bein nach. Nur schreckhaft waren sie nicht. Das Mädchen mit dem makellosen Kleid drehte sich zu uns um. Jetzt erst sahen wir den roten Fleck. Jetzt erst sahen wir den verschmierten Lippenstift. Die dunklen Augenhöhlen. Zwei alte Frauen murmelten den Anfang des Recordare. Wieso hatten sie überlebt? Ausgerechnet sie? Dem Tod ist das Alter egal. Im Gegenteil: Er ist auf Junge aus. Je jünger, desto besser. Das Mädchen ging an uns vorbei dem Ausgang zu. Waren es unsere Gesichter, die sie als Letztes sah?
Der Wald war dicht. Der Weg schattig. Wir lernten die Naturgesetze mit kleinen Figuren aus Holz. Wir lernten das Beten mit kleinen Figuren aus Wachs. Wir lernten die Gesetze der Schöpfung mit kleinen Figuren aus Lehm. Wir lernten Geheimschriften, gaben uns andere Namen und dekorierten uns mit selbstgebastelten Ehrenabzeichen. Hinter der Hütte standen Männer, denen es immer noch ernst war. Man konnte vor ihnen nicht weglaufen. Noch bevor sie das Wort an einen richteten, musste man ihnen ins Gesicht schlagen. Nur so hatte man überhaupt eine Chance.
Der Direktor lehnte am Fenster und blickte hinunter in den Anstaltshof. Eine Sirene heulte. Es war ein Probealarm. »Ab jetzt nur noch Probealarm«, sagte er und schenkte sich einen Selbstgebrannten ein. Die Gefangenen hatten sich auf den Boden geworfen. »Man wirft sich nicht mehr zu Boden, man stellt sich in Zweierreihen auf. Man rennt nicht mehr in den Keller, man tritt ins Freie. Man sitzt nicht mehr mit angezogenen Knien und Bauchweh in der Zimmerecke, man legt sich flach auf die Pritsche.«
Zu spät kamen wir abends nach Hause. Ein Mann stand neben der Spüle und trank aus einer Feldflasche. Die Wiege war weggeräumt. Die Spiegel verhängt. Das stehende Wasser ausgegossen. Die Mutter machte eine unmerkliche Bewegung mit dem Kopf: Frag jetzt nicht. Wir wussten nicht, was wir nicht fragen sollten, und fragten sicherheitshalber gar nichts.
Die Stadt schien von sich selbst befreit. Das, was Tag um Tag in sie hineingepresst wurde, das, was beständig aus ihr herausströmte, auf das Land, hinein ins Unbekannte, ins Blaue, wie man weiterhin sagte, obwohl es grau war, olivgrün und lediglich hier und da von einem phosphoreszierenden Schimmel besetzt, unterlag keiner fassbaren Ordnung mehr, sondern nur noch einem mechanisierten Ablauf.
Die aufgeplatzten Straßen gingen über die Trümmer hinweg wie angeklebte Bahnen einer Spielzeugsiedlung, zu der eben auch Wege gehören, eben auch Häuser gehören, Gärten, Bürogebäude und ein Bahnhof. Die Stadt war ein bedeutungslosen Abbild ihrer selbst. Gerade weil sie nicht komplett dem Erdboden gleichgemacht worden war – und darin glich sie der eben vergangenen Ordnung –, sondern in allem noch beinahe so vorhanden war wie immer. Aber eben nur beinahe. Und dieses Beinahe war leicht zu übersehen.
Der Vater, der sich weiterhin so nannte und auch von uns weiterhin so genannt wurde, obwohl wir in der Regel vermieden, ihn direkt anzusprechen, trat vor das Haus. Dieses Haus, damit fing es schon an, zeigte nicht nur Risse, einen halb eingefallenen Dachstuhl und einen unbegehbaren, mit Schutt angefüllten Keller, sondern war in seiner Funktion für ihn, den Vater, und uns, seine Familie, ungewiss. Man traf Personen im Hausflur, die man nicht kannte und die sich auch dann nicht vorstellten, wenn man grüßte und den eigenen Namen nannte, von denen man kurzum nicht wusste, was sie im Schilde führten. Ja, dieser Ausdruck wurde wieder häufiger benutzt und tat ein Übriges, sich der eigenen Zeit nicht als etwas Unbekanntem und Neuem zu vergewissern, sondern sie mit den Hilfskonstruktionen historischer Möglichkeiten zu vermessen. In diesem Fall dem Mittelalter.
War das Mittelalter dieser Zeit wirklich so fern? Solche Verknüpfungen sind im Nachhinein schwerlich auszumachen, da es immer nur Vorstellungen eines Mittelalters sind – dunkel und abgekappt von den Erkenntnissen der Antike –, die sich an den Vorstellungen einer Gegenwart messen – auf eine andere Art dunkel und von seiner Geschichte getrennt.
Der Vater hielt einen Brief in der Hand. Der Brief war adressiert an den Schüler Ralph Fählmann. »Wer ist das?«, wollten wir wissen. Und: »Hat er früher hier gewohnt?« Denn unter seinem Namen stand unsere Anschrift. Der Vater antwortete nicht. Er schaute an uns vorbei. Wir liefen hoch in die Wohnung. »Ralph Fählmann! Ralph Fählmann! Ralph Fählmann!«, riefen wir und ließen uns auf das wacklige Bett fallen, das wir nachts teilten. Einer von uns nahm einen Schmierzettel, faltete ihn zusammen und stellte sich mit ernster Miene vor uns andere hin. Erst wagten wir nicht zu lachen, denn er spielte den Vater. Dann schrien wir: »Antworte! Oder hat es dir die Sprache verschlagen? Wer ist Ralph Fählmann?« Wir versuchten an den Schmierzettel zu kommen und lasen einen erfundenen Liebesbrief vor. »Mein lieber Ralph«, begann der Brief, »ich liege hinter dem Holunderbusch und lauere Dir auf. Ich habe ein Seil gespannt, das ich straffziehe, wenn Du kommst. Du wirst stürzen und Dir das Knie aufschlagen, und ich werde Dich pflegen. Wir werden in einem Keller leben und Kinder haben, die das Tageslicht nicht kennen. Verstoße mich nicht. Verlache mich nicht. Zeige Deine Zähne nicht. Klopfe an jeden Baum und jede Borke. Meide Kreuzwege. Gehe rückwärts über den Karmelitersteg. Falte aus diesem Brief keinen Flieger, sondern eine Schwalbe. Wirf sie nachts aus der Dachluke. Such sie am nächsten Morgen nicht. Such sie am übernächsten Morgen nicht. Such sie nicht.«
Während wir unter dem Bett mit einem Kopierstift das traurige Gesicht des Schülers Ralph Fählmann auf die Rückseite des Schmierzettels malten, steckte der Vater vor dem Haus den Brief in die Hosentasche und schaute sich um. Die Bewegung, mit der er sich umsah – der Vater war jung, gerade einmal Mitte dreißig, auch wenn er älter aussah –, erinnerte ihn an eine Zeit, in der das Haus frisch verputzt war und er jeden Mieter, selbst jeden Besucher, den die Mieter von Zeit zu Zeit empfingen, kannte. Das Gefühl der Angst, das diese kurze, durch eine körperliche Bewegung entstandene Irritation in ihm hätte hervorrufen müssen, blieb jedoch ungefühlt. Stattdessen schüttelte er den Kopf über einige Jungen, die auf dem Schuttplatz herumlungerten, den er von der leichten Anhöhe, auf der das Haus stand, sehen konnte. Die Jungen teilten sich eine halbe Zigarette, vielleicht war es auch nur ein Stummel, dann malten sie sich aus Langeweile die Gesichter mit einem Kohlerest schwarz an. Wenn alles um einen herum in Trümmern liegt, lässt sich ein Gefühl der Zerstörungswut nur schwer ausleben.
Aber gab es nicht eine unbeschreibliche Wut? Und hätte man nicht am liebsten, anstatt wieder Stein auf Stein zu setzen, alles noch tiefer und diesmal ganz bewusst und mit eigener Hand in Grund und Boden rammen wollen? Die ersten sorgsam eingesetzten Fensterscheiben einschmeißen, den wackligen Buden einen Tritt versetzen? War die Aufforderung, an einer neuen Ordnung mitzuarbeiten, nicht eine Unverschämtheit, nachdem Ordnung Synonym geworden war für Vernichtung, für Anmaßung, für Willkür und Chaos? Hätte man sich nicht erstmal ein, zwei Jahre im Schlamm wälzen müssen und jegliches Mittun verweigern? Einfach dasitzen im Matsch und die Planeten kreisen lassen und an sich selbst herunterschauen, um zu erahnen, was das ist, dieser Körper, der durch Zufall entstanden war und durch einen weiteren Zufall überlebt hatte.
Wann hatten wir das letzte Mal einen Drachen steigen lassen? »Noch nie«, sagte der Jüngste, »Schon ewig her«, der Älteste. Wann hatten wir etwas gebastelt, das nicht anschließend in großen Körben eingesammelt und an Bedürftige verteilt worden war? Wer waren diese Bedürftigen? Wir warfen uns ein Bettlaken über und versteckten uns in der Speisekammer. Schließlich bekamen wir Angst vor uns selbst, rissen das Laken hastig herunter und liefen zurück ins Wohnzimmer. Vielleicht war Ralph Fählmann der Junge, der in der kleinen Souterrainwohnung neben dem Holzhandel saß und nie nach draußen durfte. Vielleicht war es der Junge, der eine Woche lang mit seinem toten Zwillingsbruder in einem Bett gelegen hatte. Oder der Junge, dem manchmal das eine Auge aus der Höhle nach draußen rutschte. Oder der, der immer so leicht Nasenbluten bekam und stotterte. Wir würden warten, bis alle schliefen, und dann den Brief aus der vom Vater über einem Stuhl abgelegten Hose stehlen und lesen.
Der Vater ging ins Haus zurück und stieg die knarrende Treppe zu der Wohnung im dritten Stock empor. Das Geländer, kippelig, fasste er nicht an, auch wenn er sich immer wieder dabei ertappte, seine Hand danach ausstrecken zu wollen. Der kurze Weg zur Wohnung erlaubte es ihm nicht, die eigenen Schritte als schwer und den eigenen Körper als müde zu empfinden. Der Abend drang durch das leicht schlagende Flurfenster und fiel über das Schild »Vorsicht frisch gewachst«, dessen Schrift fast völlig verblasst war in den letzten Jahren, als er keine Zeit gehabt hatte, darauf zu achten. Bohnerwachs gab es schon lange nicht mehr. Aber wahrscheinlich war die Idee, die Stufen zu bohnern, bereits davor abhandengekommen.
Die Wohnungstür hatte kein Schloss. Der Vater bahnte sich auf dem Treppenabsatz einen Weg zwischen abgestellten Dingen, deren Wert nur der hätte benennen können, der sie hierhergeschleppt hatte. Oder gab es keine Werte mehr? Nahm man nach Belieben etwas mit, weil es herumstand und niemandem zu gehören schien? Auch diese Frage lässt sich kaum beantworten. Werte, ein ähnlich diffuser Begriff wie: Ordnung. Eigenartig, dass der Plural den banal materiellen Begriff des Werts adelt, während die Ordnung umgekehrt durch den Plural bedroht scheint. Waren beide nicht ohnehin Begriffe, die den meisten Menschen ein Leben lang kein einziges Mal in den Sinn kamen, es sei denn, sie wurden gezwungen, sich dazu zu äußern, weil man sie auf eine bestimmte Ordnung oder gewisse Werte einschwören wollte? Und was sollten sie dann schon groß sagen? Sie würden ahnen, dass sie nicht ehrlich sein und von dem würden sprechen können, was ihnen unwillkürlich in den Sinn kam, dem Wetter zum Beispiel oder dem unbefestigten Weg, den sie jeden Tag entlanggingen, einem Brief, der nicht zugestellt werden konnte, oder der Faszination, die eine Dose mit Drops in ihnen auslöste. Denn was sollte eine banale Dose Drops mit Ordnung und Werten zu tun haben? Und weil sie nicht wagten, diese Verbindung zu knüpfen, blieb etwas Grundlegendes unbenannt.
Allein der Name Drops: ein Wort, das jeder Flexion widerstand und seine Einsilbigkeit in reinen Klang transzendierte. Ein Wort, von dem man nicht wusste, woher es stammte, das fremd war und zugleich sofort vertraut. Man betrachtete die Dose, sagte das Wort, öffnete den Deckel mit einer halben Drehung gegen das Unterteil und legte ihn beiseite. Das plissierte Papier war zu sehen. Gefaltet wie eine Kerzenmanschette und mit einem Loch in der Mitte. Daumen und Zeigefinger fuhren von oben in die Öffnung und zogen die Papierrosette auseinander. Die mattglänzenden Drops, teilweise von weißem Puder bestäubt, kamen zum Vorschein. Ein Drops wurde genommen, höchstens einer pro Tag, und in den Mund gesteckt. War die kurze und unangenehme Reibung durch den Puderzucker am Gaumen überwunden, ließ der Drops sich leicht und immer leichter lutschen, bis er sich von selbst im Mund drehte und bei jeder Drehung einen manchmal hellsauren, dann wieder süßdunklen Geschmack abgab. Dieser Geschmack war der Triumph der Auflösung, die Aura des Vergehens. Dieser Drops war Verheißung und Erfüllung in einem und entstammte einer anderen Welt als die aus dem verschmierten Kindermund herausgestammelte Verdopplung Bonbon oder die dem hageren Greis verschriebene Pastille.
Wir standen ehrfürchtig um den Tisch, wenn die Mutter sich setzte, die Hände an der Schürze abtrocknete, die runde Blechdose nahm, aufdrehte, abstellte, den Inhalt betrachtete und dann einen Drops herausnahm und in den Mund steckte. Noch nie hatten wir selbst einen berühren, geschweige denn in den Mund nehmen dürfen. Und bereits jetzt konnten wir uns nicht mehr daran erinnern, wie der Drops zu uns gekommen war und welches frühere Abendritual er ersetzte. Das Apfelschälen, das Nennen der drei Namen, das Richten der Haarnadel, das Falten des Tuchs, das Horchen an der Wand, das Prüfen der Finger, das Vergleichen der Nähte, das gabelose Geben oder das achtlose Nehmen? Der Jüngste stupste seinen ausgestreckten Zeigefinger vorsichtig in den Puderzucker, der anders war als gewöhnlicher Puderzucker, mehlhafter, bitter im Geschmack, wie Backpulver, das bald wieder in kleinen Tütchen im oberen Fach des Küchenschranks liegen würde.
Der Tag neigte sich, das Licht wurde sanft und verbarg die verstaubte Armut der Wohnküche. Wir hörten nur noch unseren Atem und spürten allein unsere heißen Backen und zusammengeballten Fäuste. Die Mutter setzte sich, und schon das war ungewöhnlich, da sie sonst immer in Bewegung war und selbst während der Mahlzeiten zwischen Herd und Esstisch hin- und herging. Der Vater, noch abgelenkt vom Moment des Alleinseins im Treppenhaus, trat in die Stube und sah seine Frau mit entrückter Miene und uns in andächtigem Schweigen und blieb stehen, weil er wortlos begriff, dass er seiner Frau nie näher würde kommen können, als wenn er sie in diesem Moment bei sich beließ. Und er begriff, ebenso wortlos, aber anders als sonntags oder an Feiertagen auf Knien in der Kirche, dass es etwas wie die jungfräuliche Geburt geben musste. Der Drops war die Dreifaltigkeit, deren Göttlichkeit sich in der auserwählten menschlichen Mundhöhle zum Heiligen Geist entgegenständlichte. Die Dose der Tabernakel. Die Wohnküche der Sakralraum. Und nur weil man den Umgang mit dem Numinosen im Alltag nicht gewohnt war, räusperte sich der Vater und erlöste seine Frau von der Unerträglichkeit des Moments, dem etwas hätte folgen müssen, ohne dass ihm etwas hätte folgen können. Und vielleicht war das seine Funktion: Das Unerträgliche immer wieder zu unterbrechen, um es durch diese Unterbrechung als Möglichkeit zu erhalten.
Wir aber hassten diesen Moment, weil wir wieder entscheiden mussten und überlegen, vor wem wir mehr Angst hatten und wer uns gleichgültiger war und wie lange diese gemeinsame Gefangenschaft noch dauern würde. Der Vater lächelte, weil er uns in Andacht versunken glaubte, während wir auf den Moment warteten, in dem die Mutter den Drops verschlucken und an ihm ersticken würde. Wir erwarteten und fürchteten diesen Augenblick gleichermaßen, weil wir danach mit einem unfähigen Mann zusammenleben müssten, der uns mit leeren Drohungen würde in Schach zu halten versuchen. Wir konnten uns die eigene Freiheit aber nur über den Tod der Mutter vorstellen. Wäre es nicht ein schöner Tod, dachten wir uns, halb als Ausrede, halb als Trost, mit einem bunten Drops im Hals dahinzuscheiden? Der Vater würde sie schütteln und wir würden schreien, so wie wir es gelernt und immer wieder geübt hatten. Bis morgens früh würden wir wach bleiben, wie besessen hin- und herlaufen, um dann wieder ganz unerwartet völlig still und ausdruckslos dazusitzen. Wir würden gleichzeitig lachen und weinen und eine Nachbarin würde uns eine heiße Milch kochen und sagen: »Ihr seid ja völlig übermüdet.« Aber wir wären nicht übermüdet. Wir wären auf der Suche nach einem Ausweg. Einem Ausweg, den uns die Erwachsenen versperrten.
Sie waren einfältig, hatten alles geglaubt, was man ihnen vorgebetet hatte, und nicht einmal geblinzelt, wenn ihnen befohlen wurde, die Augen zu schließen. Augen zu, Mund auf. Nach diesem Motto hatten sie gelebt, alles geschluckt und nichts von der Welt gesehen. Für sie war es egal, wo sie lebten. Funktionierte das elektrische Licht nicht, gingen sie früher ins Bett und schliefen mit offenen Mündern, bis der Rachen ausgetrocknet war. Ihr Horizont reichte bis zu einem bunten Bonbon, und das Gefühl für diesen Bonbon verwechselten sie mit Inbrunst und Religion. Ihre Welt war immer zugig. Immer klemmte eine Schublade. Immer ließ sich eine Tür nicht richtig schließen. Alles, was sie auf etwas anderes hätte hinweisen können, verstanden sie nicht. Wurde es ihnen aufgedrängt, wie etwa ein Brief an einen unbekannten Schüler, spürten sie keine Neugier, sondern nur eine der vielen Varianten von Gleichgültigkeit. Sie sprachen von Postgeheimnis und ahnten noch nicht einmal, was ein Geheimnis war. Als sie jung waren, hatten sie sich einmal eine Kladde gekauft, auf die erste Seite geschrieben »Liebes Tagebuch« und auf den nächsten Seiten doch nur ihre Pfennigausgaben notiert.
Selbst der Tod und das Vorbeihetzen der Geschichte konnte sie nicht schrecken. Nicht weil sie unerschrocken gewesen wären, sondern weil sie von alldem nichts mitbekamen. Die Welt drehte sich wie ein Wirbelsturm um ihr kleines, vollgestopftes Haus, aber wenn sie am anderen Morgen vor die Tür traten, waren sie wieder einmal verschont geblieben. Sie fassten sich an den Hut und grüßten den Nachbarn: »Na, da sind wir noch mal mit einem blauen Auge davongekommen.« Doch selbst dieses blaue Auge existierte allein in ihrer Vorstellung und gesellte sich dort zu Kindstaufe, Eheschließung und anderen Stadien auf dem Lebensweg, für die man einen entsprechenden Satz parat hielt.
Da sie nichts wirklich überwanden, verharrte alles in einem Dämmerzustand, aus dem es jederzeit würde hervorbrechen können als das Immer-wieder-Gleiche: ein mit dickem Firnis lackiertes Familienporträt, je nach Epoche mit oder ohne Volksempfänger, je nach Gemütslage mit oder ohne Lächeln, je nach Finanzlage mit oder ohne Perlenkette. Draußen die glühende Landschaft, drin die anheimelnde Düsternis. Draußen Erde, drinnen Holz. Und irgendwann wurden die drei dann eins: der Leib in einer Holzkiste im Erdreich. Verscharrt.
Die längst angebrochene Zeit wurde nach einigen Jahren noch einmal als solche verkündet und damit auch offiziell dem allgemeinen Vergessen übergeben. Vater und Mutter saßen sich mit halb offenen Mündern am Esstisch gegenüber. Die Kinder waren herangewachsen. Das Haus neu verputzt. Das Unglück war von nun an Privatsache. Die Erinnerung war nicht einmal verschwommen. Sie fehlte.
I
1
Krank? Stellte sich das nicht erst später heraus, sehr viel später, als alles schon vorbei war?
Ich glaube auch nicht, dass Siebert wirklich krank war. Ein Simulant, wenn man meine Meinung hören will.
Man simuliert nur das, was man hat.
Sagt wer? Dr. Ritter?
Leben wir nicht in einer Welt der Simulation?
Mittlerweile. Aber nicht damals. Damals war alles real.
Das heißt?
Siebert war krank. Der Alltag war grau. Dr. Ritter kam, drückte mit einem Spatel Sieberts Zunge herunter und hörte ihn ab.
Aber es muss doch eine Diagnose geben. Um welches Leiden soll es sich denn bei dieser angeblichen Krankheit Sieberts gehandelt haben?
Um das sogenannte von Dr. Ritter untersuchte, beschriebene und als Oneirodynia Diurnae bezeichnete Alltägliche Irrgehen.
Von Irrgehen kann keine Rede sein. Siebert hatte bereits damals seit Wochen die Wohnung nicht mehr verlassen.
Genau das ist doch eins der Symptome besagten Leidens. Der Betroffene vermeidet es, aus dem Haus zu gehen, aus Angst, sich zu verirren.
Sieberts Zuhausebleiben war also eine Vermeidungshaltung?
Er stand den ganzen Tag am Fenster und sah nach draußen auf die Straße und in Richtung Lindholmplatz.
Gab es am Lindholmplatz nicht ein altes Hünengrab und später dann den Exekutionsplatz, oder bringe ich da etwas durcheinander?
Seelenloch nannte man den Ort meines Wissens, aber ich weiß nicht, warum.
Am Lindholmplatz stand die alte Remise. Wir haben da selbst noch als Kinder gespielt.
War das an dem bewussten Winterabend, als das Unglück passierte?
Stimmt, dieser Winterabend, der so harmlos anfing. Siebert wurde von seiner Mutter zum Einholen geschickt.
Aber das war nicht am Lindholmplatz. Siebert wohnte mit seinen Eltern ganz woanders.
Mit dem bewussten Abend ist also nicht der Abend des Attentats gemeint?
Siebert war mit seinen Eltern in einem abgelegenen Haus untergekommen. Und ich meine mich zu erinnern, dass dieses Haus Seelenloch genannt wurde. Woher der Name kam, kann ich allerdings auch nicht sagen.
Besagtes Haus stand lange leer. Außerdem hatte man dort den kleinen Ralph Fählmann tot aufgefunden.
Nein, Ralph Fählmann war das nicht. Der Junge, den man im Seelenloch fand, hieß anders.
Er hing an der Decke.
Auch das stimmt nicht. Er steckte mit dem Oberkörper in einem mit Schlacke gefüllten Bottich.
War er nicht schon skelettiert?
Die Fenster waren verhängt. Im ersten Stock stand eine Frau in einem weißen Kleid.
Die Gräfin?
Nein, die ermordete Prostituierte.
Kein Wunder, dass Siebert als Kind Alpträume hatte und sich nachts nicht mehr nach Hause traute.
Es war doch genau umgekehrt. Er wollte nach Hause, traute sich aber nicht über das dunkle und unbeleuchtete Feld.
Weil es dort noch ungeräumte Granaten gab?
Die Granaten hatte man geräumt, aber das Feld war mit sogenannten Seelenlöchern übersät.
Kinder, die gesündigt hatten, blieben mit ihren Füßen in einem Seelenloch hängen und verhungerten.
Wurde Siebert von der Dunkelheit überrascht oder hatte ihn seine Mutter zu spät losgeschickt?
Siebert war ein verträumtes Kind. Er trödelte beständig auf dem Heimweg.
Vielleicht hat sich dieses Trödeln bis in seine Erwachsenenzeit fortgesetzt. Dann litt er unter Umständen gar nicht unter einer spezifischen Krankheit.
Die Winterabende waren sehr düster damals.
Sieberts Elternhaus lag auf einer Anhöhe.
Nicht in einer Talsenke?
Nein. Es war ein seltsames Gebäude mit einem windschiefen Dach. Draußen lagen allerlei alte Schrottteile herum. Wenn man an der letzten Straßenecke der Selbsthilfesiedlung stand, sah man es in der Ferne. Es hatte etwas von einer alten Mühle, nur ohne Flügel.
Handelt es sich um die Ecke, an der Siebert mit seinen Einkäufen zitternd anhielt und auf einen Bekannten seiner Eltern oder einen der Hausbewohner wartete, um sich ihm anzuschließen?
Wie viele Meter waren das von dieser Stelle bis zu Sieberts Elternhaus? Fünfhundert? Höchstens siebenhundert.
In der Dunkelheit verschwimmen die Proportionen. Wenn man nicht einmal die Hand vor den eigenen Augen sieht, können zwanzig Meter unüberwindbar erscheinen. Noch dazu für einen Jungen, der keine zehn ist.
Schließlich kniff er die Augen zusammen, presste die Lippen aufeinander, als wäre die Dunkelheit eine Flüssigkeit, in die er tief eintauchen müsste, um einen auf den Grund gesunkenen Handschuh emporzuholen, und rannte los.
Einen Handschuh?
Ja, einen Damenhandschuh aus braunem, feinem, leicht brüchigem Leder, der vor ihm in der flüssigen Dunkelheit schwebte und dessen Finger Siebert mit einer Bewegung, als pflückten sie aus der sie umgebenden viskosen Leere etwas heraus, aufforderten, ihm zu folgen.
Er fiel zweimal der Länge nach hin. Beide Male so unerwartet, dass er die eng an den Körper gepressten Arme nicht mehr rechtzeitig hochbekam, sondern lediglich und erst kurz vor dem Aufprall den Kopf mit einem Ruck zur Seite drehte, um sein Gesicht zu schützen.
War er mit dem Fuß in eins der Seelenlöcher geraten? Spürte er, wie es ihn hinab in die darunterliegenden Gänge zog? Träumte er nicht auch als Erwachsener noch regelmäßig von diesem Abend? Selbst in der Nacht vor dem Attentat?
Dr. Ritter hatte Siebert ein Mittel für eine traumlose Nachtruhe verschrieben.
»Traumlose Nachtruhe«, heißt nicht so ein Roman von Horst Nehmhard?
Zuhause konnte er seiner Mutter nicht erklären, warum er die Einkäufe an der Straßenecke zurückgelassen hatte. Selbst als sie ihn aufforderte, genauer nachzudenken, fiel ihm kein wirklicher Grund ein. Dennoch hatte er die Lebensmittel nicht einfach vergessen, sondern ganz bewusst zurückgelassen.
Gab es Zeugen für diesen Vorfall?
Keine, die sich dazu äußern wollten.
Also ist Sieberts Tagebuch doch noch aufgetaucht? War es nicht mitsamt seinen anderen Schriften verschollen? Angeblich von ihm selbst vernichtet?
Ist es nicht merkwürdig, dass alle anderen Papiere verschwunden sind und ausgerechnet dieses Tagebuch erhalten sein soll?
Welche Bedeutung hat der braune Damenhandschuh?
Stand eigentlich eine Kastanie am Lindholmplatz oder ein Walnussbaum?
Ist Siebert nicht der in den Schriften Dr. Ritters als S. abgekürzte Kranke, dem neben dem Alltäglichen Irrgehen auch noch das ebenfalls von Dr. Ritter beschriebene »Manische Kritzeln« diagnostiziert wird?
War Dr. Ritter nicht ein Studienkollege von Dr. Hauchmann? Und war der alte Siebert nicht sein Doktorvater?
Der alte Siebert war doch Schrotthändler, ohne jede akademische Ausbildung.
Mit der Bezeichnung »der alte Siebert« ist nicht zwangsläufig Sieberts Vater gemeint.
Sind nicht die verstreuten Notizen Horst Nehmhards unter dem Titel »Manisches Kritzeln« erschienen?
Können wir uns darauf einigen, dass es regnete?
Es kam tatsächlich ein ziemlicher Guss herunter, der die Passanten nicht weit vom Lindholmplatz in die engen Seitengassen drängte. Unter ihnen ein Arzt, der von einem Hausbesuch kam, sowie eine junge Frau, deren Handtasche sich beim eiligen Überqueren der Straße öffnete, sodass ein Stenoblock herausrutschte und auf das nasse Pflaster fiel. Als ginge ihn das alles nichts an, lief jemand mit einem schlechtsitzenden Verband vorbei.
Handelt es sich bei dem Arzt um Dr. Ritter, der gerade seinem Patienten Siebert einen Hausbesuch abgestattet hatte, nicht wegen der durchaus beherrschbaren Oneirodynia Diurnae, sondern um ihm eine weitere, wesentlich schlimmere Diagnose zu überbringen, die Sieberts Leben von Grund auf verändern würde?
Der Arzt ist ein zufällig vorbeieilender Passant. Siebert geht es vor allem um die junge Frau mit dem Stenoblock. Er meint in ihr nämlich Marga zu erkennen.
Arbeitete Marga zu dieser Zeit nicht als Sekretärin?
Marga arbeitete in einem der Büros im unzerstörten Gebäudekomplex am Friedrich-Fritz-Winter-Platz. Warum aber sollte sie an ihrer eigenen Wohnung vorbeigehen, um kurz vor dem Lindholmplatz in die Schneidgasse einzubiegen, die sie leicht auf anderem Weg hätte erreichen können, ohne Gefahr zu laufen, dass Siebert, der die meiste Zeit am Fenster stand und nach draußen schaute, sie entdeckte?
Diese angeblich überbrachte Diagnose, die dann auch noch zu einer Veränderung in Sieberts Leben führen soll, ist ein schrecklich aussageloses Klischee, das nur dazu dient, die Aufmerksamkeit von anderen Dingen abzulenken.
Das stimmt. Es war nicht die Zeit, in der sich ein Leben durch eine überbrachte Diagnose veränderte. Erstens. Zweitens: Diagnosen wurden und werden nicht überbracht. Drittens: Es gab überhaupt nicht das Instrumentarium, um eine wie auch immer geartete mortale, fatale oder auf andere Art lebensverändernde Diagnose zu stellen. Die Ärzte konnten, wenn überhaupt, etwas erahnen, die Menschen vertrösten und aus ihren überfüllten Wartezimmern wieder nach Hause schicken.
Dennoch gelang es Dr. Ritter in dieser Zeit, ein komplexes Krankheitsbild wie das der Oneirodynia Diurnae zu beschreiben.
Bei der Oneirodynia Diurnae handelt es sich bestenfalls um eine Arbeitshypothese. Die Beschreibung von Dr. Ritter ist zudem ungenau und in einer romantisierenden Sprache verfasst.
Heißt es nicht sogar an einer Stelle: »Die Bewegungen der Stadt bestimmen den Pulsschlag des Erkrankten«? Und später dann: »Ihm wird durch eine Auflösung der Raumstrukturen in reine Zeitlichkeit die Orientierung versagt, weshalb er die Ruhe des Rechtecks sucht«?
Wird damit auf die eigenwillige Form der Stadt angespielt?
Der Kranke sucht Beruhigung in einem Zimmer, das er nicht mehr verlässt, einer Wohnung, in die er sich zurückzieht, oder auch dem genau abgegrenzten Ausblick aus einem Fenster.
Stammt der Begriff von der »Ruhe des Rechtecks« nicht aus dem gleichnamigen Roman von Horst Nehmhard?
Nehmhards Roman erschien erst Jahre später, nachdem sich die Definition des Alltäglichen Irrgehens als Krankheit in einer von Bechthold und Meininger durchgeführten Untersuchung bereits als unhaltbar erwiesen hatte. Dr. Ritter wurde dabei neben dem Fehlen entsprechender Testreihen zu Recht eine unzulässige Bündelung von disparaten Symptomen nachgewiesen.
Ist nicht jeder Krankheitsbegriff eine Bündelung disparater Symptome? Zeichnet das Zusammenführen vorher nicht als zusammengehörig gedachter Erscheinungen nicht generell die Schaffung eines Begriffs aus?
Als Bechthold und Meininger die Untersuchungsergebnisse Ritters widerlegten, war bereits eine andere Zeit angebrochen. Krankheiten entwickeln sich nie unabhängig von der Epoche, in der sie auftauchen, sondern werden von den historischen Gegebenheiten getragen. Die nervösen Ticks der Moderne etwa, die dem flimmernden Zucken der neu entwickelten Filmprojektoren entsprachen. Das sogenannte Rauschsprechen, das mit den ersten Grammophonen auftauchte. Das Streckengehen bei Männern und das nie eindeutig gefasste, vielmehr allgemein als »Weichen« beschriebene Gehverhalten von Frauen zur Zeit der ersten Eisenbahnen. Und was ist mit der Fleckgestalt?
Der Fleckgestalt?
Die Unfähigkeit, eine Person als Ganzes wahrnehmen zu können. Der Erkrankte sieht sein Gegenüber als verschiedenfarbige Flecken, die auseinanderzufallen drohen.
Welche Bedeutung haben die an der Straßenecke zurückgelassenen Einkäufe in der Erinnerung Sieberts? Geht er auf sie noch einmal genauer ein?
Waren Bechthold und Meininger nicht Assistenzärzte bei Dr. Ritter? Sorgte das Ergebnis ihrer Untersuchung nicht für die frühzeitige Entlassung von Dr. Ritter, während sie ihre eigene Karriere dadurch beförderten und wenig später Leiter des neuen Klinikums an der Ostflanke wurden?
In Aufzeichnungen anderer Tagebuchschreiber, die zum Vergleich herangezogen wurden, ist von Regen übrigens keine Rede. Das Eisenbahnunglück auf der Zufahrt zum Ostbahnhof wird erwähnt. Die Fällung der letzten beiden Platanen im Stadtpark. Und der ungewöhnlich starke Wind, der die Sandhügel am Nahrthalerfeld abtrug.
Kam unter dem Sand etwas zum Vorschein?
Was hätte zum Vorschein kommen können?
Seelenlöcher zum Beispiel.
Die Seelenlöcher befanden sich nicht auf dem Nahrthalerfeld, sondern in der Nähe von Sieberts Elternhaus. Außerdem sind das Ammenmärchen.
Und was ist mit der alten Karte im Privatmuseum in der Dolmenstraße, auf der sämtliche Seelenlöcher der Stadt minutiös verzeichnet sind?
Könnte es nicht sein, dass das Wetter bei Siebert eine symbolische Rolle spielt und seinen Seelenzustand beschreibt, weshalb andere Tagebuchschreiber in ihren Aufzeichnungen nicht zwangsläufig auch Regen erwähnen müssen?
Der auf die regennasse Straße fallende und vom Arzt aufgehobene Stenoblock wäre dann als Symbol einer Verbindung zwischen Arzt und Sekretärin zu interpretieren.
Siebert verdächtigte Marga, ein Verhältnis mit dem ihn behandelnden Arzt, Dr. Ritter, zu haben?
Siebert selbst wäre folglich der Mann mit dem schlechtsitzenden Verband, der vorübergeht, als ginge ihn das alles nichts an.
Wofür steht der schlechtsitzende Verband?
Vielleicht für eine Verletzung, die sich nicht richtig behandeln lässt?
Also die Oneirodynia Diurnae?
Nein, eher ein psychisches Problem, etwas, das Sieberts Verhältnis zu Marga betrifft.
Das Alltägliche Irrgehen ist eine psychische Krankheit.
Siebert fürchtete Dr. Ritter, weil er ihm und seinen Behandlungsmethoden schutzlos ausgeliefert war.
Vielleicht war Dr. Ritters Diagnose vorgeschoben, um Siebert als Rivalen auszuschalten.
Das hieße, Marga hätte Dr. Ritter nicht durch die Krankheit Sieberts kennengelernt, sondern weil sie Dr. Ritter kennenlernte und ein Verhältnis mit ihm begann, veranlasste sie Dr. Ritter, Siebert eine psychische Krankheit zu diagnostizieren? Ist das glaubwürdig? Hätte Siebert nicht irgendwelche Symptome aufweisen müssen?
Symptome lassen sich leicht einreden. Niemand ist gesund. Uns allen fehlt irgendetwas. Und oft sind wir froh, wenn man uns den Weg in eine Krankheit erleichtert.
Das stimmt. Siebert brachte zudem aus seiner Kindheit eine gewisse Disposition für ungewöhnliche Krankheiten mit.
Hatte er sich nach dem bewussten Abend nicht eine seltsame Gangart angewöhnt, mit der er den Seelenlöchern auszuweichen versuchte?
Konnte er ferne Objekte nicht nur noch verschleiert wahrnehmen?
Hatte er nicht beständig Angst vor einer erneuten Begegnung mit der Gräfin?
Es gab keine Gräfin. Nur besagte Prostituierte. Aber auch die hatte mit Sieberts ehemaligem Elternhaus nichts zu tun.
Dafür aber mit Siebert, oder?
Nach dem Vorfall mit den an der Straßenecke zurückgelassenen Einkäufen konnte Siebert einen Arm nicht mehr bewegen. Als seine Mutter ihn am anderen Morgen weckt und er die Bettdecke fassen will, versagen ihm die Finger den Dienst und er muss feststellen, dass der rechte Arm ab der Schulter wie ein Fremdkörper kalt und leblos an ihm hängt. Siebert schreit, springt auf, rennt in die Küche und schüttelt sich, als wolle er sich von dieser nicht mehr zu ihm gehörenden Extremität befreien. Die Mutter will ihn beruhigen, packt ihn an den Oberarmen, erschrickt aber ebenfalls, als sie den kalten Arm berührt, worauf sie Siebert wieder loslässt und sich dessen Panik noch einmal steigert, er sich in einem Gefühl der besinnungslosen Verzweiflung mehrfach im Kreis um sich selbst dreht, schließlich zum Fenster läuft, dies aber glücklicherweise nicht öffnen kann, da er in seiner Erregung nicht auf den Gedanken kommt, den linken Arm zu benutzen.
Warum läuft Siebert zum Fenster? Wollte er hinausspringen? Nur weil er seinen rechten Arm nicht mehr spürt?
Folgte er dem Befehl der Gräfin, die ihm einflüsterte, sich in eins der zahlreichen Seelenlöcher vor dem Haus zu stürzen?
Die letzten Nachkommen des einzigen Grafengeschlechts der Gegend wurden vor über 150 Jahren hingerichtet.
Trug die ermordete Prostituierte nicht den Spitznamen Baronesse?
Da es ihm weder gelingt, den Arm zu beleben, noch abzuschütteln, gerät Siebert in Panik. Er fühlt sich von der abgestorbenen Extremität als etwas Fremdem verfolgt. Es ist ein Moment des Schocks, weil eine bestehende Ordnung – »mein Körper funktioniert« – nicht mehr gültig ist, sich aber noch keine neue Ordnung – »ich kann meinen rechten Arm nicht mehr bewegen« – etabliert hat.
Das ihn in diesem Dazwischen beherrschende Gefühl der völligen Orientierungslosigkeit und Entfremdung lässt Siebert vor sich selbst fliehen. Anders ausgedrückt, das Gefühl, das Eigene als fremd zu empfinden, ist so unerträglich, dass Siebert bereit ist, alles zu tun, um diesem Gefühl ein Ende zu setzen, auch wenn es ihn, so absurd es scheinen mag, sein Leben kostet.
Dann ist diese Episode eine Parabel für die Zeit, in der die bestehende Ordnung nicht mehr gültig ist und noch keine neue etabliert wurde?
Liefen die Menschen damals unentwegt umher und versuchten, ihrem Leben ein Ende zu bereiten? Wohl kaum.
Dieses von Siebert erwähnte Beispiel soll seine Disposition verdeutlichen, sich unter Umständen von Marga und Dr. Ritter ein Krankheitsbild einreden zu lassen, da er nach besagtem Erlebnis das Vertrauen in seinen Körper verloren hatte und sich auch später noch ständig beobachtete, um selbst minimale Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und eine drohende Verschlimmerung abzuwenden.
Es ist also eine Parabel für den Verlust des Vertrauens in die abgestorbenen Staatsorgane?
Wünschte sich der kleine Siebert den Adel aus seinen Märchenbüchern zurück?
Es handelt sich nicht um eine Parabel, sondern um ein Erlebnis aus Sieberts Kindheit. Die Mutter gewinnt die Fassung wieder, schickt den Bruder los, um Dr. Ritter zu holen, bringt Siebert zurück ins Bett und beginnt, seinen leblosen Arm mit Alkohol einzureiben. Siebert riecht den Alkohol, spürt aber weder Wärme noch die Hand der Mutter. Er weint, weil er meint, sterben zu müssen. Gleichzeitig fallen ihm zwei Mädchen aus der Volksschule ein, die ihre langen Zöpfe abgeschnitten bekamen, weil sie Läuse hatten. Auch sie meinten, sterben zu müssen, und weinten und schrien, bevor sie sich in ihr Schicksal fügten.
Wollte sich der junge Siebert mit diesem Bild beruhigen? Bereitete er sich innerlich darauf vor, seinen rechten Arm opfern zu müssen, so wie die Mädchen ihre Zöpfe opfern mussten, um weiterleben zu können? Oder ist es ein ganz anderes Bild, das Siebert in der Erinnerung vor Augen hat und von ihm auf sein jugendliches Ich übertragen wird, denn es scheint wenig wahrscheinlich, dass den beiden Mädchen die Zöpfe öffentlich abgeschnitten wurden?
Siebert sinkt durch die Aufregung und den Alkoholdunst in eine Ohnmacht. Als er wieder aufwacht, gerät er erneut in Unruhe, weil er lauter fremde Menschen um sich sieht und zunächst nicht weiß, wo er sich befindet. Er denkt sogar für einen Augenblick, bereits gestorben und in einer anderen Welt zu sein. Zuerst ist er erleichtert, da er sicher war, wegen seiner Sünden in die Hölle oder zumindest ins Fegefeuer zu geraten, dann aber erinnert er sich an seinen Arm, versucht, abermals vergeblich, ihn zu bewegen, und empört sich über eine Nachwelt, die sich nicht wesentlich von der alten Welt unterscheidet. Schließlich sieht er seine Mutter und erkennt in einem der fremden Männer Dr. Ritter, der seinen Arm untersucht und feststellt, dass sich Siebert, wahrscheinlich durch einen der beiden Stürze am Vorabend, die rechte Schulter ausgekugelt hat und über Nacht so ungünstig lag, dass die Blutversorgung abgedrückt wurde. Dr. Ritter renkt die Schulter ein und fixiert sie mit einem Verband, dann setzt er die Blutzirkulation durch feste Massagen wieder in Bewegung. Siebert schreit auf, denn das in den Arm zurückströmende Blut verursacht ihm große Schmerzen. »Siehst du«, sagt Dr. Ritter, »jetzt spürst du schon wieder was.«
Darauf bezieht sich viele Jahre später der Tagebucheintrag des erwachsenen Siebert, dass Schmerz Empfindung bedeutet, während Empfindungslosigkeit darauf hinweise, dass etwas abgestorben sei.
Spielt er damit auf seine Beziehung zu Marga an? Hofft Siebert einerseits darauf, dass etwas in ihm abstirbt, während er sich andererseits davor fürchtet? Schmerzt ihn das Verhältnis von Marga und Dr. Ritter, während ihn der Gedanke ängstigt, seine Beziehung zu Marga zu beenden?
Vielleicht hat Siebert Angst, dass ein Gefühl in ihn zurückströmt und ihm dadurch Schmerzen verursacht.
Das alles sind Hypothesen. Es ist noch nicht einmal klar, ob Marga Dr. Ritter überhaupt kannte.
Obwohl Dr. Ritter Siebert behandelte?
Selbst das ist nicht eindeutig erwiesen. Es spricht nämlich einiges dagegen, zumindest gegen die Person Dr. Ritter, der einmal als Kinderarzt des jungen Siebert, dann als behandelnder Arzt des erwachsenen Siebert auftaucht, was recht unglaubwürdig ist.
Warum sollte ein Arzt nicht zwanzig, dreißig Jahre praktizieren?
Das schon, aber bleibt man als Erwachsener bei seinem Kinderarzt? Gibt es nicht aus gutem Grund Kinderärzte?
Das heißt, Siebert macht aus seinem Kinderarzt und dem Arzt, der ihn wegen der Oneirodynia Diurnae behandelt, eine Person? Warum sollte er das tun?
Ein weiterer Eintrag aus Sieberts Tagebuch: »Ein Geflecht von Schnüren. Dunkelblaues Wollgarn. Graue Fäden. Zurückgelassen auf einem Holztisch zwischen Obstbäumen. Es ist bereits Herbst. Ein Abend. Tiefhängende Wolken.«
Das bestätigt die Auffassung, Sieberts Eintragungen nicht als Beschreibungen einer Realität, sondern als metaphorische Reflexionen zu verstehen. Siebert versucht, seine Gefühle in entsprechende Bilder zu fassen. Das Geflecht von Schnüren könnte zum Beispiel dem Beziehungsgeflecht zwischen ihm, Marga und Dr. Ritter entsprechen.
Eine solch eindimensionale Interpretation raubt den Bildern ihre Mehrdeutigkeit. Gerade um die geht es aber.
Merkwürdig ist folgender Eintrag: »Müde auf dem Heimweg. In der Dunkelheit neben einem Stück Mauer schaut ein Junge auf seine ausgestreckte Hand und fühlt zum ersten Mal die Möglichkeit, etwas vergessen zu können. Es ist ein Vergessen, das nichts mit Erinnern zu tun hat, sondern aus sich selbst entsteht und eine erste Trennung andeutet. Er meint, von außen auf sich zu sehen. Ein Jeep fährt vorbei. Gegenüber steht Siebert am Fenster.«
Was ist daran merkwürdig? Siebert bewegt sich, wie wir gesehen haben, in seinen Aufzeichnungen oft in der Erinnerung. Warum sollte er nicht eine fiktive Welt konstruieren, in der er selbst auftauchen und am Fenster gesehen werden kann? Er ist der Junge und gleichzeitig der, der den Jungen beobachtet.
Es geht gerade nicht um Erinnerung, sondern um das Vergessen. Ein selbstständiges Vergessen, das nicht Gegenteil des Erinnerns ist, sondern ein eigenständiger Vorgang.
Wie könnte man den Vorgang des eigenständigen Vergessens beschreiben? Handelt es sich um eine gedankliche Bewegung, die aber, anders als das Erinnern, nicht durch etwas ausgelöst wird, sondern aus dem Nichts kommt?
Könnte man das mit Seelenlöchern überzogene Feld vor Sieberts Elternhaus oder die mit Seelenlöchern durchsetzte Stadt als Symbol für Sieberts lückenhafte Erinnerung verstehen?
Der Junge betrachtet seine ausgestreckte Hand. Heißt das, Siebert erinnert sich wieder an den abgestorbenen Arm und merkt, dass er selbst dieses einschneidende Ereignis, wenn auch vielleicht nur für wenige Momente, hatte vergessen können?
Und der Jeep wäre dann eine Anspielung auf die Zukunft.
Der Jeep?
Der Jeep steht mit dem Attentat in Verbindung. Immer wieder taucht er in Sieberts Tagebuch auf. Scheinbar nur am Rande erwähnt, lässt er sich als Andeutung lesen, als Hinweis auf etwas, das noch aussteht.
Am Abend des Attentats setzt sich Siebert übrigens, und auch das ist bezeichnend, in eine größtmögliche Distanz vom Tatort. Er beschreibt sich außerhalb seiner Wohnung – ausgerechnet an diesem Abend, möchte man sagen –, mehrere Kilometer entfernt unter einer Eisenbahnbrücke. Es heißt dort: »Die gelb erleuchteten Rechtecke der Zugfenster tanzen über die nächtliche Brücke. Wasser schwappt gegen die Pfeiler. Von weiter oben kommen Stimmen. Jemand bietet eine Wette an. Um was? Erst jetzt fällt ihm ein, dass er keinen Einsatz zu bieten hat. Wie früher auf dem Schulhof sagt er reflexhaft: ›Um die Ehre.‹«
Um die Ehre. Es geht Siebert also um seine verletzte Ehre. Siebert versucht, das Attentat zu rechtfertigen.
Wie bereits gesagt: Das alles sind Interpretationen. Was Siebert mit diesen Eintragungen genau meinte, ist nicht zu sagen. Die genauen Umstände des Attentats sind ebenso wenig aufgeklärt.
Und wenn diese Eintragungen gar nicht von Siebert selbst stammen?
Gibt es eine Schriftanalyse?
Sieberts Handschrift soll sich durch die Krankheit stark verändert haben.
Je weniger Siebert ausging und zu Hause ausharrte, desto deutlicher nahm er die Bewegungen der Stadt wahr, beinahe so, als könne er sie am Himmel über der alten Schlosserei ablesen. Allen anderen, die draußen entlangliefen, die in Häusern verschwanden, wieder herauskamen mit einem Aktenordner unter dem Arm, über den Platz gingen, im Vorübergehen in die immer noch leeren Auslagen der Geschäfte blickten, schienen diese Bewegungen zu entgehen.
Ist das ein weiterer Eintrag aus Sieberts angeblichem Tagebuch, in dem er sich zu einem Menschen mit einem besonderen Sensorium stilisiert, wie es Kranke übrigens oft tun, um sich über ihre aussichtslose Lebenssituation hinwegzutrösten? Verständlicherweise.
Siebert spricht von sich selbst in der dritten Person. Mindert oder verstärkt das die Selbststilisierung?
Bemerkenswert, dass er mit der Formulierung »Bewegungen der Stadt« an die Beschreibung anknüpft, die Dr. Ritter von dem an Alltäglichem Irrgehen Erkrankten gibt, wenn er schreibt: »Die Bewegungen der Stadt bestimmten den Pulsschlag des Erkrankten.«
Wir wissen nicht, wer hier wen kopiert.
Als der Arzt und die anderen Menschen, bei denen es sich wahrscheinlich um Nachbarn handelte, wieder gegangen sind und Siebert sich etwas beruhigt hat, bringt ihm die Mutter auf einem Tablett eine Tasse Milch und ein Frühstücksbrot ans Bett. Siebert nimmt einen ersten Schluck, spürt jedoch plötzlich und für ihn völlig unerwartet einen nicht zu unterdrückenden Widerwillen und Ekel und muss sich sofort übergeben. In dem Moment nämlich, als er die Milch herunterschluckt, meint er, dass es sich um die Milch handeln muss, die er am Vorabend geholt und mit den anderen Einkäufen, auch Brot und Butter, an der Straßenecke zurückgelassen hat. Die Mutter hatte das Einkaufsnetz noch am selben Abend herbeigeschafft, gleich nachdem Siebert nach Hause zurückgekommen war. Dennoch hatten die Einkäufe für etwa eine Viertelstunde unbewacht an der Straßenecke gestanden. Siebert entwickelt aus diesem unvermutet auftauchenden Ekel, vielleicht auch, um ihn zu rechtfertigen, die Vorstellung, dass Mäuse in die Milchflasche eingedrungen seien, Käfer sich in die Butter gebohrt hätten, Wanzen und Ungeziefer im Brot nisteten. Tagelang kann er nichts zu sich nehmen, weil er von diesen Phantasien heimgesucht wird. Jeder Bissen verursacht ihm Übelkeit. Er lässt sich auf gutes Zureden hin etwas Kamillentee einflößen und begleitet, obwohl geschwächt und durch seinen bandagierten Arm zusätzlich beeinträchtigt, seine Mutter schließlich zum Einkaufen. Sie will ihm zeigen, dass sie frische Milch, neue Butter und gerade angeliefertes Brot kauft, allesamt Dinge, vor denen er sich nicht ekeln muss. Doch es hilft nichts. Kaum haben sie das Lebensmittelgeschäft betreten, überkommt Siebert ein erneuter, diesmal noch allgemeinerer Ekel, weil er meint, sämtliche Waren seien von Mäusen, Käfern, Wanzen und Ungeziefer befallen. Da er schon lange nichts mehr im Magen hat, kann er sich nicht übergeben, wird aber von einem Würgreflex heimgesucht, der ihn die nächsten Wochen nicht mehr verlässt. Die erste Nahrung, die er wieder zu sich nehmen kann, ist Zwieback. Weil Zwieback in versiegelten Blechbüchsen verkauft wird, erscheint er Siebert relativ sicher. Siebert untersucht die Büchse genau, bevor sie geöffnet wird. Nach dem Essen verschließt er sie mit Klebeband und lässt sie von seiner Mutter auf den Schrank stellen. Siebert selbst muss das Klebeband vor jeder Mahlzeit, und nachdem er die Büchse erneut untersucht hat, entfernen. Mithilfe dieses Rituals kann man ihn langsam wieder an normale Nahrung gewöhnen. Indem ihm die Mutter zeigt, dass alles, was sie zubereitet, aus versiegelten Blechdosen kommt, wird es Siebert langsam möglich, wieder an den täglichen Mahlzeiten teilzunehmen. Nur Milch verweigert er weiterhin über Monate. Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass eine Maus ausgerechnet in eine Milchflasche geraten sollte, sieht Siebert genau dieses Bild immer wieder vor sich und meint sich sogar zu erinnern, dass ein Junge vor seinen Augen eine ganze Flasche Milch leergetrunken und ihm anschließend eine tote Maus auf dem Flaschenboden gezeigt und vor seinen Augen hin- und hergeschwenkt habe.
Ist das nicht eine recht eindeutige Allegorie? Die alten Lebensmittel sind kontaminiert und nur die in Dosen importierte Nahrung der Alliierten genießbar? Stichwort: Corned Beef.
Können diese Erinnerungen nicht für noch etwas anderes stehen? Sind nicht gerade die Bilder von den beiden Mädchen, denen die Zöpfe abgeschnitten werden, und dem Jungen, der Milch aus einer Flasche trinkt, in der eine Maus schwimmt, so aussagestark, dass sie nur symbolisch zu verstehen sind?
Ist es nicht merkwürdig, dass sich die imaginierte Vorstellung von verseuchtem Essen über das reale Leiden einer ausgekugelten Schulter und eines beinahe abgestorbenen Arms legt und diese in den Hintergrund drängt? Oder erfahren wir noch mehr darüber, etwa wie der Heilungsprozess verlief und ob irgendwelche Schäden zurückblieben?
Dazu äußert sich Siebert nicht. Stattdessen findet sich nach der Schilderung der Episode mit dem Arm völlig unvermittelt folgender Eintrag: »Jemand blutet aus der Nase. Eine Frau öffnet, diesmal ganz bewusst, ihre Handtasche. Die Wiederholung der Rituale täuscht über die Geschichte der Endlichkeit hinweg.«
Ist »Geschichte der Endlichkeit« nicht auch ein Romantitel von Horst Nehmhard?
Viel interessanter ist doch das bewusste Öffnen der Handtasche. Könnte man nicht sagen, dass Marga Dr. Ritter in der Schneidgasse zufällig begegnete und sie sich dort kennenlernten, weil er den zu Boden gefallenen Stenoblock aufhob und ihr reichte? Es wäre eine Variation des fallengelassenen Taschentuchs. Das bewusste Öffnen der Handtasche wäre dann Margas spätere Hingabe an Dr. Ritter.
Fand diese sogenannte Hingabe in der Pension Guthleut in der Ulmenallee statt?
Warum verbinden sich bei Siebert Kindheitserinnerungen regelmäßig mit seinem Verhältnis zu Marga? Ist es die Melancholie angesichts seiner unglücklichen Liebe, die diese Erinnerungen hervorruft?
Siebert hatte von seinem Fenster aus keinen Einblick in die Schneidgasse, die vor dem Lindholmplatz, von Sieberts Wohnung aus gesehen, rechts abgeht.
Auf einem Normalachtfilm sieht man einen Mann auf einer Terrasse mit einem Kind tanzen. Der Kopf des Mannes ist nicht zu erkennen. Orangefarbene Farbkleckse und weiße Lichtblitze umkreisen die beiden. Ein unschuldiger Sommertag.
Was heißt unschuldig in dem Zusammenhang?
Diese Szene findet an einem Sommertag statt, dem man weiter keine Beachtung schenkt, weil man meint, dass noch viele solcher Tage folgen werden. Wir befinden uns am Beginn des Sommers. Am Beginn einer neuen Zeit zudem.
Es sind also relativ neue Filmaufnahmen? Woher stammt das Filmmaterial? Wer hat es entwickelt? Und wer hat die Szene gefilmt?
Spielt das eine Rolle?
Man denkt unwillkürlich an eine Frau. Die Mutter des Kindes und die Gattin des Mannes, der dort tanzt. Was aber, wenn ein anderer Mann diese Szene aufgenommen hat?
Handelte es sich bei dem Mann, der mit dem Kind tanzt, um den alten Siebert? Während Dr. Ritter, sein ehemaliger Doktorand, diese Szene filmt?
Liegt Ritters Promotion beim alten Siebert zu diesem Zeitpunkt nicht bereits sehr viele Jahre zurück?
Warum sollte er seinem Doktorvater nicht weiterhin freundschaftlich verbunden sein und ihn von Zeit zu Zeit besuchen oder einer Einladung folgen?
Ist Dr. Ritter dem alten Siebert etwas schuldig?
Dr. Ritter legt großen Wert auf Beziehungen. Nur darum bekam er in einer so schwierigen Zeit überhaupt Gelder für seine fragwürdige Untersuchung der Oneirodynia Diurnae.
Vielleicht bekam Dr. Ritter gar keine öffentlichen Gelder für seine Untersuchungen, sondern einen entsprechenden Zuschuss aus einem Fonds, den der alte Siebert eingerichtet hatte. Dennoch kann es sich bei diesem Filmausschnitt um ein ganz harmloses Vergnügen mit einem Enkel- oder Nachbarskind handeln. Hinter den orangefarbenen Farbklecksen und weißen Lichtblitzen, vielleicht auch außerhalb des Kameraausschnitts, kann eine komplette Kaffeegesellschaft versammelt sein, die dem unschuldigen Vergnügen des Mannes mit dem Kind zuschaut.
Es gibt keine unschuldigen Vergnügen. Und sie sind es schon gar nicht, wenn man sie so nennt.
Sie sind es vor allem dann nicht, wenn andere zuschauen. Der Zuschauer raubt allem die Unschuld.
Was hieße das für Siebert, der Tag für Tag am Fenster steht, auf die Straße schaut und damit längst zu einem chronischen Zuschauer geworden ist? Kann man wirklich sagen, dass er den Menschen, die über den Lindholmplatz spazierten und auf der Straße vorübergingen, allein durch seinen Blick die Unschuld raubte?
Man kann immer zufällig in den Fokus eines anderen geraten. Bei dem mit einem Kind tanzenden Mann handelt es sich aber um eine Vorführung, zu der Menschen geladen wurden. Sie mögen vielleicht auch aus anderen Gründen gekommen sein, zum Beispiel um bei einem Sektempfang über den vom alten Siebert eingerichteten Fonds unterrichtet und danach zum Spenden aufgefordert zu werden. Nichtsdestotrotz wurden sie im Laufe dieses Empfangs Zeuge dieser fragwürdigen Zurschaustellung.
Man trägt also für alles die Verantwortung? Selbst für Situationen, in die man zufällig gerät? Sind solche Gedanken nicht Auslöser der Oneirodynia Diurnae? Man wird von der überall lauernden Verantwortung erschlagen, wagt nicht länger, bewusste Ziele anzustreben, sondern verfällt dem besagten Alltäglichen Irrgehen, das einen dazu bringt, das Haus nicht mehr zu verlassen, da man sich nur dort in einer überschaubaren, vor allem abgeschlossenen Umgebung sicher sein kann, nicht in eine Situation zu geraten, die einem eine weitere Verantwortung aufbürdet.
»Bilder, die verwischt einen Arm zeigen, der sich dreht, eine Schulter, die sich wendet, eine Hand, die nach etwas greift, ein Gesicht, das sich aufrichtet, Augen, die sich schließen: Warum gibt es kaum Erinnerungen an solche Momente, wo doch das meiste, wenn genau erinnert, unscharf sein müsste?«
Beschreibt Siebert hier seine nachlassende Sehschärfe, die ihm eine Orientierung zusätzlich erschwerte? War Sieberts Situation nicht relativ aussichtslos? Hatte er sein Leben nicht, wie es an anderer Stelle heißt, »an die Wand gefahren«, und beging er deshalb eine Gewalttat, die ihn aus dieser ihn immer weiter einengenden Entwicklung befreien sollte?
»Ein Arm, der sich dreht«. Taucht hier erneut der ausgekugelte Arm auf? Bezieht sich die Unschärfe auf den ungenauen Vorgang des Erinnerns?
Man kann am Beispiel Sieberts sehen, dass auch eine Tat, die später als unüberlegt und für den Ausführenden selbst als unerklärlich beschrieben wird, einen Vorlauf hat, den man »unbewusste Planung« nennen könnte.
Ist »Unbewusste Planung« nicht der Titel eines Romans von Horst Nehmhard?
Haben die Kindheitserinnerungen in diesem Zusammenhang eine spezifische Bedeutung? Vermitteln sie Siebert das Gefühl, alles sei vorherbestimmt und ergebe sich aus dem bereits Erlebten? Oder verstärken sie seine Abwehr gegen das Leben, aus dem er sich, aus welchem Grund auch immer, zu befreien versucht?
Eine Frau sitzt in einem gekachelten Raum und wartet. Ein Hotel wird abgerissen. Ein anderes bleibt stehen, obwohl das obere Stockwerk fehlt. Es wird ein Leinentuch über einen Körper gelegt. Die langen Gänge. Das flackernde Licht. Einer lässt die Aktenmappe nicht los, die er bei sich trägt. Ein anderer erscheint in zerschlissener Uniform ohne Rangabzeichen. Ein Mädchen dreht sich vor einem leergeräumten Geschäft auf der Straße um. Ein Jeep fährt vorbei. Die Organisation ist schwer aufrechtzuerhalten.
Kann es sein, dass Marga Sieberts Tagebuch ergänzt hat? Diese Stelle hört sich so an.
Der Jeep würde dagegensprechen. Der Jeep ist, wie wir gesehen haben, ein für Siebert signifikanter Topos. Er versucht sich durch ihn zu rechtfertigen.
Bevor sie die Anstellung in einem der Büros im unzerstörten Gebäudekomplex am Friedrich-Fritz-Winter-Platz bekam, arbeitete Marga vorübergehend als Krankenschwester. Sie sprach selten von ihren Patienten und den Erlebnissen, denen sie dort ausgesetzt war, aber es gibt tatsächlich eine Geschichte, in der ein Mann mit einer Wunde im Bauchraum eingeliefert wurde, der seine Aktenmappe, wahrscheinlich um sich zu schützen, vor diese Wunde presste und nicht bereit war, sie loszulassen, bis einer der Ärzte die Tasche kurzerhand entzweischnitt.
Wenn Marga als Krankenschwester arbeitete, liegt es doch auf der Hand, dass sie in diesem Zusammenhang Dr. Ritter kennenlernte.
Dr. Ritter führt eine eigene Praxis und arbeitet nebenher in der Forschung. Mit dem notdürftig in der ehemaligen Brauerei in der Gottfried-Helm-Straße eingerichteten Lazarett hatte er nie etwas zu tun. Zudem war Marga keine ausgebildete Krankenschwester, sondern leistete dort eine Art Hilfsdienst.
Kam sie dabei mit dem angeblichen Spion in Berührung, der sich als Arzt ausgab?
Es handelt sich um den Fall Behring. Ein angeblicher Arzt und Chirurg, der im Lazarett in der Gottfried-Helm-Straße arbeitete und durch seine Zurückhaltung auffiel, mit der er nur alltägliche Diagnosen und Bagatellbeschwerden kommentierte, sich aber standhaft weigerte, bei schwerwiegenden Krankheiten eine Meinung abzugeben oder gar, obwohl ein akuter Mangel an entsprechend ausgebildeten Ärzten herrschte, zu operieren. Seine Umgebung nahm seine Weigerungen gezwungenermaßen hin. Er schlich wie ein Gespenst durch die Kellergewölbe des Lazaretts, jemand, den man nicht gerufen hatte, der aber pünktlich jeden Morgen erschien und jeden Abend verschwand. Der blieb, wenn man ihn dazu aufforderte, und mit etwas billigem Fusel anstieß, wenn jemand Geburtstag hatte. Einmal folgte ihm eine Krankenschwester eher zufällig auf dem Heimweg und meinte zu hören, wie er immer wieder einzelne Sätze vor sich hin sprach, so als wolle er sich unbedingt etwas einprägen. Ein anderes Mal sah ihn ein Kollege zufällig im Flur etwas hastig auf einer Karteikarte notieren. Diese und andere Beobachtungen untermauerten das Gerücht, es handele sich bei dem Kollegen nicht um einen Arzt, sondern um einen Spion, der herausfinden sollte, ob sich unter den Ärzten, Schwestern und Helfern noch Anhänger der alten Ordnung befanden. Natürlich befanden sich noch Anhänger der alten Ordnung unter den Ärzten und dem Krankenhauspersonal, und genau die empörten sich darüber, dass man sie nicht ihre Arbeit machen lasse und sie sogar daran hindere, Menschen zu helfen, ja, dass sogar Menschen sterben mussten, weil man sich um solch unwichtige Details kümmerte anstatt um die Versorgung Bedürftiger.
Mit der alten Ordnung ist doch die Ordnung gemeint, die sich selbst neue Ordnung nannte?
Genau, die alte Ordnung war die sogenannte neue Ordnung.
Aber war dann die zeitlich neue Ordnung, also die Ordnung, die die sogenannte neue Ordnung ablöste, wieder die alte Ordnung?
Mit Neu und Alt verhält es sich wie mit Gut und Böse: Begriffe ohne Aussage, die nur in Relation zu etwas anderem existieren.
Was existiert nicht in Relation zu etwas anderem?
Besagtem Kollegen gegenüber, dessen Eigenheiten man bislang geduldet hatte, verhielt man sich fortan distanziert. Man sprach in seiner Gegenwart schnell, nachlässig und mit veralteten und gehobenen Ausdrücken, um herauszufinden, ob er wirklich Deutscher war. Was man bislang als Schüchternheit und Unsicherheit gedeutet hatte, interpretierte man nun als hinterlistige Täuschung und Verstellung.
Nach einigen Wochen waren selbst die Kollegen und Schwestern, die sich anfänglich skeptisch den Anschuldigungen gegenüber gezeigt hatten, dazu übergegangen, den Arzt ebenfalls zu schneiden. Warum, so fragten sie, habe er auch etwas hastig auf einer Karteikarte notiert? Überhaupt: Was für eine Karteikarte? Handelte es sich um eine entwendete Krankenakte? Ein Duplikat? Eine Fälschung, die er hatte unterschieben wollen? Und wer wisse überhaupt, was er nicht alles schon untergeschoben habe, um unschuldige Mitarbeiter zu denunzieren?
Es schneite. Ein harter Winter setzte ein. Es gab Todesfälle unter den Patienten wie unter den Ärzten. Aus der Not machte man eine Tugend. Nun müsse der Spitzel operieren, da helfe nichts mehr, und dann werde man schon sehen, was er draufhabe. Die Patienten starben ohnehin, so oder so. Was das anging, hätte man sich nichts vorzuwerfen.
An einem Montagmorgen rief man den Verdächtigen in den Operationssaal, hieß ihn, sich umzukleiden, sich zu desinfizieren und eine einfache Blinddarmoperation vorzunehmen. Überrascht, konsterniert, unfähig zu antworten, folgte der angebliche Spion den Anweisungen zuerst wie im Schlaf, um dann im letzten Moment vor dem bereits anästhesierten Patienten aus dem Operationssaal zu fliehen. Eine beherzte Schwester folgte ihm laut rufend treppauf in den Hof, dann wieder treppab in den Keller, wo er schließlich zurück in den von einigen Holzwänden notdürftig abgetrennten Operationssaal stürmte, die bereits operierenden Ärzte zur Seite stieß und mit bloßen Händen in den gerade geöffneten Leib des Patienten griff, um wahllos Organe herauszureißen. Die vor Schrecken erstarrten Anwesenden brauchten einen Moment, bevor sie ihn überwältigen, niederringen, narkotisieren und endlich außer Gefecht setzen konnten.
War Marga die Schwester, die den Spion auf dem Nachhauseweg beim Einprägen aufgeschnappter Gesprächsfetzen beobachtet hatte? Und war sie es auch, die ihn aus dem Keller hinauf in den Hof und wieder zurück verfolgte, ihn also erst dazu brachte, diese Kurzschlusshandlung zu begehen?
Marga war an dem Geschehen nicht beteiligt. Sie musste sich gerade um einen Jungen kümmern, der mit mehreren in Hände und Füße eingeschlagenen Eisennägeln eingeliefert worden war. Sie hatte dem Spion einmal einen Bleistift geliehen und ihm während einer Mittagspause die Hälfte ihres Frühstückbrots angeboten, weil er ihr hungrig vorgekommen war. Er hatte jedoch dankend abgelehnt.
Und was geschah mit dem angeblichen Spion, nachdem man ihn überwältigt hatte?
Der war mit einem Mal verschwunden. Der Betrieb im Lazarett ging seinen normalen Gang, als habe es ihn nie gegeben. Jahre später angestellte Nachforschungen ergaben Folgendes: Nachdem man mit allen zur Verfügung stehenden Kräften vergeblich versucht hatte, den so grausam auf dem Operationstisch zugerichteten Patienten zu retten, beschlossen zwei an diesem Morgen anwesende und inzwischen verstorbene ältere Ärzte, dessen Tod zu nutzen, um die Existenz des angeblichen Spions zu vernichten. Sie trugen seinen Namen und seine Daten in die Sterbeurkunde ein und gaben als Todesursache einen Blinddarmdurchbruch an. Dann operierten sie den immer noch narkotisierten und niedergerungenen Spion, durchtrennten seine Stimmbänder, kappten die Sehnen seiner Hände, um ihm auch eine schriftliche Mitteilung unmöglich zu machen, und fügten ihm noch weitere chirurgische Veränderungen zu, die ihn unkenntlich machen sollten. Nachdem man die Schnitte einige Tage notdürftig hatte verheilen lassen, wurde der Spion in der Südstadt ausgesetzt.
Hatte man ihm die Papiere des auf dem Operationstisch verstorbenen Patienten zugesteckt?
Nein, natürlich nicht. Das hätte ja den Verdacht wieder auf das Lazarett gelenkt. So hielt man den Spion für einen der Überlebenden des Eisenbahnunglücks, die immer wieder orientierungslos und mit ähnlichen Wunden in den Straßen anzutreffen waren.
Aber doch nicht mit frischen Operationsnarben.
So etwas lässt sich nur bei genauerem Hinsehen unterscheiden. Und niemand betrachtete die an Straßenecken oder in Hauseingängen herumlungernden Verwundeten genauer. Außerdem darf man das damals herrschende Chaos nicht vergessen, nicht nur in den Krankenhäusern und Lazaretten, nicht nur in der Verwaltung mit ihren willkürlich verteilten Ämtern, sondern auch im Alltag und in den Straßen der Stadt.
Drückt sich dieses Chaos, besser dieses verlorene Ordnungsprinzip, nicht auch in Sieberts Krankheit aus? Wer unter Oneirodynia Diurnae leidet, hat Mühe, Strukturen wahrzunehmen. Er empfindet eine Stadt nicht durch Straßen geordnet, sondern in gewisser Weise leer. Das macht ihm die Orientierung unmöglich. Ebenso geht es ihm mit gesellschaftlichen Strukturen.
Damit ist der Kranke eine Zeiterscheinung. Die Zeitungen, genauer der eine Bogen Notzeitung, der zu dieser Zeit in unregelmäßigen Abständen erschien, berichtete immer wieder von einer »allgemeinen Machtlosigkeit«.
Unter den zerborstenen Buchstaben der Leuchtreklame am Bahnhofshotel hielt ein Mannschaftswagen. Niemand stieg aus. Niemand wurde eingeladen.
Der Kranke empfindet die Leere der Stadt nicht so, als habe man die Menschen aus ihr vertrieben, sondern als wären die Menschen in ihr verschwunden. Es sind nicht die kaum bevölkerten Straßen, die ihn irritieren, sondern die Lücken in den Häuserreihen und die zuvor noch nie von ihm bemerkten Gassen und Durchgänge, die in unbekannte Viertel führen.
Welche Viertel sind genau gemeint?