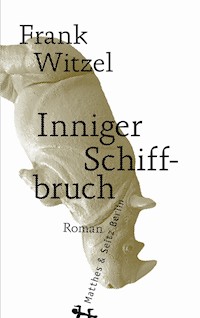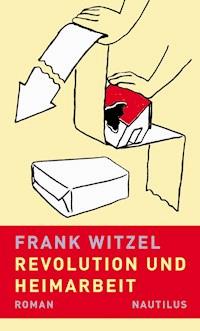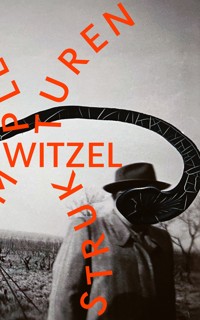Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Schreiben heißt die Einsamkeit verteidigen, in der man sich befindet", schreibt María Zambrano. Wenn aber schon das Schreiben generell die Einsamkeit verteidigt, was geschieht in einem Tagebuch, das der vorgegebenen Form zwar folgt, sich aber gleichzeitig gegen sie zur Wehr setzt? Frank Witzel vertraute sich zwei Monate jeden Tag einem Tagebuch an, ohne dabei der Form des Tagebuchs zu vertrauen. Seine Aufzeichnungen sind gekennzeichnet von einer Skepsis gegenüber dem eigenen Erleben und Denken – und nicht zuletzt auch gegenüber dem Vorgang des Schreibens selbst. Witzels Umgang mit den sogenannten Fakten, die sich hier, wenn überhaupt, nur am Rande finden, heben die Aufzeichnungen im wahrsten Sinne des Wortes ins Metaphysische: Personen, Begegnungen, Reisen oder alltägliche Ereignisse werden unmittelbar von ihrer vermeintlichen physischen Existenz befreit und schon im Notieren in die metaphysische Reflexion umgelenkt. Ein eindrucksvolles Schreibprojekt, das mit diesem ersten Band seinen Anfang nimmt. "Betrachtet man das Schreiben aus einer existenzialistischen Sicht, dann wird auch verständlich, warum etwa Kafka wollte, dass man seine Schriften vernichtet, denn sie waren Zeichen seiner Lebenspraxis, Zeichen seiner Stadien auf dem Lebensweg, die ihm außerhalb der eigenen Existenz leer und unbedeutend erschienen." - Frank Witzel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Frage des Tagebuchs ist zugleich die Fragedes Ganzen, enthält alle Unmöglichkeiten des Ganzen.In der Eisenbahn überlegte ich es unter dem Gesprächmit P. Es ist unmöglich, alles zu sagen, und es istunmöglich, nicht alles zu sagen. Unmöglich die Freiheitzu bewahren, unmöglich sie nicht zu bewahren.
Franz Kafka
Frank Witzel
UneigentlicheVerzweiflung
METAPHYSISCHESTAGEBUCHI
Ich will mich aber selbst entkleiden, meine Händeausbreiten, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, um überdas stille gehende Wasser der Vergangenheit zuschwimmen oder darinne unterzugehen.
Johann Georg Hamann,Entkleidung und Verklärung
Inhalt
23.09.2018
24.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
27.09.2018
28.09.2018
29.09.2018
30.09.2018
01.10.2018
02.10.2018
03.10.2018
04.10.2018
05.10.2018
06.10.2018
07.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
29.10.2018
30.10.2018
31.10.2018
01.11.2018
02.11.2018
03.11.2018
04.11.2018
05.11.2018
06.11.2018
07.11.2018
08.11.2018
09.11.2018
10.11.2018
11.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
17.11.2018
18.11.2018
19.11.2018
20.11.2018
21.11.2018
22.11.2018
23.11.2018
ÜBERSETZUNG DER FREMDSPRACHIGEN ZITATE
AUSGEWÄHLTE LITERATUR
23.09.2018
Beim Aufwachen fällt mir die Möglichkeit ein, über das nachzudenken, über das ich nicht auf meine übliche Art und Weise schreiben, also erzählen kann. Es kommt mir gleichzeitig ein Buch in den Sinn, das Journal métaphysique von Gabriel Marcel, das ich seit vielen Jahren besitze, aber nie wirklich gelesen habe. Dass sich Gedanken in einer Chronologie entwickeln, weiterentwickeln und einen Prozess abbilden, ohne auf ein Ziel hinauszulaufen, erscheint mir verlockend – anders also als Marcel, der ein System erarbeiten wollte und angeblich »scheiterte«; als könnte man im Denken scheitern. Man kann im Leben scheitern. Man kann im Erzählen scheitern. Aber nicht im Denken. Schließlich ist Denken ein Herausfinden, ein Prozess, der auch dann nicht gescheitert ist, wenn das Denken selbst seinen Ansatz als unbrauchbar erkennt.
Nachdenken: wie eigentlich sollte das anders funktionieren als durch das Schreiben? Indem man dasitzt und in die Ferne starrt und einem alles Mögliche durch den Kopf rauscht? Oder wie Musil es beschreibt: »Bonadea hatte sich inzwischen, da sie nicht dauernd gegen die Zimmerdecke schauen konnte, am Diwan auf den Rücken gestreckt, ihr zarter mütterlicher Bauch atmete im weißen Batist unbeengt von Schnürleib und Bunden; sie nannte diese Lage: Nachdenken.«
Der Denker von Rodin denkt ja gerade nicht. Er sinniert vielleicht, versucht einen Entschluss zu fassen. Aber Denken kann sich nicht auf einen Entschluss beziehen, sondern entsteht gerade aus der Suspendierung eines Entschlusses. Denken als Vorgang außerhalb des Schreibens kann höchstens ein Nicht-Denken sein, ein Leermachen, damit einzelne Sätze in diese Leere hineinströmen können, die man dann notiert. Die sogenannten Meditationen.
Selbst Freud war schon recht bald klar, dass es in der Psychoanalyse um keine talking cure, sondern eine writing cure geht. Wie anders könnte man die von Sándor Ferenczi in seinem Tagebuch zitierte Aussage Freuds »Die Patienten sind ein Gesindel« verstehen? Ferenczi schreibt: »Die Patienten sind nur gut, um uns leben zu lassen, und sie sind Stoff zum Lernen. Helfen können wir ihnen ja nicht.« Das heißt, der Analytiker denkt schreibend über sie nach und versucht daraus eine Erkenntnis für sich zu erlangen, vielleicht auch nur sein Denken überhaupt in Gang zu setzen. Damit ist der Patient selbst der Arzt, denn er hilft dem Therapeuten, und unter Umständen sogar anderen Kranken. Nur eben ihm selbst kann nicht geholfen werden. Es ist das Problem der endlichen und unendlichen Analyse, das nur dann offensichtlich wird, wenn eine Heilung angestrebt wird. Aber Denken / Schreiben kennt keine Heilung: Es ist die Haltung des Todkranken, jeder Denkprozess, ob bewusst oder unbewusst, eine meditatio mortis.
Als ich im Grimm unter »Todeskrankheit« nachschaue, finde ich ein interessantes Zitat aus Sophiens Reise von Memel nach Sachsen: »und da die sele des kinds sich selbst nicht, und noch weniger ihren körper kennt: so kan in ihren, durch todeskrankheiten ganz entkräfteten empfänglichkeiten wol unmöglich ein schmerz sein.« Das hieße, die Schmerzempfindung setzt Erkenntnis voraus, wo doch Erkenntnis, zumindest in der Psychoanalyse, den Schmerz erst heilen soll. Unabhängig von den üblichen Implikationen dieses Gedankens (weil Tiere, selbst »primitivere« Menschen angeblich keinen Schmerz empfinden, darf man nach Belieben mit ihnen umspringen) könnte man sagen, dass Selbsterkenntnis Schmerz verursacht, gleichzeitig aber auch das Mittel zu dessen Linderung mitgibt, sozusagen die »wirkliche« Selbsterkenntnis, die den Schmerz, den sie verursacht, aufhebt.
Mich fasziniert das von Johann Timotheus Hermes gezeichnete Bild einer Seele, die weder sich noch den Raum um sich herum kennt. Was »ist« ihr?, möchte man altertümelnd fragen. Ist das nicht genau die Beschreibung des Zustands absoluter Panik? Gerade diesem Wesen aber die Möglichkeit zur Schmerzempfindung abzusprechen, erscheint doppelt grausam. Und doch steckt eine gewisse Wahrheit darin, weil der Zustand der absoluten Panik unter anderem dadurch entsteht, dass ich meine, keinen Grund zur Panik zu haben, folglich kein Recht, das zu empfinden, was ich empfinde, weil ich es nicht nach außen hin vermitteln kann. Ich bin also dieses von Hermes betrachtete Kind, und meine Seele kennt sich und den sie umgebenden Körper insofern nicht, als sie den Blick des anderen auf sich übernimmt.
Die Seele, die unverbunden im Körper herumfällt, einmal da anstößt, einmal dort und so Schmerzen verursacht, erzeugt eine Form der männlichen Hysterie, die sich in den Gottestrunkenen und Märtyrern zeigt.
Nicht ohne Grund wurden Religionen von Männern geschaffen. Der Ursprung des Seelenglaubens als eine Art Gebärneid. Konsequenterweise musste der Frau eine Seele abgesprochen werden, weil sie in Form der Gebärmutter ohnehin schon das Original besaß, das der Mann mit der Seele lediglich zu kopieren versuchte.
Wahrscheinlich werden wir nur selten für das getröstet, was uns wirklich schmerzt, weil es in den Augen der anderen banal und unverständlich ist. Deshalb trägt das Durchleben einer wirklichen, das heißt gesellschaftlich anerkannten Tragödie auch immer eine Befriedigung in sich, wenigstens jetzt den bislang versagten Trost zu erhalten, den man auf die ungetrösteten Bereiche auszudehnen versucht.
Erst lernt man durchschlafen, dann durchleben.
Nach dem Grimm ist eine Todeskrankheit eigentlich eine »todbringende, tödliche Krankheit«, dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, wird ein Abschnitt aus den Gesprächen zwischen Goethe und Karl von Holtei zitiert, der dieser Definition widerspricht: »er (Göthe) hatte unterdessen eine todeskrankheit durchgemacht und, von dieser erstanden, an eine freundin geschrieben: ›nach groszem verlust (tod seines sohnes) und drohender lebensgefahr hab’ ich mich wieder auf die füsze gestellt.‹« Goethe, der den Gedanken an den eigenen Tod zeitlebens verdrängte, wird hier als ein mit mythischer Kraft ausgestatteter Mensch geschildert, der aus eigener Kraft »ersteht« und sich auf die Füße stellt. Ob der Tod des Sohnes wirklich ein »großer Verlust« für ihn war, mag dahingestellt sein. August war in den Augen seines Vaters ein Versager, dem letztlich nichts anderes übrigblieb, als während der Italienreise, auf die er vom Vater geschickt wurde, zu sterben, weil er sich sonst doch nur immer weiter an einer Vorgabe hätte messen müssen, die jede Leistung zum Schrumpfen bringt und vernichtet. Das Einzige, was er dem Vater voraushaben konnte, war der Tod. Und das begriff auch der Vater, wenn er auf den Grabstein schreiben ließ: »GOETHE FILIVS PATRI ANTEVERTENS OBIIT ANNOR XL MDCCCXXX. (Goethe der Sohn dem Vater vorangehend starb mit 40 Jahren 1830)«. Selbst diese Inschrift handelt mehr vom Vater als vom verstorbenen Sohn. Gleichzeitig ist sie Beweis für die Todesangst des Vaters, der nicht vom Sterben (mori), sondern euphemistisch vom Dahingehen (obeire) sprechen muss. Die »drohende Lebensgefahr«, von der Goethe zu Holtei aber spricht, war nicht der Verlust des Sohnes, sondern die Demütigung, dass dieser ihn dort hatte schlagen können, wo Goethe selbst am verwundbarsten war.
Mit dem Gedanken an Marcels Journal métaphysique verbindet sich unwillkürlich eine erzählerische Ebene: das Bild einer kleinen Kammer, einer Gasse in einem etwas abgelegenen Pariser Viertel, einerseits klamm, andererseits tröstlich. Tröstlich, sich wo und wann auch immer auf das Denken verlassen zu können. Klamm, sich eben darauf verlassen zu müssen, weil das Leben selbst nichts weiter zu bieten hat.
Ich werde mich wahrscheinlich immer zwischen diesen beiden Ebenen bewegen, der konkreten Vorstellung, die erzählt werden will, und dem Denken, das sich immer wieder vom Konkreten lösen möchte.
So, wie ich über mein eigentliches Thema, die Liebe, nicht schreiben kann, stattdessen darüber nachdenken will, könnte ich über die Tagespolitik weder schreiben noch denken. Die einzige Möglichkeit wäre, alles Wort für Wort zu dokumentieren. Den Titel könnte man dann auch gleich dem entsprechenden Vorbild entnehmen: Die letzten Tage der Menschheit.
Oder ein Tagebuch, das nur das Wetter notiert: Heute bedeckt, regnerisch, der Wind biegt den Ahorn, dessen »Nasen« schon braun und eingefallen, dessen Blätter aber noch kräftig grün sind. Draußen ist es wesentlich wärmer als erwartet. Die leeren Sonntagsstraßen durcheinandergewirbelt mit Blättern und Papieren.
Vielleicht geht es gar nicht um die Unterscheidung zwischen Erzählen und Denken, sondern um meine Vorstellung, dass ich nur das erzählen kann, was mich bewegt, womit meine Möglichkeiten zwangsläufig eingeschränkt sind, da ich mir mein Thema nicht suchen kann, einerseits, und da ich andererseits nicht über das schreiben kann, was mir (noch) zu nah, zu ungreifbar, zu wenig erzählerisch fassbar ist, hoffe ich wohl, über den Umweg des Denkens doch noch zum Erzählen zu kommen. Gedanken erzählen sozusagen. Dabei könnte sich noch eine weitere Möglichkeit auftun, nämlich etwas zu erzählen, das sich mir nicht persönlich aufdrängt, mich noch nicht einmal interessiert, um durch die Sprache dennoch auf etwas zu stoßen, das sich mir begreiflich macht. Das wäre eine Art psychoanalytischer Ansatz, gemäß dem man sich gar kein Thema aussuchen kann, das nichts mit einem zu tun hat.
Wahrscheinlich passt zu der Suche nach einem neuen Schreibansatz auch die Tatsache, dass ich gerade noch einmal schwimmen lerne. Etwas lernen, das man schon kann. Was will ich lernen? Vielleicht, dass es um nichts weiter geht. Um kein Ergebnis. Nur um das Beobachten. Nur um die Möglichkeit, sich selbst bei etwas zuzusehen. Ich merke zum Beispiel, dass mir das Atmen im Weg steht. Ich möchte am liebsten schwimmen, ohne zu atmen. Der Atem bringt meine Koordination durcheinander. Ich kann das Einatmen nicht mit dem Auftauchen, das Ausatmen nicht mit dem Eintauchen kombinieren. Ich möchte frei davon sein. Mir geht es wie der Taube in Kants Kritik der reinen Vernunft, die sich das Gleiten im luftleeren Raum noch unbeschwerter vorstellt, als durch den Luftwiderstand gebremst zu werden. (»Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, daß es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde.«)
Beim Schwimmen kann ich meine Vorstellungen vom Schwimmen als illusorisch erkennen. Halte ich an diesen Vorstellungen fest, werde ich scheitern (untergehen). Wie aber ist es mit meinen Vorstellungen von der Liebe? Sind sie nicht vielleicht genauso irrwitzig? Schwerelos eintauchen, frei sein und so weiter. Und wenn ich scheitere, beschimpfe ich den anderen, so wie Xerxes den Hellespont mit den Worten auspeitschen ließ: »Du bittres Wasser, dir legt der Gebieter diese Strafe auf, weil du ihn beleidigt, ohne daß er dir ein Leid gethan.« Natürlich hinken diese Vergleiche, aber etwas ist auch dran an ihnen. Der unglücklich Liebende glaubt sich trotz der eigenen Bereitschaft zu lieben und obwohl er dem anderen doch nur Gutes will verschmäht, ganz so, als könne man Liebe durch eine erbrachte Leistung bewirken. Daraus leitet er das Recht ab, verletzt und beleidigt zu sein und den anderen anzuschuldigen, wenn nicht gar zu bestrafen, anstatt über seine Art des Liebens nachzudenken und sie entsprechend zu modifizieren. Es sind die ganzen überzogenen Klischees, die dem im Weg stehen. Wenn es hieße: »Das Schwimmen, das Schwimmen ist eine Himmelsmacht«, wären die meisten Schwimmer schon jämmerlich abgesoffen. Vielleicht sollte man es wie beim Trockenschwimmen auch erst einmal allein und für sich versuchen mit dem Lieben.
Unwillkürlich fällt mir auf, dass es bei den meisten anderen Schwimmern, die mit mir im Becken sind, auch ziemlich hapert mit der Technik. Viele Krauler schlagen tatsächlich auf das Wasser ein, ohne sich dabei größer vom Fleck zu bewegen. Dabei weiß ich weder, was jeder von ihnen eigentlich bezweckt, noch was für Voraussetzungen (Handicaps) er mitbringt. Und wie so oft scheinen all die anderen mir schon im nächsten Moment überlegen, weil sie nicht mich beobachten, sondern ich sie.
Es gäbe noch die Möglichkeit, das zu spielen, was man ist, wenn man es schon nicht werden kann. Genau das, was beim Schwimmen eben nicht funktioniert, denn wenn ich das Schwimmen nur spiele und nicht beherrsche, ertrinke ich. Und wie ist es beim Denken? Kann man das Denken spielen? Wahrscheinlich ja, allerdings ertrinkt (verblödet) man auch dabei.
Kurzparabel à la Kafka: Es gab eine Schauspielerin, die so talentiert war, dass sie alles spielen und sich sogar, wenn verlangt, fliegend als Taube durch den Luftraum bewegen konnte. Als man sie tatsächlich für eine Rolle aufforderte, über der Bühne umherzufliegen, tat sie das, stürzte jedoch im nächsten Moment ab, nicht, weil ihre Fähigkeiten versagt hätten, sondern weil sie im Moment des Fliegens begriff, dass sich ein wirklich talentierter Schauspieler immer ein Rest Zurückhaltung auferlegen muss, um nie völlig in der Rolle aufzugehen, wie sie es mit Leichtigkeit gekonnt, jedoch nur ein unbegabter Laienspieler umgesetzt hätte.
24.09.2018
Lange habe ich mich geweigert, über meine Beziehung zu O zu schreiben, und dieses Schreibverbot scheint auf gewisse Weise immer noch zu existieren. Bin ich mit Nietzsche der Meinung, dass man nicht über etwas schreibt, um es zu überwinden, sondern weil man es bereits überwunden hat, dann würde ich mir lediglich etwas nicht eingestehen wollen, denn natürlich kann man etwas auch überwinden, ohne darüber zu schreiben, oder meine ich, dass ich erst durch das Schreiben einen endgültigen Schlussstrich ziehe, indem ich, wenn schon nicht O selbst, so doch meine Beziehung zu ihr, mein Gefühl zu ihr, in den Bereich der Fiktion hineinversetze? Naiv diejenigen, die meinen, sie schrieben nur das auf, was geschieht, ohne das Geschehen damit zu beeinflussen.
Über das nachdenken, was man nicht erzählen kann, nicht, weil es unfassbar wäre, sondern weil es unfassbar bleiben soll.
Denken, weil ich das Fühlen nicht ertrage. Schreiben, weil ich das Denken nicht ertrage.
Man behauptet zwar immer wieder, etwas nicht ertragen oder aushalten zu können, aber stimmt das überhaupt? Erträgt man es nicht im selben Moment bereits?
Steht der Gedanke einmal da, muss er nicht länger gedacht werden. Ist aber der Satz, der dasteht, tatsächlich der Gedanke, den ich dachte? Was ist ungenauer, das Fühlen, das Denken oder das Schreiben? Ich denke, dass es das Fühlen ist, dann das Denken, schließlich am genausten, wenn auch nicht genau genug, das Schreiben. Wahrscheinlich ist es aber genau umgekehrt, führt das Denken den Zweifel in das Fühlen ein, den das Schreiben dann komplettiert. Ich befinde mich folglich im Irrtum über das, was ich tue, kann es aber dennoch nicht anders machen.
Ablenkung und Heilsversprechen: zwei Pole, zwischen denen ich mich bewege.
Ich verzweifle nicht am Leben, sondern an meinen Meinungen über das Leben. Und dass Meinungen stärker sind als die Wirklichkeit, kann ich überall um mich herum beobachten. Die grundsätzliche Unwahrheit der Politik: vorzugeben, sich um Realitäten zu kümmern, wo es um Meinungen geht. Schon allein deshalb muss Resignation einen Wert haben, weil ich nicht der Realität gegenüber resigniere (wie sollte das gehen?), sondern gegenüber meinen Meinungen über diese Realität. Und auf diesem Feld kann man gar nicht genug resignieren.
Marcel schreibt: »Quand nous parlons de Dieu, sachons bien que ce n’est pas de Dieu que nous parlons. Est c’est à quoi il faut prendre garde quand on traite de Dieu comme créateur.« Mir scheint es eigenartig, dass Gott fast immer auch mit demjenigen gleichgesetzt wird, der »alles« erschaffen hat. Ist das nicht eine seltsame Vermischung, die den Glauben eher behindert als fördert? Denn solange ich diese materialistische Grundlage des Glaubens mit mir herumschleppe, wie sollte ich da Gott erkennen?
Kann man das erkennen, was einen schuf? Kann man überhaupt aus einer Abhängigkeit heraus erkennen? Kann man aus einer Abhängigkeit heraus lieben, oder ist die Liebe nicht vielmehr in diesem Augenblick bereits unmöglich geworden? Ein Argument für den Don Juanismus, der damit auch auf die männliche Ausprägung dieser Form von Liebe verweist: eine Form der Idealisierung, die ihren Ursprung nicht nur überwindet, sondern bewusst hinter sich lässt. Ich sage nur: Beatrice, Laura, Heloise, Sophie, Regine usw. Diese Liebe wird mit einem Erweckungserlebnis verwechselt, und die in der Regel nicht näher gekannte Frau als Auslöser dieser Erweckung verehrt. Die Frau muss entschwinden, damit die Liebe ihrer wirklichen Prüfung entgeht und zum Ideal werden kann. Damit ist die Erweckung nicht Beginn einer Entwicklung, sondern deren Endpunkt. Sie nährt sich durch eine beständige Rückerinnerung an diesen Moment, von dem man ahnt (und unwillkürlich auch hofft), dass er nicht noch einmal wiederkehren wird, damit man diese Lücke mit dem füllen kann, was man je nach Anschauung Religion, Idealismus oder eben Liebe nennt: eine Wiederanbindung, eine Rekonstruktion, eine Wiederholung.
Ich meine gerade zu verstehen, warum Kierkegaard die Wiederholung als die Wirklichkeit und den Ernst des Daseins bezeichnet. Aber ist es nicht schmerzlich, dass die Wiederholung trotz allem auf der Resignation beruht, das Ursprüngliche nicht halten zu können?
Was beweist sich in der Schöpfung? Warum kann nicht ein anderer der Schöpfer sein, ohne dass Gott seine Stellung gleich verlieren muss? Und könnte Gott nicht sogar selbst aus der Schöpfung entstanden sein? Würde das seine Position schmälern? Erst dort würde Religion interessant, wo sie Materialismus, Chronologie, Erbfolge usw. ablegt. Wen interessiert es eigentlich, wer die Welt erschaffen hat bzw. wie sie entstanden ist?
Lässt sich nicht vielleicht auch der Satz, dass sich immer alles um Sex dreht, außer beim Sex auf die Metaphysik anwenden? (Oscar Wilde: »Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.«) Und vielleicht stimmt es sogar, obwohl ich an den zweiten Satz erst gar nicht dachte, dass es auch in der Metaphysik um Macht geht.
Wie man an Menschen sieht, die Kopfhörer tragen, beeinflusst das Gehör auch andere Tätigkeiten, sodass sie die Zeitung lauter umblättern, sich lauter räuspern, eben alles lauter, das heißt aber gleichzeitig auch kräftiger machen, ohne dass ihnen dieser unwillkürliche Ausgleich bewusst wäre. Alles ist gleichzeitig auch immer Reaktion auf das, was ich wahrnehme. Kann man da noch von einem freien Willen sprechen?
25.09.2018
Es ist die letzte Stunde meiner Therapeutin für diesen Tag. Sie hat sie für mich angehängt, weil ich in der Woche davor bei O war und sie die Woche darauf auf Fortbildung ist. Ich erzähle ihr, dass ich in der Nacht, als ich von O zurückkam, zwei Träume hatte. »Das eine Mal kam ich zu Ihnen und eine Freundin von Ihnen war da, und Sie haben zu mir gesagt, es ist ohnehin schon spät und lohnt sich nicht mehr richtig, die Stunde anzufangen, weil sie lieber mit Ihrer Freundin weggehen wollten. Gleich anschließend habe ich eine Variante davon geträumt, da kam ich zu Ihnen und Ihr neuer Freund, ein junger Mann, Anfang zwanzig, war da, und Sie waren frisch verliebt und haben ihn beständig angefasst und geküsst und sich um ihn gekümmert. Die Stunde sollte dann ganz normal stattfinden, nur eben mit ihm, der neben Ihnen auf einer Couch lag. Der Junge selbst war recht konturlos.« Ich überlege, was diese beiden Träume mit O zu tun haben können, mit der ich mich am selben Tag gestritten und die ich im Streit verlassen hatte. Meine Therapeutin meint, sie habe das Gefühl, der Junge sei ein Anteil von mir. Mir fällt ein, dass er im Traum tatsächlich zuerst auf dem Stuhl saß, auf dem ich immer sitze, und dann aufstand, um mir Platz zu machen und sich auf die Couch zu legen.
Das Aufspalten im Traum geschieht so natürlich, dass es wahrscheinlich eine ungeheure Anstrengung bedeutet, sich im wirklichen Leben »zusammenzuhalten« und als Einheit zu empfinden.
Vielleicht entsteht der psychische Schmerz allein durch den Gedanken, man habe eine Identität, und durch die Mühe, die es braucht, diese Identität aufrechtzuerhalten. Was, wenn ich das Gefühl hätte, der, der auf dem Stuhl sitzt, ist ein anderer als der, der ins Schlafzimmer geht und sich aufs Bett legt, der mit O streitet ein anderer als der, der mit ihr in der Küche Tee trinkt usw. Und natürlich entsprechend auch bei anderen, wo man es ohnehin eher so empfindet, jedoch meist als Enttäuschung: »Du bist ja gar nicht … Du hast doch gesagt … etc.«
Ich sitze also da und versuche, die Woche mit O zusammenzufassen, ihr ein Thema zu geben, sie in ein Narrativ zu pressen. Welche Bedeutung hat das Narrativ? Auf den ersten Blick scheint es der Versuch zu sein, gewisse Abläufe zu verstehen. Könnte das Narrativ aber nicht genau für diese Abläufe verantwortlich sein? Je klarer das Narrativ wird, desto undeutlicher wird mein Leben. Sollte ich das umkehren und versuchen, durch ein unschlüssiges, verworrenes Narrativ mein Leben zu ordnen?
Für wen erstelle ich dieses Narrativ? Wahrscheinlich für den großen Anderen. Obwohl niemand daran glaubt, ist es wichtig, dass ein Narrativ existiert, um sich darauf zu berufen.
Die Entstehung des biographischen Narrativs aus der Vorstellung vom Jüngsten Gericht.
Sich entwickeln heißt, sich dem Willen zur Biographie verweigern.
Ich merke, dass ein Witz, den mein Vater gern in meiner Kindheit erzählte, unwillkürlich zu meinem Lebensmotto wurde: Ein Verrückter ist in der Irrenanstalt, weil er sich für eine Maus hält. Nach mehreren Jahren der Therapie wird er als geheilt entlassen, kehrt aber schon nach einer halben Stunde verängstigt zurück, weil er einer Katze begegnet ist. Auf die Ermahnung des Therapeuten hin, dass er doch mittlerweile wisse, keine Maus zu sein, entgegnet er: »Aber ob die Katze das weiß.« Die Katze ist der große Andere. Es ist nicht entscheidend, was ich tatsächlich bin, sondern dass er es weiß.
Metaphysik kann erst dort anfangen, wo Gott von seiner Rolle des großen Anderen und des Schöpfers befreit wird. Jede Spekulation, die diese Prämissen vernachlässigt, endet zwangsläufig in der Banalität.
Bislang habe ich das Thema Sexualität in der Therapie ausgespart, so wie ich es auch sonst ausspare. Das Reden über Sexualität ist dem Reden über Gott ähnlich, nicht in dem Sinn, dass es sich um etwas ähnlich Bedeutendes, Mystisch-Mythisches, Komplexes handeln würde, sondern dass es zu den Themen gehört, in denen das Objekt Subjekt ist und das Subjekt Objekt, was jeder Erzählhaltung automatisch zuwiderläuft. Versucht man diese Umkehrung aus Naivität oder Grandezza zu ignorieren, wird es Pornographie, ähnlich wie die mangelhafte metaphysische Spekulation, gegen die Wittgenstein anschrieb.
Das Thema Sexualität gänzlich aus dem Werk zu suspendieren, löst das grundsätzliche Problem nicht. Wenn meine Therapeutin andeutet, dass das Thema Sexualität zu bereden wichtig wäre, weil sich in ihm Verhaltensweisen zeigen, die auch sonst auftauchen, so müsste erst geklärt werden, wie – in welcher Form, mit welcher Sprache – ich darüber sprechen soll bzw. kann.
Es ist mehr als verständlich, dass die problematischen Themen immer mehr ausgeräumt werden, dabei sind Atheismus, Asexualität natürlich keine Lösung, wie das A Privativum verrät, durch das diese Begriffe in einer negativen Abhängigkeit zu dem verharren, das sie zu verneinen vorgeben.
Ob das Problem gelöst wird, wenn ich eine andere Sprache für Metaphysik oder Sexualität finde, bleibt fraglich, denn es müsste mit dieser anderen Sprache auch eine andere Form der Logik entstehen.
Um mich mit anderen über mich zu verständigen, muss ich mich zum Objekt machen, und genau dieser Vorgang verhindert es, dass ich mich mit anderen über mich verständigen kann. Der Verrückte hat insofern recht, wenn er auf seiner Unsicherheit besteht, ob die Katze von seinem »wahren«, das heißt menschlichen Zustand weiß. In der Therapie hat er sich selbst zum Objekt machen müssen, um zu einer angeblich realistischen Einschätzung über seinen Zustand zu gelangen. Er ist geheilt, aber gleichzeitig von sich entfremdet, und durch diese Entfremdung entsteht die Frage neu, wie er sich in der Welt – der Katze gegenüber – verhalten soll. Dafür kann der Therapeut keine Lösung anbieten, das ist die wahre Pointe des Witzes. Der Verrückte hat recht und hätte auf seinem Maus-Sein bestehen sollen.
Wenn ich über Sexualität spreche, dann mache ich nicht nur mich zum Objekt, sondern gleichzeitig auch O. Das heißt, ich mache uns zu einem Objekt. Aber während ich bereit sein kann, mich zu einem Objekt zu machen, wie soll ich O zu einem Objekt machen, ohne eine pornographische Reduktion vorzunehmen? Mehr noch, wie soll ich unser Verhältnis beschreiben, wenn wir beide Objekte geworden sind?
Vielleicht sollte ich tatsächlich, wie Kinder bei einer Befragung, Sexualität lieber mit Puppen nachstellen, als darüber zu sprechen. Bei Kindern soll es die mangelnde Möglichkeit des Ausdrucks ersetzen, aber dieser Ausdruck ist in der Welt der Erwachsenen ebenso wenig vorhanden. Es gibt keinen passenden Ausdruck, höchstens eine Form der – eher fragwürdigen – Vereinbarung.
In der Nacht werde ich zu müde, um zu denken, zu müde, um zu schreiben, zu müde, um zu streiten. Aber es wäre kein wirkliches Nachgeben, sondern nur ein scheinbares, weil die mit der Müdigkeit heraufsteigende Angst die Ecken des eigenen Willens und des eigenen Wollens abschleift.
Es ist nicht der Tod, der den Hobel ansetzt und alle gleich schleift, sondern die Todesangst.
26.09.2018
Wahrscheinlich muss ich sämtliche, ein Leben lang unhinterfragt benutzte Empfindungen noch einmal klären: Fühlen, Denken, Meinen, Hoffen, Lieben etc.
Erneut die Frage, die sich mir fast selbstverständlich immer wieder aufzudrängen scheint: Gibt es tatsächlich einen Vorgang, den man als »Denken« bezeichnen könnte? Ich kann nur denken, wenn ich schreibe. Entweder auf dem Papier oder indem ich Sätze bilde. Wenn ich mich aber hinsetze und ohne »nach der Schrift zu sprechen«, wie man früher das Hochdeutsche vom Dialekt abgrenzte, vor mich hin sinniere, dann entsteht sofort ein Wirrwarr in mir, ein Konglomerat aus Eindrücken, Gefühlen, Gedankenfetzen, wie ein ausgekippter Mülleimer, der zu weiter nichts führt. Interessant dabei ist, dass selbst der bewusst formulierte Gedanke, mit dem ich über das Denken nachdenke, sofort wieder in Vergessenheit gerät, um wenig später in immer neuer und unbedachter Form aufzutauchen, ganz so, als wolle er mich mit diesem Impuls beruhigen, gleichzeitig aber eine nachhaltige gedankliche Bearbeitung verhindern.
»Fühlen Sie sich leer?«, steht auf dem Plakat eines psychiatrischen Notdienstes. Wie fühlt sich Leere an? Kann man Leere fühlen? Oder beginnt das Problem nicht vielmehr dort, wo man sich überhaupt fühlt und nicht vielmehr ist? Das artikulierte Fühlen scheint ohnehin das zu benennen, was sich jenseits des Seins befindet. Fühlen ist Bewusstsein über das Sein, ohne darüber zu wissen. Solange ich bin, muss ich nichts benennen, werde ich allerdings in meinem Sein irritiert, dann fühle ich mich mit einem Mal (gut, schlecht etc.). Die beständige Frage danach, wie es dem anderen geht, bezweckt nichts anderes, als ihn aus seinem Seinszustand herauszuholen. Anstatt zu sein, fängt er an zu meinen.
Was wäre das Gegenteil von dem Gefühl der Leere? Das Gefühl erfüllt zu sein, vom anderen, von Gott? Das Gefühl, von Liebe erfüllt zu sein, verkehrt sich schnell in sein Gegenteil. Entsteht überhaupt erst in diesem Moment die Leere, in dem etwas nicht mehr da ist, das einmal da war? Wäre das die Definition von Leere? Dann würde sich die Frage »Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?« ganz einfach dahingehend beantworten lassen, dass Nichts erst durch etwas entstehen kann, quasi als Nichtung. Aber gibt es nicht vielleicht eine genuine Leere und könnte diese Leere nicht eine noch größere Sicherheit vermitteln als das Gefühl, von etwas anderem erfüllt zu sein?
Ich kann O nicht mehr sehen und möchte gleichzeitig (deshalb?) niemand anderen mehr sehen. Bedeutet das, O öffnet mir den Zugang zur Welt und verschließt ihn wieder? Aber es gab auch ein Leben vor O. Da waren es dann L, M oder N, die ihre Funktion entsprechend innehatten. (Schon wenn ich »Funktion« schreibe und O mit anderen in einen Vergleich setze, scheint meine mit aller Kraft aufrechterhaltene Illusion der Besonderheit unserer Beziehung unter meinen Fingern zu zerbröseln.) Also kann es nicht an ihr liegen, sondern an mir. Ich teile der Geliebten eine Funktion zu, sie steht zwischen mir und der Welt. Ist sie da, kann ich die Welt sehen, ist sie weg, bleibt mir alles andere verschlossen. Liegt darin nicht vielleicht die generelle Problematik, und könnte ich wieder mit O zusammen sein, wenn ich sie von dieser ihr zugeteilten Funktion endlich befreie? Das hieße aber, ich bräuchte sie nicht mehr. Warum dann mit ihr zusammen sein? »Weil ich dich brauche, kann ich nicht mit dir zusammen sein. Weil ich dich nicht brauche, kann ich mit dir zusammen sein.« Daran wird deutlich, dass Liebe nichts mit »brauchen« zu tun haben kann.
Wie seltsam mir manchmal alles vorkommt: Gesichter, Gesten, Worte, die nicht mehr für sich selbst stehen, sondern nur an anderes erinnern.
Ist der Selbstmord wirklich das grundlegende philosophische Problem und nicht vielmehr die Frage danach, wodurch überhaupt der Gedanke entsteht, sich das Leben nehmen zu können? Man ist schnell bei Verzweiflung, Traurigkeit, Angst usw. Aber in diese Untiefen hinabzusteigen scheint weniger lohnend als die Beschäftigung mit einer metaphysischen Spekulation. Das Letztere scheint zu adeln, das Erste klingt wie ein Bekenntnis zur Banalität.
Vielleicht kann ich den Ausgang aus der Hölle, meinetwegen auch den aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, nicht erkennen, weil er gar nicht, wie ich bislang dachte, komplex ist, sondern banal. Die Herausforderung besteht darin, sich der Banalität zu stellen, die Banalität anzunehmen.
Es geht mir beim Schwimmen ähnlich wie früher, wenn ich etwas zu lernen versuchte und immer das Gefühl hatte, je mehr ich mich damit beschäftige, desto weniger weiß oder kann ich auf dem betreffenden Gebiet. Wahrscheinlich ist das völlig normal, da man beim Lernen ja auch das Gebiet selbst kennenlernt und dadurch überhaupt erst feststellt, wie viel es gibt, das man nicht kann und nicht weiß. Dennoch ist es mir nie richtig gelungen, in etwas eine Fähigkeit zu entwickeln, mit der ich zufrieden bin und die mir das Gefühl vermittelt, wenigstens etwas einigermaßen zu beherrschen. Das liegt daran, dass ich mich nur schlecht beschränken kann. Man muss sich aber beschränken können. Am glücklichsten diejenigen, für die Beschränkung und Horizont zusammenfallen.
Ich sehe in der U-Bahn ein junges Paar, sie hängt an ihm, küsst beständig sein Gesicht. Im Außenbecken des Nordbads das nächste Paar, ebenfalls jung: sie stehen im Becken und sie hat die Arme um seinen Hals, die Beine um seine Hüften geschlungen. Natürlich sind sie infantil und nervig in ihrer Selbstbezüglichkeit. Später ein ganz ähnliches Paar, sie hängt so sehr an ihm und lässt sich von ihm durch das Becken ziehen und tragen, dass ich mit einem Mal denke, ich irre mich, es handelt sich gar nicht um ein Liebespaar, sondern um einen Pfleger mit einer Gelähmten. Ich warte, bis sie aus dem Becken gehen, sie bis zuletzt auf seinem Rücken und an seinen Hals geklammert, doch dann geht sie selbstständig die Stufen hoch. Ich versuche meine Reaktion zu beobachten, bin ich nur genervt, weil ich neidisch bin, oder würde mir, auch im übertragenen Sinne, eine solche Frau nicht wahnsinnig auf die Nerven gehen? Habe ich nicht Beziehungen zu solchen Frauen schnell beendet, wenn auch nicht bewusst aus diesen Gründen? Spielt also gar nicht die Sehnsucht nach einer solchen Beziehung eine Rolle in meinem Gefühl des Unwohlseins, sondern vielmehr die Vorstellung, auch O könnte bereit sein, oder war sogar bereit, sich auf diese Art an jemanden zu hängen? Nur eben nicht an mich. Und da wäre ich wieder bei meinem Thema, das nicht zu bekommen, was … ja, jetzt wird es interessant, was folgt hier: ich brauche, ich will, gar mir zusteht? Fangen wir vorn an: brauchen. Ich weiß nicht, was ich brauche, und wenn ich etwas an mir bestätigen könnte, dann ist es René Girards Theorie der mimetischen Begierde. Meine Begierde entsteht in diesem Moment über den Vergleich, deshalb könnte ich gar nicht sagen, was ich »wirklich«, das heißt ursprünglich brauche. Wobei es genau diese ursprüngliche Begierde wahrscheinlich nicht oder nur insofern gibt, als sie leer ist und ich sie ohnehin erst entsprechend mimetisch erlernen muss. Ich denke Folgendes, irre mich aber wahrscheinlich: Gäbe es keine Beziehungen, generell keine Intimität zwischen Menschen, dann wäre es wahrscheinlich auch für mich okay, beziehungslos zu leben. Dann als Zweites: wollen. Ich empfinde meinen Willen als gebrochen. Was ich will, erscheint mir suspekt. Wie komme ich überhaupt darauf, etwas zu wollen, habe ich denn das Recht dazu, ist mein Wille nicht immer ein Wille zur Macht und so weiter? Weil dem so ist, muss ich erst herausfinden, wie viel Platz mir der andere für meinen Willen einräumt. Fast könnte ich sagen, ich schließe mich dem anderen Willen gern an, aber so ist es nun wiederum auch nicht, selbst wenn ich es das ein oder andere Mal versucht habe. Drittens: mir zustehen. Unvorstellbar.
Nach wie vor interessant bleibt die Frage nach den Gefühlen: Wie überhaupt Gefühle wahrnehmen? Wo genau sie wahrnehmen? Wie sie beschreiben, ohne sie zu verändern? Es stellt sich unmittelbar die Frage nach dem Körper: Hat der Körper die Gefühle, während sie der Geist nur benennt und für sich reklamiert, damit aber gleichzeitig dem Körper abspricht und verändert? Kann ich fühlen, ohne zu benennen? Kann ich vielleicht nur dort fühlen, wo ich nicht benenne?
Ich habe das Gefühl, mich dem Narrativ verweigern zu müssen, um geheilt zu werden, befürchte aber, dass es genau umgekehrt ist, ich ein Narrativ brauche, damit ich geheilt werde. (Nur ein Narr hat ein Narrativ.)
Ich sehe andere Frauen an wie eine Pflicht, suche krampfhaft danach, was mir gefallen könnte, wo ich doch lieber O anschauen möchte, an der mir so viel gefällt. Wenn mir aber so viel an ihr gefällt, warum kann ich es dann nicht bei dem Anschauen von ihr belassen? Liegt der Widerspruch allein bei mir? Ich hatte es seinerzeit bei A probiert, nach ihrem Selbstmordversuch, sie sollte sagen, was wir machen, und ich mache es dann. Als ich ihr den Vorschlag machte, glaubte ich, es wirklich ernst zu meinen, wenn auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus, merkte aber schon im Moment, als ich es aussprach, dass es nicht stimmte. Später bei B war es ähnlich, ich hatte auch ihr viel angeboten, aber wahrscheinlich kam mein Angebot zu spät, sodass sie es nicht mehr annehmen, wahrscheinlich noch nicht einmal mehr wahr nehmen konnte. Bei O ist es ähnlich. Heute dachte ich, dann will ich nichts. Und dieser Gedanke scheint erneut den Beweis anzutreten, dass das Nichts aus etwas entsteht. Wenn ich schon nicht bekommen kann, was ich will, will ich wenigstens meine Wahlfreiheit behalten und wähle das Nichts. Sein und Trotz.
27.09.2018
Ist in der Philosophie ein System vielleicht nichts anderes als ein geschlossenes Narrativ?
Ist es erst die Errichtung einer Dichotomie oder deren Aufhebung, wenn ich dem Körper die Verantwortung zurückgebe? Die Niere denkt nicht über sich nach. Warum soll ich dann über sie nachdenken? Das Bedenken des Körpers, die Sorge um den eigenen Körper, ist wahrscheinlich schon der erste Irrweg, was das Verhältnis zum Körper angeht.
Dass man in den Körper eingreift, erscheint verständlich. Man will ohne Schmerzen leben, schließlich überhaupt noch leben. Aber ist es nicht seltsam, dass wir anfangen, im Körper herumzustochern und ihn immer weiter und immer genauer aufteilen? Es stellt sich die Frage nach der Identität, die wir für uns beanspruchen, wo es absurd erscheint, in dem Wirrwarr von Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen, Körperfunktionen eine Identität ausmachen zu wollen. Der Identitätsgedanke gehört in den Bereich der Metaphysik, er kann bestenfalls Spekulation sein, so wie das Nachdenken über Gott. Ihn als Gedanken der Physik zu interpretieren ist ein Kategorienfehler.
Die Abkehr vom Identitätsgedanken hat einerseits ein Gefühl der Befreiung zur Folge, lässt aber gleichzeitig die Sehnsucht unerfüllt, die ihn bewirkte. Die eigentlich interessante Frage beginnt erst dort, wo ich mir darüber klar bin, dass ich diese beiden Bestrebungen in mir, die nach Freiheit und die nach Eindeutigkeit, nicht werde vereinbaren können.
Es stellt sich die Frage nach einer Philosophie der Ungenauigkeit, die sich mit diesem Problem befasst. Eine Philosophie des Vagen.
Vielleicht sind die Schlafwandler gar nicht Opfer ihres Schicksals, das sie unbewusst durchlaufen, sondern ihres eigenes Glückes Schmied, indem sie im Bereich des Vagen und Ungenauen bleiben, dabei in Bewegung, vor allem aber, ohne auf einer Identität zu beharren.
Das biologische Konzept, nach dem das Denken in erster Linie der Selbsterhaltung dient, kann ich in keiner Weise bestätigen. Bei mir ist es so eindeutig, dass das Denken genau dieser Selbsterhaltung entgegenwirkt, dass ich mich natürlich fragen muss, ob mein Denken deshalb nicht vielleicht gestört ist, was ja durchaus sein mag. Sollte ich mich einfach damit zufriedengeben oder nicht doch herausfinden, was es mit meinem spezifischen, wenn auch vielleicht aus biologischer Sicht gestörten Denken auf sich hat und ob auch diesem Denken nicht vielleicht etwas abzugewinnen ist?
Mir kommt (in München) eine junge Frau entgegen, die sich für den Abend – wahrscheinlich auf der Wies’n – herausgeputzt hat. Sie trägt ein durchaus schickes modernes Dirndl mit einem Lederrock und einer dezenten Jacke. Im Haar hat sie einen Blütenkranz. Sie wirkt gleichzeitig schüchtern und offensiv und das erweckt Mitleid in mir, weil ich eine Hilflosigkeit vermute, aus der heraus sie selbst nicht entscheiden kann, was an ihrer Kleidung noch Zitat ist und was ernst gemeint, was eine Absicht verfolgt und was eine Tradition befolgt. Und ich denke, dass sie unter Umständen auch sonst nicht weiß, was sie will, sondern von einer unbestimmten Sehnsucht getrieben ist, die sich natürlich nicht erfüllen wird heute oder nur insofern, als sie diese Sehnsucht durch ihre Kleidung ausgedrückt hat.
Vielleicht ist es ohnehin ein Missverständnis, Sehnsucht als etwas anderes als einen Ausdruck von Gefühl zu verstehen. Sehnsucht drückt sich aus, das ist alles. Sie zielt nicht auf Erfüllung, die ohnehin nur enttäuschen kann.
28.09.2018
Ein Mann wacht nach vielen Jahren morgens zum ersten Mal in völliger Ruhe und ohne Angst oder Panik auf. Er liegt im Zimmer, in das langsam das erste Sonnenlicht zu fallen beginnt und braucht seit Langem gegen nichts anzudenken; er muss nichts wegschieben, sich von nichts ablenken. Nach einer Weile beschleicht ihn der Verdacht, dass dieser Zustand, in dem er keinerlei Irritation verspürt, unter Umständen noch bedrohlicher ist. Ihm fällt ein Traum von vergangener Nacht ein: Er lag in seinem Bett, als es schellte. Er wollte aufstehen, um zur Wohnungstür zu gehen und auf den Türöffner zu drücken, konnte sich aber keinen Zentimeter rühren. War dieser Traum vielleicht gar keiner gewesen, sondern hatte ihm der Körper den Dienst versagt, so wie ihm jetzt, während er ganz ruhig in seinem Bett liegt, der Geist den Dienst versagt?
Um zu überleben, einen Kompromiss aushandeln zwischen Körper und Geist: einmal ist der eine dran, einmal der andere.
Warum habe ich mit einem Mal das Bedürfnis, in die dritte Person zu wechseln? Hat es etwas mit meiner Entscheidung zu tun, mich nach außen hin mit O zu versöhnen, mich aber innerlich immer weiter von ihr zu lösen? Es scheint der körperliche Entzug zu sein, der mir Probleme bereitet und der sich schon durch ein Telefonat wieder beruhigen lässt. Gleichzeitig versuche ich, die Ursachen für das beständige Scheitern zu beseitigen, die ich in meinem Wollen vermute.
Es ist eine Mischung aus Arroganz und Verkennung der eigenen Lage, mit der wir auf die Zeit schauen, in der wir leben, weil wir gleichzeitig glauben, außerhalb von ihr zu stehen und nicht wirklich von ihr betroffen zu sein. Liegt es daran, dass man nur das Vergangene benennen kann, weshalb man daraus dann falsche Schlüsse zieht? Das Gegenwärtige entfaltet keine Bedeutung aus sich selbst heraus, zumindest keine, die sich nicht jederzeit revidieren ließe, und es scheint im Nachhinein das unbewusste Handeln, das eine Epoche ausmacht.
Die grundsätzliche Arroganz allem anderen gegenüber erstreckt sich auch auf das andere, das ich selbst produziere und bin. Toleranz ist also in erster Linie etwas, von dem ich selbst profitiere.