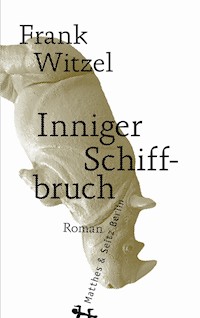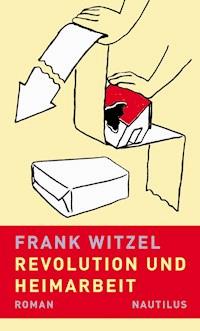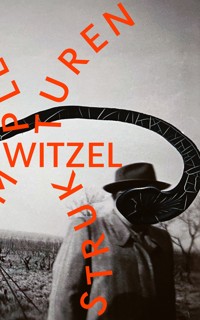Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frank Witzels hinreißend komischer Roman über Leben und Werk der Schriftstellerin Bettine Vondenloh – deren Romane 120 Seiten nie überschreiten und stets Bestseller werden – ist Literaturbetriebskrimi ebenso wie skurrile Dorfgeschichte: Ein gigantischer Wal beginnt darin gehörig zu stinken, die Psychoanalytiker Jacques Lacan und Wilhelm Reich entkommen knapp einem gefährlichen Sturz, eine riesige Wachsstatue Himmlers offenbart ihr Innenleben und der Erzähler kommt in Verdacht, ein Verhältnis mit der in die Jahre gekommenen Schriftstellerin gehabt zu haben. Am Ende wissen wir zwar nicht mehr als zuvor, aber sind um einiges klüger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MATTHES&SEITZBERLINPAPER·BACK
Frank Witzel
VONDENLOH
Roman
Für Celia
INHALT
VONDENLOH
1LYCOPODIUM
2DER GÜNDELHOF
3DIE WALURNE
4OLIVIAS MONDFAHRT
5DAS VERLIES
6HANDKE, STIEGER, HERR KOSSLER UND FRÄULEIN LINDNER
7DAS HOCHHAUS
8DAS PILZGERICHT
9INTIMSCHICHT
10DIE ELSCH-044
11DAS SYMPOSIUM
12BEGEGNUNGEN IN PARIS
13ENTHÜLLUNGEN
14WACHS UND GIFT
15NACHRUHM
ANHANG
MATERIALIEN
1REINHOLD KUNELLA
Klarname Kunella
2GERHARD HEIMS
Lachen und Strafen
3MARIA-FRANZ MONDNER
Nachlasshandel
4BRUNO MANGOWITZ
Cradlebait
5HEIDEMONE TURKEWEIT
Madeleine und Bäckerblume
6MAGRET DÜRKHEIM-BLYCHER
Durch Erfindungen vervollständigen
7PAT INKOW
Du ist ein anderer
AUTOREN
1
LYCOPODIUM
Der Komponist Gottfried Heinzell, dem ich im Frühjahr 1996 ein Libretto über die Kindheit der Schriftstellerin Bettine Vondenloh anbot, schrieb mir in seinem Antwortbrief, er empfinde meine Geschichte in ihrer geradezu symbolischen Überhöhung ergreifend, könne sich aber eine tonale Umsetzung nur schwerlich vorstellen. »Vielleicht«, fügte er hinzu, »haben Sie das Thema literarisch bereits ausgeschöpft, sodass meine Musik nur noch Untermalung wäre, nicht aber, wie ich es mir selbstverständlich für meine Arbeit wünsche, tragendes Element.«
Ich verstehe Heinzells Einwand heute sehr gut und bin mittlerweile sogar der Meinung, dass eine Oper, gleichgültig in welchem musikalischen Stil gehalten, nicht der geeignete Rahmen ist, meine Kenntnisse vom Leben Bettine Vondenlohs der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; selbst wenn ich seinerzeit, einer ersten trotzigen Reaktion folgend, den zurückgesandten Text noch einmal kopierte und gleichzeitig an Dieter Schnebel und Helmut Lachenmann verschickte. Erst als ich mein Libretto von beiden Komponisten unkommentiert zurückerhielt, gebot ich meinem blindwütigen Aktionismus Einhalt und gestand mir ein, dass der Grund, warum ich Bettine Vondenloh im Jahr ihres vierzigsten Geburtstags eine Art Denkmal hatte setzen wollen, allein in meiner eigenen Unfähigkeit lag, die unabweisbaren Folgen der verfließenden Zeit in entsprechender Langmut hinzunehmen und als unabänderlich zu akzeptieren.
Da ich ein knappes halbes Jahr älter bin als Bettine Vondenloh, hatte ich die beschwerliche Hürde schon zuvor, allerdings nicht ganz ohne Blessuren, genommen. Schon einige Wochen vor meinem Geburtstag überfiel mich nämlich täglich um vier Uhr nachmittags eine zuvor nicht gekannte Müdigkeit, die mich zwang, jegliche Tätigkeit ruhen zu lassen, um wie von einer Art Ohnmachtsanfall befallen einzuschlafen. Keine noch so große Willensanstrengung, kein Genuss von starkem Kaffee oder Tee, kein Öffnen des Fensters, Besprengen des Gesichts mit Wasser, keine Leibes- oder Konzentrationsübungen verschafften Erleichterung, weshalb ich mir wohl oder übel und gerade dort, wo ich war, eine Schlafstelle suchen und diese ein bis anderthalb Stunden in Anspruch nehmen musste. Danach erhob ich mich durchaus erfrischt und setzte meine Arbeit fort, als sei nichts geschehen.
Ich arbeitete damals noch im Verkehrsbüro von Leinheim, das, außer mittwochs, täglich bis achtzehn Uhr geöffnet ist, ein Umstand, der mich meine körperliche Verfassung allein vorübergehend und mithilfe immer mühseliger ersonnenen Ausreden verbergen ließ.
Ich suchte meinen Arzt auf, schilderte ihm die glücklicherweise zeitlich fest einzugrenzende Symptomatik und betonte ausdrücklich, dass ich mich ansonsten weder überanstrengt noch niedergeschlagen fühlte und im Gegenteil, bis auf eben diese relativ kurzen Unterbrechungen, durchaus zufrieden mit meinem Gesundheitszustand sei. Er stellte noch einige ergänzende Fragen und verschrieb mir dann Lycopodium in der Potenz D12.
Vielleicht hätte ich es als ein Zeichen des Schicksals deuten sollen, dass man mir in der Apotheke Mehrbrinck aus Versehen erst ein anderes Mittel bestellte, doch vertraute ich ganz den Empfehlungen meines Arztes und ließ das falsche Präparat, ohne mir auch nur den Namen zu merken, zurückgehen. Nachdem ich schließlich mit einem weiteren Tag Verzögerung angefangen hatte, dreimal täglich fünf Globuli einzunehmen, erfuhr ich jedoch keine körperliche Verbesserung, sondern im Gegenteil eine Steigerung meiner Müdigkeit, die sich nun auf den gesamten Nachmittag auszudehnen begann.
Mit dem Phänomen der Erstverschlechterung vertraut, maß ich diesem Zustand keine allzu große Bedeutung bei und setzte die Einnahme fort. Nach einer Woche war ich nicht mehr fähig, das Haus zu verlassen. Ich war nicht allein müde und erschöpft, alle Dinge und Lebewesen, die mich umgaben, schienen mir in trüb-viskosem Bernstein eingefangen, der, sobald ich mich ihm näherte, von meinem unregelmäßigen Atem beschlug. Die Münder der Menschen öffneten sich, doch verstand ich nicht, was sie sagten. Wollte ich reagieren, versagten meine Gliedmaßen mir den Dienst, während das Treiben der Welt ungerührt, wenn auch in verzögerter Bewegung, an mir vorübertrieb.
Da mein Arzt ein zweiwöchiges Fortbildungsseminar besuchte und mir die Sprechstundenhilfe der von ihm angegebenen Vertretung mitteilte, dass eine diagnostische Einschätzung meines Zustands ohne ein längeres und natürlich entsprechend kostspieliges Erstgespräch nicht möglich sei, ich darüber hinaus ohnehin frühestens in fünf Wochen einen Termin bekommen könne, musste ich notgedrungen selbst nach einer Alternative suchen. Gerade noch rechtzeitig, denn eine zunehmende Lustlosigkeit erstickte langsam jeglichen Unternehmungsgeist in mir, ließ ich mir von einem Arbeitskollegen aus der Ulmer Universitätsbibliothek ein homöopathisches Kompendium mitbringen, um selbst das mir verschriebene Mittel nachzuschlagen.
Was ich dort unter dem Stichwort Lycopodium fand, erschien meinem laienhaften Blick zunächst als durchaus zutreffend. »Die Beschwerden verschlimmern sich zu einer festen Zeit, meistens zwischen 16 und 20 Uhr.« Es war richtig, dass es diesen festen Zeitpunkt meiner Müdigkeit gab, nur hätte ich ihn nicht als eine direkte Form der Verschlechterung beschrieben, da ich im Übrigen, wie bereits erwähnt, wohlauf war.
»Die mentale Symptomatik von Lycopodium ist mannigfaltig. Er ist müde. Er hat einen trüben Geisteszustand, leidet unter chronischer Erschöpfung, Vergesslichkeit, hat eine Aversion gegen neue Unternehmungen, Abneigung gegen seine eigene Arbeit.« Auch das war in gewissem Maße richtig. Eine Aversion gegen meine eigene Arbeit hatte ich allerdings nie verspürt, wobei ich unter der eigenen Arbeit natürlich nicht meine Tätigkeit im Leinheimer Verkehrsbüro verstand, sondern das, was mich außer unserer gemeinsam verbrachten Kindheit mit Bettine Vondenloh verband, nämlich das Schreiben.
»Furcht vor Menschen mit gleichzeitiger Furcht vor Einsamkeit. Möchte sicher sein, dass noch jemand im Haus ist, aber verlangt nicht nach Gesellschaft. Gibt es zwei benachbarte Zimmer in einem Haus, so geht der Lycopodium-Patient in das eine und bleibt dort, ist aber froh, einen anderen nebenan zu wissen.«
Ich war mir einen Moment unsicher, ob diese Symptomatik nicht doch auf mich zutreffen könnte, befand aber während der weiteren Lektüre und im Zusammenhang mit anderen beschriebenen Symptomen, die ich keineswegs aus eigener Erfahrung kannte, dass mehr Gründe gegen eine fortgesetzte Einnahme des Mittels sprachen als dafür.
Natürlich bin ich, wie der Lycopodium-Patient, emotional leicht erregbar, aber ich weiß diese Gefühle immer zu kontrollieren. Auch ist meine Einsamkeit keine selbst gewählte, sondern ein Zustand, der sich aus mancherlei von mir nicht immer zu kontrollierenden äußeren Lebensumständen ergeben hat. Kurzum, ich setzte das Mittel ab, worauf es mir schon am nächsten Tag besser ging. Darüber hinaus war ich sogar in der Lage, die mich immer noch in einer leichteren Form überkommenden Schlafanfälle zu überwinden.
Ich dachte an Lessing, der gegen Ende seines Lebens an Narkolepsie litt, und an Fechner, der mit Sicherheit Lycopodium-Patient war, da man sich mit ihm über Jahre ausschließlich von einem benachbarten Raum und durch ein in die Zwischenwand eingelassenes Rohr hatte unterhalten können, und fing an, einen Aufsatz über diese beiden und weitere Literaten zu verfassen, die ich, einer ersten Schematisierung folgend, unter dem Oberbegriff der »Lycopodien« zusammenfasste. Die Arbeit ging mir gut von der Hand, bis ich mich Beispielen der jüngeren literarischen Vergangenheit zuwandte und dabei natürlich als Erstes an Helga erinnert wurde.
Helga Dahmel ist der richtige Name von Bettine Vondenloh. Es ist der Name, auf den sie 1956 in der Sankt-Marien-Kirche in Leinheim getauft wurde und unter dem man sie die neunzehn Jahre von ihrer Geburt bis zu ihrem Weggang im Jahre 1975 in unserem Ort kannte.
Leinheim liegt etwa dreißig Kilometer östlich von Ulm und ist ein kleines, eher unbedeutendes Städtchen. Helgas Vater besaß dort am hinteren Ende der Haunsheimerstraße, dort, wo der Weg eine Biegung zum Hirschberg hinaufmacht, das einzige Weißbinder- und Tapezierergeschäft, sodass die Dahmels im Vergleich zu vielen anderen Familien, darunter auch meiner eigenen, schon frühzeitig zu einem gewissen Wohlstand gekommen waren. Helgas ältere Brüder arbeiteten im väterlichen Geschäft und betrieben zusätzlich einen regen Handel mit Gebrauchtwagen, die sie nach Feierabend in einer angemieteten Scheune, nur wenige Meter vom elterlichen Haus am Hirschberg, zurechtschweißten.
Helga war schon als junges Mädchen ausgesprochen hübsch. Im Winter trug sie die von ihrer Tante aus Deffingen gestrickten Norwegerpullover und im Sommer abgelegte Oberhemden ihrer Brüder. Die dunklen Haare waren stets zu einem Knoten zusammengesteckt, und bereits damals hatte sie beim Lächeln diesen etwas melancholischen Blick mit der in Falten gelegten Stirn, den ich heute noch in den unterschiedlichsten Verlagsprospekten und Feuilletons des In- und Auslands bewundern kann.
Nachdem ihr Bruder Georg, genannt Stoffel, beim Versuch, einen Benzintank zu schweißen, schreckliche Verbrennungen davongetragen hatte, begann Helga mit dem Schreiben. Sie war damals gerade vierzehn und besuchte, wie auch ich, das Gymnasium in Ulm. Obwohl ihr der Deutschunterricht lag, nahm sie sich für ihre ersten Schreibversuche keine Autoren der Schullektüre zum Vorbild, sondern einen Schriftsteller, der regelmäßig auf der zweiten Seite der kostenlos erhältlichen Zeitschrift Bäckerblume kurze Geschichten veröffentlichte. Dieser Autor hieß, wenn ich mich recht erinnere, Jo Hanns Rösler. Die Lektüre seiner Geschichten, die auch meine Mutter gerne las, nahm nie mehr Zeit in Anspruch, als man zum Verzehr eines Stück Kuchens und einer Tasse Kaffee am Nachmittag benötigte. Rösler war ein Meister darin, die heile Welt des Kleinbürgertums zu schildern, deren fest gefügte Ordnung der Schicksalsmotor von Zeit zu Zeit in ein fast angenehm zu nennendes Schwingen versetzt, welches der Autor mit geschickter Hand innerhalb weniger Zeilen wieder zu beruhigen verstand, ähnlich dem Betreiber einer Schiffsschaukel, der zum Abbremsen eine Planke gegen den darübergleitenden Kiel presst. Mit der Erinnerung an seinen Namen verbindet sich für mich heute noch der Geruch von frisch gemahlenen Kaffeebohnen und den kandierten Mandeln des Bienenstichbelags.
Ich las zu dieser Zeit bereits Die Begrüßung des Aufsichtrats von Peter Handke und hatte für jegliche Form der Trivialliteratur nur Verachtung übrig. Ebenso wenig wie Helga war ich Zeuge von Stoffels Unfall gewesen, dennoch entwarfen sich in meinem Inneren sogleich Bilder von expressionistischer Eindringlichkeit: Stoffel! Benzingetränkter Leib! Menschliche Fackel! Stürmt an gegen klein gestutztes Spaliergewächs! Stürzt in die frisch beackert aufgeworfene Scholle, um des infernal funkenden Feuers Herr zu werden! Dornbusch motorisierter Maschinenwelt! Scherenschnitt des Keilriemens Unwägbarkeit! Verglühendes Irrlicht am Leinheimer Horizont!
Der magische Realismus, der im Jahr 1970 zwar schon existierte, in Süddeutschland jedoch noch gänzlich unbekannt war, hätte ein vergleichbares Bild aufgegriffen und in das dichte Gespinst von Mythologie und Wahn eingewebt, dem kein Leser vor einer atemlosen Beendigung der Lektüre entkommen wäre. Die Historie eines ganzen Volkes ließe sich so entwerfen, denn das tragische Geschick von Helgas Bruder fand mit dem Unfall selbst noch lange kein Ende, sondern erstreckte sich in die Zeit der Rekonvaleszenz, als dem Unglücklichen die frisch über die Wunden wachsende Haut immer wieder abgezogen werden musste, um eine wenigstens einigermaßen narbenlose Verheilung zu unterstützen.
Diese Sinnbilder der Identitätsfindung verlangten für mich entweder nach der kühlen Gleichgültigkeit der Moderne oder dem barocken Glühen des Phantasmas, und obwohl ich ein Quäntchen mehr an Lebenserfahrung besaß und ahnen hätte können, dass Helga mit Sicherheit noch zu dicht an diesem schrecklichen Ereignis war, um es direkt an- und aussprechen zu können, war es mir damals nicht möglich, ihre literarische Herangehensweise zu akzeptieren, geschweige denn in ihr die ersten, wenn auch schüchternen Äußerungen eines großen Talents zu erkennen.
Die Geschichte, die sie mir eines Morgens, es waren etwa sechs Wochen seit dem Unglück vergangen, im Bus gab, füllte eine ganze aus ihrem Geografieheft herausgerissene DIN-A4-Seite und hieß: »Es klingelt bei Monschauers«. Herr Monschauer war unser Religionslehrer. Ein Junggeselle, der meines Wissens nach keinerlei Familie besaß, weshalb ich mich über den Titel wunderte. Ich ahnte damals noch nicht, dass Helga sich schon in ihrem ersten Text ganz intuitiv jener Form der Verschlüsselung bediente, die sie eine ganze Schriftstellerkarriere lang beibehalten sollte und auf die sich, nicht zuletzt, auch ihr Ruhm gründet.
»›Heute gehst du aber mit dem Hund raus‹, sagte Frau Monschauer am Samstagmorgen. Ihr Mann schaute ärgerlich über den Rand der Zeitung. Ein Artikel über einen Zauberkünstler hielt ihn gefesselt. Von diesem Mann hieß es, er könne durch Flammen gehen, ohne dabei Schmerz zu empfinden.«
So lauten die ersten Zeilen der Erzählung, die auch gleichzeitig deren Höhepunkt darstellen, da im Folgenden von nichts weiter als einem tatsächlich stattfindenden kleinen Spaziergang und dessen Banalitäten berichtet wird. Am Ende sitzt Herr Monschauer wieder hinter seiner Zeitung, als sei rein gar nichts geschehen. Und erst im letzten Satz, fast wie nachgeschoben, erfüllt sich der Titel der Geschichte, denn es schellt bei Monschauers, jedoch bricht gleichzeitig mit dieser Erfüllung die Erzählung jäh ab.
Die mittlerweile vergilbte und an den Falzungen brüchige Seite gehört zu meinen wertvollsten Erinnerungsstücken, und ich muss gestehen, dass es mich heute zutiefst ärgert, damals den dritten Satz rot angestrichen zu haben.
»Ein Zauberkünstler geht nicht durch Flammen«, teilte ich Helga dazu lapidar am anderen Morgen mit. »Außerdem wirkt der Ausdruck ›gefesselt‹ in diesem Zusammenhang komisch.« Sie erwiderte nichts, sondern schenkte mir nur ihr unvergleichliches Lächeln, in das sich eine Spur des Bedauerns mischte.
Seltsamerweise ist meine rote Tinte schneller verblasst als die blaue, in der sie ihre Zeilen schrieb. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Kopie ihres Erstlings besitzt. Wahrscheinlich nicht. Kopiergeräte waren damals noch selten, und dass sie sich die Geschichte abgeschrieben hat, kann ich mir nicht vorstellen.
Schon um ein besseres und genaueres Verständnis ihrer Werke zu ermöglichen, hätte ich mein Wissen über Helga gerne mit anderen geteilt. Doch obwohl der Ruhm Bettine Vondenlohs gerade in den letzten Jahren unvorstellbare Ausmaße erreichte, schien man im Allgemeinen mehr an privaten Einzelheiten interessiert als an ersten Proben ihres Schaffens. So wurde ein mir als fest zugesicherter und in monatlich erscheinenden Programmzeitschriften auch bereits angekündigter Termin bei Beckmann im letzten Moment wieder abgesagt, weil ich angeblich »nicht genug Persönliches einzubringen hätte«. Dies teilte mir knapp zehn Tage vor der Aufzeichnung eine Dame telefonisch mit, wobei ich mich fragte, wie sie überhaupt auf diesen Gedanken kam, und wenn, weshalb erst so spät. 500 Mark Ausfallhonorar, das sei der übliche Satz, und vielleicht würde es ja ein anderes Mal zu einem anderen Thema klappen. Beckmann sei ohnehin eine reine Prominenten-Talkshow. Nun konnte ich mich nicht länger zurückhalten und fragte direkt heraus, warum sie mich dann überhaupt genommen hatten. »Es ist bekannt, dass Frau Vondenloh sehr publikumsscheu ist und so gut wie keine Interviews gibt. Wir hatten gehofft, auf diesem Weg etwas Näheres über sie zu erfahren.«
»Aber das können Sie doch noch immer«, wandte ich ein.
»Wie gesagt«, überging die Dame meinen Zwischenruf, »es gab da einige Schwierigkeiten. Vielleicht haben Sie ja woanders Glück.«
An meiner Stelle hatte man an besagtem Montag einen gewissen Götz Alsmann eingeladen. Bei Alsmann, den ich zuvor noch nie gesehen hatte, handelte es sich allem Anschein nach um ein Multitalent mit einem auffälligen, aber durchaus ansprechenden Äußeren. Natürlich war er viel wortgewandter, als ich es je hätte sein können. Er sprudelte über von Anekdoten und berichtete von seinen Erlebnissen als Musiker und Entertainer. Ich erfuhr viele interessante Details aus dem Showgeschäft, so zum Beispiel, dass Alsmann die Angewohnheit hat, in seinem Garderobenraum in das Waschbecken zu urinieren, weil ihm das Glück bringt.
Ich wandte mich, der Anregung, es einmal woanders zu versuchen, folgend, an Johannes B. Kerner, beging aber den Fehler, in meinem Brief die fehlgeschlagene Einladung bei Beckmann zu erwähnen. Man teilte mir daraufhin mit, dass ich nicht direkt als Gast infrage käme, unter Umständen aber bei einer Sondersendung mitwirken könne, die für die zweihundertste Ausstrahlung vorgesehen sei und sich unter dem Titel »Abgelehnt!« ausschließlich mit Menschen beschäftige, die bei anderen Talkshows nicht angenommen worden waren. Jeder könne dann in einem kurzen Statement von seinem Misserfolg berichten. Obwohl ich glaube, dass ich auch bei dieser Sendung mein Anliegen nicht richtig werde vertreten können, einfach schon aus einem Mangel an Zeit, ließ ich mich vormerken.
Ich habe mir vorgenommen, bis dahin etwas Ordnung in meine Aufzeichnung über Helga zu bringen. Natürlich ist da an erster Stelle die Kindheit zu erwähnen, durch die unser Leben nachhaltig geprägt wird. Elternhaus, Schule und nicht zuletzt der Wohnort, mit dem ich auch beginnen möchte.
2
DER GÜNDELHOF
Der einstige Gündelhof, das jetzige Heimatmuseum Leinheim, war ein unheimlicher Ort, der die Fantasie von uns Kindern gefangen hielt. Das weitläufige und in ein Hauptgebäude und zwei Seitenflügel aufgeteilte Anwesen befindet sich auf einer kleinen Erhebung gleich rechts am Ortseingang. Ein großes Holztor, in das eine schmale Tür eingelassen ist, verschließt den gepflasterten Hof, in dessen Mitte ein Brunnen und ein alter, in den letzten hundert Jahren bedauerlicherweise schon dreimal vom Blitz getroffener und deshalb toter Eichenstamm steht.
Während des Krieges wurden die Zimmer und vor allem die Kellerräume als Munitionsdepot benutzt. Kurz vor Einmarsch der Alliierten verminte der Sohn des damaligen Bürgermeisters das Gelände so gründlich, dass selbst die Amerikaner sich unverrichteter Dinge zurückziehen mussten.
Man erzählt Fremden und Besuchern in Leinheim gern die Geschichte einer zehntägigen Belagerung, wahrscheinlich um in ihr den dörflichen Zusammenhalt zu symbolisieren. Tatsächlich hatten die Besatzer einen einzigen Panzer und einen Jeep nach Leinheim abkommandiert, weil man in der Gegend von Ulm Lager- und Konstruktionsplätze für Geheimwaffen vermutete. Als die beiden Insassen des Jeeps jedoch bei einem ungeschickt ausgeführten Anfahrmanöver zum Gündelhof eine der Minen auslösten und dabei bedauerlicherweise ums Leben kamen, während der ihnen nachfolgende Panzer aus unerfindlichen Gründen ein nur fenstergroßes Loch in das Mauerwerk hatte schießen können, beschloss die Vorhut, wieder abzudrehen und den strategisch unwichtigen Ort sich selbst zu überlassen.
Währenddessen war der Bürgermeistersohn am Morgen nach seiner nächtlichen Aktion mit einem demolierten Armeemotorrad neben der Bahnstrecke nach Riedhausen einem Gütertransport hinterhergerast, hatte jedoch bei einer Wegschlaufe die Kontrolle über sein Gefährt verloren, war kopfüber in einen Stacheldrahtzaun gestürzt und schließlich von seiner ihm nachkommenden Maschine erschlagen worden.
Dies war der Grund, warum niemand im Ort wusste, wo genau sich die um den Gündelhof vergrabenen Minen befanden, ein Umstand, der sich tief in das Gedächtnis der Leinheimer eingrub und selbst Anfang der Sechzigerjahre noch präsent war, als man uns Kinder, wenn auch scherzhaft, vor den »Tret-Tellern« warnte.
Sei man erst einmal, so wurde später bei Gruppenstunden und in Zeltlagern erzählt, auf eine Mine getreten, müsse man vollkommen ruhig bleiben, den Fuß auf keinen Fall von dem Sprengsatz zurückziehen und unbedingt den Kontakt mit dem Metall halten, da sich sonst der Zünder lösen und eine Detonation herbeiführen würde. Anstatt also dem aufkommenden Gefühl der Panik nachzugeben und fortzulaufen, sei es vernünftiger, auszuharren und um Hilfe zu rufen, damit andere das eigene Körpergewicht durch einen schweren Stein oder einen anderen Gegenstand ersetzen könnten.
Mit dem Abstand von bald vierzig Jahren frage ich mich, ob in dieser Anweisung nicht ein Sinnbild für die Existenz innerhalb einer dörflichen Gemeinschaft wie der von Leinheim zu finden ist: die Unterdrückung instinktiver Regungen, das Ausharren an einem Ort und nicht zuletzt die Sorge für einen Nachfolger und Ersatz, bevor man es wagen kann, sich zu entfernen. Allerlei Erlebnisberichte, passend für jede Altersgruppe und Stellung innerhalb des sozialen Verbandes von Leinheim, malten die reale Bedrohung in grellen Farben aus und führten ein angemessenes Verhalten exemplarisch vor. Identifikationsfigur der heranwachenden Jugend war der vierzehnjährige Rolf Kamstarr, der im ungewöhnlich frostigen April 1947 eine ganze Nacht auf besagte Weise ausgeharrt hatte, um erst in den frühen Morgenstunden von einem vorbeifahrenden Bauern und mithilfe eines halben Mühlsteins aus seiner unglücklichen Lage befreit zu werden. Dabei verlor er zwar nicht sein Leben, büßte jedoch sein rechtes Bein ein, das von der einseitigen und starren Belastung abgestorben war und amputiert werden musste.
Der Mythos aber braucht den Ritus, um sich aktiv im Alltagsleben verankern zu können. Doch bereits Ende der Fünfzigerjahre, als Helga und ich den Kindergarten der Sankt-Marien-Kirche besuchten, gehörte die alljährliche Mutprobe des »Minenpflügens« der Vergangenheit an. 1956 hatte das Land Baden-Württemberg diesem nicht ganz ungefährlichen Treiben ein Ende bereitet, indem Experten mit neuester Minensuchgerätschaft das Gelände um den Gündelhof weiträumig abgingen und durch mit speziellen Greifarmen ausgestattete Panzerfahrzeuge der gerade neu gegründeten Bundeswehr von seinen letzten Altlasten befreien ließen.
Die Bevölkerung von Leinheim begriff instinktiv, dass der Zusammenhalt ihrer Gemeinschaft von einer fragwürdigen Aufgeklärtheit der Nachkriegszeit bedroht wurde, und setzte alles daran, die dörfliche Mythenbildung weiter wuchern und das relativ frisch erworbene Brauchtum fortleben zu lassen. So zogen an jedem ersten Samstag im April die Burschen herausgeputzt und in Tracht durch die Straßen und hinaus zum Gündelhof, wo sie eine Unzahl über das Jahr angefertigter und am Vorabend dort versteckter Tretminen-Attrappen mit gezielten Stockschlägen aus dem Boden hebelten.
Anfänglich beobachteten wir Kinder dieses Treiben mit ungläubigem Staunen, ahmten aber schon bald mithilfe alter Besenstiele und ausrangierter Pappdeckel von Waschmitteltrommeln das Minenschlagen bie unserem Spiel im Hof nach.
Faszinierender, eben weil es uns in seiner strengen und rituellen Ausführung fremd bleiben musste, war für uns hingegen die Verhüllung des Schlupfs. Der Schlupf war die durch den Beschuss des Panzers seinerzeit im Mauerwerk des Gündelhofs entstandene Lücke, die man aus einem Aberglauben heraus viele Jahre unverschlossen hielt. Anfänglich wurde das Loch nicht vermauert, da man sich im Rathaus durch diesen Schaden gegenüber den Alliierten einen Anspruch auf Reparationskosten ausrechnete.
Tatsächlich war zwei Tage nach dem Beschuss ein Colonel mit großer Gefolgschaft erschienen, um die sterblichen Überreste der beiden Jeep-Insassen zu bergen und am Waldrand, in sicherem Abstand zum Minenfeld, einen schlichten Obelisken als Gedenkstein niedersetzen zu lassen. Eine genaue Untersuchung des Vorfalls wurde angekündigt und der Bürgermeister aus diesem Grund angewiesen, nichts an dem Einschussloch zu verändern.
Die amerikanische Fahne wurde gehisst, nach einigen Minuten des schweigenden Gedenkens wieder eingezogen, von zwei Soldaten zusammengefaltet und auf den Leichenwagen mit den beiden Eisensärgen gelegt. Dann verließen die Amerikaner gemessenen Schrittes, wobei der Colonel und sechs seiner Begleiter zu Fuß hinter dem Wagen hergingen, das Dorf.
In den nächsten Monaten geschah trotz mehrerer Nachfragen und Eingaben der Stadt Leinheim von Seiten der Alliierten nichts. Stattdessen tauchten jedoch in der Bevölkerung alte Gerüchte wieder auf, die von einem Schatz sprachen, den die Frau des Grafen Gündel in der Nacht auf den Antlasstag noch schnell in einem unterirdischen Gang hatte in Sicherheit bringen können, bevor das rebellische Bauernvolk sie und ihren Mann in einem Fackelzug zum Hirschberg geleitete, wo man sie »wie räudige Hunde« erschlug.
Durch die Lücke im Mauerwerk hatte nun jedermann zumindest die theoretische Möglichkeit, ins Innere des Gündelhofs zu gelangen, auch wenn er dazu das damals noch nicht geräumte Minenfeld hätte überqueren müssen. Und obwohl es recht unwahrscheinlich war, dass jemand dies tatsächlich versuchen würde, begann man, sich im Dorf gegenseitig zu verdächtigen.
Einmal hieß es, die Eltern des Rolf Kamstarr seien für den Verlust seines Beines verantwortlich, da sie ihn losgeschickt hätten, nach dem Gündelgeld zu suchen. Dann wieder beschuldigte man den Bürgermeister, sein Sohn habe den Gündelhof nur deshalb vermint, weil er den Schatz entdeckt und allein habe bergen wollen.
Derartiges Gerede brachte Unruhe in die Gemeinde. Die schweigsame Übereinkunft, unterschiedliche Positionen und Anschauungen während des Krieges, wie man die Nazizeit hier abkürzte, nicht allzu genau zu untersuchen und das Vergangene im Allgemeinen vergangen sein zu lassen, schienen gefährdet. Die angenehme Gleichheit einer neu erworbenen Demokratie, deren dörfliche Umsetzung unterschiedliche Parteien ohnehin nur nominell kannte, drohte sich in eine unbarmherzige Positionierung von gegensätzlichen Verschwörungstheorien zu verkehren.
Der amerikanische Colonel sei ein Schauspieler gewesen, der Sohn des Bürgermeisters überhaupt nicht tödlich verunglückt, sondern vielmehr mit dem Gündelschatz auf und davon, und das verlorene Bein des armen Rolf Kamstarr nicht die Folge eines Missgeschicks, sondern der Blutzoll für den Versuch, das Lügengeflecht aufzudecken. Die Logik einer zeitlichen Abfolge war innerhalb dieser Beweisführungen außer Kraft gesetzt. Zuschreibungen von Beweggründen wechselten täglich, handelnde Personen erschienen in vielerlei Gestalt, während Leinheim sich als Zentrum einer Welt entwarf, die selbst in ihrem entferntesten Winkel noch einen Bezug zur unverwechselbaren Geschichte des Ortes aufwies.
Als man jedoch anfing, Erbfolgen infrage zu stellen und angesehene Leinheimer Familien, die schon über Generationen hinweg bestimmte Ämter bekleideten, zu verdächtigen, musste der Bürgermeister handeln und eine Lösung herbeiführen, die auf der einen Seite dem Befehl des Colonels, nichts an dem Mauerschaden zu verändern, gerecht wurde, auf der anderen Seite die Einwohner von Leinheim vor irrigen Spekulationen und unter Umständen sogar wagemutigen Versuchen, in den Gündelhof einzudringen, bewahrte.
Als Erstes wurde mit recht primitiven Mitteln, nämlich indem man Schweine über das verminte Feld trieb, ein schmaler Pfad zu dem Loch in der Außenmauer gesichert und mit Pflöcken abgesteckt. Am darauffolgenden Sonntag schritten der Bürgermeister und einige Vertreter der Gemeinde über diesen Pfad zum Schlupf, um ihn unter den Augen der das Feld säumenden Gemeindemitglieder zu verhängen. Man hatte dazu einen Stoff aus blauem Samt mit dem Wappen von Leinheim und dem Motto des Geschlechts derer von Gündel (»Non Omnis Moriar«) verziert. Dieser Stoff besaß an jeder Seite jeweils acht Ösen, durch die man starke Eisennägel in die Fugen des Mauerwerks trieb, um das Tuch so vor dem Loch zu befestigen. Die Nägel wurden eingegipst und als ein Übriges von einem vereidigten Notar an den Stoffösen plombiert und versiegelt.
Der Bürgermeister verkündete, dass dieser Behang unter allabendlicher und allmorgendlicher Kontrolle des Dorfpolizisten so lange dort hängen bleiben würde, bis man eine verbindliche Antwort der Alliierten über die Höhe der Entschädigungssumme erhalten habe. Die Einwohner klatschten und gingen gemeinsam auf den Marktplatz, wo man an herausgestellten Tischen das durch die Minen vortranchierte Schweinefleisch zu sich nahm.
Da die zweireihig angepflanzte Kette von Birken, die den Gündelhof von der Zufahrtsstraße abtrennte, schon teilweise während des Kriegs abgeholzt, dann kurz nach dem Krieg, wahrscheinlich wegen des hohen Eisengehalts im Boden, völlig eingegangen war, stand das alte Gemäuer den Witterungen noch schutzloser ausgesetzt gegenüber als früher. Die erste und seinerzeit auch als einmaliger Akt geplante Verhängung des Schlupfs fand im Jahre 1948 statt. Synthetische Stoffe waren unbekannt, geeignete Formen der Imprägnierung gab es nicht, kurz gesagt: Nach kaum einem halben Jahr hing vor dem Loch in der Mauer des Gündelhofs ein fadenscheiniger Fetzen, der seinen Zweck schon lange nicht mehr erfüllte, obwohl der Dorfpolizist seiner morgendlichen und abendlichen Kontrolle, wenn auch oft nur im Vorbeiradeln auf der Straße, pflichtgemäß nachkam.
Bald war es unter den Jugendlichen zu einer Form der Mutprobe geworden, sich zwischen den Tuchfetzen und durch das Mauerloch ins Hofinnere zu zwängen. Nicht allein, dass dadurch der Stoff natürlich noch mehr litt, auch die Gerüchte bekamen neue Nahrung. Jeder, der sich einmal überwunden hatte, im Schutz der Nacht den Schlupf zu durchkriechen, berichtete natürlich lautstark, was ihm alles auf der anderen Seite begegnet sei.
Die alte Eiche habe wieder angefangen zu blühen und trage sogar sonderbare blaue Früchte, die jedoch, sobald man sie berühre, zerplatzten, um den Pflücker mit einer tintenähnlichen Flüssigkeit zu bespritzen, die dieser sieben Monate nicht mehr von seiner Haut bekam. Natürlich liege das amputierte Bein von Rolf Kamstarr im Hof, zusammen mit einigen Überresten der beiden amerikanischen Jeep-Insassen. Seltsam anzusehen sei auch der eingetrocknete Kadaver eines Schweins. Es handele sich dabei um das erste der unglücklichen Tiere, die man zur Freiräumung des Pfades über das Minenfeld getrieben habe. Es sei mit einer solchen Wucht in Stücke gerissen worden, dass die Einzelteile über die Mauer des Gündelhofs hinweggeflogen seien, um sich dort wieder zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Eingegangen, weil nichts Essbares im Hof zu finden gewesen sei, gliche der vernarbte Schweinekadaver dem in Abschnitte unterteilte Schaumodell in Metzgereien, das dem Laien mithilfe von Zahlen den Sitz von Schopfbraten, Karree und Schlegel anweist.
Aber auch der Gündelschatz kam nicht zur Ruhe. Verlängere man die Linie, so hieß es, die der Schatten des von den Amis aufgestellten Obelisken im ersten Junivollmond werfe, durch den Schlupf hindurch ins Innere des Hofes, so stoße man auf den Ort, an dem der Schatz vergraben sei. Dieser Hinweis löste eine neue Welle der Begeisterung in Leinheim aus, da man in ihm gleichzeitig die Bestätigung für eine Mitwisserschaft der Besatzer fand. Die Tatsache, dass zur geeigneten Feststellung eines Punktes mindestens zwei Koordinaten von Nöten sind, schien im neu aufflammenden Enthusiasmus unterzugehen. Schließlich könne man zur Not die gesamte Verlängerung des Schattens quer durch den Hof aufgraben.
Glücklicherweise hatte der Bürgermeister, und das obwohl keinerlei rechtsverbindliche Zusagen, geschweige denn reale Zuwendungen vonseiten der Alliierten eingegangen waren, schon frühzeitig den Satz geprägt: »Solang der Schlupf verhänget ist, Leinheim keinen Pfennig misst.« Ein Motto, das er jetzt noch einmal in Bronze gießen und in kleinen Repliken zum Verkauf an Wanderer und Sommerfrischler herstellen ließ. Diese hefteten sich den Spruch als Nadeln ans Revers, nagelten ihn sich als Plaketten an den Wanderstock oder rieben ihn als Aufkleber auf den Koffer und brachten ihn so hinaus in die ganze Welt oder zumindest den Alb-Donau-Kreis. Und was in der Fremde Wirkung zeigte, das fand auch endlich in der Heimat Anklang.
Bald hatte jeder Leinheimer diesen Leitspruch auf einen Teller gemalt oder in Salzteig ausgebacken in seiner Küche hängen. Die gemeinsame Losung ließ selbst härteste Verfechter von Verschwörungstheorien und bestausgerüstete Schatzsucher wieder näher zusammenrücken. Geführt von einem Glauben, der die Gemeinschaft am Ende doch immer wieder über das individuelle Besitzstreben stellt, beschloss der Gemeinderat, einen besser gewebten Stoff anfertigen zu lassen und diesen einmal im Jahr in einer kleinen Zeremonie mit anschließendem Fest auszutauschen. So sei der Schlupf auf immer geschlossen und der Geldsegen für die Stadt gesichert.
Eigentlich hätte damit Frieden in Leinheim und um den Gündelhof einkehren können, gäbe es innerhalb des menschlichen Strebens nach Sicherheit und Unversehrtheit nicht eine Art Gegenbewegung, welche einfach nicht in der Lage ist, die minimalisierten Gefahrenpunkte zu vernachlässigen oder zu übersehen, sondern sie im Gegenteil immer stärker mit einem Gefühl der Bedrohung aufzuladen, so als sammle und vereinige sich in diesen wenigen Unwägbarkeiten alles zuvor aus dem Weg Geräumte. Dieser letzte Punkt war für Leinheim der 14. September, der Tag, an dem alljährlich der Tuchaustausch am Schlupf vorgenommen werden sollte.
Es war bereits aufwendig genug gewesen, sich auf ein möglichst unbedeutendes und mit keinem anderen Ereignis in Zusammenhang stehendes Datum zu einigen, einen möglichst unauffälligen Tag also, der weder an den Tod des Bürgermeistersohns noch an die Beschießung durch die Alliierten oder die Hinrichtung der Gündels, geschweige denn einen fremden nationalen oder internationalen Feiertag erinnern sollte. Nach vielen Überlegungen, dem Studium der städtischen Chronik und Einbeziehung anderer Faktoren wie Witterung, Ernte und Gemeindeleben im Allgemeinen, war man auf den 14. September als harmlosen und banalen Termin verfallen.
Selbst der Schutzpatron des Tages, der Heilige Johannes Chryostomus, entstammte dem nicht ohne Weiteres zu verortenden Antiochien und wies gegenüber anderen Heiligen den Vorzug eines unspektakulären Todes auf – es heißt, er erkrankte an Kopfschmerzen, legte ein weißes Gewand an und schied bei vollem Bewusstsein aus dem Leben. Darüber hinaus konnte seinem noch nicht einmal auf ein genaues Datum festgelegten Martyrium auch am 27. Januar gedacht werden.
Als man nun diesen 14. September zur Beruhigung aller errechnet und festgelegt hatte, flachte das ängstliche Interesse am Tuchwechsel jedoch nicht ab, sondern fixierte sich endgültig auf die wenigen Sekunden, in denen der Schlupf unbedeckt sein würde, da man das alte Tuch schon abgenommen, das neue aber noch nicht aufgespannt hatte. Um diese Sekunden rankten sich die aberwitzigsten Legenden, die bei aller fantastischen Denkarbeit doch immer wieder auf die Ursprünge des menschlichen und demnach auch Leinheim’schen Denkens zurückkamen: den Tod und den Schatz der Gündels.
Wem es gelänge, in diesen Sekunden der Tuchlosigkeit durch den Schlupf zu spähen, so hieß es, der erkenne das ganze vor ihm liegende Jahr, und wenn er es nicht erkenne, so nur, weil er in diesem Jahr das Zeitliche segne. Dem gegenüber stand die Befürchtung, bei einem Blick durch das Loch zu erblinden oder eben Schreckliches zu sehen wie etwa einen platten Schweinskadaver oder ein amputiertes Bein. Auch die Gündels tauchten erneut auf. Da ihr Leitspruch »Non Omnis Moriar« durch das zeitgemäßere »Solang der Schlupf verhänget ist« ersetzt worden war, fürchtete man die Einlösung ihrer Maxime, die zum ersten Mal auch einen Sinn bekam, da der Satz schließlich prophezeite: Ich werde nicht zur Gänze sterben.
Erst im Jahr 1987 sollte sich dieser Zustand ändern und damit auch die Umrüstung des Gündelhofes zum heutigen Heimatmuseum Leinheim vorbereiten. In diesem Jahr nämlich erreichte das öffentliche Interesse an der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA ihren absoluten Tiefpunkt. Intern sprach man von Kürzungen und dem Einfrieren verschiedenster Gelder. Die amerikanische Bevölkerung schien sich um die Expansion in den Weltenraum nicht länger zu kümmern, und so kam man auf die Idee, seine Fühler ins Ausland auszustrecken, um sich nach dem Prinzip der Wiederbelebung von außen, mit dem auch der Leinheimer Bürgermeister sein Motto durchgesetzt hatte, wieder ins Gespräch zu bringen. Die Idee, einen Deutschen mit ins All zu nehmen, war schon ein erster Schritt, vor allem aber musste man den Menschen klarmachen, dass die Weltraumfahrt auch einen irdischen Nutzen besaß. Farbfernseher, Teflonpfannen und Kugelschreiber, die unter Wasser schrieben, gehörten mittlerweile zum Alltag und wurden längst nicht mehr mit Raketen in Verbindung gebracht. Den Markt mit neuen Segnungen zu überschwemmen, würde auch keine besondere Aufmerksamkeit erregen, weshalb man an den Stellen anzusetzen beschloss, an denen ein tatsächliches Bedürfnis vorhanden war. Zum Beispiel in Leinheim.
Ein Neffe des Colonels, der seinerzeit den mittlerweile stark von der Witterung befallenen Obelisken an den Rand des Feldes vor dem Gündelhof gesetzt hatte, arbeitete in dem zur Imageaufbesserung der Astronautik eingesetzten Ausschuss und erinnerte sich während eines kreativen Brainstormings an die Kriegserzählungen seines Onkels, in denen auch Leinheim und der Schlupf eine Rolle spielten. Beide hatten diesem nämlich in den Jahren nach dem Krieg noch einige Unannehmlichkeiten bereitet. Kaum in die Staaten zurückgekehrt, musste der Colonel sich gegenüber einer Untersuchungskommission zu den Vorwürfen äußern, er habe den Vertretern der Stadt Leinheim Zusicherungen finanzieller Art gemacht und darüber hinaus Anweisung erteilt, nichts an dem Einschussloch in der Mauer des Gündelhofs zu verändern.