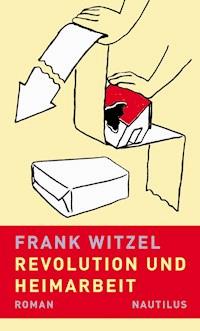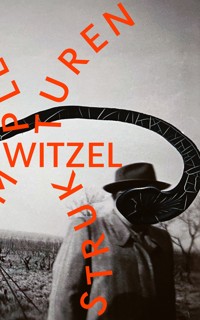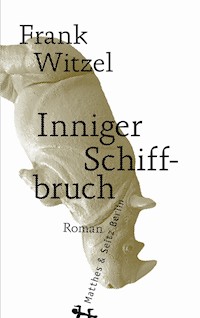
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Beschäftigung mit dem Nachlass seines verstorbenen Vaters ruft im Erzähler von Frank Witzels autobiografischem Roman Erinnerungen an eine Kindheit wach, in der das Fernsehen den Vorabend erfindet. Eine Kindheit voller Disziplinierungsmaßnahmen wie Hausarrest, Tonband- und Fernsehverbot, in der die Eltern ihrem Kind unwissentlich den Schrecken der einst selbst erlittenen Trennung als unentwegte Drohung weitergeben. Eine Kindheit, in der ein Sonntag klar strukturiert, die Kittelschürze für die Hausfrau unabdingbar und die von Erwachsenen erdachte Mondfahrt Peterchens ein Horrorszenario ist wie das der Mainzer Fastnacht. Wie sehr sich das individuell Erlebte und kollektiv Erfahrene gegenseitig durchdringen, zeigt sich, wenn Witzel gerade nicht die inszenierten Bilder aus dem Familienalbum "Unser Kind", sondern vielmehr die ausgesonderten Aufnahmen mit der Frage zur Hand nimmt, ob nicht sie es sind, die Auskunft darüber geben können, wie etwas wirklich gewesen ist. Im unentwegten Zweifel am Wahrheitsgehalt der eigenen Erinnerungen zeigt sich Frank Witzel einmal mehr als ein so nahbarer wie begnadeter Erzähler, dem es gelingt, über das Persönliche die Verfasstheit einer Nachkriegsgesellschaft in der neuen BRD zu erfassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Witzel
Inniger Schiffbruch
Roman
Und mir fiel das Ewige einund daneben die alten Jahreszeiten und diesedaseiende Zeit, die lebendige, tönende. Alsosinkt der Gedanke mir weg ins Übermaß. Untergehenin diesem Meer ist inniger Schiffbruch.
Die letzte Strophe des L’infinitovon Giacomo Leopardiin der Übersetzung von Rainer Maria Rilke
Inhalt
1. Das Rhinozeros
2. Wo das Verwünschen noch geholfen hat
3. Das Kind hinter der Portiere
4. Vier Formen der Dummheit und dreieinhalb Formen der Trauer
5. Die tote Mutter und ihr deutsches Kind (Eine Übertragung)
6. Kommunionbildchen
7. Das Pflaster
8. Vorfahren und Nachkommen
9. Andeutung, Entziehung, Isolation und Entscheidung
10. Portrait des Erstgeborenen als Blutvergießer
11. Kalender machen
12. Ein Gruß aus Solingen
13. Die Paganinigeheimnisformel
14. Des Nicht-Seins Bedingung
15. L’infinito
16. Heimsuchung (Eine Dämonologie)
17. Das unterbrochene Narrativ
18. Rückkehr zur Nestbaumhütte
1
Das Rhinozeros
Zwei Monate nach dem Tod meines Vaters hatte ich einen Traum: Aus einer erhöhten Perspektive näherte sich mein Blick durch den morgendlichen Dunst eines ersten Frühlingstages einer Siedlung mit bungalowartigen Einfamilienhäusern, wie sie Ende der sechziger Jahre modern wurden. Er streifte suchend über die Dächer und senkte sich schließlich in eine Straße, die in einem Wendehammer endete, wo er vor einem Haus mit einer großen Blauzeder im Vorgarten anhielt. Wie eine Ansichtskarte, die etwas zeigt, das einem so vertraut ist, dass es als Abbildung fremd bleiben muss, fror dieses Bild ein, während der Blick ins Innere des Hauses drang und sich dort mit meinem Körper verband, der, gerade erst aufgestanden, vom Schlafzimmer in Richtung Küche ging, wohl, um sich dort einen Tee zu machen. Bevor ich jedoch die Küche erreichte, fiel mir ein, dass ich seit Längerem versäumt hatte, nach dem Haus meiner Eltern zu sehen, das sich direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite befand und seit ihrem Tod leer stand. Ich ging zur Garderobe, zog mir einen Mantel über, nahm den Schlüssel mit den Initialen E. H. aus dem Schlüsselkasten, verließ das Haus und eilte hinüber. Bereits beim Öffnen der Tür und Eintreten in den Flur bemerkte ich, dass die Wohnung leicht überhitzt war. Ich dachte an die Kosten, die das verursachen würde, und ärgerte mich, die Heizung nicht abgedreht zu haben. Zögerlich, da mir die Umgebung völlig unbekannt zu sein schien, ging ich den Flur entlang bis zu einer Treppe, die nach oben, wahrscheinlich zum Speicher führte, jedoch nicht zu betreten war, weil die unterste Stufe direkt an der Wand ansetzte, in der auch die Geländer verankert waren. Vergeblich versuchte ich einen Zugang zu finden, wandte mich schließlich ab und ging zur Wohnzimmertür. Als ich sie öffnete, schlug mir eine noch stickigere, streng riechende Luft entgegen. Vorsichtig betrat ich den Raum, dessen Mobiliar von der Zimmermitte an die Wände geschoben war, so, als hatte man für etwas Platz schaffen wollen. Gerade war ich im Begriff, die Tür hinter mir zu schließen, als mir langsam und erschöpft ein lebensgroßes, jedoch völlig abgemagertes Rhinozeros entgegenkam. Erst in dem Moment fiel mir mit Schrecken ein, dass ich nicht nur dieses Rhinozeros, sondern auch die fünf Hunde meiner Eltern zu füttern und mit Wasser zu versorgen vergessen hatte. Keinerlei Geräusche waren zu hören und auch das Rhinozeros verharrte eigenartig still und unbeweglich vor mir, fast, als habe es nur so lange ausgeharrt, um nun vor meinen Augen zu verenden. Vorsichtig schaute ich mich im Zimmer um, da ich befürchtete, etwas Ekelerregendes, etwa eine Reihe von Kadavern, zu entdecken. Und tatsächlich entpuppte sich das, was ich aus einiger Entfernung anfänglich für Teppichvorleger gehalten hatte, im Näherkommen als ausgetrocknete Fellreste. Zu meinem großen Entsetzen befand sich an einem dieser Felle der noch lebendige Kopf eines Hundes. Ähnlich wie das Rhinozeros rührte auch er sich kaum, sah mich nur traurig an und bewegte stumm die ausgetrockneten Lefzen. In Panik rannte ich aus dem Haus und hinüber zu mir, von wo aus ich eine Freundin anrief, die mir versprach, sofort einen Veterinär zu verständigen.
Obwohl der Traum intensiv war und ich verstört aus ihm erwachte, hatte ich nicht die geringste Lust, mich weiter mit ihm zu beschäftigen. Die letzten Monate meines Wachzustandes waren anstrengend genug gewesen, und auf weitere Einblicke in den konfusen Zustand meiner Psyche konnte ich momentan gern verzichten. Es gibt Traumbilder, die etwas zusammenfassen, auf das man von allein niemals gekommen wäre, hier aber hatte ich das Gefühl, einem fremden Traum beigewohnt zu haben, einer filmischen Inszenierung, die mit billiger Effekthascherei arbeitete. Meine Eltern waren nicht mehr am Leben, das stimmte, allerdings hatten sie ihr Haus bereits zwei Jahre vor ihrem Tod verlassen und waren in ein Seniorenheim gezogen. Auch wohnte ich nicht in ihrer Nähe, schon gar nicht in derselben Straße. Am hervorstechendsten, neben der Bezeichnung Rhinozeros, die mein träumendes Ich verwandt hatte, während ich normalerweise Nashorn sagen würde, war die Erscheinung dieses Tiers, das in seiner aufdringlichen Symbolik einem billigen Ratgeber zur Deutung von Träumen entstiegen schien. Sollte es das versinnbildlichen, was ich unwissentlich vernachlässigt und damit dem Tod überantwortet hatte, das, was ich in meinem Verhältnis zu meinen Eltern bislang nicht hatte sehen wollen oder können?
Das Stück Rhinocéros von Ionesco fiel mir ein, das ich nur dem Namen nach kannte. Ich widerstand der Versuchung, nachzuschauen, von was genau es handelte, denn was könnte sich daraus schon für mich erschließen, selbst wenn mir wieder einfallen würde, doch vor vielen Jahren einer Inszenierung beigewohnt und diesen Abend in der Zwischenzeit lediglich vergessen zu haben? Als Nächstes erinnerte ich mich an eine Erzählung Bertrand Russells, in der er eine seiner ersten Begegnungen mit Wittgenstein beschreibt. »Mein deutscher Ingenieur ist, befürchte ich, ein Narr. Er vertritt die Meinung, nichts Empirisches sei erfassbar. Ich bat ihn zuzugeben, dass sich kein Rhinozeros im Raum befände, doch selbst das lehnte er ab.« Wie leicht schien es mir nach diesem Traum, zuzugeben, dass sich kein Rhinozeros im Raum befindet, verglichen mit der umgekehrten Erkenntnis seines Vorhandenseins, noch dazu im Zustand der Agonie, die man mehr oder minder selbst verschuldet hatte. Unwillkürlich drängte sich mir eine Parabel in dem Sinne »Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!« auf, doch gelang es mir nicht, diese Konstruktion auch nur ansatzweise zu durchdenken und in Worte zu fassen. Ein Zustand, der mir in meinem momentanen Alltag, und nicht nur in Bezug auf meine Träume, mittlerweile recht vertraut war.
Ich hatte relativ bald nach dem Tod meines Vaters angefangen, mir einige Dinge zu notieren, und war deshalb in einen unausgesprochenen Konflikt mit meiner Therapeutin geraten, da ich das Gefühl hatte, sie akzeptiere diesen Schreibvorgang nicht als eine angemessene Form der Trauerarbeit, und mir bereits der Begriff »Trauerarbeit« problematisch erschien, denn wenn ich etwas nicht verspürte, war es Trauer, und wenn ich auf etwas keinen Wert legte, war es zusätzliche Arbeit. Ich hatte beim Tod meiner Mutter vor zwei Jahren keine Trauer verspürt und verspürte sie auch jetzt nicht nach dem Tod meines Vaters. Ich fühlte eine Art Bedauern. Ein Bedauern, dass das Leben meiner Eltern nun unwiderruflich vorbei war. Dieses Bedauern nahm manchmal die Form einer Traurigkeit an, aber Trauer war das meines Erachtens nicht.
Nachdem ich diesen uneingestandenen Groll gegen meine Therapeutin eine Zeit lang mit mir herumgetragen hatte, nahm ich mir schließlich vor, ihn in der nächsten Stunde zur Sprache zu bringen. Genauer gesagt nahm ich mir vor, die Therapie mit der Begründung zu beenden, mein Vertrauen in unsere Beziehung sei erschüttert. Ich legte mir verschiedene Sätze zurecht, ebenso verschiedene Antworten auf die von mir erwarteten Ausflüchte und betrat an einem Mittwochvormittag Anfang Oktober die Praxis. Ich hätte etwas zu sagen, kündigte ich an, kaum, dass ich mich gesetzt hatte, um sofort und ohne eine Antwort abzuwarten hastig, allerdings nicht ganz so wie vorbereitet, hervorzustoßen, dass ich es nicht zulassen werde, einen Keil zwischen mich und mein Schreiben getrieben zu bekommen, weshalb ich die Therapie hiermit beende. Ich war über dieses eher unpassende Bild des Keils, das mir spontan gekommen war, selbst verblüfft, so als wäre das Schreiben nicht eine Tätigkeit, der ich nachging, sondern etwas mir Fremdes, wie eine andere Person, zu der ich ein wie auch immer geartetes Verhältnis unterhielt. Zudem hatte ich das, was ich mir als letzten Trumpf hatte aufbewahren wollen, nämlich die Drohung eines Therapieabbruchs, gleich zu Beginn ausgespielt und damit vertan. Meine Therapeutin fragte mich, was genau sie denn in Bezug auf mein Schreiben gesagt habe. Ich überlegte einen Moment, konnte mich aber an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern, eben nur, dass es sich dabei um keine adäquate Form der Trauerarbeit handle. Es wundere sie, sagte sie, das so ausgedrückt zu haben, da sie den Begriff »Trauerarbeit« in der Regel vermeide und auch nicht glaube, dass es bessere oder schlechtere Formen gäbe, mit Gefühlen umzugehen. Dennoch, oder gerade deshalb tue es ihr aufrichtig leid, dass ein solcher Eindruck in mir entstanden sei.
Ich war über dieses unerwartete Entgegenkommen einigermaßen erstaunt und versuchte mir die Situation noch einmal genau vor Augen zu führen: Sie hatte dort gesessen, wo sie immer saß, und ich hier, wo ich immer saß, und dann hatte ich davon gesprochen, mit ersten Aufzeichnungen zum Leben meines Vaters und meiner Eltern begonnen zu haben, worauf sie – tatsächlich nichts gesagt hatte. Sie hatte nur einen Moment gezögert und mir, so meinte ich es vor mir zu sehen, einen eigenartigen Blick zugeworfen.
Worüber ich oder sie in der verbleibenden Stunde sprachen, war mir schon bald wieder entfallen. Dachte ich daran zurück, sah ich nur das Licht vor mir, das durch das Fenster fiel, den Tisch mit dem kleinen schwarzen Wecker und einer Schachtel mit dem, was meine Eltern »Zupftücher« genannt hatten und ich wohl »Kleenex« nennen würde. Dann war da der Teppich, der Fußboden, die Wände, obwohl sich an dieser Stelle meine Erinnerung aufzulösen begann und in andere Räume hineinverlagerte, in denen ich im Laufe meines Lebens bereits gesessen hatte und die nun, wie oft in meiner Erinnerung, eine Art Urzimmer formten, und schließlich die Hand meiner Therapeutin, die sie mir wie jedes Mal nach der Stunde gab und mit der sie meine Hand einen kurzen Moment länger festgehalten hatte als sonst.
Das Schreiben, das mir zu diesem Zeitpunkt noch relativ leichtgefallen war, wurde mir in den folgenden Wochen und Monaten immer mehr zur Qual. Je dringlicher ich mir die Frage stellte, was genau eigentlich ich zu schildern vorhatte, und je weniger ich darauf eine Antwort fand, desto unfähiger wurde ich, einen genauen Plan zu entwerfen oder mich anderen Arbeiten zuzuwenden. Ohne sagen zu können, woher diese Sturheit kam, schienen gegenläufige Kräfte in mir zu wirken, da mich immer häufiger bereits am frühen Nachmittag eine bleierne Müdigkeit überfiel. Gelang es mir nicht, mich von kleinen Verpflichtungen aus dem Haus locken zu lassen, konnte ich Stunden auf dem Bett, der Couch oder dem Fußboden verbringen, ohne dabei konkret über etwas nachzudenken. Vor allem das Erinnern, das doch Grundlage meiner Arbeit hätte sein sollen, mochte sich nicht einstellen. Versuchte ich, mir die Vergangenheit bewusst vor Augen zu führen, geriet ich in einen sterilen Raum, vergleichbar einer leergeräumten Turnhalle, besser noch dem, was Anfang der siebziger Jahre in jedem größeren Dorf entstand und die Bezeichnung »Allzweckhalle« trug. Ich ging mit dem sicheren Gefühl, dass sich an diesem Ort etwas ereignet haben musste, durch diese Halle, konnte aber nicht sagen, ob man die Bewohner der Häuser am Rheinufer wegen Hochwasser evakuiert und hier untergebracht hatte, die Schulklassen meiner Volksschule sich während eines Probealarms hier aufhielten, oder ob lediglich eines der Mädchen, in das ich in meiner Schulzeit verliebt gewesen war, diesen Saal für ihre Hochzeitsfeier gemietet hatte. Vielleicht war auch nur eine der Bands hier aufgetreten, in denen ich als Jugendlicher gespielt hatte; diese Bands, die sich in der Regel nach dem ersten Auftritt aufgelöst oder zumindest umbesetzt hatten. Zeitweise gab es in unserem Umfeld sogar Mädchen, die uns bewunderten. Eine schenkte mir zum siebzehnten Geburtstag einen Gitarrengurt aus Schlangenlederimitat und eine Susy-Card in Übergröße, auf der sie mir wünschte, der »beste Bassist der Welt« zu werden, obwohl ich in der Band doch nur Bass spielte, weil es eben einer machen musste, während ich wie besessen Gitarre übte und mit einem Freund Duos von Carulli und Carcassi einstudierte, bis er sich bei einem Praktikum in einer Schreinerei Zeige- und Mittelfinger der linken Hand zur Hälfte absägte. Das aber waren alles Erinnerungen, die nur mich selbst betrafen, obwohl ich doch vorgehabt hatte, mich dem Leben meiner Eltern anzunähern.
Ich las in Roland Barthes’ kurzen Skizzen, die er in den zwei Jahren nach dem Tod seiner Mutter zu Papier gebracht hatte – es waren auch die letzten Jahre vor seinem eigenen Tod –, und versuchte mich dann wieder in das genaue Gegenteil zu vertiefen: über 1200 Seiten in enger 6-Punkt-Schrift, die Jean-Louis Baudry vierzehn Tage nach dem plötzlichen Tod seiner Frau zu schreiben begonnen hatte. Ich konnte beides nachvollziehen: immer kurz vor dem Verstummen noch ein paar Worte festhalten oder sich in eine manische Gedächtnisarbeit stürzen, um sich abzulenken. »Ich verstehe, warum in dem Werk von Frances Yates, das Marie mir geschenkt hatte, die Gedächtniskunst darin besteht, die Dinge, an die man sich erinnern will, mit bestimmten Orten zu verbinden. Da die Orte nicht mehr vorhanden sind, verliere ich die Erinnerung an Ereignisse, die mit dem Bild, das sie trugen, auch die Wirklichkeit der Gefühle verschlingen.« Traf diese Beobachtung tatsächlich zu, oder waren nicht im Gegenteil gerade die Orte noch vorhanden, eben nur in gewissem Sinne verwaist oder nicht mehr zugänglich? Und waren sie es nicht, die überhaupt die Erinnerung auslösten, mich aber in genau diesen Erinnerungen darauf hinwiesen, dass das Hochgespülte nicht nur lückenhaft und unzusammenhängend war, sondern eigenartig ungreifbar, um nicht zu sagen »banal«?
Anders als Baudry schien mir das Erinnern selbst an eine Grenze zu stoßen, mehr noch sich durch diese Grenze selbst ganz grundsätzlich infrage zu stellen. Der Gedanke, dass Literatur unter Umständen doch nur das Besondere und Ungewöhnliche beschreiben kann, während sich ihr das Alltägliche und Normale entzieht, deprimierte mich. Plötzlich sah ich mich nicht einmal mehr imstande, mit ein, zwei Sätzen in meinem Kalender zu notieren, was ich am jeweiligen Tag unternommen hatte, wie es sonst meine Angewohnheit war. Ich hätte mich dazu zwingen können, weiterhin meine Tage zusammenzufassen und auf einen Nenner zu bringen, doch allein die Vorstellung weckte in mir einen Widerstand, der sich langsam auf mein übriges Schreiben auszudehnen begann.
Passenderweise, und eigentlich war das kein Wunder nach den vielen Jahren, die ich bereits in meiner Wohnung lebte, gingen rasch hintereinander eine Reihe von Leuchtstoff- und Neonröhren kaputt, und da ich nicht wusste, ob man für sie überhaupt noch entsprechenden Ersatz bekam, und immer wieder vergaß, mich in einem Geschäft danach zu erkundigen, musste ich mich für einige Wochen nach Anbruch der Dunkelheit vom Schein der Schreibtischlampe zu dem der Nachttischlampe durch meine Wohnung tasten. Ein Zustand, dessen Symbolhaftigkeit mir anfänglich gar nicht bewusst wurde, da ich ihm zunächst keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, um ihn dann in seiner ausgestellten Lebensuntüchtigkeit, ganz so als hätte ich meine Wohnung zu einer Bühne umgestaltet, in der ich meine Unzulänglichkeiten zur Schau trug, als grotesk und peinlich zu empfinden.
Ich hatte immer noch keine Ahnung, warum in meinem Traum ein Rhinozeros aufgetaucht war und warum meine Eltern fünf Hunde hätten besitzen sollen, obwohl sie ihr ganzes Leben kein einziges Haustier gehabt hatten. Im Sommer, als ich vier war, kam regelmäßig eine Katze zu uns in den Garten, der wir etwas Milch in einer Schale hinstellten. Weil sie nicht ins Haus durfte, setzte ich mich neben sie auf die Stufe vor der Haustür und streichelte sie. Meine Mutter war damals schwanger. Im August, kurz vor der Geburt meines Bruders, sagte sie, die Katze dürfe nicht mehr kommen, weil Katzen sich Neugeborenen auf das Gesicht setzen und sie ersticken. Tatsächlich sah ich die Katze von diesem Tag an nicht wieder. Ich hatte sie nicht verjagt und auch nicht gesehen, dass meine Mutter sie verjagt hätte. Wir hatten allerdings auch keine Schale mit Milch mehr in den Garten gestellt.
Einige Wochen nach der Geburt meines Bruders machten wir einen ersten Familienspaziergang, bei dem er in meinem alten Kinderwagen aus geflochtenem Peddigrohr gefahren wurde. Dabei kamen wir über die Autobahnbrücke, die nicht weit hinter unserem Haus lag. Ich ging wie immer nah am Geländer, um nach unten zu schauen, wo ich diesmal zu meinem Schrecken eine tote Katze auf dem Seitenstreifen liegen sah. Ich konnte nicht erkennen, ob es sich um die Katze handelte, die immer zu uns gekommen war, wandte mich schnell ab und verschwieg meinen Eltern, was ich gesehen hatte. Wollte ich keine Bestätigung für meine Vermutung oder verdächtigte ich sie insgeheim, selbst etwas mit dem Tod der Katze zu tun zu haben? Dass es nicht ratsam scheint, als Kind auf Geheimnisse zu stoßen, die Erwachsene hatten verbergen wollen, ahnte ich schon damals, nachdem ich gerade die Schwangerschaft meiner Mutter, ohne entsprechende Fragen zu stellen, verfolgt hatte. In den nächsten Jahren würde ich die Fähigkeit, heikle Themen bereits vorzeitig erkennen und umgehen zu können, noch weiter verfeinern, es sei denn, sie traten so überraschend auf wie an einem Vormittag während der Osterferien einige Jahre später – ich war bereits auf dem Gymnasium, mein Bruder gerade eingeschult –, als ich nach einem Familieneinkauf in der Stadt, während wir, noch in Jacken und Mänteln, die Tüten in der Küche ablegten, etwas Blutiges auf dem Boden entdeckte, das ähnlich wie eine kleine, etwas längliche, geschälte Tomate aussah, und unwillkürlich fragte, was das denn sei, um, kaum dass ich den Satz beendet hatte, zusammen mit meinem Bruder durch die hastig zugezogene Küchentür hinaus in die Diele geschoben zu werden. Anders als bei der Katze war hier nicht die Entdeckung das Erschreckende, sondern die Reaktion meiner Mutter, die mir erneut vor Augen führte, dass die Welt voller Fallstricke war, die ich trotz größter Aufmerksamkeit oft erst dann erkannte, nachdem ich bereits über sie gestolpert war. Hinter einem Geheimnis schien sich immer eine Lücke in der Wahrnehmung von Realität aufzutun, die das, was Wirklichkeit generell war, infrage stellte, weshalb sie verheimlicht und verschwiegen werden musste. Dabei war mir unklar, ob die Erwachsenen diese »Realitätslücken« nur vor uns Kindern verbargen, während sie selbst damit umzugehen verstanden, oder ob sie sich auch selbst von ihnen bedroht fühlten. Was die Katze anging, so schien der Fall recht eindeutig: Da meine Mutter ihr eine instinkthafte Tötungsabsicht unterstellte, war es nur natürlich, sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln von ihrem Neugeborenen fernzuhalten. Dass in dem Rhinozerostraum keine Katzen vorgekommen waren, wies auf ihr Fehlen und damit ihren Tod hin: Das Verdrängte und Vergessene war in unübersehbarer Größe wiedererstanden, allerdings geschwächt und dem Tod geweiht, eher Gespenst als Symbol. Ich meinte mich zu erinnern, dass eine solche Geschichte – Geburt eines Geschwisterteils fällt mit dem Verlust eines geliebten Spielzeugs, Spielkameraden oder eben Tiers zusammen – ein gängiger Topos aus der Legenden- und Sagenwelt war, wurde aber zu sehr von einer anderen Erinnerung abgelenkt, um dieser Spur weiter nachzugehen.
Diese andere Erinnerung lässt sich in etwa so beschreiben: Sechseinhalb Jahre nach dem geschilderten Spaziergang machten meine Eltern am Samstag, den 18. Februar 1967, eine Woche nach Fastnacht, mit mir und meinem Bruder einen Ausflug in den Taunus. Wir fuhren in unserem dunkelblauen VW durch Wiesbaden und nahmen am Alten Friedhof die Platter Straße, um nach Hahn zu fahren, wo meine Eltern nach einigem Suchen in Richtung einer Neubausiedlung abbogen und über noch unbefestigte Straßen zwischen Bauwagen, Schutthaufen und Gerätschaften bis zu einem Bungalow fuhren, der in einer unbegrünten Vertiefung lag, vor der sie anhielten. Das sei das neue Haus von Gregers, sagte mein Vater. Sie würden kurz hineingehen und Guten Tag sagen. Wir allerdings sollten im Auto warten, weil Gregers in Bezug auf Kinder »komisch« seien. Kaum waren meine Eltern mit einer in Zellophan eingewickelten Flasche Riesling ausgestiegen und hinter einem der Sandhügel verschwunden, machte ich das Autoradio an und hörte zum ersten Mal Ruby Tuesday.
Herr Greger war Anfang fünfzig und spielte im Orchester meines Vaters Geige. Seine etwa zehn Jahre jüngere Frau fuhr ihn jeden Donnerstag zur Probe, die im Gemeindehaus der Kirche stattfand, in der mein Vater Organist war und auf deren Grundstück wir das ehemalige Haus des Küsters bewohnten. Frau Greger war berufstätig und brachte meinem Bruder und mir bei jedem Besuch eine bestimmte Sorte Pfefferminzkaubonbons aus einem Süßwarenladen der Innenstadt mit, in dessen Nähe sie arbeitete. Immer nachdem sie ihren Mantel an die Garderobe gehängt hatte, wir die Bonbons in Empfang genommen, uns bedankt und Gute Nacht gesagt hatten, gingen meine Mutter und sie in das Fernsehzimmer unter dem Dach, wo sie sich unterhielten, ein Glas Wein tranken und alle vierzehn Tage um 21 Uhr Das Kriminalmuseum im ZDF sahen. Obwohl die von Martin Böttcher komponierte Titelmelodie ähnlich harmlos war wie auch seine Musik für die Pater-Brown-Filme, bekam meine Mutter, wie sie später sagte, schon nach den ersten Takten eine Gänsehaut. Allein der Vorspann dauerte ganze drei Minuten, in denen die Kamera durch lange, vom Publikumsverkehr belebte Gänge einer Polizeiwache fuhr, um zu einer Asservatenkammer zu gelangen, dem sogenannten Kriminalmuseum, das »selbstverständlich für die Öffentlichkeit gesperrt« war und allein der »Schulung und Weiterbildung des Polizei- und Justiznachwuchses« diente. Anhand eines der hier in Glasvitrinen gelagerten Gegenstände wurde dann der jeweilige Fall aufgerollt.
Die Gänsehaut meiner Mutter bezog sich auf den Umstand, dass man gleich in der ersten Folge des Kriminalmuseums zwei Körper präsentiert bekam, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen waren und deren tödliche Kopfverletzungen deutlich gezeigt wurden. Die Harmlosigkeit der Titelmelodie war also nur scheinbar gewählt, um den Schrecken einzugrenzen und den Zuschauer zu beruhigen. Tatsächlich konnte die Harmlosigkeit das Unheimliche noch steigern, weil sie sich mit dem Grauen verband, ohne dieses Grauen selbst auszudrücken. Die liebliche Melodie schien keinerlei Anlass zu geben, sich zu ängstigen, womit sie die Angst jedoch nicht besänftigte, sondern noch vergrößerte, da man das ausgelöste Gefühl nicht benennen konnte und dadurch mit seinem Unbehagen allein gelassen war. Es war eine Form der kindlichen Angst, die von den Erwachsenen allgemein als grundlos angesehen wird, denn selbst wenn sie das Kind trösten, so doch immer mit dem Hinweis, seine Befürchtungen seien unbegründet. Es ist jedoch Grundprinzip der Angst und Teil ihres Schreckens, dem Geängstigten ein Gefühl von Isolation zu vermitteln. Als Erwachsener, der aus einem Alptraum erwacht, so wie ich aus dem Rhinozerostraum, spielt man beide Rollen, die des Geängstigten und dessen, der diese Angst nicht versteht. Weil man kein Mitgefühl mehr mit sich hat, scheint man den Trost der Eltern nicht mehr zu benötigen und ist erwachsen geworden.
Es sollte noch über fünfundzwanzig Jahre dauern, bis sich meine Eltern ein eigenes Haus kaufen konnten. Meine Mutter sagte mir damals am Telefon, sie hätten ihr »Traumhaus« gefunden. Es war das Haus einer verstorbenen Opernsängerin, und meine Eltern übernahmen Teile der Inneneinrichtung wie Wohnzimmermöbel und eine Reihe gerahmter Kostümzeichnungen von der Uraufführung des Rosenkavaliers, die neben der Treppe zum Souterrain hingen. In dem zweistöckigen Haus auf dem Grundstück der Kirche, in dem sie fünfunddreißig Jahre zur Miete gewohnt hatten und in dem ich und mein Bruder aufgewachsen waren, ließen sie das meiste zurück. Meine Eltern waren damals ungefähr so alt wie ich heute.
Obwohl mein Vater Orchester- und Chorleiter war, konnten sich meine Eltern im Gegensatz zu Gregers und anderen, meist älteren Orchestermitgliedern, die in ihrer Freizeit Geige spielten und ansonsten gut dotierten Stellungen nachgingen, erst so spät ein eigenes Haus leisten, weil mein Vater finanziell wesentlich schlechter gestellt war als seine Musiker. Mir blieb lange schleierhaft, was genau meine Eltern an ihrem Traumhaus anzog, das eine gewisse Kälte ausstrahlte und mir bis zu ihrem Tod fremd blieb. Ohne dass ich im Rhinozerostraum eine Verbindung zum Haus Gregers gezogen hätte, das ich nur das eine Mal aus einiger Entfernung durch das freigewischte Seitenfenster unseres VWs gesehen hatte, schien sich mir jetzt die Bedeutung des Ganzen zu offenbaren: Ein Vierteljahrhundert hatten meine Eltern nach etwas Vergleichbarem gesucht, das sie schließlich, fern der Neubausiedlung des kleinen Ortes im Taunus, in einer recht passablen Lage in Wiesbaden gefunden hatten, ein Haus, das die etwas in die Jahre gekommene Modernität der Sechziger ausstrahlte und dessen Luxus, so wie damals üblich, nach außen hin nicht sichtbar war.
War der Wunsch, der sich für meine Eltern recht spät erfüllte, unter Umständen also gar nicht ihr eigener, sodass sie ihn, nachdem er verwirklicht worden war, endlich hinter sich hätten lassen können, wie wenn man aus einem der vielen Träume erwacht, in denen man sich in einer fremden Umgebung befindet und einer fremden Logik folgend unhinterfragt Dinge tut, die man im Wachzustand niemals tun würde? Konnte es umgekehrt tatsächlich zur Erfüllung einer wirklichen Sehnsucht beitragen, in fremden Möbeln zu sitzen, dem zu tief hängenden Kronleuchter auszuweichen und abends in das düstere Souterrain hinabzusteigen, wo das Fernsehzimmer aus dem alten Haus recht und schlecht nachgestellt worden war, mit der für die dortige Schräge eigens eingepassten Schrankwand, die nun etwas zu klein und gestutzt den neuen Apparat, der im Zuge des Hauswechsels angeschafft worden war, und einen Teil der wenigen Gegenstände und Bücher beherbergte, die meine Eltern in ihr neues Leben mitgenommen hatten? Warum überhaupt hatten sie so viel in dem alten Haus zurückgelassen, obwohl sie doch den Großteil ihres Lebens einigermaßen zufrieden dort verbracht hatten? Handelte es sich um ein symbolisches Opfer, mit dem sie das Neue zusätzlich zur Kaufsumme für sich erwerben mussten? Oder löste die Vorstellung, endlich etwas Eigenes zu haben, in ihnen ein Gefühl der Überforderung, vielleicht sogar der Panik aus, sodass sie das Eigene unwillkürlich als uneigen behandelten, um es überhaupt ertragen zu können?
Mir war dieses Gefühl nicht fremd, und es schien mir mittlerweile sogar recht wahrscheinlich, dass ich es von meinen Eltern übernommen und in eigene unreflektierte Handlungen überführt hatte. So benutzte ich zum Beispiel nicht die schöne Teeschale aus dunkelgrüner Keramik, um aus ihr meinen nachmittäglichen Tee zu trinken, sondern das, was man in Stehcafés wohl einen Pott nennt, eine ausgesprochen hässliche hellblaue Henkeltasse mit der Aufschrift »Nordwest Radio«, die ich einmal auf einem Literaturfestival in Bremen geschenkt bekommen hatte. Ebenso scheute ich mich, die geschmackvollen Notizbücher zu verwenden, die ich mir regelmäßig kaufte oder geschenkt bekam, und benutzte stattdessen billige Kladden. Bei den Notizbüchern konnte ich mein Verhalten nachvollziehen, weil das Besondere der Aufmachung dem Wesen der Notiz direkt entgegenstand; weshalb ich aber jeden Tag aus einer Tasse trank, die noch nicht einmal durch die jahrelange Benutzung eine gefühlsmäßige Bindung in mir hervorgerufen hatte, blieb mir ein Rätsel. Oder lag der Grund schlicht und einfach darin, dass mir diese Tasse die Freiheit ließ, nicht auch noch beim Teetrinken etwas empfinden zu müssen, was über den Geschmack des Tees hinausging? Wäre es folglich ein Zeichen von Reifung, wenn ich die »schöne« Teeschale benutzen könnte, ohne mich ihr verpflichtet zu fühlen? Wahrscheinlich gehört schon etwas dazu, mit Schönheit umgehen zu können, ohne sie dabei ignorieren oder idealisieren zu müssen. Eine Fertigkeit, die von Generation zu Generation weitergereicht wird und nicht ohne Weiteres zu erlernen ist, weshalb sich dieses Wissen um komplizierte Rituale und den Umgang mit Erlesenem, das, was man gemeinhin Fingerspitzengefühl nennt, für die Bürger der neuen Bundesrepublik, wie meine Eltern, immer noch im Adel verkörperte, den sie nach außen hin als »dekadent« und aus der Zeit gefallen abtaten, während sie ihn heimlich weiterhin bewunderten.
Ein Beispiel dafür war Hubertus von Meyerinck, der in der ersten Folge des Kriminalmuseums in unglaublicher Perfektion einen Rittmeister a. D. verkörperte und zum Ausspielen feiner Nuancierungen auch die nötige Zeit gelassen bekam. Seiner Rolle war nicht nur die Unklarheit über ein womöglich aktives, zumindest jedoch passives Mitwirken an zwei Weltkriegen eingeschrieben, sondern auch ein gewisser, wenn auch gemäßigter Abstieg des Adels im Deutschland der Nachkriegszeit, der ihn dazu zwang, einige Zimmer seiner recht großzügigen Wohnung unterzuvermieten. Allein wie er sich für das Jahrestreffen »überlebender Kameraden« vom Kavallerieregiment Großherzog Ernst Ferdinand an der Garderobe fertig machte und mit einer Kleiderbürste seinen Homburg striegelte, während er seiner Mieterin von der »kolossalen« Vorfreude erzählte, die alten Veteranen wiederzusehen, besonders die Herren, »die heute wieder Uniform tragen. Zwei von ihnen sind bereits wieder General – bei der Panzerwaffe, Kavallerie ist ja heute nicht mehr gefragt, leider«, war mit einer solchen Präzision dargestellt, dass man dahinter unwillkürlich von Meyerincks eigene Erfahrung vermutete. Angeblich hatte dieser Rittmeister vor vierzig Jahren, also 1923, einen Reitunfall, der seine »ganz große Karriere« beendet hatte, da er sonst auch selbst längst General geworden wäre. Die sexuelle Orientierung dieses Rittmeisters, die sich jederzeit hinter reiner Kameradschaft hätte verbergen können, deutete von Meyerinck dezent an, etwa, wenn er auf die Frage, ob der Abend mit Damen stattfinde, antwortete: »Nein, mit Tradition.« Bereits der Umstand, dass überhaupt eine »Dame« bei ihm logierte, schien ihm bei der Befragung durch den Kommissar unangenehm, während er die Herren besser zu kennen schien: »Der eine heißt Kunze-Punell, der ist bei der Damenkonfektion tätig. Der andere ist Toby Bromberg, Herrenfriseur, aber der macht gerade Ferien in Capri. Kennen Sie die Blaue Grotte?« Als er sich im Laufe des Gesprächs vergisst und in Gegenwart der gerade frisch aufgefundenen Leiche ein Couplet ansingt, weiß er sich sofort in aller Form für »diese kleine Entgleisung« zu entschuldigen. Meyerinck war tatsächlich homosexuell, und Billy Wilder erzählte, er sei in der Kristallnacht den Ku’damm entlanggelaufen und habe gerufen: »Wer von Ihnen jüdisch ist, der folge mir«, um in den folgenden Jahren mehrere Juden in seiner Wohnung zu verstecken.
In der Welt meiner Eltern gab es jedoch weder den Adel noch das Militär, weder Homosexuelle noch Juden oder Schwarze. Mitglieder dieser Gruppierungen waren aus dem reinweiß christlich entnazifizierten Neustart der Bundesrepublik in letzte Sprachfloskeln hinein verdrängt, wo jemand »vom anderen Ufer« war, der »Jud’« für etwas »nix gab« und »drei Neger im Tunnel« die vollkommene Schwärze der zurückgelassenen Vergangenheit symbolisierten. Der Adlige war zum Graf Bobby degradiert, ähnlich wie das Militär, das in der Reader’s Digest Rubrik »Humor in Uniform« in seiner Tappigkeit zur Schau gestellt wurde. Die Verheißung des Neuen schien in einer gut ausgepolsterten Mittelmäßigkeit zu liegen, in der Reichtum sich eher zufällig ergab, etwa wenn der heruntergekommene Alkoholiker nach Jahren alle leeren Flaschen zurückbrachte, um sich von dem Pfand eine Villa zu kaufen. Sicherheit aber konnte sich nur innerhalb einer Gleichheit entwickeln, da man sonst die Beschriftungen der Handtücher im Badezimmer missverstand und das G für die Abkürzung von Gesicht und das A für den entgegengesetzten Körperteil hielt, obwohl es sich tatsächlich um »Gesäß« und »Antlitz« handelte. Die Aussicht, vom Tellerwäscher zum Millionär zu gelangen, war keine Vorstellung, die in der neuen Republik Fuß fassen konnte, da das eine ebenso verdächtig war wie das andere. Stattdessen herrschte eine unhinterfragte Normalität, die man jederzeit im Inneren des kleinen Hauses hätte abrufen können und zu der auch gehörte, dass meine Mutter bei der Hausarbeit eine Kittelschürze trug, in der sie sich natürlich niemals hätte fotografieren lassen, mit der sie aber unerwartete Besucher oder Lieferanten empfing, weil es Kennzeichen der Arbeit war, die schließlich adelte, und es umgekehrt verdächtig gewesen wäre, sie an einem Werktagvormittag daheim im Kostüm anzutreffen. So sehr war dieses Kleidungsstück dem Praktischen untergeordnet, dass mir selbst als Pubertierender bei den Müttern von Klassenkameraden, die tagsüber sämtlich so gekleidet waren, entging, wie kurz und nachlässig geknöpft diese Kittel in der Regel waren und wie wenig die Frauen an warmen Tagen darunter trugen, sodass es mir erst neulich bei einer Folge Vorsicht, Falle! aus dieser Zeit auffiel, als bei einem sogenannten »Experiment mit versteckter Kamera« Hausfrauen in eben diesen Kitteln aus ihren Einfamilienhäusern geklingelt wurden, um sich gegen Vorkasse Ansichten ihres Anwesens aufschwatzen zu lassen, die von einem Fotografen nach Überreichen einer falsch adressierten Quittung mit einer Kamera ohne Film aufgenommen wurden. Und wahrscheinlich besteht Verdrängung genau darin, selbst das Offensichtliche nicht wahrnehmen zu können, weil es entsprechend harmlos konnotiert ist.
Einige Tage nach dem Traum fiel mir das zeitweilig vergessene Rhinozeros wieder ein. Genauer gesagt erinnerte ich mich an einen Witz aus Kindertagen. Einem Mann wird eine Stelle genannt, an der ein Schatz vergraben sei, den er aber nur finden könne, wenn er beim Graben nicht an ein Nashorn denke. Die Pointe bestand darin, dass der Mann den Ort aufsucht, anfängt zu graben und immer wieder vor sich hinsagt: »Ich darf nicht an ein Nashorn denken! Ich darf nicht an ein Nashorn denken!« Was war es, an das ich nicht denken durfte, und welchen Schatz galt es aus meinem Unbewussten zu heben? Und musste ich, um ihn finden zu können, das Rhinozeros nun vergessen oder erinnern?
Erneut verbrachte ich die Tage damit, mich an den Schreibtisch und zum Schreiben zu zwingen. Ich wollte möglichst rasch zu einer Entscheidung kommen und entweder den Text aufgeben, um mich mit etwas anderem beschäftigen zu können, oder einen Zugang finden, der mir interessant genug erschien, um den unzusammenhängenden Spuren meiner Familiengeschichte weiter zu folgen. An einem Abend, ich war vom Nichtschreiben erschöpft, stellte sich mit einem Mal zu dem Begriff, der sich mittlerweile von Rhinozeros zu Nashorn verschoben hatte, ein weiteres Bild zu dem des abgemagert dahinscheidenden Tiers aus meinem Traum ein. Es war das eines recht kolossalen Nilpferds, genauer gesagt das Foto des Nilpferds Rose aus dem Zoo im Central Park, das auf der Postkarte zu sehen war, die Adorno am 31. Mai 1939 aus New York an seine Eltern geschickt hatte, die kurz zuvor nach ihrer Flucht aus Deutschland in Havanna angekommen und dort in der Calle 27 de Noviembre untergekommen waren.
Die Straße des 27. November erinnerte an einen Vorfall aus der Kolonialgeschichte Kubas. Gonzalo Castañón war ein in Havanna stationierter Spanier, der als Herausgeber der Zeitung La Voz de Cuba während des Zehnjährigen Krieges gegen die Mambises, die Soldaten der kubanischen Befreiungsarmee, polemisierte und sie als Banditen und ihre Frauen als Huren bezeichnete. Der im nordamerikanischen Key West lebende Redakteur der Zeitung El Republicano, Nito Reyes, forderte darauf hin Castañón zum Duell. Castañón willigte ein und reiste zusammen mit einem Arzt und zwei Sekundanten auf die Insel vor Florida, wo man vereinbarte, einen Schusswechsel nach »korsischer Manier« auszuführen, was bedeutete, dass man sich an einem abgelegenen Ort traf und jeder der Duellanten in seiner Rocktasche einen Abschiedsbrief bei sich führte, in dem er erklärte, Selbstmord begangen zu haben. Doch sollte es dazu nicht mehr kommen, da Castañón, kaum hatte er die Insel betreten, in die Zeitungsredaktion des Republicano stürmte, erneut Nito Reyes und die Mambises beleidigte und seine Beleidigungen mit einigen Handgreiflichkeiten unterstrich, sodass man ihn verhaftete und erst nach einer Zahlung von 200 Dollar wieder auf freien Fuß setzte. Er verschanzte sich darauf hin in seinem Hotel und wartete auf ein Schiff, das ihn nach Kuba zurückbringen würde.
Als der Freiheitskämpfer Mateo Orozco ihn in diesem Hotel aufsucht, kommt es zu einem Schusswechsel, bei dem Castañón, von fünf Kugeln getroffen, stirbt. Seine Leiche wird darauf hin in einem mit Eis gefüllten Sarg nach Kuba überführt, wo er ein Staatsbegräbnis erhält. Anderthalb Jahre später besucht ein Medizinprofessor mit seinen Studenten jenen Friedhof, um in dessen Krematorium zu Lehrzwecken Leichen zu sezieren. Am anderen Tag entdeckt man eingeritzt in die Glasvitrine an Castañóns Grab den Satz: »Gonzalo Castañón, auf fremdem Boden gestorben für die Sünden des niederträchtigen Spaniens«. In einem eilig ausgeführten Prozess werden die meisten der vierzig Studenten zu Gefängnisstrafen, acht von ihnen jedoch zum Tode verurteilt und am 27. November 1871 durch Erschießung hingerichtet. Der 27. November 1954 war der Hochzeitstag meiner Eltern. Der 27. November 1955 der Tag, an dem ich getauft wurde.
Obwohl mir von vornherein klar war, dass, ähnlich wie das Rhinozeros aus meinem Traum, mehr noch die Adresse von Adornos Eltern ohne Bedeutung für die Geschichte meiner Familie war, verbrachte ich einen ganzen Nachmittag damit, den Hintergrund des Straßennamens aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen. War ich im Begriff, mich in eine fiktive Welt aus Witzen der Fünfziger, Fernsehsendungen der Sechziger und historisch und geographisch entlegenen Ereignissen zu flüchten, um mich von den Zweifeln abzulenken, die sich beinahe unmittelbar einstellten, sobald ich mich der Geschichte meiner Familie zuwandte? Und erfüllte sich in den entrückten Straßen und Wohnungen und den auf diesen Straßen umhergehenden und in diesen Wohnungen lebenden Menschen eine falsche Sehnsucht und mit dieser falschen Sehnsucht gleichzeitig ein gewisser Trotz, selbst aus dem Entlegendsten etwas ableiten zu können, irgendein Detail, das ich längst vergessen hatte und das mir in seinem Aufscheinen die eigene Vergangenheit erschließen würde? Oder war ich durch mein stures Festhalten an meiner bislang recht unergiebigen Beschäftigung in eine leichte Form der Paranoia verfallen, in der mir schlicht und einfach alles mit der eigenen Biographie verknüpft erschien?
Die Kosenamen, mit denen Adorno seine Eltern und vor allem seine Mutter in seinen Briefen bedenkt, sind gemessen an heutigen Umgangsformen schwer erträglich. Dass sich ein vierzigjähriger Denker im Exil als »Nilpferdkönig Archibald« oder »Archibald Stumpfnase Kant von Bauchschleifer« bezeichnet, seine Frau, Gretel, als »königliche Gemahlin Giraffe Gazelle« und seine Mutter als »Wundernilstute«, je nach Stimmung erweitert zu »Marimumba, meine Stutensau«, verweist auf eine derart vor-ödipale Naivität, dass man als Außenstehender nur ungern daran teilhaben möchte, besonders wenn die eigene Ehefrau sich vor den Eltern selbst als »Giraffe Gazelle im Negligé« präsentiert oder Adorno um Entschuldigung für einen ausgebliebenen Brief mit den Worten bittet: »Ich bin ganz klein in meinem Schuldbewußtsein und krieche um Dich herum und schnuppere in der Hoffnung von Deinen unbeschreiblich großen Nüstern wieder beschnuppert zu werden.« Handelt es sich hier um einen anderen Jargon der Eigentlichkeit? Oder wie Adorno selbst sagen würde: »Den Rückfall der auferstandenen Metaphysik hinter die Dialektik verbucht der Jargon als Weg zu den Müttern.« Mehr noch scheint es sich um eine Erlösungsmetaphysik zu handeln, aus der eine Utopie entsteht, »die einmal von der Liebe der Mutter zehrte«.
Im Sommer 1960, als die Katze noch da und mein Bruder noch nicht auf der Welt war, machten meine Mutter und ich mittwochnachmittags, wenn der Kindergarten geschlossen hatte, regelmäßig einen Spaziergang und besuchten meine Tante. Um mir den langweiligen Fußweg zu verkürzen, spielte meine Mutter mit mir ein Spiel, bei dem eine Frau Okapi zu Besuch kommt und durch die verschiedenen Türen einer Wohnung geht, die ich mir in den Ritzen des Gehwegs zu imaginieren hatte. Gerade nämlich hatte die Okapi-Stute Safari im Frankfurter Zoo das erste in Deutschland, also in Gefangenschaft, geborene Okapi zur Welt gebracht, das nach einem Gebirgszug seiner Heimat Kiwu getauft worden war.
Ich hatte keine Kosenamen für meine Eltern. Und sie auch nicht für mich. Mein Bruder und ich nannten meine Mutter, als wir auf die Pubertät zugingen, zeitweilig aus Spaß Macocha, was Stiefmutter auf Polnisch bedeutet. Die Bezeichnung entstand wohl aus dem Gefühl, das viele Kinder in ihrer Kindheit oder Jugend haben, wenn ihnen die verwandtschaftliche Zugehörigkeit zu den Eltern zweifelhaft erscheint. Während einige diese Empfindung ausbauen und sich einen eigenen Stammbaum konstruieren, der ihrer verkannten Besonderheit Ausdruck verleihen soll, durchlaufen die meisten diese Phase des Übergangs ohne bleibenden Realitätsverlust. Ich erinnerte mich an einen Klassenkameraden, der alles, was seine Mutter kochte, ungenießbar fand und behauptete, das sei schon immer so gewesen. Er hatte in seinem Zimmer eine Doppelkochplatte, auf der er sich selbst sein Essen zubereitete, was ich gleichermaßen bewundernswert und beängstigend fand, weil ich mich an die in der Regel ungenießbaren Speisen erinnerte, die wir uns während der Zeltlager bei den Pfadfindern kochten. Eigenartig war allerdings, dass wir das Wort Macocha von niemand anderem als unserer Mutter beigebracht bekommen hatten können. Nur, was hatte meine Mutter veranlasst, sich uns gegenüber als Stiefmutter zu bezeichnen? Waren es Andeutungen von unserer Seite gewesen, die sie lediglich aufgegriffen und in eine Art Scherz umgelenkt hatte, oder drückte sich in der Bezeichnung weniger unser Gefühl der Entfremdung aus als vielmehr ihre Befürchtung, keine »richtige« Mutter zu sein? Durch den uns fremden Begriff erhielten wir die Möglichkeit, ein Gefühl in Worte zu fassen, das uns sonst verborgen geblieben wäre, wodurch wir vorübergehend eine Beziehung zu unserer Mutter entwickelten, in der die Bezeichnung »Stiefmutter« die Funktion eines Kosenamens erhielt, den wir ohne Hemmungen verwenden konnten, gerade weil er, verschlüsselt in eine andere Sprache, das Gegenteil aussagte.
Eine gewisse Melancholie hatte mein Leben schon immer begleitet. In diesen Wochen wurde ich jedoch von Empfindungen heimgesucht, die ich nicht richtig einordnen konnte. Manchmal entwickelten sich daraus konkrete Bilder, etwa ein kleiner Zoo aus billigem, braunen Plastik, dessen einzelne Teile man in Wundertüten kaufen konnte, um sich ein Gehege aufzubauen, das eher einem Zirkus ähnelte. Das unscharfe Bild dieser Plastiktiger und -löwen, die in sich versunken hinter den nach innen gebogenen dürren Gittern standen, die sie leicht mit einem Tatzenschlag hätten umstoßen können, und mit leerem Blick in Richtung Teppichrand starrten, rief ein beinahe fiebriges Gefühl in mir hervor, weil ich mich fragte, warum mir dieses Gehege in den letzten Jahrzehnten nie in den Sinn gekommen war, während ich mich doch beständig an dieses oder jenes Spielzeug erinnert fühlte, mit dem ich viel weniger Zeit zugebracht hatte. War ich erneut auf etwas gestoßen, dessen einzige Bedeutung darin lag, dass ich ihm keinen anderen Wert außer dem des momentanen Gebrauchs beigemessen hatte? Eines der wenigen Dinge, an die ich mich nicht mit Gefühlen gebunden und die ich nicht als Stellvertreter eines metaphysischen »Urdings an sich« angesehen hatte, um es aus einer entsprechenden Distanz zu bewundern und wenn überhaupt nur vorsichtig, mit Glacéhandschuhen, wie man sagte, anzufassen und mit ihm zu spielen?
»Kaum bespielt« heißt eine geläufige Beschreibung von gebrauchtem Spielzeug, aber war es denn tatsächlich so, dass ich als Kind das Spielzeug wie ein Instrument benutzt hatte, um aus ihm die Welt meiner Vorstellungen hervorzulocken, oder war ich nicht oft vor den Dingen in eine Art Tagtraum verfallen, den sie in mir auslösten, und zwar umso intensiver, je weniger ich sie verwendete und in mein Spiel einbaute? Ich hatte das vergessen, was ich benutzt hatte, um tatsächlich zu spielen, mich zu erfahren und zu vergnügen, während vor allem das in meiner Erinnerung zurückgeblieben war, was ich bewundert hatte und zu dem auch Spielsachen gehörten, die ich mir immer gewünscht, aber nie bekommen hatte.
Es gab noch eine weitere Art von Spielsachen, die weder der Gruppe des Gebrauchs noch der der Bewunderung zugeordnet werden konnten, sondern einer dritten Kategorie, die man »Stellvertreter-Spielzeug« nennen könnte. »Stellvertreter-Spielzeug« war Spielzeug, das man geschenkt bekam, weil in erster Linie die Eltern etwas mit ihm verbanden. Bei der elektrischen Eisenbahn meines Vaters, die zu Weihnachten aufgebaut wurde und für die ich entweder zu klein oder zu groß war, lag die Sache relativ einfach: Es war sein Spielzeug, an dem mein Bruder und ich in kontrolliertem Maße teilhaben durften. Diese Situation war mir nicht unbekannt, denn sie bestand auch bei Freunden, die ein besonderes Spielzeug besaßen, das sie nur ungern aus der Hand gaben. Bei der elektrischen Eisenbahn meines Vaters wurde das Ganze allerdings durch eine Form des »double bind« verkompliziert, da er immer wieder betonte, es handele sich dabei um »unsere« Eisenbahn. Kamen Gäste, so mussten wir unsere Eisenbahn vorführen, was im Wesentlichen hieß, in Richtung des großen Brettes mit den Schienen, Bergen und Tunnels neben dem Weihnachtsbaum zu gehen und zu warten, dass mein Vater die Züge aufsetzte und den Trafo bediente. Tatsächlich hatte ich für die Eisenbahn, die lediglich langsam im Kreis fuhr, nicht viel übrig. Von den Waggons mochte ich nur den Speisewagen, weil in ihm winzige Paare und Familien an Tischen saßen und aßen, und die kleinen Fallerhäuschen, die eine Geborgenheit herbeiführten, wenn ich mich in sie hineinimaginierte.
Noch komplexer und deshalb für mich als Kind nicht zu durchschauen war das »Stellvertreter-Spielzeug« meiner Mutter, eine Kasperlefigur in Form eines Indianerhäuptlings, dessen Gesicht nicht aus Gummi bestand wie bei unseren anderen Figuren, sondern aus realistisch bearbeitetem Filz. Dieser Häuptling trug ein wertvoll besticktes Gewand, vor allem aber einen Kopfschmuck aus »echten« Federn, weshalb er in einer durchsichtigen Plastikhülle aufbewahrt werden musste. Das »double bind« meiner Mutter bestand darin, dass er einerseits wegen seines Federschmucks besonders geschont, andererseits in den grünen Stoffsack gesteckt werden musste, in den nach dem Spiel auch alle anderen Figuren wahllos hineingestopft wurden. Viel lieber hätte ich ihn aussortiert und im Wohnzimmer auf die Anrichte gesetzt, das aber wiederum ging nicht, weil es ja mein Häuptling war. Dieser Häuptling wurde zu einer ungeheuren Belastung, da er aus vielerlei Gründen nicht in das Spiel zu integrieren war. Obwohl ich Indianer über alles liebte und ein Camp und entsprechende Figuren besaß, mit denen ich stundenlang spielte, blieb dieser Häuptling zwischen Kasperle, Seppel, Gretel, Großmutter, Räuber, Schutzmann und Krokodil, wie das exotische Exponat einer Weltausstellung für die dörflichen Besucher, immer ein Fremdkörper. Nicht weil sein Kopf beinahe doppelt so groß war wie die Köpfe der anderen Puppen; dieser Kopf war so realistisch geformt, dass es mir während des Spiels nicht gelang, ihm eine Stimme zu geben. Er blieb stumm, da ich unwillkürlich darauf wartete, dass er selbst das Wort ergriff, während die anderen Figuren, kaum hatte ich sie an den Händen, fast automatisch zu sprechen begannen. Dieses Schweigen passte natürlich zu der Figur des weisen alten Häuptlings, was meine Hemmung ihm gegenüber und den Abstand zu ihm nur noch weiter vergrößerte. So lag er wie der verwundete Fischerkönig in seiner Plastikhülle neben der Kasperlebühne und brachte durch seine Präsenz das Spiel immer mehr zum Erlahmen. Die Frage aber »Was wehet dir?« hätte sich nicht an ihn, sondern an meine Mutter richten sollen, die dieses Spiel unbewusst in Szene gesetzt hatte. Dass dieser Häuptling etwas mit der Puppe zu tun haben könnte, die ihr als junges Mädchen gehört hatte und die sie nicht nur mit dem gesamten Hab und Gut der Familie bei der Beschlagnahmung ihres Elternhauses durch »die Russen« verloren hatte, sondern mit der sie, wie sie immer wieder erzählte, ein anderes Mädchen hatte spielen sehen, hätte mir als Kind jedoch unmöglich in den Sinn kommen können.
Selbst einige Jahre später, ich war damals Mitte zwanzig und schon mehrere Jahre aus dem Haus, begriff ich die tieferliegenden Gründe nicht, als meine Mutter mein ehemaliges Zimmer in Altrosa streichen und zu ihrem Zimmer machen ließ, um mit Anfang fünfzig anzufangen, Puppen zu basteln. Es waren dem Pagliaccio der Commedia dell’ Arte nachempfundene androgyne Clownsgestalten, die sämtlich einen traurigen Gesichtsausdruck hatten. Als meine damalige Freundin, die mit Feder und Aquarell hyperrealistische Käfer zeichnete, einen Stand auf einem Markt für Kunsthandwerk in Mainz anmeldete, fragte meine Mutter, ob sie ihr nicht zwei ihrer Puppen zum Verkauf mitgeben könne. Am letzten Abend des Marktes fuhr ich nach Mainz, um meiner Freundin beim Abbau zu helfen, und traf dort auf meine Eltern. Der Zeitpunkt war denkbar schlecht. Im Zug hatte mich gerade ein mir gegenübersitzender Mann – ich hatte damals noch schulterlanges Haar – angepöbelt und schließlich, da ich ihn zu ignorieren versuchte, ein feststehendes Messer aus seinem Rucksack gezogen und mich damit bedroht. Außerdem hatte mich meine Freundin vor knapp drei Wochen betrogen, sich dabei Filzläuse eingefangen und diese an mich weitergegeben. Bevor sie wenig später das Offensichtliche gestehen würde, bestand sie zu diesem Zeitpunkt noch darauf, mir treu geblieben zu sein. Da sie die lebendigen Beweise nicht aus der Welt schaffen konnte, erzählte sie mir stattdessen eine Geschichte, an die sie mich in den folgenden Tagen erinnerte, wenn ich noch einmal auf ihren Fehltritt zu sprechen kommen wollte. Die Geschichte ging ungefähr so: Ein Mann verdächtigt seine Frau, ihn zu betrügen, weshalb er sie eines Abends verfolgt, um sich Gewissheit zu verschaffen. Tatsächlich sucht sie nicht wie behauptet ihre Schwester auf, sondern verschwindet in einem Mietshaus, wo sie kurze Zeit später als Silhouette mit einem anderen Mann am Fenster eines der oberen Stockwerke erscheint. Als das Licht ausgeht, hat der Ehemann den endgültigen Beweis für ihre Untreue und kehrt nach Hause zurück. Ich weiß nicht mehr, ob dieses Drama mit der Verstoßung der Frau oder noch Schlimmerem endete, Pointe des Ganzen war, dass sie nicht ihren Liebhaber, sondern einen Arzt aufgesucht hatte, weil sie unter einer schweren Lungenkrankheit litt, und dieser das Licht gelöscht hatte, um sie zu röntgen. Der Analogieschluss meiner Freundin lag auf der Hand: Auch augenscheinlich stichhaltige Beweise können sich als falsch herausstellen. Dass sie mit dieser Erzählung nicht nur meinen Verdacht abwehrte, sondern sich darüber hinaus zum Opfer machte, gab dem Ganzen eine mir aus meiner Familie bekannte Wendung, der ich, entsprechend vorgebildet, hilflos ausgeliefert war. In dieser Stimmungslage kam ich an dem Stand an, als meiner Mutter gerade die beiden nicht verkauften Puppen von meiner Freundin überreicht wurden. Ich sah die traurigen Gesichter der Puppen, ich sah das traurige Gesicht meiner Mutter, wurde aber unmittelbar vom Blick meiner Freundin abgelenkt, in dem ich neuerlich nach Anzeichen eines Schuldeingeständnisses suchte. Natürlich war es enttäuschend, dass das, was meine Mutter zum Kauf angeboten hatte, nicht gewollt worden war, umso mehr, als sie sich zuvor noch nie mit etwas in die Öffentlichkeit gewagt hatte. Doch hier schwang etwas anderes mit, das sich mit dem grau durchzogenen Sonntagabendhimmel verband und weit zurückreichte, bis zu dem grauen Gebäude der Volkschule in der Freundstraße oder der Kapelle der Heiligen Familie mit den kahlen Bäumen und dem Acker dahinter, dem prächtigen Umspannwerk oder dem Waldbad, dessen breite Treppe gerade eine junge Frau in einem Kostüm heraufkam, die aussah wie meine Mutter, so wie ich sie von Fotografien aus den fünfziger Jahren kannte.
Mir kam das Wort »Unding« in den Sinn, das ich zum ersten Mal in seiner wörtlichen Bedeutung zu verstehen glaubte. Die von mir ehrfürchtig verehrten Spielsachen waren jede für sich genommen ein »Unding«, das sich dem Gebrauch entzog, während die billigen und konturlosen Objekte einer lieblosen Massenproduktion einen tatsächlichen Gebrauchswert für mich besaßen, den ich rücksichtslos und bis zur Neige auskosten konnte. Diese Dinge hatten mir zu gehorchen und wurden beim Spiel entsprechend zugerichtet, während die wertvollen und deshalb undinglichen Spielsachen rituell hervorgeholt und schon bald wieder in ihre Kartons zurückgelegt wurden, weil ich mich nur kurz meines Besitzes hatte vergewissern wollen, den ich durch einen Gebrauch nur gefährdet hätte. Kehrte dieser »verfemte Teil« nun in Form einer langen Prozession von »Dingen« zurück, die mit dem zwischen Leben und Tod schwebenden Rhinozeros seinen Anfang genommen hatte, um jetzt von braunem Plastikgroßwild fortgesetzt zu werden?
Ich dachte, ausgehend vom Rhinozeros, an Rizinusöl, das ich selbst, soweit ich mich erinnerte, nie eingenommen hatte, das jedoch in vielfältiger Form, meist lediglich angedroht, in meiner Kindheit existierte, wie im Film Mary Poppins, in dem Jane und Michael Banks in ihrem Entwurf einer Stellenanzeige für ein Kindermädchen anführen, niemals mit Rizinusöl und Haferschleim gefüttert werden zu wollen. Dann fiel mir das »doppeltsohlenkauende Nashorn« ein, das ein Junge in der Apotheke verlangt, zu der er geschickt worden war, um doppeltkohlensaures Natron zu holen, ein ähnlich einprägsames Bild wie das »Buddhistische Standesamt«, wie man in Wiesbaden das dort ansässige Statistische Bundesamt nannte.
Meist jedoch wusste ich nicht genau, ob dieses vor allem körperliche Gefühl des Erinnerns auf etwas Spezielles, wie etwa den Geschmack einer Schokolade, den Geruch eines Kartenspiels oder das Bild eines Jungen in kurzen Hosen, der auf einem Ziegenbock reitet, zurückzuführen war. Zudem glaubte ich mich an Dinge zu erinnern, die gar nicht zu meinem Leben, sondern zu dem meiner Eltern gehörten. Durch ihren Tod waren meine Eltern aus der familiären Funktion gelöst, sodass ich sie zum ersten Mal als Personen mit einem eigenen Leben, einer eigenen Kindheit, einem eigenen Erwachsenensein, einem eigenen Tod begriff, und nicht länger allein in Bezug auf mich. Wenn ich diese Gefühle, eher waren es Sinneseindrücke, zu beschreiben versuchte, scheiterte ich fast zwangsläufig, denn die Stärke dieser Empfindungen entstand aus vielfachen Überlagerungen, die auf keinen prägnanten Begriff gebracht werden konnten, ohne dabei etwas von ihrer Wahrheit einzubüßen.
Mein Leben erschien mir noch banaler als sonst. Ich trieb dahin, ohne mich treiben lassen zu können. Nicht nur das Schreiben fiel mir schwer, das Lesen ebenso. Und dennoch klammerte ich mich an beides. Gab es eine Verbindung zu dem Gefühl, ausgeliefert zu sein und nicht mehr über sein Leben bestimmen zu können, das meinen Vater in den letzten Jahren in eine oft aggressive Panik versetzt hatte, und der Panik, mit der ich jeden Morgen erwachte? In meinen Träumen tippte meine Mutter weiter kleine Hinweise auf Karteikarten, die jetzt in Kisten in meinem Keller lagerten und dort zum größten Teil einen Wasserrohrbruch überstanden hatten.
Ich hörte kaum Musik, da sich jede Musik, so unsentimental sie auch sein mochte, mit dem beständig und wie ausströmendes Gas durch meinen Kopf raschelnden Zirpen meines Tinnitus verband und eine Straßenszene hervorrief, durch die der alte Renault meiner Eltern fuhr: die Hände meines Vaters am Steuer in unwirklicher Brillanz ausgeleuchtet, das Haar meiner Mutter jungmädchenhaft in einem unendlichen Wehen eingefangen und ich und mein Bruder tonlos lachend auf dem Rücksitz. Dieser Filmkitsch, dem auch ich mich nicht entziehen konnte, weil er etwas mitteilte, was anders nicht beschreibbar schien, war aber genau darum Kitsch, weil das Dargestellte genau so nicht zu erleben war, sondern nur als eine Form von Religionsersatz, der uns in einem Ritus schlecht inszenierter Aufgüsse fremder Gefühle zu Schauspielern werden ließ.
Diese Ebene breitete sich mit immer größerer Kraft unter meinem Leben aus und war weder fassbar noch einzuordnen. Nach wie vor glaubte ich nicht, dass es sich bei dem, was ich fühlte, um eine Form der Trauer handelte. Da ich aber immer noch nicht benennen konnte, was sonst in mir hätte vorgehen können, fiel es mir schwer, konkrete Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Ich spielte auf Zeit, versuchte, ohne mir dessen bewusst zu sein, so wenig Entscheidungen wie möglich zu treffen und verlor dadurch immer mehr den Kontakt zu meiner Umwelt, da ich irgendwann aufgab, über etwas sprechen zu wollen, das ich selbst nicht hätte benennen können.
Überall stieß ich auf Autoren, die nicht viel älter geworden waren, als ich jetzt war. Sie gingen noch einmal in ihren Garten, verfassten einen Brief an eine langjährige Freundin und wurden beim Besuch einer Ausstellung von einem Schlaganfall heimgesucht. Ich versuchte, aus ihren Lebensdaten wenn schon nicht eine Struktur oder ein Prinzip, so doch wenigstens irgendeinen Hinweis herauszulesen, der ihren Tod zwingend und schlüssig machte und umgekehrt bedeutete, dass ich noch nicht so weit war, da gewisse Indizien in meinem Leben nach wie vor fehlten. Hatten sie nicht alle bereits frühzeitig zu sich gefunden und sich auf gewisse Weise in der Welt behauptet, während mein Leben bis ins fortgeschrittene Alter hinein unzureichend und banal verlaufen war und sich auch bis in die Gegenwart nicht wesentlich verändert hatte? Hatten sie das Leben nicht in vollen Zügen genossen, alles an Genüssen ausprobiert, vor allem einen Wert in sich selbst gesehen, den sie mit entsprechender Geste auf Podien und in den Medien zu verkörpern gewusst hatten, während ich mit dem Fahrrad zum Rewe fuhr, um mir eine Tütensuppe zu kaufen, die ich in meiner heruntergekommenen Küche zubereitete und im Stehen aß? Aber reichten diese Unterschiede wirklich aus, um mir noch ein paar Jahre zu garantieren?
Der Rhinozerostraum war nicht zuletzt deshalb eindrücklich, weil das Haus, in dem ich dort lebte und in das ich am Ende floh, dem meiner Eltern ganz ähnlich war, so als hätte ich ihr Leben nun doch als Spiegelung übernommen, während schräg gegenüber nach dem Verlassen ihres »Traumhauses« die Verwesung der unausgelebt zurückgelassenen Gefühle unaufhörlich voranschritt. Das, was vielleicht Ursache und damit auch Lösung dieses Prozesses hätte sein können, befand sich womöglich in einem oberen Stockwerk, zu dem lediglich eine nicht begehbare Treppe führte. Tatsächlich hatte das neue Haus meiner Eltern kein oberes Stockwerk, dafür eine Einliegerwohnung im Souterrain. Eine Bauweise, die sich zwanzig Jahre nach Kriegsende etablierte, als man die Erinnerung an Bunker und Luftschutzkeller so erfolgreich verdrängt hatte, dass sie erneut in der Realität auftauchen konnten. Und was die Tiere anging, so besaß meine Tante, die Schwester meiner Mutter, zeitweise einen schwarzen Pudel, der Batzi hieß. Meine Eltern hingegen schienen eine gewisse Abscheu, wenn nicht sogar einen Ekel vor Tieren zu haben, und wenn man sich den unkontrollierten Verfall der Wesen in meinem Traum ansah, war dieses Gefühl nicht völlig unbegründet.
Nun war es aber nicht der Traum meiner Eltern, auch wenn ich beim Aufwachen unwillkürlich das Gefühl hatte, mich in ihrer Welt bewegt zu haben, sondern mein eigener, handelte es sich, wenn schon, um mein eigenes unbewusst Verdrängtes, das ich auf die andere Straßenseite ausgelagert hatte, wo bei hochgedrehter Heizung Verfall und Tod regierten. Und bedeuteten die Initialen auf dem Schlüssel zu diesem Haus, E. H., nicht Elternhaus, wie ich anfänglich gedacht hatte, sondern eigenhändig? (Ich war durch Adornos Briefe an seine Eltern darauf gekommen, da er dort hinter seinen Namen manchmal die Abkürzung m.p. setzte, manu propria, was der deutschen Abkürzung e. h. entspricht.) Und wenn ja, auf was bezog sich diese Eigenhändigkeit? Auf das Leben, das ich mir eigenhändig zurechtbasteln soll, oder gar den eigenhändig herbeigeführten Tod?
In einer Art zusätzlicher Hypochondrie gesellte sich zu meiner üblichen Angst, mein Körper würde mich lediglich mit kleinen Wehwehchen ablenken, um heimlich das ganz große Ding vorzubereiten (»Da kann man gar nichts mehr machen! Maximal noch zwei Monate!«), die Vorstellung, ich würde zwar nicht wie im Traum die imaginierte Wohnstätte meiner Eltern übernehmen, dafür aber deren freigewordenen Platz auf der Lebensleiter. Ich mochte noch weniger in den Spiegel schauen, weil sich in meinem Gesicht der Verfall in rückhaltloser Brutalität abzeichnete und auch mein Körper an allen Ecken und Enden eigenartige Verschiebungen und Ausbuchtungen aufwies, die sich nicht mehr einfach mit etwas mehr Haltung aus der Welt schaffen ließen. Auch tauchten sonderbare Schmerzen beim längeren Gehen auf, die mich an ein gleichermaßen unklares wie doch recht konkretes Familienerbe gemahnten: Großvater väterlicherseits MS, meine Mutter ihr Leben lang Rheuma und mein Vater in den letzten Jahren gehunfähig durch, wenn auch nie richtig diagnostiziert, wahrscheinlich Parkinson.
Ich verstand mit einem Mal, warum sich alternde Menschen einen jüngeren Partner suchen, weil sich in ihm das eigene Gefühl der Jugend, das einen seltsamerweise nie richtig verlassen will, so unproblematisch spiegelt, dass man sich tatsächlich selbst zu verjüngen glaubt. Und vielleicht liebt man den, der einem dieses Gefühl verschafft, unter Umständen umso inniger. Selbst mein Vater hatte es noch geschafft, sich zwei Monate nach dem Tod meiner Mutter eine Freundin zuzulegen, eine »jüngere Dame« – auch wenn das jenseits der Mitte achtzig nicht mehr wirklich von Bedeutung schien – aus dem Seniorenheim, ehemalige Schauspielerin, die in vielen Vorabendserien des Hessischen Rundfunks der siebziger und achtziger Jahre mitgewirkt hatte, sodass ich sie tatsächlich wiedererkannte, als sie mir ihr Album mit Standfotos aus den jeweiligen Produktionen zeigte. Mein Vater hatte früher oft gesagt, seine Mutter habe ihn an seine Frau »weitergegeben«, und nun schien diese zum ersten Mal seit 85 Jahren entstandene Versorgungslücke gefüllt, wenn auch nur vorübergehend, denn nach einem Jahr verstarb auch sie, weshalb mein Vater das letzte halbe Jahr seines Lebens ohne eine Frau an seiner Seite auszukommen hatte.
Eine etwas gespenstische, aber nicht nur unangenehme Ruhe breitete sich um mich herum aus. Kaum unterbrochen von Verpflichtungen, konnte ich die Tage in einem recht gleichförmig ablaufenden Trott verbringen, der vor allem darin bestand, dass ich am Schreibtisch saß, vor mich hinstarrte, manchmal aufstand, um ein Buch zu suchen, darin zu blättern und mich bestenfalls festzulesen, lustlos Briefe und Grußkarten aus dem Nachlass durchging und auf Notizzetteln immer wieder von Neuem ein Konstrukt meiner Erzählung entwarf und im Entwerfen schon wieder verwarf, schließlich froh war, wenn es Abend wurde, um dasselbe nur ohne den entsprechenden Druck in der Brust weitermachen zu können, da es nicht länger Teil meines Berufs, sondern Feierabendzeitvertreib war.