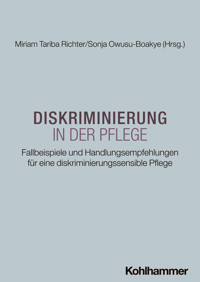
Diskriminierung in der Pflege E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Diversität von Pflegenden wie auch zu Pflegenden, so zeigt die Forschungslage und vielfältige Erfahrungsberichte, führt nicht selten zu Diskriminierungseffekten und birgt erhebliche Risiken, die sowohl die Pflegequalität als auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege negativ beeinträchtigen können. Dieses s Buch verfolgt das Ziel, anhand der im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verankerten Diversitätsdimensionen, und darüber hinaus, praxisnahe Einblicke in Erfahrungen, Mechanismen und Auswirkungen von Diskriminierung in der pflegerischen Versorgung und im Arbeitsfeld zu bieten. Gleichzeitig werden Reflektions- und Handlungsmöglichkeiten für eine diskriminierungssensible und gerechtere pflegerische Versorgung und Arbeitswelt aufgezeigt, die in Form von konkreten Impulsen und praxisnahen Strategien dargelegt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Herausgeberinnen
Prof. Dr. Miriam Tariba Richter, Professorin für Pflegewissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversity am Department Pflege und Management der Fakultät Wirtschaft und Soziales der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.
Sonja Owusu-Boakye, Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Bremen im Internationalen Studiengang Palliative Care M. Sc. mit den Schwerpunkten Diversität am Lebensende, Trauerarbeit und Qualitative Sozialforschung.
Miriam Tariba Richter/Sonja Owusu-Boakye (Hrsg.)
Diskriminierung in der Pflege
Fallbeispiele und Handlungsempfehlungen für eine diskriminierungssensible Pflege
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-042848-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-042849-2
epub: ISBN 978-3-17-042850-8
Vorwort
Hartmut Remmers
Wir befinden uns gegenwärtig in einer weltpolitischen Lage, die auf der einen Seite durch wachsende autoritäre Regime gekennzeichnet ist, auf der anderen Seite durch Marginalisierung demokratischer Verfassungsstaaten mit halbwegs fest verankerten Bürger1- und Menschenrechten. Diese Entwicklungen spiegeln sich ebenso in innenpolitischen Konstellationen demokratischer Länder mit zunehmenden rechtspopulistischen Strömungen, die durch gezielte Instrumentalisierung ausländerfeindlicher und rassistischer Ressentiments sowie biopolitischer Bereinigungsstrategien auf die Herstellung eines Maximums an soziokultureller Homogenität ausgerichtet sind. Ließen sich Tendenzen einer Diskriminierung gesellschaftlicher Minderheiten schon immer in demokratischen Staaten beobachten, so richten sich damit verbundene Herabsetzungen und Diffamierungen inzwischen auf viel breitere Bevölkerungsgruppen. Was auch immer anders, different erscheint, wird herabgesetzt zum Objekt vorurteilsvoller Deklassierung. Es ist somit das Verdienst des vorliegenden Buches, sich mit vermehrt in Erscheinung tretenden Diskriminierungen ebenso substanziell wie kritisch auseinanderzusetzen und sie exemplarisch vor dem Hintergrund häufig problematischer Praktiken im Berufsfeld Pflege in verschiedenen Facetten genauer zu untersuchen.
Grundsätzlich sind Diskriminierungen, welcher Art und welcher Form auch immer, mit universellen Ansprüchen von Menschenrechten unvereinbar. Hilfreich erscheint es daher, sich noch einmal kurz die historische Begründung der Menschenrechte und ihre politische Durchsetzung, vorrangig in der westlichen Welt, vor Augen zu führen. Dabei wird man allerdings zu einer widerspruchsreichen Diagnose kommen. Sie besteht darin, dass den in staatlichen Ordnungen einer sich entwickelnden Bürgergesellschaft sukzessive etablierten Freiheits- und Schutzrechten eine ebenso in der bürgerlichen Ordnung strukturell verankerte Disziplinierung des Menschen und Ausgrenzung großer Gruppen auf dem Fuße folgt, und zwar nach Maßgabe einer auf Weltbemächtigung ausgerichteten Herrschaftsordnung, die in ihrer Tendenz einer Kolonialisierung alles Heterogenen strukturellen Rassismus als eine Form der Diskriminierung hervorbringt (Balibar & Wallerstein, 2018). Allerdings lassen sich die für die bürgerliche Ordnung charakteristischen Disziplinierungsstrategien auch am Beispiel der Gesundheit illustrieren. Auf der einen Seite gilt Gesundheit als ein schützenswertes, die Entfaltung des Lebens ermöglichendes Gut, das als ein Bürgerrecht beansprucht wird. Doch bereits in den Institutionen der Gesundheitsversorgung zeigt sich auf höchst paradoxe Weise, dass zu den besonderen gesundheitlichen Belastungsfaktoren der dort beruflich engagierten Personen auch ein spezifischer Diskriminierungsstress als unabhängiger Prädiktor für Lebensqualität gehört (Sarafis et al., 2016). Auf der anderen Seite werden mit Gesundheit individuelle Pflichten assoziiert, sich körperlich und seelisch fit zu halten für ein möglichst reibungsloses Funktionieren gemäß Normen einer Arbeitswelt, die mehr und mehr den Charakter eines gesellschaftlichen »Gehäuses der Hörigkeit« (Weber, 1976, S. 835) angenommen hat. Wer sich Zwängen der Berufswelt nicht mehr gewachsen zeigt, wer sich ihnen bewusst entzieht, muss entweder mit sozialer Gleichgültigkeit und Verachtung oder mit Sanktionen rechnen. Was hat es mit den widersprüchlichen Phänomenen bürgerlicher Ordnung nun in concreto auf sich?
Befassen wir uns zunächst in historischer Perspektive mit jener von historischen Kämpfen begleiteten Etablierung von Menschenrechten mit späterem Verfassungsrang. Ihnen kann eine katalysatorische Funktion im Prozess der Entwicklung bürgerlicher Gesellschaften zugesprochen werden. Bekanntlich erfolgte die erste europäische Menschenrechtserklärung (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) durch die im Zuge der Französischen Revolution einberufene Nationalversammlung. Umstritten ist freilich der naturrechtliche Gehalt dieser Grundrechte, offen die Beantwortung der Frage, inwieweit Menschenrechte »präpolitischer und präjuristischer Natur sind« (Arendt, 1965, S. 193). Eher an das angelsächsische Verständnis der Bill of Rights anknüpfend, akzentuiert Hannah Arendt den besonderen Abwehrcharakter dieser Rechte gegen staatliche Machtansprüche und Willkür. Und stärker noch in aristotelischer Tradition stehend, geht Arendt davon aus, dass sich die wahre Natur des Menschen erst in jenem Zwischenraum des Politischen (»inter-esse« (Arendt, 1981, S. 173)) offenbart, in dem der Mensch sich handelnd und sprechend als zoon politicon echon bewährt – und zwar vor jenem epochalen Bruch durch die mit der Neuzeit einsetzende »Weltentfremdung« (Arendt, 1981, S. 293).
In der Tat beruht die neuzeitliche Begründung der Menschenrechte auf einem anderen Fundament, auf Anschauungen von einer Natur des Menschen, die sich wesentlich durch seine Grundbedürftigkeit auszeichnet, dem mit einem sozialen Existenzminimum als Grundlage persönlicher Selbstentfaltung im Gebrauch seines sinnlichen Vermögens entsprochen werden muss; mit einer Befähigung zur sozialen Teilhabe und einer genau darauf sich stützenden Selbstachtung der Person als Grund ihrer Würde. Auch dieser, aber nicht allein dieser naturrechtliche Begründungszusammenhang hat sich als normativ für die Tradition verfassungsrechtlichen Denkens in der Bundesrepublik Deutschland erwiesen, für das Menschenwürde-Prinzip als Fundierungsprinzip aller Grundrechte (Tiedemann, 2006), wobei ein gewisses Schwanken der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zwischen Achtungs- und Schutzpflicht grundrechtlicher Normen nicht zu verkennen ist.
Freilich weist die Tradition naturrechtlichen Denkens erheblich Brüche auf. Ersichtlich wird dies darin, dass mit der frühen Neuzeit auch die Boshaftigkeit des Menschen als Ausgangspunkt vertragstheoretischer Begründungen eines Gemeinwesens gilt (Hobbes, 1984). Grundlegend rückt erst Rousseau davon ab, und zwar unter der Annahme, dass ein gerechter, der allgemeinen Wohlfahrt dienender Zustand auf der Basis eines alle Menschen gleich bindenden, permanent zu bestätigenden Allgemeinwillens (volonté générale) geschaffen werden könne (Rousseau, 2016). In den Augen Rousseaus handele es sich bei der Boshaftigkeit des Menschen lediglich um einen historisch kontingenten Zustand, weil die Zivilisation zur Korrumpierung einer ursprünglichen Güte des Menschen geführt habe. Dies ist der Grund, warum eine zukünftig gerechte, der individuellen Selbstbestimmung verpflichtete Regierung allein durch eine Tugenderziehung der Bürger gewährleistet werden und auf genau diesem Wege auch überflüssig gemacht werden könne.
Diese Konsequenz vertragstheoretischen Denkens hat Kant nicht geteilt. Er lässt sich vielmehr von der Überzeugung leiten, dass statt Tugendhaftigkeit ein aufgeklärtes Eigeninteresse des Bürgers die beste Garantie einer dieser motivationalen Grundlage sich verdankenden Rechtsordnung sei, mit der zugleich ein Schutz des wohlverstandenen Eigeninteresses garantiert werden könne. Es sind die in der Natur des Menschen liegenden »selbstsüchtigen Neigungen«, die ihn wenigstens zur Klugheit im Umgang mit seinesgleichen zwingen (Kant, 1968).2 Selbst gewaltsame, despotische Herrschaft umstürzende Ereignisse wie die Französische Revolution sind nicht nur gerechtfertigt durch Institutionalisierung universeller Freiheitsrechte, sondern durch einen dahinterstehenden, quasi teleologisch konzipierten »Ruf der Natur« (Kant, 1968, S. 373).
Nicht zuletzt auf diese geschichtsphilosophisch untermauerte Begründung einer sowohl innergesellschaftlich als auch global einzurichtenden Friedensordnung haben sich die Vereinten Nationen stützen können bei ihrer 1948 verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Mit ihnen wird in Artikel 1 ein universell gültiger Anspruch erhoben, in Artikel 2 ein daraus folgendes Diskriminierungsverbot proklamiert. Gleichwohl kann ein die internationale Staatengemeinschaft rechtlich bindender Charakter daraus nicht abgeleitet werden. Anders verhält es sich bei der Europäischen Grundrechtecharta, die von der Europäischen Menschenrechtskonvention abzugrenzen ist, die ihrerseits auch für Russland und die Türkei Gültigkeit besitzt und deren Auslegung dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) obliegt. Damit kommt den Menschenrechten ein rechtlich-normativ zwingender, von staatlichen Institutionen durchzusetzender Charakter zu.
Schaut man sich nun die unterhalb der Sphäre des Rechts angesiedelten Gesetzmäßigkeiten bürgerlicher Gesellschaftsordnungen genauer an, so trifft man auf bemerkenswerte innere Widersprüchlichkeit dieser Ordnungen. Es handelt sich um grundlegende Transformationen herkömmlicher, wesentlich handwerklich strukturierter Arbeitsgesellschaften unter einer wachsenden Übermacht industriekapitalistischer Herrschaftsordnungen mit tiefgreifenden sozialen Zerklüftungen, neuen Abhängigkeitsverhältnissen und damit einhergehenden Freiheitsverlusten; aber auch mit eigenen Gesetzmäßigkeiten der sozialen Integration. Ein ehemals klassischer staatsbürgerlicher Gehorsam verwandelt sich in adaptives Verhalten gemäß industriegesellschaftlichen Funktionsimperativen; eine ehedem normsetzende praktische Vernunft in einen kalkulierenden Verstand der Einordnung in ein System betrieblich organisierten Lebens mit zahlreichen Entfremdungserscheinungen (Horkheimer & Adorno, 1969). Ablesbar ist dieser Wandel exemplarisch an der Umorganisation gesundheitlicher Versorgungssysteme ebenso wie an Erfahrungen mit Gesundheit und Krankheit sowie an Einstellungen gegenüber dem eigenen körperlichen und seelischen Erleben. Sprechen wir von adaptivem Verhalten gegenüber einer sich immer weiter als Hochleistungsgesellschaft aufspreizenden industriellen Moderne, so manifestiert sich solches Verhalten in überproportionalen Erfolgserwartungen nicht nur an den (überdies kommerzialisierten) Spitzensport, sondern auch an die eigene persönliche Fitness, die mit Bildern der Schönheit und Jugendlichkeit assoziiert wird und sich an ihnen misst. Der schieren körperlichen Funktionalität wird ein Wert beigelegt, der zu komplementären Reaktionsbildungen abschätzigen, stigmatisierenden Verhaltens mit Segregationseffekten führen kann.
Adaptives Verhalten zeigt sich freilich auch in einem anderen Bezugsrahmen. Dabei geht es beispielsweise in einer klassisch-medizinsoziologischen bzw. -psychologischen Perspektive darum, welche mit immer weiter wachsenden Arbeitsanforderungen verbundenen gesundheitlichen Belastungserscheinungen in endemischer Häufigkeit auftreten; welche mit bestimmten Lebensbedingungen und Lebensstilen verflochtenen materiellen, psychosozialen und verhaltensbezogenen Faktoren das Belastungsbewältigungsverhalten in der einen oder anderen Weise beeinflussen. Von zunehmendem Interesse sind dagegen Fragen, welche Prozesse einer Normalisierung sich unter dem Etikett der Gesundheit bzw. der Heilung von Krankheit in Institutionen des Gesundheitswesens vollziehen; welche Prozesse einer oft unauffälligen bzw. verschleierten Diskriminierung mit kurativen Praktiken der Anpassung jener körperlichen bzw. seelischen Phänomene einhergehen – Phänomene, welche gegenüber der als normal klassifizierten Ordnung menschlicher Lebensprozesse als deviant, als defekt, darin sogar als bedrohlich bewertet werden und aufgrund dieser Bewertung gesellschaftliche (Kontaminations-)Ängste erzeugen (Schroer & Wilde, 2016). Kritisch im Anschluss an Michel Foucault sind ebenso jene Normalisierungsstrategien einzuordnen, die eugenische Implikationen im Sinne der Verbesserung des menschlichen Genpools nahelegen (Junge, 2007), oder jene sozialhygienischen Zuschreibungen persönlicher Verantwortung für eine gesellschaftlich erwartete Gesundheit unter Einschluss moralischer Rechtfertigungszwänge mit entsprechenden Sanktionsmechanismen (Ludwig, 2023). Im Widerspruch zu all diesen Tendenzen stehen fundamentale Rechte von Personen als Menschenrechte — und dieser Widerspruch durchzieht die bürgerliche Gesellschaft als eines ihrer konstitutiven Merkmale.
Diese Zusammenhänge vor Augen gilt es, das vorliegende Buch in verschiedenerlei Hinsicht zu würdigen. Auch wenn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) seit 2006 gültig ist, so wird realistischerweise nicht erwartet werden können, dass damit diskriminierende Einstellungen und herabwürdigendes Verhalten in signifikanter Weise abnehmen, solange deren – gewiss sehr komplexe – verursachende Faktoren nicht beseitigt sind. Nicht verkannt werden darf, dass das AGG, gemessen an europäischen Rechtsnormen, eine Schwächung durch Vorbehalte von Religionsgemeinschaften erfuhr (Lewicki, 2020). Das Gesetz dient eher in seinen strafrechtlichen Konsequenzen einer Generalprävention. Gegenwärtig sind wir leider mit einer Zunahme an Diskriminierungen in unterschiedlichen Segmenten gesellschaftlichen Lebens konfrontiert, welche die Unentbehrlichkeit gesetzlich bewehrter Eingriffe nur mehr unterstreicht.
Wie viele Beiträge dieses Buches zeigen, ist den körperlichen Dimensionen der Diskriminierung eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei geht es einerseits um Fragen immer wieder thematisierter sexueller oder Geschlechteridentitäten, auf denen, trotz gewachsener gesellschaftlicher Toleranzspielräume in den 1970er/80er Jahren, ein zählebiges Tabu liegt. Ein Zeichen, dass verbreitete Normalitätsvorstellungen bis heute durch binäre Codes geprägt sind. Gerade aus gerontologischer Sicht besonders hervorgehoben sei deswegen die Tatsache, dass es sich bei der jetzt ins höhere Lebensalter hineinwachsenden Generation um die Repräsentierenden einer Protestgeneration der sogenannten 1968er handelt, von denen viele einst mit alternativen Lebensentwürfen experimentierten und sich gegenüber bis dahin kulturell tief verankerten Tabus offen zu ihrer sexuellen Identität bekannten. In einem seit Langem erneuerten restaurativen Klima ist diese Generation (nicht gleichzusetzen mit den Babyboomern) nicht nur mit spezifischen altersbezogenen Diskriminierungen (etwa der Selektion medizinischer Behandlungs- oder auch Rehabilitationsmaßnahmen) konfrontiert, sondern auch mit Problemen eines der jeweiligen Persönlichkeit zu schuldenden Respekts. In der Tat bestehen gerade in vielen Pflegeeinrichtungen und Diensten große Anforderungen an die Entwicklung antidiskriminierender und – mit Blick auf die zunehmende Zahl von Menschen mit unterschiedlichen geografischen und kulturellen Herkünften – antirassistischer Vermeidungs-, Unterstützungs- und Schutzkonzepte. In der Mehrzahl aber scheinen öffentlich finanzierte Träger der allgemeinen Wohlfahrtspflege in Deutschland immer noch an herkömmlichen, längst im Schwinden begriffenen soziokulturellen Milieus orientiert zu sein (Lewicki, 2020). Aber auch die Berufsgruppe der Pflege weist keine monolithische Identität auf. Diese speist sich vielmehr aus unterschiedlichen Erfahrungen in Bezug auf Geschlecht, Macht und beruflichen Status, die einer fortlaufenden kritischen Reflexion bedürfen (Bell, 2021).
Andererseits wird in den Beiträgen dieses Buches verdienstvollerweise auch bei verschiedenen thematischen Schwerpunktsetzungen immer wieder der öffentliche Raum als jene Sphäre akzentuiert, in der diskriminierendes Verhalten einen besonders beschämenden Charakter hat. Dies betrifft in exponierter Weise die hier angesprochenen Orte der Pflege, seien es Pflegeheime oder Krankenhäuser. Wie in den Beiträgen deutlich gemacht wird, sind es nicht allein aktive Handlungen, denen häufig diskriminierende Absichten zugrunde liegen. Die Beurteilung wird sich vielmehr auch auf die Folgen richten müssen, das heißt auf möglicherweise diskriminierende Wirkungen eines Unterlassens, bspw. der Nicht-Wahrnehmung eines Wunsches, einer signifikanten Geste, eines Ausdrucksverhaltens einer Person, die sich ihrerseits unbewussten Bewertungen, individuellen Aversionen und dergleichen mehr in einem Versorgungssetting ausgesetzt sieht. Der öffentliche Raum ist ein buchstäblich vielsagender Raum, auch der symbolischen Kommunikation, der verdeckten Deklassierung, Demütigung und Vernachlässigung, und er ist trotz vielfältiger Verhüllungen und Verschleierungen derjenige Raum, in dem gesellschaftliche Toleranzspielräume am ehesten einem Test ausgesetzt werden können.
Gewiss werden aus einer Vielzahl wissenschaftlich-analytischer Befunde zum Alltag diskriminierenden Verhaltens praktische Konsequenzen folgen müssen. Und es liegt auf der Hand, dass in dieser Hinsicht die pflegerische Ausbildung um diskriminierungssensible Trainings wesentlich ergänzt und das Bewusstsein für grundlegende Menschen- und Bürgerrechte geschärft werden muss. Allerdings wird man der Gefahr menschlicher Erniedrigungen nicht allein auf dem Wege besserer (beruflicher) Bildung begegnen können. Dabei handelt es sich möglicherweise um eine in der deutschen Kulturgeschichte überstrapazierte Annahme. Achtungsverluste fundamentaler Menschenrechte in Form diskriminierenden Verhaltens haben vielfach ihre Ursache in erneut sich ausbreitenden autoritären, vorurteilsbelasteten Einstellungen; in einem Syndrom, zusammengesetzt aus Konventionalismus, Unterwürfigkeit, Anti-Intrazeption, starrem Denken in Stereotypen, projektiven Einstellungen und Zynismus. Herabsetzendes, demütigendes Verhalten erfüllt dabei häufig die Funktion eines Ventils für persönliches Unbehagen, für Gefühle starker gesellschaftlicher Unterlegenheit und Entfremdung (Adorno et al., 1995). Zieht man Studienergebnisse der älteren Frankfurter Schule zu gesellschaftlich destruktiven Vorurteilen heran, so bedarf es dringend politisch auszuweitender Aufklärung in Verbindung mit einer deutlichen Stärkung rechtlich sanktionierender Eingriffe. Auf berufspolitischer Ebene würde das heißen, den in § 5 Abs. 2 S. 3 PflBG (Pflegeberufegesetz) formulierten Anspruch in einen Maßnahmenkatalog organisationsbezogener Prüfungen zu übersetzen. Ähnliches würde man sich für weitere Berufsfelder in unserem Land wünschen.
Für die wissenschaftliche, praktische und politische Grundlegung von Antidiskriminierungsstrategien erweist sich das vorliegende Buch als ein unverzichtbarer Baustein. Dafür ist den Herausgeberinnen ebenso wie den zahlreichen hier Publizierenden ausdrücklich zu danken.
Eine weite Verbreitung in den Berufsfeldern Pflege und Gesundheit ist diesem Werk daher sehr zu wünschen.
Hartmut Remmers
Heidelberg, im Juni 2024
Literatur
Adorno, T. W., Fraenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., Sanford, R. N. (1995).
Einleitung.
In: Adorno, T. W.:
Studien zum autoritären Charakter
(S. 1-36). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Arendt, H. (1965).
Über die Revolution.
München: Piper.
Arendt, H. (1981).
Vita activa oder Vom tätigen Leben.
München: Piper.
Balibar, É. & Wallerstein, I. (2018).
Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten.
6. Aufl. Hamburg: Argument Verlag.
Bell, B. (2021).
Towards abandoning the master’s tools: The politics of a universal nursing identity.
Nurs Inq, 28(2), e12395.
Hobbes, T. (1984).
Leviathan.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Horkheimer, M. & Adorno, T. W. (1969).
Dialektik der Aufklärung.
Frankfurt am Main: Fischer, insbes. S. 9-49.
Junge, T. (2007).
Unerwünschte Körper und die Sorge um sich selbst.
In: Junge, T. & Schmincke, I. (Hrsg.)
Marginalisierte Körper. Zur Soziologie und Geschichte des anderen Körpers
(S. 171-186)
.
Münster: Unrast.
Kant, I. (1968).
Zum ewigen Frieden.
Werke, Akademie-Ausgabe, Bd. VIII. Berlin: De Gruyter.
Lewicki, A. (2020).
Gleichbehandlung in der Pflege?
In: Dibelius, O. & Piechotta-Henze, G. (Hrsg.)
Menschenrechtsbasierte Pflege. Plädoyer für die Achtung und Anwendung von Menschenrechten in der Pflege
(S. 215-226). Bern: Hogrefe.
Ludwig, G. (2023).
Körperpolitiken und Demokratie. Eine Geschichte medizinischer Wissensregime.
Frankfurt am Main / New York: Campus Verlag, insbes. Kap. V, S. 335-371.
Rousseau, J.-J. (2016).
Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechts.
Berlin: Suhrkamp.
Sarafis, P., Rousaki, E., Tsounis, A. et al. (2016).
The impact of occupational stress on nurses’ caring behaviors and their health related quality of life.
BMC Nursing, 15, 56.
Schroer, M. & Wilde, J. (2016).
Gesunde Körper – Kranke Körper.
In: Richter, M. & Hurrelmann, K. (Hrsg.)
Soziologie von Gesundheit und Krankheit
(S. 257-271). Wiesbaden: Springer.
Tiedemann, P. (2006).
Was ist Menschenwürde? Eine Einführung.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Weber, M. (1976).
Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie.
5. Aufl. (Studienausgabe). Tübingen: J.B.C. Mohr Verlag (Paul Siebeck).
1
Der besseren Lesbarkeit wegen schließen die verkürzten historischen Benennungen der zusammengesetzten Begriffe stets alle Geschlechter mit ein.
2
Siehe dazu ebenso: Kersting, W. (2002).
Über die Grenzen der Gerechtigkeit und der Moral.
Weilerswist: Velbrück, S. 236–246.
Inhalt
Vorwort
Hartmut Remmers
Einleitung: Diskriminierung geht uns alle an!
Miriam Tariba Richter, Sonja Owusu-Boakye & Kilian Rupp
1
Diskriminierung begegnen, Potenziale von Vielfalt nutzen. Wie Diskriminierung Pflegefachkräften, Patient*innen und Organisationen im Gesundheitswesen schadet – und was wir dagegen tun können
Isabel Collien
1.1
Einleitung
1.2
Was ist Diskriminierung?
1.3
Wo ist der Diskriminierungsschutz rechtlich verankert?
1.3.1
Zivilrecht
1.3.2
Öffentliches Recht
1.3.3
Strafrecht
1.4
Zwischenfazit
1.5
Ebenen von Diskriminierung
1.5.1
Individuelle Diskriminierung
1.5.2
Institutionelle Diskriminierung
1.5.3
Strukturelle Diskriminierung
1.6
Handlungsempfehlungen
1.6.1
Diversitätsbewusste Personalauswahl
1.6.2
Diversity-Kompetenz als Teil professionellen Handelns
1.6.3
Diversity Management: Diskriminierungskritische Organisationsentwicklung
1.7
Schluss
1.8
Literatur
2
Rassismus auch in der Pflege?!
Miriam Tariba Richter
2.1
Einleitung: Was ist Rassismus und wie entsteht er?
2.2
Theoretische Erklärungsansätze von Rassismus
2.3
Handlungsebenen von Rassismus
2.4
Auswirkungen von Rassismus
2.5
Rassismus in der Pflege und im Gesundheitswesen
2.5.1
Strukturelle rassistische Diskriminierung
2.5.2
Institutionelle rassistische Diskriminierung
2.5.3
Interpersonelle rassistische Diskriminierung
2.5.4
Rassistische Diskriminierung von Pflegenden in der Langzeitpflege
2.6
Handlungsempfehlungen
2.6.1
Es braucht eine antirassistische Haltung in der Pflege
2.6.2
Was tun, wenn Rassismus im beruflichen Pflegealltag auftritt?
2.6.3
Generelle Handlungsempfehlungen für eine antirassistische Pflege
2.7
Literatur
3
Geschlechtsidentität – (k)ein Thema in der Pflege? Trans*Sensibilität als Teil einer bedürfnisgerechten pflegerischen Versorgung
Ray Trautwein & Ilka Christin Weiß
3.1
Einleitung
3.2
Geschlechtsidentität als Diskriminierungsgrund? – Begriffserklärungen
3.3
(Warum) Trans* in der Pflege berücksichtigen?
3.4
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Pflege(aus)bildung – eine Leerstelle?
3.5
Handlungsempfehlungen
3.6
Fazit: Trans*sensible Pflege als Norm/Normalität?
3.7
Literatur
4
Diskriminierung in der Pflege aufgrund der Religion am Beispiel von Muslim*innen und muslimisierten Menschen
Alisha Iman Qamar, Lynn Mecheril, Sonja Owusu-Boakye & Miriam Tariba Richter
4.1
Einleitung
4.2
Othering: Die Muslim*innen – Eine Konstruktion der Anderen
4.3
Der Islam als Feindbild? – Versuch einer Begriffsbestimmung
4.4
Religion als Instrument für Rassismus – antimuslimischer Rassismus
4.5
Diskriminierung und antimuslimischer Rassismus im Gesundheitswesen
4.6
Fallbeispiele: Diskriminierung durch antimuslimischen Rassismus im Gesundheitswesen
4.7
Gesundheitliche Auswirkungen von antimuslimischem Rassismus
4.8
Handlungsempfehlungen
4.9
Strukturelle Handlungsbedarfe
4.10
Institutionelle Handlungsbedarfe
4.11
Schluss: Take-Home Reflektion
4.12
Literatur
5
Diskriminierung von Menschen mit Be_hinderung
Stefanie Schniering & Beatrice Frederich
5.1
Einleitung: »Das sieht man Dir ja gar nicht an« – Diskriminierung von Menschen mit Be_hinderung
5.2
Theoretische Hinführung: Ableismus
5.3
Barrieren und Diskriminierungserleben in der Gesundheitsversorgung: Empirische Einordnung zum Erleben von zu pflegenden Menschen mit Be_hinderung
5.4
Diskriminierung von Pflegenden mit Be_hinderung
5.5
Professionelles pflegerisches Handeln in der Begleitung von Menschen mit Be_hinderung
5.6
Verwirklichungschancen von Menschen mit Be_hinderung zum Schutz vor Diskriminierung
5.7
Handlungsempfehlungen
5.7.1
Gesellschaftliche Ebene
5.7.2
Institutionelle Ebene (Einrichtungen des Gesundheitswesens und Bildungseinrichtungen)
5.7.3
Individuelle Ebene (Pflegende)
5.8
Literatur
6
Diskriminierung in der Pflege aufgrund des Alters
Rosa Mazzola
6.1
Einleitung
6.2
Zur Diskriminierungskategorie Alter
6.3
Zur Begriffsbestimmung altersbezogener Diskriminierung
6.4
Zur Häufigkeit und Formen altersbezogener Diskriminierung
6.5
Altersbezogene Diskriminierung ist multidirektional
6.6
Diskriminierung und Gewaltformen in Pflegeeinrichtungen
6.7
Dimensionen altersbezogener Diskriminierung – interpersonale, institutionelle, gesellschaftliche Dimension
6.7.1
Gesellschaftliche Dimension – Ageism
6.7.2
Exemplarische Vertiefung altersbezogener institutioneller und interpersoneller Misshandlung: Zur Situation altersbedingter Diskriminierung in Pflegeeinrichtungen
6.8
Diskussion – Konfrontation mit dem Forschungsstand
6.9
Handlungsempfehlungen
6.10
Fazit
6.11
Literatur
7
Sexuelle Identität – ein Thema in der Pflege?
Inka Wilhelm
7.1
Einleitung
7.2
Sexuelle Identität, Heteronormativität und Heterosexismus
7.3
Die Situation nicht heterosexueller Menschen in Deutschland
7.4
Diskriminierungserfahrungen im Lebensverlauf
7.5
Sexuelle Identität und Alter
7.6
Bedürfnisse und Befürchtungen nicht heterosexueller Menschen in der Pflege
7.7
Sexuelle Identität in der Pflege beachten
7.8
Handlungsempfehlungen
7.9
Fazit
7.10
Literatur
8
Soziale Herkunft
Nathalie Englert, Marco Noelle & Andreas Büscher
8.1
Einleitung: Soziale Ungleichheit im Kontext professioneller Pflege?
8.2
Was ist soziale Ungleichheit?
8.3
Entstehung und Erklärung sozialer Ungleichheit
8.4
Theoretische Erklärungsansätze
8.5
Notwendigkeit des Verstehens versus Gefahr der Stereotypisierung
8.6
Soziale Ungleichheit und Gesundheit
8.7
Soziale Ungleichheit und Pflege
8.8
Handlungsempfehlungen
8.9
Literatur
9
Körpergewicht – Ein bisher kaum berücksichtigtes Diskriminierungsmerkmal mit großer (Aus-)Wirkung
Sonja Owusu-Boakye & Nicole Oeste
9.1
Einleitung: Die Normierung von Körpern
9.2
Soziale Anerkennung und Fettphobie
9.3
Diskriminierung aufgrund des Gewichts
9.4
Gewichtsbezogene Stereotypisierung und Stigmatisierung
9.5
Selbststigmatisierung
9.6
Adipositas als anerkannte Krankheit: Fluch und Segen zugleich
9.6.1
Pro Anerkennung von Adipositas als Krankheit: Schutz vor Gewichtsdiskriminierung
9.6.2
Contra Anerkennung: Ist Mehrgewichtigkeit krankhaft?
9.7
BMI: das Maß der Dinge?
9.8
Gewichtsdiskriminierung im Gesundheitswesen
9.9
Fazit: Aktiv werden gegen Gewichtsdiskriminierung!
9.10
Handlungsempfehlungen
9.11
Literatur
Die Autor*innen
Einleitung: Diskriminierung geht uns alle an!
Miriam Tariba Richter, Sonja Owusu-Boakye & Kilian Rupp
»Ich frage mich, warum – und natürlich ist das eine der psychischen Folgen von Diskriminierung, von Kranksein im Gesundheitssystem, mit dem Gefühl, nicht versorgt zu werden. Also das ist es, warum du dich selbst infrage stellst.
Warum passiert das? Stimmt etwas nicht mit mir? Habe ich etwas falsch gemacht oder sollte ich mich anders verhalten, damit die Ärzte [und Pflegenden] sich um mich kümmern?« (Ahmad; DeZIM, 2023, S. 174)
Stellen Sie sich vor, Sie hatten einen Sturz mit dem Fahrrad und werden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Schulter schmerzt und Sie können kaum laufen, außerdem fühlen Sie sich leicht benommen. In der Notaufnahme werden Sie bei der Anmeldung mit Ihrem richtigen Namen und Pronomen angesprochen und müssen dort eine Zeit auf die erste Untersuchung warten. Da dies ein bisschen dauern kann, bekommen Sie schon einmal Informationsmaterial des Krankenhauses in die Hand gedrückt. Sie freuen sich, dass dieses nicht nur in einfacher Sprache und somit sehr verständlich verfasst ist, sondern Sie dort auch Ihre Muttersprache vorfinden. In dem Informationsblatt steht, dass in diesem Krankenhaus alle Menschen willkommen sind. Eine Pflegefachperson nimmt die erste Einschätzung ihres Zustands vor. Sie bekommen eine Trage, die Ihren Körpermaßen entspricht. Bei der ersten Beurteilung Ihres Zustands werden die Berührungen bei der Untersuchung angekündigt und sensibel mit der Entblößung Ihres Körpers umgegangen. Als Sie Schmerzen und weitere Beschwerden angeben, werden diese ernst genommen und entsprechend behandelt. Bei der Anamnese werden Sie später nach den Ihnen wichtigen Bezugspersonen gefragt. Es werden Ihnen nur auf die Behandlung abzielende Fragen gestellt. Sie bekommen das Essen, das Ihrem Lebenskonzept entspricht und Sie erhalten eine Ihrer Verletzung, Bedarfe und Lebenssituation angemessene professionelle, gesundheitliche und pflegerische Versorgung.
Nun sagen Sie, sollte das nicht bei allen Patient*innen so sein?
Dies ist aber nicht der Fall, denn eine angemessene professionelle, gesundheitliche und pflegerische Versorgung erhalten nicht alle Personen. In der deutschen Gesellschaft und somit im deutschen Gesundheitswesen sind Ressourcen und Teilhabechancen unterschiedlich und ungerecht verteilt und von gesellschaftlichen Machtverhältnissen geprägt. Es ist z. B. von großer Bedeutung, in welchen sozialen Verhältnissen Sie aufgewachsen sind, welchen Glauben Sie haben, wie Sie Ihre Geschlechtsidentität definieren oder zu welchem Geschlecht Sie sich hingezogen fühlen und mit wem Sie zusammenleben. Es macht einen Unterschied, in welchem Land Sie geboren sind, welche Sprache Sie sprechen oder wie Sie heißen. Es ist relevant, wie Ihr Aussehen wahrgenommen wird, wie Ihre körperliche Erscheinung ist, über welche Formen und Fähigkeiten Ihr Körper verfügt und wie alt Sie sind. Diese Merkmale definieren Sie und Ihre Position in der Gesellschaft, diese verschiedenen Merkmale definieren uns alle in unterschiedlicher Weise. Sie machen unsere Identität aus. Das ist der Kern unserer Diversität, die bestimmt, wie wir durch die Welt gehen (können) und welche Chancen wir in verschiedenen Lebensbereichen wie etwa in der Bildung, im Arbeitsleben, auf dem Wohnungsmarkt oder im Gesundheitswesen haben. Sie hat Einfluss darauf, wie wir in Pflege handeln oder behandelt und versorgt werden.
Wenn Sie die oben beschriebene Erfahrung im Gesundheitswesen machen, verfügen Sie über Privilegien, die Ihnen Anerkennung und eine gute pflegerische Versorgung gewährleisten. Dann entspricht Ihre Diversität den gesellschaftlichen Normvorstellungen von z. B. Aussehen, Geschlecht, (sozialer) Herkunft, Religion, sexueller oder geschlechtlicher Identität etc.
Was aber, wenn z. B. Ihre Muttersprache nicht Deutsch ist, Sie nicht in Deutschland geboren sind und Sie in finanziell schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind? Was, wenn Ihre Körpermaße nicht der Norm entsprechen oder Ihr Aussehen als fremd wahrgenommen wird? Was ist, wenn Ihnen als trans* Person neugierige Fragen zu Ihren Genitalien gestellt werden, wenn Ihre auf Religiosität bezogenen Bedarfe nicht akzeptiert werden? Was ist, wenn Sie aufgrund Ihres Alters übergangen werden, wenn Ihre Schmerzen als kulturell übertrieben abgewertet werden oder Ihnen aufgrund von Rassismen unterstellt wird, dass Sie kaum Schmerzempfinden haben? Was, wenn die Ihnen nahestehenden Personen in Ihrer Not nicht zu Ihnen dürfen, da Ihre Beziehungskonstellation nicht den gesellschaftlichen Normvorstellungen entspricht?
Was ist, wenn …?
Diskriminierung betrifft uns alle!
Wenn Diversitätsmerkmale gesellschaftlich nicht anerkannt sind, können sie sich negativ auf die Teilhabechancen in einer Gesellschaft auswirken und sich in sog. De-Privilegien eines Menschen zeigen. Dies führt dazu, dass Personen anders als andere Menschen betrachtet und behandelt werden sowie Ausschlüsse und Diskriminierung erfahren. Diskriminierung ist ein Phänomen, das im Gesundheitswesen und in der Pflege allgegenwärtig ist und sich sowohl institutionell als auch in der Interaktion von Personen zeigt.
Was wissen wir über Diskriminierung im Gesundheitswesen und damit auch in der Pflege?
Der Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungsschutz im Gesundheitswesen – Wissensstand und Forschungsbedarf für die Antidiskriminierungsforschung, erschienen 2021, zeigte zum ersten Mal zusammenfassend potentielle Gefährdungsmomente von Personen entlang verschiedener Diversitätsmerkmale wie Geschlecht, Religion, Be_hinderung3, Alter, sexuelle Identität, sozioökonomischer Status und Gewicht auf. Dabei war das Ergebnis, dass die nationale Forschungslage noch deutlich ausbaufähig ist. Diversitätsmerkmale wie z. B. sozioökonomische Herkunft, geschlechtliche und sexuelle Identität oder Rassismus im Gesundheitswesen werden marginal oder zweitrangig untersucht, geraten aber durch gesellschaftliche Entwicklungen wie die Bewegung Black Lives Matter (Rassismus) oder das Selbstbestimmungsgesetz (Geschlechtsidentität) deutlicher in den gesellschaftlichen Fokus. Auch gibt es Forschungsdesiderate hinsichtlich Religion oder Körpergewicht als Diskriminierungsmerkmal, die sich auf die Versorgungsqualität im deutschen Gesundheitssystem auswirken. Ob ausreichend beforscht oder nicht, die Ergebnisse des Berichts zeigen auf, dass Diskriminierung im Gesundheitswesen und der Pflege erhebliche Risiken für alle darin befindlichen Personen hat (Bartig et al., 2021).
Dabei stehen Ungleichbehandlung und Diskriminierung im Gegensatz zum pflegerischenFürsorgeprinzip. Das Pflegeberufegesetz (§ 5 Abs. 1–2) sieht vor, dass Pflegefachpersonen Menschen aller Altersstufen u. a. unter Berücksichtigung wissenschaftlicher und ethischer Standards umfassend pflegen und damit der Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situation der zu pflegenden Menschen dienen sollen. Sie müssen dabei die konkrete Lebenssituation, den sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrund, die sexuelle Orientierung sowie die Lebensphase der zu pflegenden Menschen berücksichtigen, deren Selbstständigkeit unterstützen und das Recht auf Selbstbestimmung achten (§ 5 Abs. 2 PflBG). Ethisch-moralisch sind zu Pflegende in einer besonders vulnerablen Lage, da sie in existentiellen, die Integrität bedrohenden Lebenssituationen unterstützungs- und pflegebedürftig sind. Sie sind in ihrer lebenspraktischen Autonomie eingeschränkt und auf pflegerische Versorgung angewiesen (Friesacher, 2008). Daher basiert das pflegeberufliche Unterstützungshandeln auf einer unausweichlichen asymmetrischen Beziehung zwischen Pflegenden und Pflegeempfänger*innen, wobei letztere auf fürsorgliches Handeln angewiesen sind. Dieses ist eine pflegerische Care-Aufgabe gegenüber anderen, aber auch sich selbst (Conradi, 2001; Friesacher, 2008), die sich anlehnend an eine deontologische Ethik in aktiven Tätigkeiten äußern kann. Im Kontext von Diskriminierung wäre das ein aktives Einschreiten und advokatorisches Handeln, um Diskriminierung zu vermeiden und sich stellvertretend für das Recht auf Nichtdiskriminierung der Patient*innen einzusetzen. Oder aber auch in passiven Handlungen wie in der Unterlassung von Diskriminierung von Patient*innen.
Auch Sie können Ihren Teil dazu beitragen, Diskriminierung entgegenzuwirken!
Um das pflegerische Qualifikationsziel zu erreichen, eine moralische Haltung zu Diskriminierung zu entwickeln, fürsorgend zu handeln und letztendlich auch dem gesellschaftlichen Auftrag der Pflege im Kontext der Gesundheit von Menschen Rechnung zu tragen, braucht es eine dringende Auseinandersetzung mit dem Phänomen Diskriminierung in der Pflege.
Diese Auseinandersetzung ist nicht bequem, da sie von jeder Person einfordert, sich mit dem eigenen Handeln im Berufsalltag und den Rahmenbedingungen in einem Beruf auseinanderzusetzen, der vielen, vor allem auch strukturellen, Herausforderungen unterliegt. Die Auseinandersetzung mit Diskriminierung ist aber kein Add-on-Thema, dem sich angenommen werden kann, wenn alle pflegerischen Herausforderungen bearbeitet sind. Denn Diskriminierung prägt schon jetzt tagtäglich die Realität von Pflegenden wie zu Pflegenden massiv, beschädigt diese und reduziert deren gesundheitliche Chancen und Wohlbefinden (u. a. Bartig et al., 2021) oder kann bei Pflegenden zu einem Ausstieg aus dem Beruf führen (Ulusoy & Schablon, 2020). Zwar nehmen zu Pflegende in dieser Betrachtung aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilität eine spezifische Rolle ein, aber auch Pflegende selbst sind in vielfältiger Weise von Diskriminierung betroffen, welche wir in diesem Buch ebenfalls adressieren möchten.
Wir möchten Sie daher einladen, sich mit dem Thema Diskriminierung in der Pflege auseinanderzusetzen, damit Sie in Ihrem Berufsalltag ein Bewusstsein für unterschiedliche Formen von Diskriminierung entwickeln können und Impulse wie Ideen erhalten, mit Diskriminierung in der Pflege umzugehen und sich dieser bewusst entgegenzustellen, sei es in der Pflegepraxis oder in anderen Bereichen.
Das Ziel des Buches soll sein, einen Überblick zur Diskriminierung in der Pflege zu geben, der einerseits für das Thema sensibilisiert und zu eigenen Reflexionsprozessen anregt und andererseits auch Handlungsalternativen und Veränderungspotentiale aufzeigen soll.
Das Buch richtet sich an Sie!
In unserer Gesellschaft haben fast alle Menschen neben De-Privilegien auch Privilegien, also Eigenschaften und Fähigkeiten, die ihnen Handlungsmöglichkeiten und damit Macht verleihen. Diese Macht kann dafür eingesetzt werden, sich an die Seite von Menschen zu stellen, die Diskriminierung in der Pflege erfahren. Es braucht Menschen, die eine moralische Haltung gegenüber Diskriminierung einnehmen und gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die sich auch in der Pflege zeigt, nicht anerkennen, die sich selbst als Teil diskriminierender Strukturen begreifen und ihr dahingehendes Handeln verändern. Es braucht Verbündete, die marginalisierten Personen eine Stimme verleihen und diese unterstützen (Bishop, 2015). Dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt, um Benachteiligung, Diskriminierung und Ungerechtigkeit in der gesundheitlichen Versorgung abzubauen und Chancen auf eine gerechte Gesundheitsversorgung und Pflege zu ermöglichen, egal in welchem Bereich der pflegerischen Versorgung diese arbeiten oder sich befinden.
Mit diesem Buch möchten wir eine breite Fachöffentlichkeit in der Pflege ansprechen und sowohl die Pflegepraxis, pflegerische Einrichtungen und Institutionen als auch die Pflegewissenschaft, -forschung und -pädagogik, vor allem den Bereich der Pflege(aus)bildung, die Gesundheitspolitik und weitere interessierte Berufsgruppen im Gesundheitswesen erreichen.
Mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Diskriminierung tragen Sie dazu bei, dass sich erstens Ihr Arbeitsumfeld positiv verbessert, vor allem für diejenigen, die Diskriminierung erfahren. Zweitens erhalten Ihre Patient*innen eine Pflege, die positiv unterstützt und dazu beiträgt, deren Lebenswelten und -realitäten anzuerkennen und Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern. Sie erhalten zudem Anhaltspunkte, welche strukturellen Veränderungspotentiale es in Einrichtungen bedarf sowie welche Forschungslücken oder pädagogische Implikationen bestehen. Und letztendlich leisten Sie einen Beitrag, die Gesellschaft, in der wir alle leben, ein Stück weit zu verändern und eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten.
In dem Buch wird die Diversität in unserer Gesellschaft positiv anerkannt, aber die damit verbundene (Mehrfach-)Diskriminierung in dieser und insbesondere in der Pflege kritisiert. Diversität bedingt sich durch eine Zunahme, aber vor allem durch eine stärkere Sichtbarkeit an Vielfalt in unserer Gesellschaft, welche auf verschiedene Entwicklungen wie demografischer Wandel, Migrationsgeschichten und soziale Wandlungsprozesse zurückgehen, die sich in vielfältigen Lebenslagen von Menschen niederschlagen. Die Anerkennung und Sichtbarkeit von gesellschaftlicher Vielfalt bringt Potentiale wie auch Herausforderungen mit sich. Die Zunahme und Sichtbarkeit von unterschiedlichen Herkünften, natio-ethno-kulturelle (Mehrfach-)Zugehörigkeit, Religionen, Sprachen oder Merkmale wie äußere Erscheinung, geschlechtliche und sexuelle Identität, sozioökonomischer Status, Alter, Be_hinderung etc. werden in unserer Gesellschaft häufig nicht einfach wertfrei betrachtet, sondern es zeigen sich Unterscheidungen und Differenzsetzungen, die an Begriffen wie dem Anderssein und Normalität oder der Konstruktion von Minderheiten und Mehrheiten ersichtlich werden. Daher müssen im Kontext von Diversität immer auch historisch gewachsene gesellschaftliche Machtverhältnisse und das Zustandekommen von konstruierten Kategorien kritisch reflektiert werden. Dies spiegelt sich in der begrifflichen Verwendung von Diversity wider. In diesem Sinne ist Diversity untrennbar mit Fragen der Gleichstellung und Antidiskriminierung von Menschen in unserer Gesellschaft und auch in der Pflege verbunden und bringt u. a. pflegerische und rechtlich-moralische Implikationen mit sich, die im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eingefordert werden müssen (Richter, 2024).
Wie im ersten Kapitel noch tiefergehend verdeutlicht wird, basieren Diskriminierungen auf kategorialen Unterscheidungen, von denen Personen oder soziale Gruppen betroffen sind und die zur Begründung und Rechtfertigung gesellschaftlicher (ökonomischer, politischer, rechtlicher, kultureller) Benachteiligungen verwendet werden. Durch Diskriminierung werden auf Grundlage jeweils wirkungsmächtiger Normalitätsmodelle Personen und Gruppen markiert, denen vor allem der Status des gleichwertigen Gesellschaftsmitglieds bestritten wird (Scherr, 2010). Da Diskriminierung ein strafrechtlicher Tatbestand ist und der Schutz vor Diskriminierung nach dem AGG eine institutionelle Verpflichtung, sollen ausgehend von dieser rechtlichen Rahmung die dort aufgenommenen sechs Diskriminierungskategorien in diesem Buch aufgezeigt werden. Im AGG werden die Rechte für Arbeitnehmende (z. B. Pflegende) und Pflichten für Arbeitgebende (z. B. Einrichtungen des Gesundheitswesens) ausdrücklich mit dem Ziel formuliert, Menschen vor Diskriminierung zu schützen, Sanktionen gegenüber diskriminierenden Personen auszusprechen und Strukturen zu verändern, die Diskriminierungen begünstigen. Die rechtliche Rahmung macht deutlich, welche Verantwortung Institutionen des Gesundheitswesens und der Pflege wie auch alle Menschen, die in ihnen arbeiten, zur Vermeidung von Diskriminierung innehaben. Nicht alle Diskriminierungsformen können den AGG-Kategorien theoretisch stringent zugeordnet werden (Kap. 4). Auch sollen zusätzlich darüber hinaus am Beispiel von sozialer Herkunft, Körpergewicht und institutioneller Diskriminierung in Pflegeorganisationen die Diskriminierungskategorien erweitert und darauf verwiesen werden, dass Diskriminierung sich weitaus vielfältiger darstellt und noch nicht in allen Bereichen rechtliche Berücksichtigung findet.
Keinesfalls soll der Eindruck entstehen, dass in diesem Buch alle Diskriminierungsformen enthalten sind oder dass die aufgenommenen Kategorien einer wertenden Rangordnung entsprechen. Wir haben die Abfolge des AGG übernommen und möchten keine Hierarchien bei Diskriminierungen vornehmen, da sie für alle davon Betroffenen gleichermaßen gewaltsam, verletzend und gesundheitsabträglich sind, wenn auch in unterschiedlicher Weise.
Es ist außerdem wichtig zu betonen, dass nicht nur ein spezifisches Merkmal auf Lebenslagen einwirkt. Menschen haben also bspw. nicht nur eine Geschlechtsidentität. Sie gehören auch einer spezifischen Altersgruppe an, haben eine bestimmte soziale und ethnische Herkunft, eine sexuelle Identität, sind (bzw. werden) be_hindert oder nicht, gehören einer Religion an und haben einen Körper, der sich anhand verschiedener Merkmale definieren lässt (Köbsell, 2010). Der Ansatz der Intersektionalität nimmt diesen Aspekt auf und untersucht verschiedene Differenzkategorien sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Dominanz- und Herrschaftsverhältnisse (Winker & Degele, 2009). Der Begriff Intersectionality wurde 1989 von Kimberlé Crenshaw eingeführt (Crenshaw, 1989). Schwarze Frauen kritisierten bereits in den 1970er Jahren den Feminismus weißer Frauen aus der Mittelschicht, da die spezifischen Diskriminierungserfahrungen von Schwarzen Frauen aufgrund ihres Geschlechts in Verbindung mit rassistischer Diskriminierung darin nicht berücksichtigt wurden (The Combahee River Collective, 1978). Crenshaw stellte in juristischen Fallanalysen fest, dass Schwarze Frauen in US-amerikanischen Antidiskriminierungsgesetzen nicht vorkamen, da diese entweder in Bezug auf das Geschlecht für weiße Frauen oder auf die aufgrund des Aussehens zugeschriebene ethnische Herkunft für Schwarze Männer formuliert waren und nur dann Rechtschutz boten, wenn Benachteiligungen auf eine eindeutige Ursache zurückgeführt werden konnten. Durch diese getrennte Betrachtung der Kategorien gender und race blieben Schwarze Frauen unsichtbar, obwohl ihr Risiko, Verletzungen durch Diskriminierungen in beiden Kategorien und speziell in deren miteinander verwobenen Kombination zu erfahren, deutlich erhöht ist (Crenshaw, 1989). Um die Komplexität dieser sich überkreuzenden Diskriminierungserfahrungen sichtbar zu machen, nutzte Crenshaw die Metapher, dass Schwarze Frauen sich auf einer Straßenkreuzung (engl. intersection) befinden, auf der aus unterschiedlichen Richtungen und zu unvorhersehbaren Zeitpunkten Diskriminierungen wie Autos auf sie zukommen, sie erfassen und verletzen. Straßenkreuzungen stehen für die gesellschaftlich verankerten Differenzverhältnisse und die damit verbundenen Diskriminierungserfahrungen, die sich »überschneiden, […] sich wechselseitig verstärken bzw. abschwächen und immer wieder verändern« (Windisch, 2014, S. 147). Das bedeutet auch, dass sie nicht bloß nebeneinanderstehen und additiv zusammengezählt werden können, wie die Begriffe doppelte Diskriminierung oder Mehrfachdiskriminierung annehmen lassen. Die im Anschluss an Crenshaw von Timo Makkonen benannte intersektionale Diskriminierung beschreibt viel mehr die Verwobenheit und das Zusammenwirken mehrerer Diskriminierungsformen in einer Situation (Makkonen, 2002). Bei einem Unfall auf einer unübersichtlichen Straßenkreuzung kann es häufig nur schwer zu verfolgen sein, wie viele und welche Autos genau welche Verletzung verursacht haben und aus welchen Richtungen diese kamen. Und manchmal sind alle Autos gleichermaßen beteiligt (Crenshaw, 1989). Genauso kann es z. B. einer queeren Schwarzen Pflegekraft in einer Situation ergehen, in der ihre pflegerische Unterstützung abgelehnt wird. Sie wird die Ablehnung nicht immer auf ein einzelnes Merkmal zurückführen können, d. h., ob sie von der pflegebedürftigen Person aufgrund von rassistischen Zuschreibungen, ihrer Geschlechtsidentität oder wegen Vorurteilen gegenüber ihrer sexuellen Identität abgelehnt wird oder ob erst das Zusammenwirken dieser verschiedenen Merkmale zur Ablehnung geführt hat.
In der Pflege gibt es eine Vielzahl und Vielfalt solcher Erfahrungsmomente, welche die Relevanz der Thematik dieses Buches deutlich machen. Pflegende brauchen im Umgang mit selbst erlebter Diskriminierung, aber eben auch mit eigenem (bewussten oder unbewussten) diskriminierenden Verhalten, Wissen sowie Reflexions- und Handlungsmöglichkeiten, um sich mit dem Thema Diskriminierung tiefergehend auseinandersetzen zu können.
Dieses Buch soll einen Überblick über verschiedene Diskriminierungskategorien geben und hat eine wissenschaftsbasierte Sensibilisierung zum Ziel. Da es bisher noch keine bzw. kaum Literatur zum Thema Diskriminierung in der Pflege gibt, soll das Buch ein Überblickswerk und Handbuch darstellen.
In den einzelnen Kapiteln wird die jeweilige Diskriminierungskategorie einführend kurz erläutert. Anschließend wird durch die Autor*innen aufbauend auf empirischen Befunden exemplarisch ein Schwerpunkt innerhalb der Kategorie gesetzt, der meist anhand eines konkreten Fallbezugs dargestellt wird. Auf diese Weise sollen diskriminierende Handlungen in der Pflegepraxis, ihre Mechanismen und Auswirkungen hervorgehoben und analysiert werden. Die einzelnen Kapitel schließen jeweils mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Wie bereits erwähnt, setzt sich das Kap. 1 kategorienübergreifend mit institutioneller Diskriminierung im Gesundheitswesen und der Pflege auseinander. Es geht dabei nicht nur um die Auswirkungen von Diskriminierung auf Pflegende und zu Pflegende, sondern auch um die übergeordneten Folgen für Institutionen und wie diese die negativen Effekte in eine positive Sicht auf Potenziale von Vielfalt umwandeln können. In den darauffolgenden acht Kapiteln werden verschiedene Differenzkategorien und die für diese Dimensionen spezifischen Formen von Diskriminierung dargestellt.
Das Kap. 2 widmet sich zunächst der Kategorie Rassismus und ethnische Herkunft und deren tiefliegender gesellschaftlicher Verankerung. Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den verschiedenen Bedingungen, die rassistische Diskriminierung in der Pflege ermöglichen. Dies wird exemplarisch am Beispiel des Anti-Schwarzen Rassismus in der Langzeitpflege herausgearbeitet.
Im Kap. 3 wird der aktuelle Stand von Diskriminierung bezogen auf die Geschlechtsidentität thematisiert. Am Beispiel von Trans*Sensibilität in der pflegerischen Versorgung werden hier derzeit noch bestehende Wissenslücken in Bezug auf Geschlechterdiversität in der Pflegebildung und -ausbildung benannt, um anschließend zu erörtern, wie eine diskriminierungssensible Pflege für trans*, inter* und nichtbinäre Personen gewährleistet werden kann.





























