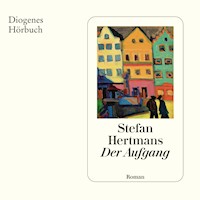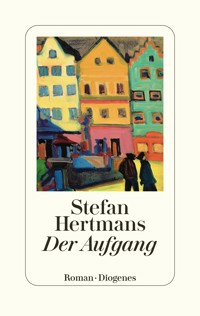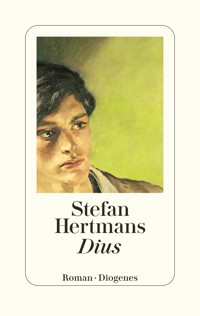
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Dius an seiner Haustür klingelt, ist Anton überrascht und irritiert. Keiner seiner Studenten an der Kunsthochschule ist bisher so ungeniert in sein Privatleben vorgedrungen. Oder hat ihm gar seine Freundschaft und einen Schreibplatz in einem alten Dorfhaus inmitten nordisch rauer Landschaft angetragen. Im Wechsel aus konzentriertem Arbeiten und langen Spaziergängen entwickelt sich dort ein fast altmodisch anmutendes Band der Freundschaft zwischen den beiden Männern, während sich ihre jeweiligen Leben zu Hause nicht ohne Komplikationen weiterdrehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stefan Hertmans
Dius
Roman
Aus dem Niederländischen von Ira Wilhelm
Diogenes
Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen wäre.
Thomas von Aquin
I
Egidius De Blaeser, von allen Dius Prati genannt, war die Frucht einer ehebrecherischen Romanze seiner unternehmungslustigen Mutter mit einem Sizilianer, der, kaum war er Inhaber eines Eiscafés in der belgischen Provinzstadt Heist-aan-Zee geworden, allabendlich die eisigen Augen von Dius’ künftiger Mutter über dem Stracciatella-Eis, dem Gelato al limone und dem Sorbetto al cioccolato schweben sah. Ob er der Verführung ihrer Augen oder ihrer leckenden Zunge erlag, ist nicht überliefert. Die geheime Liaison dauerte immerhin einige Monate, wie die im Rollstuhl eines Pflegeheims sitzende Mutter dem Sohn während eines offenherzigen Moments zitternd gestand, wenige Monate bevor sie ihren westflämischen Geist aufgab. Dius’ Vater mag etwas geahnt haben, wenn er Dius’ pechschwarze Haare mit den hochblonden Locken seiner Frau und den eigenen bleichen Strähnen verglich. Das Eiscafé gab es nicht mehr; Dius meinte, das Ladenlokal sei bereits kurz nach seiner Geburt wieder zu vermieten und sein biologischer Vater spurlos verschwunden gewesen.
Dius’ Eltern besaßen unweit der Küste ein Schuhgeschäft; das große, alte Gebäude ging jenseits des Innenhofs in eine geräumige Werkstatt über, in der Dius’ offizieller Vater seine Zeit vor Regalen voll abgelatschter Schuhe mit Reparaturen verbrachte, während seine Frau sich im Laden mit den Kunden unterhielt – ihre schrille Stimme war oft bis in die Werkstatt zu hören, wenn die Maschinen nicht surrten.
Diese summenden Maschinen gehören zu meinen frühesten Erinnerungen, erzählte mir Dius einmal, der Geruch von Heißkleber, vom Schmieröl auf den Lagern, ich kann es noch immer riechen. Oft habe ich mich mit geschlossenen Augen neben meinen Vater auf den Werkstattboden gesetzt, ich wollte das sirrende Geräusch vom Schleifstein so intensiv wie möglich genießen. Ich öffnete die Augen erst wieder, wenn die Räder aufhörten, sich zu drehen, oder mein Vater anfing, Absätze zu besohlen, und mich das Gehämmere aus der Trance riss.
In diesem Haus habe ich später öfter übernachtet, verbrachte mehrere Wochen tagsüber lesend am Strand und träumte von Büchern, die ich nie schreiben würde. Die Wohnung im zweiten Stock hatte einen kleinen Balkon aus belgischem Kalkstein mit Blick auf die Werkstatt; dort stand ich manchmal und rauchte, weil Rauchen in den Zimmern verboten war. Im altmodischen Wohnzimmer mit den lackierten Holzvertäfelungen hing vor einer rot-goldenen Tapete ein gerahmter Druck, auf dem eine offensichtlich wohlhabende Familie des 19. Jahrhunderts sich um eine kleine Kalesche im Schnee versammelt hatte; darunter stand in roter Schnörkelschrift Snowed up on Christmas Eve – Worte, an die ich mich viele Jahre später ganz unerwartet erinnern würde.
In Heist hatte ich mit Nouka einmal einen trägen Augustmonat lang einen Urlaub verbracht. Sie spielte auf einem kleinen Kassettenrekorder pausenlos Musik von den Gipsy Kings. Das war vor der Erweiterung des Hafens, als Heist noch etwas von seiner ehemaligen Grandeur besaß, eine melancholische Atmosphäre, in der wir an langen Sommerabenden zur Brasserie Coupe de Nice schlenderten, wo Nouka jeden Tag Meloneneis mit gebrannten Nüssen und Schlagsahne aß, die Füße auf einen der weißen Plastikstühle legte und ich ihr liebevoll den Sand zwischen den Zehen wegstreichelte, deren schwarz lackierte Nägel aussahen wie vollkommene, stetig an Größe abnehmende Venusmuscheln.
Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, wie Dius an meiner Haustür klingelte. Ich wohnte damals in der Altstadt eines Provinzorts. Nouka öffnete die Tür; ich saß im oberen Stockwerk und arbeitete an meiner Dissertation, sie wusste, dass ich nicht gestört werden wollte, umso mehr, weil ich zu jener Zeit nicht besonders gut vorankam. Sie rief mich mit den Worten herunter, dass einer von meinen Studenten vor der Tür stehe.
Als ich durch den langen, schmalen Gang zur Tür kam, sah ich einen jungen Mann, pechschwarzes Haar umgab seinen Kopf wie ein dunkler Strahlenkranz. Die obersten Knöpfe seines kragenlosen weißen Hemds waren offen, eine Goldkette glitzerte im Brusthaar. Er sah zugleich abgerissen und elegant aus, ein Kleinkrimineller mit der Haltung eines Aristokratensohns. Er war wohl kaum älter als zwanzig – ich erkannte in ihm sofort den Studenten, der in meiner Vorlesung über den Maler Vittore Carpaccio einmal gerufen hatte, er könne Hunde viel besser malen als der Venezianer, dessen Hunde aussehen wie Scheißhaufen. Der ganze Hörsaal verstummte erschrocken, bevor sich vereinzelt ein Kichern regte. Dius wurde feuerrot, sprang auf und rannte aus dem Saal. Mir selbst verschlug es für einen Augenblick die Sprache angesichts der Tatsache, dass sich aus einer im Grunde lächerlichen Bemerkung eine derart peinliche Situation entwickeln konnte. Um meine Konzentration war es geschehen – Carpaccios Hunde waren in der Tat etwas merkwürdig und zogen plötzlich die ganze Virtuosität des großen Malers ins Lächerliche. Man muss sich nur den merkwürdigen Köter auf dem bekannten Porträt Zwei wartende Venezianerinnen anschauen: Männchen machend, die Vorderpfoten auf die Hände der leer vor sich hinstarrenden Dame am rechten Bildrand gestützt, blickt er den Betrachtenden mit jener unterwürfigen Gekränktheit an, die als abstoßend empfinden muss, wer das devote, hysterische Wesen der Hunde ohnehin nicht leiden kann. Ich spürte, dass ich meine Studierenden nicht mehr zu fesseln vermochte, schaltete den Projektor aus und beendete die Vorlesung vorzeitig. Als ich die Akademie verließ, sah ich mich um, konnte Dius aber nirgendwo entdecken.
Nun aber hatte Nouka diesem noblen Unbekannten unsere Hautür gastfreundlich geöffnet, der jetzt mit einem etwas provokanten Grinsen vor mir stand und sagte: Darf ich reinkommen? Ich habe eine Überraschung für Sie.
Dass ein Student an der Tür des Dozenten klingelt, als wäre er ein reicher, freigebiger Onkel, war derart ungewöhnlich, dass es mich einen Moment lang verwirrte. Dius sah mich mit einem Anflug heiterer Arroganz abwartend an. Ich hätte ihn jetzt höflich wegschicken und streng tadeln können, dass es höchst unangebracht sei, auf diese Weise in die Privatsphäre eines Dozenten einzudringen, doch bevor ich merkte, was ich tat, hatte ich ihn mit einer Geste, die zum Ausdruck bringen sollte, dass ich wohl keine andere Wahl hätte, schon aufgefordert einzutreten. Damit war der Ton gesetzt. Dius betrat das Wohnzimmer, ich bat ihn, Platz zu nehmen. Dann brach es aus ihm heraus.
Ihm sei aufgefallen, dass ich etwas überarbeitet sei … Nein, er wolle mir nicht zu nahe treten, Entschuldigung, er meine es nur gut, aber ich hätte ihn nun einmal … tief beeindruckt, oder, warten Sie, nein, ähm … Das mit den Hunden tue ihm leid – eigentlich … So oft habe er in meinen Seminaren Gedanken gehabt, die er sich nicht zu sagen getraut habe … und deshalb habe er sich jetzt gedacht, nein, das stimme auch nicht ganz, im Grunde ist es so …
Ich möchte Ihr Freund sein, schoss es aus ihm heraus. Er wurde knallrot und verstummte.
Verblüfft starrte ich den jungen Mann an; er versuchte, in einer Mischung aus Draufgängertum und Verlegenheit die Fasson zurückzugewinnen, indem er die Fingerspitzen aneinanderpresste und mich zögernd ansah. Der Anblick eines Menschen in seiner völligen Arglosigkeit wirkt bisweilen wie eine Offenbarung. Jede Hierarchie zwischen uns zerbröckelte. Ich war Anfang dreißig, uns trennten höchstens zehn Jahre. Jemanden um die Freundschaft zu bitten war ein starkes Stück – ganz so, als bäte ein kleiner Junge das Nachbarmädchen darum, mit ihm ›gehen‹ zu dürfen, was im Grunde darauf hinauslief, sich von nun an die Süßigkeiten zu teilen.
Sofort schoss mir durch den Kopf, wie viele Abhandlungen es doch zum Thema Freundschaft gibt – sie ist, abgesehen von der Liebe, vielleicht eines der größten Themen der Kulturgeschichte; Ovid schrieb weltberühmte, teils verzweifelte Gedichte für Freunde, die er verloren hatte, Senecas Meinung nach ist ein Freund so etwas wie ein alter ego, für Cicero ist die Freundschaft moralisch gar der Liebe überlegen, da sie eher auf der bewussten Entscheidung für einen Menschen beruht als auf der blinden Leidenschaft für dessen erotische Ausstrahlung – doch in diesem Moment fiel mir einzig ein, was Michel de Montaigne über seine Freundschaft zu Étienne de La Boétie geschrieben hatte: »Weil er er war; weil ich ich war.« Etwas in mir gab sich mit jener Unbesonnenheit geschlagen, mit der man unübersichtlichen Situationen oft zu begegnen pflegt: quia absurdum – weil es keinen Grund dafür gibt.
Aha, sagte ich, räusperte mich und schwieg.
Zwei laut miteinander plaudernde Studierende gingen die schmale Straße vor meinem Haus entlang. Ich wohnte nur wenige Hundert Meter vom Institut entfernt, an dem ich lehrte, und war es gewohnt, Studierende von mir vor meinem Haus vorbeigehen zu hören. Doch nun saß einer von ihnen in meinem Wohnzimmer, nachdem er ziemlich unverfroren bei mir geklingelt und mich damit irgendwie kalt erwischt hatte, denn ganz offensichtlich vermochte ich dem nichts entgegenzusetzen.
Ich will nicht aufdringlich sein, sagte er, als die Stille unbehaglich wurde, aber oben in den Poldern im Norden von Belgien, nicht weit von der niederländischen Grenze, steht mir ein Haus zur Verfügung, in dem Sie konzentriert arbeiten könnten. Ich habe gehört, dass Sie gerade an Ihrer Dissertation schreiben. Sie sehen oft so … nun ja, müde aus, und da dachte ich …
Er hatte den Kopf gesenkt und blickte von unten zu mir herauf, als erwarte er einen Hieb oder eine grobe Zurückweisung.
Ich fürchte, dass ich ihn die ganze Zeit nur erstaunt angestarrt habe – in mir mischten sich Gefühle von Verärgerung, Faszination und Ungeduld. Ich erinnerte mich an einen Text, den Dius zu Anfang des Semesters abgegeben hatte; darin vergleicht er sich mit einem Fohlen, das sich auf eine Weide voller starrender Stiere verirrt hatte; offenbar fühlte er sich unter seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen ähnlich fremd, einsam und fehl am Platz. Seine Handschrift war seltsam unstet, allerdings schrieb er auch mit einer Rohrfeder, wodurch die Buchstaben breit ausfielen und mit ungleichmäßigem Tintenfluss schräg über das Blatt tanzten, als wären sie im Sturm bergaufwärts gegen den Wind geschrien worden; sein kurzer Aufsatz nahm vier Blätter in Beschlag, wofür ein gewöhnlicher Studierender lediglich eines benötigt hätte. Kindlich und naiv war sein Geständnis, und gleichzeitig sprach eine außerordentliche Schönheit daraus. Ich hatte seinen Text in eine Schublade gelegt, statt ihn, wie vorgeschrieben, mit den Arbeiten der anderen Studierenden ins Archiv zu geben. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich seine Arbeit hätte bewerten sollen. Die Aufgabe für die Studierenden war gewesen: Positionieren Sie sich im heutigen künstlerischen Klima. Dius jedoch schrieb über die Temperafarbe des 15. Jahrhunderts, über den Goldenen Schnitt in den Polderlandschaften und über seinen Wunsch, nach Ushuaia zu ziehen, um Lamas in freier Wildbahn zu beobachten. Vielleicht war sein Text aber auch die raffinierte Parodie eines konzeptuellen Kunstmanifests, mit dem er meine Aufgabenstellung lächerlich machen wollte.
Die vier ungelenk vollgekritzelten Blätter, die mir jetzt, nach all den Jahren, eher ein Hilferuf als ein Aufsatz zu sein scheinen, müssen noch in irgendeiner Schreibtischschublade liegen.
Ich habe in den Poldern ein Malatelier, sagte er, es ist ein altes Dorfhaus, das nicht mehr benutzt wird. Es grenzt an einen verwahrlosten Park mit einem kleinen Schloss. Ich könnte Ihnen dort einen schönen Raum frei machen, wo Sie sich zurückziehen und in aller Stille arbeiten können. Miete brauchen Sie keine zu bezahlen. Ich werde Sie nicht stören. Und für das Essen sorge ich auch.
Er senkte wieder den Kopf und schaute mich unter den Augenbrauen hervor mit Spannung und Erwartung an, als fürchtete er, dass ich ihn gleich hinauswerfen würde.
Weil ich ohne Antwort weiter still vor mich hin starrte, nahm er seinen ganzen Mut zusammen und setzte alles auf eine Karte: Sollen wir nächsten Mittwochnachmittag hinfahren? Es ist ungefähr zwanzig Kilometer von hier.
Ich stieß ein kurzes, ungläubiges Lachen aus.
Ich habe keine Ahnung, was mich ritt – ich konnte mir Noukas bedenkliches Kopfschütteln bereits blendend vorstellen; sie würde mich fragen, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte: Ich, der überarbeitete Dozent, der für nichts Zeit hatte, und schon gar nicht für romantische Ausflüge mit ihr, plante eine Landpartie, und das nota bene mit einem Studenten, statt die wertvolle Zeit für etwas Sinnvolleres zu nutzen?
Aber es war zu spät; irgendwo in meinem Kopf hatte sich etwas aufgetan und frischen Wind hereingelassen, ein verheißungsvolles Aufschimmern unverhoffter Möglichkeiten versprach, mich aus meinem selbst verschuldeten Lebenstrott zu befreien.
Gut, sagte ich so beiläufig wie möglich, warum nicht.
Und da er nun seinerseits schwieg, fügte ich, nun selbst fast verlegen, hinzu: Also abgemacht. Wo treffen wir uns?
Ich werde Sie abholen, sagte er. Ich fahre. Nächsten Mittwoch um zwei Uhr?
Ich schob ihn zur Tür hinaus und zuckte entschuldigend mit den Achseln, als Nouka ihren Kopf aus der Wohnzimmertür steckte und mich fragend ansah.
Ich verschwand in mein Arbeitszimmer und vertiefte mich in Kants Aussagen über meine Urteilskraft: Denn, ist der die Kausalität bestimmende Begriff ein Naturbegriff, so sind die Prinzipien technisch-praktisch; ist er aber ein Freiheitsbegriff, so sind diese moralisch-praktisch.
Was zum Teufel soll ich damit?, fragte ich mich verzweifelt und ging mir einen Kaffee kochen.
Im klapprigen Transporter, den Dius nur seine ›Camionette‹ nannte und mit dem er mich an jenem Mittwoch ins Polderdorf Ganzevliet fuhr, lag ein Haufen Zeugs. Aufgerissene Gipssäcke, zerbrochene Keilrahmen, Meißel, Handsägen und Hammer, eine Rolle Maschendraht, aufgerollte Leinwand und mittendrin ein altes Ölfass. Alles polterte wild durcheinander und verursachte zusammen mit dem lärmenden Brüllen des altersschwachen Motors einen so ohrenbetäubenden Lärm, dass wir kaum ein Wort wechseln konnten; die Federung in den Sitzen war so gut wie nicht mehr vorhanden, bei jedem Straßenhubbel war es, als bekämen wir einen Tritt in den Hintern. Plötzlich hielt Dius den Schalthebel in der Hand, doch er grinste nur, stieß ihn heftig in die Öffnung zurück, rührte kurz darin herum, schaltete und fuhr weiter, als wäre nichts geschehen. Wir kamen zum ehemaligen Militärgebiet kurz vor Eikenlo, wo Dius auf die verlassenen Baracken zufuhr, das Auto parkte und meinte: Lass uns erst mal einen kurzen Spaziergang machen.
Ich war zu perplex, um darauf zu reagieren. Die Sonne stach durch die wässrigen Wolken, ich roch den scharfen Geruch der Pappeln, und bei einem schlammigen Graben flatterten und flirrten an langen Zweigen die Blätter einer Silberpappel. Ein Taubenschwarm taumelte flügelklatschend über unseren Köpfen. Ich zitterte vor Kälte, steckte die Hände in die Taschen meines dünnen Jacketts und stapfte hinter Dius her, grollend jetzt und voll Bedauern, dass ich nicht in meinem warmen Arbeitszimmer geblieben war, um zu lesen, was es weiter über meine Urteilskraft zu sagen gab.
Die Achtzigerjahre hatten gerade begonnen, es gab noch keine Handys, das Internet existierte noch nicht, die Schlagzeilen der Nachrichten wurden beherrscht von den Anschlägen einer kommunistischen Terrorzelle auf Ziele des NATO-Hauptquartiers bei Evere unweit von Brüssel.
Der Luftdruck fiel rasch, die Sonne spendete kaum Wärme. Aber der Duft des sauren, feuchten Waldbodens kitzelte mir in der Nase; wann hatte ich solch frische Natur gerochen, seit ich das dunkle, hohe Haus in der Altstadt bezogen hatte? Meine Lungen schienen sich zu öffnen und mit ihnen meine stets verschlossenen, viel zu geschäftig jagenden Gedanken. Nachdem wir ungefähr eine Viertelstunde über Asphaltwege gegangen waren, erreichten wir ein Waldstück, das recht wild und verlassen aussah. Dius ging vom Weg ab und sprang über einen Graben. Er winkte mir. Mit einem unbeholfenen Sprung landete ich neben ihm; ich musste mich kurz an seiner Schulter festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Er zeigte auf einen dunklen Baumstumpf mit sichtbar durchgesägten Wurzeln und inmitten von Spuren, die darauf hindeuteten, dass versucht worden war, den Strunk wegzuschleifen. Dius sah mich mit strahlenden Augen an.
Vogelaugen-Ahornwurzel, sagte er begeistert. Dieser Wurzelstock ist pures Gold wert. Hilfst du mir, ihn zum Auto zu bringen? Allein schaffe ich es nicht. Ich verkniff mir jeden Kommentar. Dius bückte sich, zerrte den Stumpf frei und hob ihn an einer Seite hoch.
Nimmst du ihn von der anderen Seite?
Und als sein Blick auf meinen verärgerten Gesichtsausdruck fiel: Das ist ein ganz seltenes Holz, nur die alten Waldarbeiter kennen es noch. Ich will es in ganz dünne Scheiben schneiden und als Furnier verwenden. Ich baue dir daraus einen Tisch, an dem du schreiben kannst. Du wirst sehen, es wird etwas ganz Einzigartiges. Es wird mein Geschenk für dich.
Ich betrachtete den modrigen, teils mit Moos bewachsenen Wurzelstumpf. In mir regte sich Widerwille angesichts der unsinnigen Wucherungen in der obszönen, dunklen Blöße des Holzes, Symbol fast für die Sinnlosigkeit des ganzen Unterfangens hier, für meine Fügsamkeit, mich dafür einspannen zu lassen, und am Ende sogar für die Richtungslosigkeit meines ganzen bisherigen Lebens.
Von der halbstündigen Plackerei ist mir nicht nur die kalte Schmiere auf meinen harte Arbeit nicht gewohnten Händen in Erinnerung geblieben, sondern auch, dass das unförmige Holz dauernd wegrutschte, dass wir in den Pausen keuchten und nach Luft schnappten, bevor wir den verfluchten Brocken aufs Neue hochhoben, dass mir der Rücken wehtat, dass Dius lachte, mich immer wieder anspornte und sagte, dass wir es bald geschafft hätten – und dass ich am Ende Blasen an den Fingern hatte. Nachdem wir den Stumpf mit großer Mühe ins Auto gehievt und Eikenlo hinter uns gelassen hatten, hielt Dius unterwegs bei einem Imbiss und kam mit zwei gegrillten Hähnchen und einer großen Portion Bratkartoffeln zurück. Pfeifend stieg er wieder in den Transporter, wo ich auf dem Beifahrersitz die Nase ziemlich voll hatte. Wir polterten über eine alte Pflasterstraße, vorbei an sumpfigen Wiesen und Alleen aus vom Polderwind schräg wachsenden Pappeln. Der Baumstumpf im Transporterraum übte derweil ohrenbetäubend Kickboxen mit dem Ölfass. Je länger wir fuhren, desto fröhlicher wurde Dius.
Was bedeutet es eigentlich, poetisch zu leben? Bevor ich das alte Dorfhaus in Ganzevliet betrat, hatte ich mir diese Frage noch nie gestellt. Das Haus war angefüllt mit einer disparaten Anhäufung bunt zusammengewürfelter Gegenstände, ein wildes Durcheinander aus Möbeln, Musikinstrumenten, Nippes, Stapeln wacklig aufgetürmter Bücher; außerdem waren da noch zwei exotische Kris, ein kleiner Schädel, wohl von einer Ziege, daneben der größere eines Menschen; ein rauer, wie eine Ingwerknolle geformter Granitstein, auf dem ein dickes Brett aus unbearbeitetem Holz lag – das alles kam mir in seiner zufälligen Form und Willkür wie eine geheime Schatzkammer vor und machte auf mich den unmissverständlichen Eindruck von etwas, das man mit einiger Berechtigung Inspiration nennen könnte – eine materialisierte Wolke aus Zufällen, aus einzelnen Objekten, die durch ihre Unbehaustheit auf eine Existenz als bloßes Ding reduziert worden waren. Was für ein Kontrast dagegen mein Arbeitszimmer zu Hause, das mit den schlichten Regalen voll alphabetisch geordneter Bücher und dem stets ordentlich aufgeräumten Schreibtisch aussah wie eine akademische Unterart der Fantasielosigkeit.
Hinten im Raum standen ein Harmonium und daneben eine große Staffelei mit einem unfertigen Bild, eine augenscheinlich mythische Szene, die ich eher im 16. Jahrhundert als im späten 20. verortet hätte. Sogleich stieg mir der Geruch von Terpentin, Leinöl und Sikkativ in die Nase.
Ich stellte mir vor, wie in früheren Zeiten die Honoratioren und Bürger der Umgebung in diesem jetzt feucht riechenden Saal Aufführungen des Laientheaters oder Konzerte der örtlichen Blaskapelle besucht hatten – darauf nämlich ließen die Tuba, das Alphorn und die vermutlich defekte Klarinette schließen. Letztere lag auf einem von Staub bedeckten Sekretär, welcher nur noch drei Holzbeine besaß und statt des vierten einen Stützstab aus verrostetem Eisen. Ein kleiner Vogel hatte sich in den fahlweißen Dachstuhl hoch über uns verirrt und knallte, durch unser Erscheinen aufgeschreckt, nun schmerzhaft gegen eines der hohen Kippfenster. Wie ein nasser Lappen stürzte er herab und ging im unübersichtlichen Haufen der Gegenstände sofort verloren. Ich beobachtete das Ganze mit offenem Mund, während Dius aus dem kleinen Vorraum, der früher wohl eine Art Empfangszimmer gewesen war und den er zu einer Behelfsküche umfunktioniert hatte, Besteck, Teller und Gläser holte und damit eine auf Böcken ruhende Tischplatte deckte. Nachdem er die Kartoffeln auf zwei Teller verteilt und das Hähnchen auf eine alte, mit Eichenlaub verzierte Zinnplatte gelegt hatte, ging er zu einem Plattenspieler, und kurze Zeit später schallte Musik des göttlichen Orlando di Lasso durch den Saal – Vinum bonum et suave. Ich hatte eine ausgesprochene Schwäche für Lassos Musik, ich lauschte ihr des Nachts, wenn ich verzweifelt Trost suchte für mein so wenig heldenhaftes Leben. Mir verschlug es für einen Moment den Atem; Dius lud mich mit einer großzügigen Geste ein, Platz zu nehmen, stach eine Fleischgabel in eines der Hähnchen, legte es vor sich auf den Teller und machte sich darüber her. Es war fünf Uhr nachmittags; draußen versank langsam die Sonne. Durch die großen nach Norden gehenden Fenster sah ich einige bereits gelb verfärbte Baumwipfel schwanken, darüber trieben eiligst tief liegende, gold geränderte Wolken. Der Wind donnerte dumpf um das hohe Dach des alten Gebäudes.
Von den Ereignissen dieses Tages blieb mir vor allem der Anblick des überwältigenden Dämmerlichts über den Poldern in Erinnerung – sieht aus wie ein ausgelaufener See, sagte Dius. Ich folgte ihm zu einer Weißdornhecke, in die er ein rundes Guckloch geschnitten hatte: Dahinter zogen sich nasse Ackerfurchen wie die Schraffuren eines Kupferstichs bis zum Horizont und bildeten die mit einem Rahmen versehene Landschaft eines Traums. In der Ferne zeichnete ein riesiger Schwarm Stare surreale Wolken in die Luft. Wir kamen zur Rückseite des Gebäudes, hier war der Giebel oben offen, und ein großer Heuboden erstreckte sich über die gesamte Fläche des darunterliegenden Saals. Davor stand eine Leiter, sie war nach uralter Art aus dünnen Baumstämmen, viereckigen Nägeln und inzwischen verrostetem Eisendraht gefertigt. Wir traten einige Schritte zurück und konnten so ein wenig auf den Heuboden sehen, wo gräuliches Stroh in lockeren Haufen die Dielen bedeckte. Wenn ich dort oben arbeite, sagte Dius, ziehe ich die Leiter hoch, damit mich keiner stört.
Wer soll dich hier denn stören?, fragte ich einfältig.
Das wirst du schon noch merken, sagte er und ging weiter.
Am Ende des Grundstücks kamen wir zu einem flachen Bach. Dius balancierte auf einem Holzbrett zur anderen Seite, ich folgte ihm: Wir kamen in den Schlossgarten. Durch die Bäume war ein dunkles Gebäude zu sehen. Verspielt spiegelten sich die rot beschienenen Abendwolken in den großen Fenstern der ersten Etage und riefen einen seltsamen Lichteffekt hervor, der den Anschein erweckte, als brannten im Haus sämtliche Lichter. Eine wie ein herausgerissener Engelsflügel hoch über den leicht sich wiegenden Parkbäumen schwebende, letzte Wolke gemahnte uns daran, dass der Nachmittag ein Ende nahm.
Hier wohnt schon lange keiner mehr, erklärte Dius, eigentlich ist es gar kein Schloss, sondern eine alte Kommandantur, du weißt schon, so ein Gutshaus aus Napoleons Zeiten, dazu gehören mehr als zehn Hektar Land.
Er führte mich in die Tiefe des überwucherten Parks, wo eine verfallene Pergola stand. Ein kalter Wind erhob sich, der erste Atem der Nacht. Zwei kleine Vögel flüchteten vor unseren Füßen her und verschwanden im fahlgrauen Brombeergewucher. Es roch nach Feuer und laubbedeckter Erde. Mich schauderte vor Kälte. Unter der Pergola standen einige hässliche und unfertige Büsten wie Totems aus einer anderen Zeit. Das Dämmerlicht verlieh ihnen etwas Unheilvolles. Ich stellte lieber keine Fragen.
Wir kehrten zum Dorfhaus zurück. Inzwischen war es dunkel geworden; im großen Saal schienen die Gegenstände aufeinander zu gekrochen zu sein und bildeten nun eine undifferenzierte Masse; durch die hohen Fenster zog es mächtig. Auf dem Weg zurück in die Stadt sprachen wir kaum. Als ich zu Hause ankam, war Nouka nicht da; auf dem Tisch lag eine Notiz: Bin mit einer Freundin zum Tanzen. Bis morgen.
Aber auch am nächsten Morgen war sie nicht da.
Dius sah ich in den nächsten Wochen nicht mehr. Er schwänzte meine Lehrveranstaltungen und verpasste einen Abgabetermin für eine Arbeit. Zu dieser Zeit behandelte ich gerade den im 16. Jahrhundert lebenden italienischen Maler Jacopo da Pontormo, berühmt für seine großen religiösen Gemälde, darunter eine atemberaubende Kreuzabnahme. Ich zeigte den Studierenden ein Dia der durch und durch großartigen Szene und wies sie dabei auf die von den Blicken der einzelnen Figuren ausgehenden, schräg über das ganze Gemälde verlaufenden Linien hin. Ich fragte, was Pontormo mit diesen zerrütteten Linien und Blickrichtungen eigentlich sagen wollte. Im verdunkelten Hörsaal schien das strahlende Blau der Trauergewänder fast fluoreszierend aufzuleuchten. Ich richtete die Aufmerksamkeit des Auditoriums auch auf die merkwürdige Figur am äußersten Bildrand, die uns als einzige direkt in die Augen sah. Das ist Pontormo, erklärte ich. Er blickt uns an, als wollte er fragen: Und? Was haltet ihr von diesem Bild? Ein paar der Studierenden betrachteten die Abbildung gebannt; ein auf eine Leinwand projektiertes Gemälde leuchtet noch verführerischer als das Original, als befände sich hinter der Leinwand ein Licht, das unmittelbar aus einer anderen Welt herüberleuchtete. Woher nahm der Maler den Mut, das Hauptinteresse von der toten Christusfigur abzulenken? War das in der Zeit einer höchst misstrauischen Inquisition nicht riskant? Verbirgt sich im Dargestellten möglicherweise eine geheime Nachricht, die wir heute nicht mehr verstehen? War Pontormo der Ansicht, dass der Glaube keinen unverrückbaren Halt mehr bot, oder wollte er uns sagen, dass die Trauer über den Tod des Heilands die Welt in jeder Hinsicht aus dem Gleichgewicht gebracht habe? Einige Studierende hielten den Blick starr auf ihre Pulte gerichtet, voller Angst, ich könnte sie aufrufen. Doch der eigentliche Grund meiner verärgerten Fragerei war, dass Dius meine Seminare so offensichtlich schwänzte – Seminare, in denen ich ihn gerne mitsamt seiner auf den Heuboden führenden Leiter durch meine Ausführungen provoziert hätte. Als ich zwischen meinen Salven von Fragen kurz Luft holte, nutzte ein Student die Chance, sich laut zu räuspern, als wollte er mir damit sagen, dass ich wohl doch ein wenig zu weit gehe. Das reizte mich jedoch nur, mit der Fragerei fortzufahren, leicht pikiert angesichts des Schweigens der Zuhörenden. Konnte sich ein Maler im Florenz des 16. Jahrhunderts solche Kapriolen überhaupt erlauben? Die religiösen Ikonen aus den früheren Jahrhunderten stellten gewöhnlich den Glauben als etwas Unerschütterliches dar, wobei die Blicke der Heiligen starr auf das Ewige gerichtet waren. Bei Pontormo, so erklärte ich weiter, entdecken wir aber ein Durcheinander an Perspektiven, die sich gegenseitig aus dem Lot bringen. Das erweckt beim Betrachtenden ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit und der Bedrohung. Nun zeigte ich das Dia einer Rötelzeichnung, auf der der Maler sich selbst nahezu nackt abgebildet hatte, ganz wie ein zeitgenössischer Popstar, sein Körper ähnlich ausgezehrt wie der von Iggy Pop; er blickt provozierend und deutet mit ausgestrecktem Arm fast anklagend auf uns, als wollte er sagen: Schaut erst mal auf euch selbst, bevor ihr mich verurteilt. Daraufhin führte ich weiter aus, dass Pontormo in seiner Zeit ein Einzelgänger gewesen sei, ein Mann, den der große Künstlerlebensbeschreiber Giorgio Vasari als Exzentriker und schwierigen Charakter geschildert habe. Außerdem galt er als Geizhals und Nörgler, und in seinen Tagebücher schrieb er eher über Alltäglichkeiten wie das Essen oder seine Verdauung als über die große Kunst; allbekannt ist die Anekdote, wonach er auf einem Dachboden gemalt habe, dessen Leiter er hochzog, um nicht gestört zu werden. Doch welch erhabene Bilder hat dieser Maler geschaffen! Sollte der Charakter eines Künstlers bei der Beurteilung dessen, was um der Schönheit willen entsteht, überhaupt eine Rolle spielen? Ich suchte in den Gesichtern der Studierenden nach einer Reaktion. Vergebens; ich sah, wie mehrere einander zuzwinkerten, als wollten sie sich damit zu verstehen zu geben, dass der Typ da vorn ihnen gehörig auf die Nerven gehe. Andere kritzelten auf ihrem Papier herum. Sollte ich es für heute also besser dabei belassen? Ich zeigte noch einige weitere Dias mit Gemälden und fragte die Studierenden, ob sie sich vorstellen könnten, dass Pontormo seine eigene Leiter in einem Bild darstellen würde? Auch wenn sich meines Wissens nach auf keinem seiner Bilder eine Leiter fand, wäre es durchaus denkbar, dass er für eine Kreuzabnahme die eigene Leiter zum Modell herangezogen hätte. Oder ist es unpassend, Details des eigenen Lebens in ein Bild zu schmuggeln? Würden Sie, so fragte ich weiter, Ihr Schlafzimmer zeichnen oder beschreiben? Nun kam etwas Bewegung in die jungen Leute. Eine Studentin antwortete bissig, dass sie diese Frage unanständig finde und dass es mich nichts angehe, wie es in ihrem Schlafzimmer aussehe. Ich wollte gerade antworten, dass ich es keineswegs so gemeint habe, als Dius hinten im Saal auftauchte. Er hüstelte leise, nickte mir wie entschuldigend zu und setzte sich in die hinterste Reihe.
Ein junger Mann in der ersten Reihe beschloss dann doch, etwas zu sagen. Ich vermute, begann er, dass man als Maler niemals das darstellt, was einen zum Bild motiviert, sondern das, was es wert ist, betrachtet zu werden: die Bedeutung, die Absicht, das zu einem bestimmten Zweck geschaffene Bild. Warum also sollte Pontormo seine eigene Leiter in einer Kreuzabnahme abbilden? Diese launige Anspielung auf sein eigenes Leben hätte doch nur von der Essenz des Ganzen abgelenkt, oder?
Eine Studentin mit rabenschwarzen Locken fügte hinzu, dass etwas doch erst durch die Abbildung eine Bedeutung erlange und dass sich der Wert eines Gemäldes weniger aus der Wahl des Sujets ergebe als aus dessen Ausarbeitung. Ich spürte, wie mein Adrenalinspiegel stieg: Endlich machten sie den Mund auf!
Es folgte eine recht lebhafte Diskussion über die Frage, ob Künstler sich von der Welt absondern sollten, um diese besser darstellen zu können. Ich bin eher für exgagement als für engagement, rief einer: Wenn man den Anforderungen des Alltags aus dem Weg geht, bietet sich sofort etwas Tieferes, etwas Besseres an, und man reagiert nicht wie ein Pawlow’scher Hund auf einen bloß äußeren Reiz. Sofort erhob sich ein Chor widersprüchlicher Meinungen, und einige der Studierenden blieben auch noch über das Ende der Stunde hinaus, um die Diskussion fortzusetzen.
Als ich nach Hause kam, stand Dius vor meiner Tür. Es sei Mittwochnachmittag. Das stimmt, antwortete ich, aber heute ist mir nicht danach, ich muss noch arbeiten. Dius blickte mich lange an, nickte und verschwand.
Zwei Wochen später fuhr ich in meinem eigenen Auto nach Ganzevliet. Ich hatte Dius in der Zwischenzeit nicht mehr gesehen und bedauerte meine schroffe Zurückweisung. Schließlich war er an jenem ersten Mittwochnachmittag, an dem er mich einfach entführt hatte, höflich und großzügig gewesen. Ich machte mir Sorgen wegen seiner Resultate für das laufende Semester: Er hatte bei mir keine Arbeit abgegeben, und in den Ateliers war er auch nicht gesehen worden.
Ich mache einen Nachmittagsspaziergang, sagte ich zu Nouka. Sie hob nicht mal den Kopf, war vollkommen in ihre Arbeit vertieft.
Ich fand es merkwürdig, den Weg zum Dorfhaus allein zu fahren, ich kam mir vor, als bewegte ich mich auf verbotenem Terrain. Die flämische Landschaft zeigte sich mir unverfälscht: zerschnitten von Straßendörfern, zersiedelt, voller banaler Gebäude, gewaltsam von Zäunen zerrissen, hier und da ein verlorenes Stück Wiese, auf der einige tranige, dickärschige Bullen standen, einige karge Baumgruppen, die als Wald herhalten mussten, vereinzelte Industriehallen, ein Supermarkt neben einer Tankstelle, Villen der unterschiedlichsten Baustile, seelenlose Behausungen, hässliche Gebäudekomplexe und schäbige Reihenhäuser, die sich scheinbar aneinander festhalten mussten, weil ihnen schlecht geworden war unter den erstickenden Abgaswolken der stetig vorbeidonnernden LKWs – und dazu das, was man in Flandern ›den buiten‹ nannte, die end- und seelenlosen Vororte. Erst nach etwa zwanzig Kilometern öffnete sich die Landschaft, und ich konnte durchatmen.
Als ich ankam, sah ich Dius’ Camionette vor dem großen Tor stehen. Am Ende der Auffahrt stand das Ölfass, daneben lag eine Schleifscheibe. Ich ging ins Haus – im Saal war niemand. Alles lag noch so da, wie ich es bei meinem ersten Besuch angetroffen hatte. Durch die Kippfenster pfiff der Wind; das Polderlicht stand niedrig, blendete und glitzerte durch das alte Fensterglas herein. Über mir hörte ich ein Poltern. Ich erinnerte mich, dass man nur durch den offenen hinteren Giebel auf den strohbedeckten Dachboden gelangen konnte. Also ging ich um das Gebäude herum – das hohe Poldergras war noch nass von den letzten Nächten, in denen es unaufhörlich geregnet hatte – und sah, dass die Leiter zum Heuboden hochgezogen war. Von oben hörte ich ein Stöhnen, Seufzen, Flüstern, auch das unterdrückte Kreischen einer weiblichen Stimme; ich war gerade im Begriff, Dius zu rufen, als mir sein Name im Halse stecken blieb. Ich hörte, dass das Seufzen und Stöhnen in immer kürzeren Abständen erfolgte und lauter wurde, dass die weibliche Stimme anfing, unverständliche Worte auszustoßen, ich realisierte, dass ich Zeuge eines heftigen Liebesakts war und dass ich mich eigentlich sofort hätte umdrehen und gehen sollen, statt hier wie festgenagelt stehen zu bleiben und zu lauschen; ich rührte mich einige Minuten lang nicht vom Fleck, ergriffen von einem merkwürdigen Gefühl der Verlassenheit, ich blickte mich um – sah den Garten, die alten Türen in der Hauswand, den Dunst über dem kleinen Bach, den aufsteigenden Nachmittagsnebel, hörte das heisere Krächzen von Krähen und Elstern, den Traktor, der sich auf einem benachbarten Acker durch den Schlamm kämpfte – das alles erschien mir, mitsamt dem hoch erregten Stöhnen über mir, restlos unwirklich, als befände ich mich nicht länger in meinem eigenen Leben, sondern wäre durch einen unsichtbaren Spiegel gestiegen und hätte mich im Dahinter hoffnungslos verlaufen. Die Laute auf dem Heuboden wurden allmählich leiser, die Stimmen klangen gedämpfter und intimer, ich hörte die weibliche Stimme schluchzen, hörte das Stroh rascheln. Nun musste ich zusehen, dass ich wegkam. Wie um einer drohenden Gefahr zu entrinnen, rannte ich zur Vorderseite des Gebäudes und die Auffahrt hinunter, sprang in mein Auto und startete den Motor. Ziellos fuhr ich über die Landstraßen, die Pappeln rochen süßsauer und verdoppelten sich in den spiegelglatten Oberflächen der stillen, schwarzen Wassergräben; die Sonne hatte sich hinter gleißendem Nebel versteckt. Im diesigen Licht über den leeren Feldern sah ich einige Tauben kippelnd flattern, mal waren sie ein weißes, mal ein dunkles Flockengestöber. Ganz langsam verwandelte sich der Himmel in das prachtvolle Firmament eines niederländischen Gemäldes aus dem 17. Jahrhundert. Ich kann nur noch in Gemälden denken, dachte ich mir. Ähnlich wie der französische Schriftsteller Stendhal nur diejenigen Landschaften als solche wahrnahm, die er vorher auf Kupferstichen gesehen hatte.
Als ich Dius eine Woche später wiedersah – er lehnte an der Wand neben dem Eingang zur Akademie und wirkte mehr denn je mutterseelenallein –, sagte ich ihm, dass ich in Ganzevliet gewesen sei. Oh, sagte er, an dem Tag war ich gar nicht da. Ich öffnete den Mund, um zu antworten, schloss ihn aber unverrichteter Dinge wieder.
Hast du deine Seminararbeit fertig?, fragte ich ihn.
Er sah auf seine Füße und antwortete: Ich werde sie dir nächste Woche in Ganzevliet vorlesen.
Bevor ich fortfahre, muss ich noch etwas gestehen.
Damals litt ich selbst stark unter Zweifeln und Unsicherheit. Ich war mit einer neuen Kollegin mehrmals etwas trinken gegangen; sie unterrichtete Fotografie, war etwa fünf Jahre jünger als ich, hochintelligent und empfindsam, unsere Gespräche waren vom ersten Treffen an anregend und inspirierend. Ehe ich michs versah, war ich verliebt und betrog Nouka mit dieser etwas streng erscheinenden jungen Frau, die sich, kaum war die Tür irgendeines gemieteten Zimmers hinter uns ins Schloss gefallen, überraschend schnell aller Kleider entledigte und mich geradezu besprang, sich auf mich setzte und sich ins Entzücken ritt, während ich meine Nase in ihre wogende, rotbraune Lockenmähne drückte und mein Glück nicht fassen konnte. Danach blieben wir im Bett liegen, streichelten und umarmten uns schweigend, stundenlang, sodass ich mir zu Hause bald immer abwegigere Entschuldigungen für meine Verspätungen ausdenken musste. Diese Situation machte mich schizophren und verlogen; meine Beziehung zu Nouka verschlechterte sich zusehends, Schuldgefühle plagten mich, mir fehlte der Mut, ihr alles zu gestehen, wodurch ich mir dann auch noch wie ein erbärmlicher Feigling vorkam. Gleichzeitig bestimmte die Euphorie dieser geheimen Liebe alles um mich herum, und ich verfiel von einer extremen Stimmung in die andere. Es hatte sich als überaus praktisch erwiesen, sich mittwochnachmittags zu verabreden, weil dann keine Lehrveranstaltungen stattfanden und ich vorgeben konnte, an der Akademie zu bleiben und in meinem Zimmer zu arbeiten.
Jetzt, da Dius vorgeschlagen hatte, zum Dorfhaus hinauszufahren, wusste ich nicht so recht, was ich tun sollte. Gleichzeitig war ich neugierig, welchen Text er mir vorlesen würde – und ich ertappte mich dabei, dass ich mich darauf freute, den großen, befreienden, mit all den inspirierenden Dingen vollgestopften Saal wieder zu betreten.
Und so fuhren wir am nächsten Mittwoch erneut nach Ganzevliet. Dius hatte seine Camionette ein wenig aufgeräumt und war die ganze Fahrt über recht schweigsam. Als wir uns der Stelle näherten, wo man zu den Poldern rechts abbiegen musste, fuhr er geradeaus. Ohne mich anzusehen, sagte er, dass wir zuerst zur Küste fahren würden, weil er mir dort etwas zeigen wolle. Ich fluchte innerlich, platzte dann aber doch heraus, dass ich genug davon hätte, von einem Studenten gekidnappt zu werden, der ständig etwas anderes tut, als er sagt, und außerdem – bilde er sich etwa ein, ich würde jeden freien Mittwochnachmittag – oh, wie quälte mich der Gedanke an mein wunderbares Geheimnis – einfach so seinen Launen zur Verfügung stehen?
Ich schluckte.
Dius murmelte: Du wirst gleich sehen, weshalb.
Wir fuhren also zur Küste und hielten vor einer kleinen Kirche in den Dünen. Wir stiegen aus. Es wehte ein starker Wind, der das Strandgras heftig hin- und herschleuderte; Sandkörner prasselten uns ins Gesicht, sodass wir die kleine Kirche mit zugekniffenen Augen betraten. Das Gotteshaus war, da es ein Wochentag war, leer; leise erklang alte polyfone Musik – Guillaume de Machaut, wenn ich mich nicht täuschte. Sofort erfassten mich Ruhe, Einsamkeit, Stille – wie unprätentiös kann sich das Erhabene doch im Alltäglichen verbergen. Auf den Kirchenbänken lagen vom Sonnenlicht verstreute Flecken und schienen zu wandern. Erstaunt und bewegt ließ ich meinen Blick durch den Raum gleiten.
Ich möchte dir zeigen, worüber ich in meiner Seminararbeit schreiben wollte, sagte Dius und ging durch den Kirchenraum bis zu einer Nische beim Seitenaltar. Dort standen zwei dunkle Holzstatuen: Christus und Johannes der Täufer. Der Täufer steht über dem Heiland und ist im Begriff, ihn mit dem Wasser aus einer Muschel in der Hand zu besprengen; auf seinen Schultern liegen einige Palmblätter. Christus hält den Kopf leicht geneigt und hat die Hände in frommer Erwartung vor der Brust gefaltet; die Füße verschwinden im Holzsockel, in dem ein paar Furchen das Wasser des Jordan andeuten.
Was sich allerdings in dem beleuchteten Alkoven unter den beiden Skulpturen befand, raubte mir den Atem: Dort lag eine vollendete Kopie der weltberühmten Statue der heiligen Cecilia aus der Santa-Cecilia-Basilika im römischen Stadtteil Trastevere. Die Skulptur ist außerordentlich ergreifend; der Legende nach wurde der Leichnam Cecilias nach ihrer Enthauptung im 3. Jahrhundert in einen Sarg gelegt, der, als man ihn im Jahr 1600 öffnete, einen vollkommen unverwesten Körper enthielt. Zu diesem Anlass schuf Stefano Maderno die Statue, die jedes Jahr zahllose Touristen zu Tränen rührt. Die heilige Märtyrerin liegt wehrlos, wie tief schlafend auf der Seite. Ihre zarten Hände ruhen wie erschossene Vögel vor ihr. Zwei Finger der rechten Hand sind ausgestreckt, womit wohl auf die Geste des Salvator Mundi angespielt werden sollte; an der linken Hand ist nur der Zeigefinger ausgestreckt, als zeigte die Märtyrerin auf ihre Henker – somit verweist die eine Hand auf die Rettung und die andere auf den Untergang. Der Kopf ist vom Betrachtenden abgewandt. Das Haar ist hochgesteckt, wie es einer jungen Frau von hohem Rang in jener Zeit geziemt, und teilweise verdeckt von einem Tuch, das halb unter ihr liegt, als wäre sie mit dem Gesicht daraufgestürzt. Und dann gelangt der Blick des Betrachtenden an die Stelle, um die sich hier am Ende alles dreht: Im zarten Hals der jungen Frau ist ein tiefer Schnitt, aus dem ein dicker Blutstropfen quillt. Das römische Original besteht aus makellosem Carrara-Marmor. Auch wenn diese Kopie hier, wie ich vermutete, notgedrungen aus poliertem Gips war, stand sie in ihrer Wirkung dem Original in nichts nach.
Dius sah mich mit wildem Blick an. Er war tiefrot im Gesicht, zitterte sichtlich, versuchte, etwas zu sagen, doch etwas war stärker als er, er gestikulierte in Richtung Statue und sagte: Das da. So was will ich können. Diese … Er schluckte. Die Skulptur in der kleinen Kirche war damals noch nicht durch eine Glasscheibe geschützt. Man konnte sie berühren, wenn man wollte, sogar streicheln; konnte den tiefen Schnitt an ihrem schönen Hals betasten. Dius kniete sich hin, legte die Hand auf den kalten Hals und bedeckte die Wunde. Ich hörte sein schweres Atmen, sah sein wirres, schwarzes Haar zittern und glaubte, ihn weinen zu hören. Ich blieb reglos neben ihm stehen, ich hätte ihm gerne die Hand auf die Schulter gelegt. Ich spürte, dass hier etwas geschah, das er nicht in Worten ausdrücken konnte, vielleicht nicht einmal in Worten ausdrücken wollte. Mehr noch, ich verstand, dass er hierin seine Semesterarbeit sah, eine Arbeit ohne Worte: Er wollte mir einen Moment des Erhabenen in der Kunst zeigen, während mein stets misstrauischer Geist es einen winzigen Augenblick lang für möglich hielt, dies könnte eine weitere Inszenierung von Dius sein, um mir zuzusetzen. Auch dachte ich mir: Vom Verlangen nach dem Erhabenen bis zum Lächerlichen der Gefühle ist es nur ein Schritt. Mir war durchaus klar, wie schäbig dieser letzte Gedanke war, denn in meiner Ausbildung hatte ich gelernt, die Gefühle eines jungen Menschen angesichts eines Kunstwerks bedingungslos ernst zu nehmen. Dius ließ mich tief in seine Seele blicken, Worte waren hierfür zu banal.
Ich weiß nicht, wie lange wir so verharrten: er kniend, die Hand auf der Wunde, ich über ihn gebeugt, Mitverschworener seiner Gefühle und dennoch völlig von ihnen ausgeschlossen. Er ein Teil der Skulptur, ich der Betrachter. Mit jeder wortlosen Minute, die verstrich, verstärkte sich mein Eindruck, dass das Kunstwerk uns seinerseits betrachtete; als feuerte es von jedem Punkt aus Bedeutung auf uns ab und sagte: Das hier ist es, was wirklich zählt im Leben. Du musst dich entscheiden. Versteckst du dich hinter einer Mauer der Skepsis, damit du unangreifbar bleibst, und gibst mit zusammengekniffenen Lippen den Distanzierten, um dadurch deinen intellektuellen Arsch zu retten? Oder bist du offen dafür und ›lässt es an dich ran‹, wie man heutzutage sagt.
Ich hatte das Gefühl, dass Dius mir durch sein rückhaltloses Zerfließen mit der Statue eine Lektion erteilte: Er verschaffte mir eine Erfahrung, die mir, zutiefst skeptisch aufgrund einer auf akademischen Kunstkenntnissen beruhenden, professionellen Besserwisserei, seit Langem versagt geblieben war. Ich beneidete ihn um seine grenzenlose Gefühlsfähigkeit, wusste ich doch, dass mir meine eigene schon vor geraumer Zeit abhandengekommen war, obgleich sie seit Kurzem wieder aufflackerte – dank meiner mich zur Untreue treibenden Geliebten. Sofort sah ich ihren zarten, aber festen Hals in meinen streichelnden Händen vor mir.
Es dauerte lange, bis wir die Kirche verließen: zwei Eingeweihte, die ein geheimes Ritual vollführt hatten. Wir gingen zum Strand. Als ich auf eine Buhne steigen wollte, hielt Dius mich zurück. Könnte glatt sein, sagte er und trat auf die mit Meeresalgen bedeckten Steine. Es zog ihm sogleich die Beine weg, und sein großer Körper schlug lang hin. Er riss sich die rechte Hand an einer Muschel auf. Sofort kam er wieder auf die Beine, rieb sich die verletzte Handfläche und lächelte wie zur Entschuldigung.
Besser ich als du, sagte er, und wir gingen weiter.
Wir fuhren in absoluter Stille zum Dorfhaus; seltsame Wolken, wie sie nur in dieser Gegend vorkamen, trieben über den Himmel – wunderliche, verlorene Formationen, die sich zu verdichten schienen, bevor sie sich in nichts auflösten. Im Saal war es kalt, und es roch feucht. Ich sah, dass Dius das Ölfass gekippt und der Länge nach auf ein geschweißtes Metallkreuz montiert hatte; vorn war nun eine Art Aschekasten ausgesägt, davor etwas Maschendraht. Hinten war eine Öffnung, in die Dius ein Ofenrohr geschoben hatte, das er es bis zu einem der Kippfenster verlängerte, hindurchführte und mit hitzefester Folie abdichtete.
Zunächst legte er einige Holzscheite in das Ölfass und zündete sie an; danach stapelte er mehrere, immer größer werdende Scheite kreuzweise darüber, bevor er mit ein paar großen Brocken Holz obenauf endete. Das Feuer zog rasch Luft und arbeitete sich nach oben durch. Das trockene Pappelholz loderte knisternd auf, Dius schien seine gute Laune wiederzuerlangen. Wir gingen in die Küche. Dort baumelte ein roher Schinken an einem s-förmigen Haken, der vom Balken herabhing. Den habe ich selbst geräuchert, sagte er, nahm das Fleisch ab, ergriff ein Messer, sog, als es seine Wunde in der Hand berührte, kurz Luft durch die Zähne und schnitt einige Scheiben ab. Der Schinken schmeckte vorzüglich; erst jetzt realisierte ich, dass ich seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte und halb am Verhungern war. Dius holte aus einem Schrank eine Flasche mit Weißwein hervor, der auffällig gelb aussah. Kraftvoll riss er die Metallfolie vom Flaschenhals, warf sie neben sich auf den Boden, stieß mit einem Schraubenzieher den Korken durch den Flaschenhals, sodass der Wein herausspritzte, und schenkte mir ein Glas voll ein; das Zeug schmeckte nach vergorenem Traubensaft und Korken, aber es wärmte meinen noch immer ausgekühlten Körper. Habe ich ersteigert, sagte er, auf einem Landgut hier in der Gegend. Sechzig Flaschen zum Preis von sechs. Jahrgang 1914. Er lachte. Ich blickte ihn kopfschüttelnd an; ich wusste immer noch nicht, was ich von ihm halten sollte.
Was die heilige Cecilia betrifft …, fing ich vorsichtig an.
Doch Dius’ Blick trübte sich sofort ein, als hätte ich mit nur einer Handbewegung das feine, unsichtbare Gewebe der Erinnerung an das, was wir gerade gemeinsam erlebt haben, zerrissen. Er schüttelte den Kopf, sah mich hilflos an, stammelte etwas Unverständliches und schnitt nochmals drei große Scheiben vom Schinken ab, die wir aßen und mehrere Gläser des schal gewordenen Weins dazu tranken, ohne weiter noch ein Wort zu wechseln. Erst da sah ich das geronnene Blut in seiner Handfläche und den dunklen Fleck in der Schale, in der das Fleisch gelegen hatte. Er richtete seinen Blick zum verhangenen Himmel hinter den Kippfenstern hinauf, als hätte er alles um sich herum vergessen. Die enorme Dämmerung der Polderlandschaft umgab uns. Vom Park des Gutshauses her hörten wir eine Eule schreien, der einsamste Ruf der ganzen Vogelwelt. Zwischen den Nebelbänken ging über den Äckern und Feldern der Mond auf. Fast eine ganze Stunde lang spazierten wir über schmale, endlose Wege, stiegen dann in die Camionette und fuhren schweigend nach Hause.
Am nächsten Tag notierte ich in meine Examensliste, dass ein gewisser Egidius De Blaeser, statt eine Seminararbeit einzureichen, ein mündliches Examen abgelegt habe, welches er mit Auszeichnung bestanden habe. Den Titel der Arbeit ersann ich selbst.
Das Wundmal der Kopie.
Ich weiß nicht wie, aber nach einigen Monaten kam Nouka hinter meine Affäre. Wir stritten uns mehrere höllische Nächte hintereinander fürchterlich, da ich ihr nichts versprechen konnte und keine Entschuldigung hatte für meine Untreue und zudem die Affäre weder jetzt noch irgendwann zu beenden gedachte. Zugleich war mir ganz elend, weil ich ihr so viel Kummer und Schmerz bereitete. Vor allem die Anwandlungen von verzweifelter Zärtlichkeit, die ich immer noch für sie empfand, setzten mir stark zu. Bei einer dieser Auseinandersetzungen schlug sie mir mitten ins Gesicht, worauf ich sie an den Haaren packte und so heftig daran zog, dass sie fast gestürzt wäre. Wir erschraken derart über das Ausmaß an Gewalt, zu dem wir fähig waren, dass wir uns von da an aus dem Weg gingen. So lebten wir einige Wochen nebeneinanderher, die Nerven äußerst angespannt, das Schweigen feindselig, und vermieden es, gleichzeitig in Küche oder Bad zu sein. Ich schlief auf dem Wohnzimmersofa. Manchmal war mir danach, Nouka zu umarmen und um Verzeihung zu bitten, aber ich wusste, dass das sinnlos war; ich traf und liebte meine wundervolle Fotografin weiterhin. Seit meinem Ausflug mit Dius brauchte ich nur ihren wunderbaren Hals zu berühren, wenn sie keuchend neben mir lag, die Augen schloss und einschlief, und mein Körper begann heftig zu zittern, und mir wurde ganz elend vor lauter Gefühl.