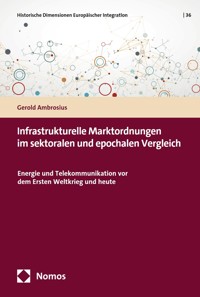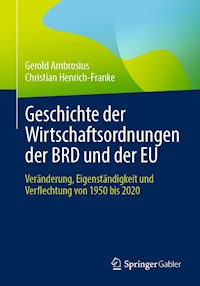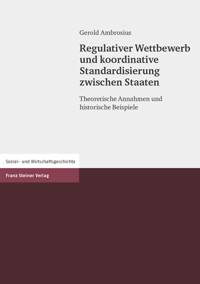Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den Jahren zwischen 1800 und 1870 wurden die Weichen für eine neue Epoche gestellt. Industrialisierung, Staatsreform und aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft kennzeichneten das kommende Zeitalter ebenso wie der technische Fortschritt durch Dampfschiff, Eisenbahn und Telegraph. Gleichzeitig blieben in vielen Ländern weiterhin Agrarwirtschaft, Monarchie und Feudalismus maßgeblich. Kaum eine andere Phase europäischer Geschichte ist daher so stark von Diversität, Transformation und Kontinuität geprägt. Diese vielfältigen Entwicklungen behandelt der Band eingängig und konzise anhand der Themenfelder Gesellschaft, Gewalt, Recht, Staat, Technik und Wirtschaft. Auf diese Weise erhält der Leser einen schnellen, gut lesbaren und fundierten Überblick über die wichtigsten Herausforderungen der Epoche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Europäische Geschichte der Neuzeit
Gerold Ambrosius/Christian Henrich-Franke
Diversität, Transformation, Kontinuität: Europa 1800–1870
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Umschlagbild: Ludwig Passini: Künstler im Café Greco in Rom (1856), Kunsthalle Hamburg, Wiki Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludwig_ Passini_-_K%C3%BCnstler_im_Cafe_Greco_in_Rom.jpg (abgerufen am 17.02. 2020).
1. Auflage 2020
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-038196-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-038197-1
epub: ISBN 978-3-17-038198-8
mobi: ISBN 978-3-17-038199-5
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
1 Überblick
1.1 Vorbemerkungen
1.2 Epochale Zäsuren und Kontinuitäten der europäischen Geschichte
1.3 Kontinuität, Transformation und Diversität in Europa
1.4 Fazit
2 Staat
2.1 Vorbemerkungen
2.2 (Nationale) Staatlichkeit im Wandel
2.3 Zwischenstaatlichkeit
2.4 Fazit
3 Recht
3.1 Vorbemerkungen
3.2 Verfassungsrecht
3.3 Agrarrecht
3.4 Gewerbe- und Handelsrecht
3.5 Arbeitsrecht
3.6 Völkerrecht
3.7 Rechtsprechung
3.8 Fazit
4 Gewalt
4.1 Vorbemerkungen
4.2 Binnenstaatliche Gewalt
4.3 Zwischenstaatliche Gewalt (Kriege)
4.4 Fazit
5 Wirtschaft
5.1 Vorbemerkungen
5.2 Gesamtwirtschaft
5.3 Landwirtschaft
5.4 Industrie
5.5 Dienstleistungen
5.6 Europäischer Wirtschaftsraum
5.7 Fazit
6 Technik
6.1 Vorbemerkungen
6.2 Technische Basisinventionen
6.3 Technische Innovationen als Motor der Industrialisierung
6.4 Gesellschaftlich-wirtschaftliche Folgen des technischen Fortschritts
6.5 Fazit
7 Gesellschaft
7.1 Vorbemerkungen
7.2 Soziale Schichtung und soziale Mobilität
7.3 Sozialer Protest
7.4 Räumliche Mobilität
7.5 Fazit
Literatur
Abbildungsnachweis
Index
1 Überblick
1.1 Vorbemerkungen
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts stellt einen Zeitraum dar, in dem große Teile Europas auf einen neuen, dynamischen Entwicklungspfad einbogen. Tiefgreifende Veränderungen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft transformierten das Leben in den europäischen Ländern und führten zu einer noch dominanteren Stellung Europas in der Welt. Insbesondere die Industrialisierung – nicht nur ihre wirtschaftlich-technische Dimension – kann als eine säkulare Zäsur bewertet werden, wie sie Europa seit dem Neolithikum nicht mehr erlebt hatte. Der damit verbundene Transformationsprozess begann in den nordwesteuropäischen Ländern Großbritannien, Belgien und Nordfrankreich und breitete sich dann grob vereinfacht von ›West nach Ost‹ und von ›Nord nach Süd‹ aus. Ob man ihn als evolutionäre Veränderung oder als revolutionären Umbruch interpretiert, hängt wesentlich davon ab, welche Dimension des menschlichen Lebens man betrachtet. In jedem Fall hatte er seinen Ursprung weit vor dem 19. Jahrhundert und seine Folgen reichten weit ins 20. Jahrhundert hinein.
Auffallend sind die Ungleichzeitigkeiten, mit denen sich die Wandlungen vollzogen, und dass sie in kaum einer anderen Epoche so ausgeprägt waren. Die Unterschiede der Veränderungen im Hinblick auf Zeitpunkt, Verlaufsmuster und inhaltliche Ausprägung lassen sich schwer zu einer einheitlichen ›europäischen Geschichte‹ verdichten. Die einzelnen Entwicklungsstränge verliefen selten linear. Stattdessen wechselten sich Phasen des Wandels und Phasen des Stillstandes oder der Rückschritte ab. Einerseits stellten historische Großereignisse wie Kriege und Revolutionen bedeutsame Katalysatoren der Veränderungen dar. Politische Umgestaltung erfolgte oftmals erst als Reaktion auf äußeren und/oder inneren Druck. Zahlreiche Kriege – von den napoleonischen Kriegen über die Unabhängigkeitskriege bis hin zum Krimkrieg und den Einigungskriegen in Italien und Deutschland – veränderten nicht nur die europäische Landkarte, sondern insbesondere auch die innenpolitischen Konstellationen. Andererseits waren es die vielen kleinen Entwicklungsschritte in Recht, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft, die sich nur selten zeitlich genau verorten lassen, die aber in ihrer Summe für die langfristige Entwicklung der europäischen Länder mindestens von der gleichen Bedeutung waren wie die Großereignisse.
Die Bestimmung einer historischen »Phase«, »Epoche« oder »Periode« muss bis zu einem gewissen Grad immer willkürlich sein, zumindest wenn ein Raum wie Europa mit unterschiedlichen Kulturen und Traditionen betrachtet wird und verschiedene Aspekte des menschlichen Zusammenlebens wie Staat, Recht, Wirtschaft, Technik, Gewalt und Gesellschaft berücksichtigt werden. Das gilt auch für die Unterteilung eines solchen Zeitraums in weitere Zeitabschnitte. Zum ersten liegt der Grund darin, dass sich die Länder bzw. Regionen eigenständig entwickelten. Selbst wenn man beispielsweise für Spanien unter Berücksichtigung aller Aspekte mehr oder weniger klar abgrenzbare Zeitabschnitte definieren könnte, müssen diese nicht auch für Russland, Frankreich oder die Schweiz sinnvoll sein. Es spricht sogar mehr dafür, dass dies nicht der Fall ist. Eine Chronologie der Ereignisse unter gesamteuropäischem Blickwinkel muss also nicht nur die großen Entwicklungslinien berücksichtigen, sie stellt immer auch einen Kompromiss zwischen den spezifischen Länderprofilen dar. Zum zweiten trifft die Periodisierung beispielsweise unter politisch-staatlichen Aspekten nicht auch auf die unter technisch-wirtschaftlichen oder sozial-gesellschaftlichen zu. Generell sind wirtschaftliche, technische oder gesellschaftliche Entwicklungen gerade dadurch gekennzeichnet, dass meist keine klaren Periodisierungen vorgenommen werden können. Wirkliche Strukturbrüche sind kurzfristig kaum zu erkennen – selbst nicht in Verbindung mit politischen Revolutionen. Zum dritten spielt deshalb der Zeithorizont bei Periodisierungsversuchen eine wichtige Rolle. Kürzere Zeitabschnitte werden häufig nach politischen Kriterien gebildet, bei längeren können auch wirtschaftliche, soziale bzw. gesellschaftliche sinnvoll sein. Vielleicht ist es stringenter, verschiedene Zeitabschnitte auf der Grundlage eines gemeinsamen Kriteriums vorzunehmen – z. B. der staatlichen Strukturen oder der zwischenstaatlichen Gewalt –, zwingend notwendig ist das nicht.
Eine Periodisierung, die der Vielschichtigkeit der Veränderungen für ganz Europa in den Jahren zwischen 1800 und 1870 gerecht wird, ist also praktisch nicht möglich, es sei denn, man fokussiert sich auf spezielle Aspekte. Es sollen deshalb zwei Punkte besonders betont werden: Zum einen wird hervorgehoben, dass die hier behandelten Jahrzehnte auch mit Blick auf die langen Entwicklungslinien der europäischen Geschichte eine beispiellose Zäsur darstellen; es steht also die gesamteuropäische Perspektive im Vordergrund. Zum anderen wird dem Überblick in diesem Kapitel eine geographische statt einer zeitlichen Untergliederung zugrunde gelegt, um so die räumliche Diversität der Entwicklung angemessener erfassen zu können. Allerdings werden mit ›Nord-/Westeuropa‹ und ›Süd-/Osteuropa‹ zunächst nur zwei Räume gegenübergestellt, die wiederum aus Dutzenden von autonomen Staaten und halbautonomen Territorien bestanden. Eine länderspezifische Differenzierung erfolgt dann in den jeweiligen Themenkapiteln. Dabei liegen den beiden Räumen keine geographisch klar umrissenen Territorien mit eindeutigen Grenzen zugrunde. Vielmehr stellen sie ein heuristisches Mittel dar, um die Diversität von Transformation und Kontinuität besser erfassen zu können, ohne die geschichtlichen Ereignisse gleich auf die Ebene der einzelnen Länder herunter zu brechen. Insbesondere bricht die Fokussierung auf zwei Ländergruppen mit der Vorstellung eines lediglich zeitlich verzögerten, aber letztlich inhaltlich gleichartig verlaufenden Transformationsprozesses. Dass es sich nicht um einen solchen handelte, zeigt sich besonders an der geographischen Peripherie Europas, denn hier löst sich die Vorstellung eines einheitlichen ›europäischen Modells‹ von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft endgültig auf.
Abb. 1: Europa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Infobox 1: Staaten und halbautonome Territorien um 1830
1.2 Epochale Zäsuren und Kontinuitäten der europäischen Geschichte
Die hier behandelten Jahrzehnte von 1800 bis 1870 stellen eine entscheidende Schwellenphase in der europäischen Geschichte auf dem Weg vom agrarischen, ständisch-feudalen Absolutismus in die neue »Großepoche« des industrialisierten, bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaates dar, die letztlich nur verstanden werden kann, wenn sie eingebettet wird in die langfristige Entwicklung der Industrialisierung und der Herausbildung der (Verfassungs-)Staatlichkeit seit der Frühen Neuzeit. Der Beginn der 1870er-Jahre kann dabei als eine Zäsur betrachtet werden, weil die Schwellen- bzw. Transformationsphase auslief und sich sowohl die Industrialisierung als auch die nationale (Verfassungs-)Staatlichkeit als wesentliche Strukturprinzipien durchgesetzt hatten und ihren Siegeszug antreten konnten.
1.2.1 Industrialisierung
Im Vergleich zur Politikgeschichte lässt sich Wirtschaftsgeschichte kaum auf punktuelle Großereignisse beziehen. Wirtschaftliche Prozesse und insbesondere Strukturveränderungen vollziehen sich eher kontinuierlich und nur selten in radikalen Umbrüchen. Die Entwicklung von der Agrar- über die Industrie- zur Dienstleistungswirtschaft haben bis heute viele Länder der Welt erlebt und fast immer nahm diese Transformation Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte in Anspruch. So besaß beispielsweise Großbritannien in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine Agrarwirtschaft, industrialisierte sich seither und hatte hundert Jahre später in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Industriewirtschaft, um noch einmal hundert Jahre später in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem endgültigen Einstieg in die Dienstleistungswirtschaft zu beginnen. Wenn die hier behandelten Jahrzehnte durchweg in Verbindung mit landwirtschaftlichen und industriellen – im Übrigen auch kommunikativen und verkehrlichen – ›Revolutionen‹ gebracht werden, handelt es sich zumindest bei ersteren in zeitlicher Hinsicht wohl eher um ›Evolutionen‹. Die Industrialisierung breitete sich zwar von Nordwesten allmählich nach Südosten aus, aber der größte Teil Europas blieb bis in die 1850er-/1860er-Jahre agrarisch-kleingewerblich strukturiert. Die Industrieregionen, die in den nordwest- und mitteleuropäischen Ländern – vereinzelt auch in den südeuropäischen – entstanden, strahlten im Vergleich zu heute noch relativ wenig auf die gesamten (Volks-)Wirtschaften aus. Will man trotz aller Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern bzw. Territorien einen Zeitpunkt bestimmen, an dem der europäische Wirtschaftsraum den Durchbruch zur beschleunigten Industrialisierung vollzog, so wären dies die 1850er-/1860er-Jahre. Allerdings deuteten sich in den Ländern, in denen Industrieregionen entstanden, schon zuvor die Konsequenzen der Industrialisierung an, die dann später in fast allen Ländern Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändern sollten. Insofern kann man in inhaltlicher Hinsicht zumindest von einem fundamentalen Umbruch sprechen. Produktionstechnisch und -organisatorisch unterschied sich die mechanisierte Arbeitsteilung der industriellen Produktionsweise jedenfalls deutlich von der landwirtschaftlichen und handwerklichen. Daneben waren es die sozialen bzw. gesellschaftlichen Folgen, die den revolutionären Charakter der Industrialisierung ausmachten und die bereits im hier behandelten Zeitraum die west- und mitteleuropäischen, teilweise auch die südeuropäischen Länder zu spüren bekamen: Die neuen gewerblich-industriellen Arbeitsbedingungen wurden schon damals als unmenschlich empfunden. Das alltägliche Leben der Menschen musste sich der neuen Produktionsweise mit ihrem strengen Arbeitsrhythmus und ihrer rigiden Arbeitsdisziplin anpassen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse änderten sich insofern, als sich in Verbindung mit der politisch-rechtlichen Entfeudalisierung neue soziale Schichten und neue soziale Mobilitätsmuster herauszubilden begannen. Es formierten sich neue politische, wirtschaftliche und soziale Interessengruppen, sodass sich am Ende der hier dargestellten Periode in einer Reihe europäischer Länder die Gesellschaftsformation andeutete, die später als ›bürgerlich-kapitalistische‹ bezeichnet wurde, um die neue Epoche der Industriewirtschaft und -gesellschaft begrifflich zu erfassen. Damit kein falscher Eindruck entsteht, sei aber noch einmal betont, dass in weiten Teilen Europas – insbesondere in Süd- und Osteuropa – die Industrialisierung noch nicht wirklich Fuß gefasst hatte und hier auch in den 1850er-/1860er-Jahren noch agrarwirtschaftliche und agrargesellschaftliche Verhältnisse dominierten.
Neben der produktionstechnischen Arbeitsteilung prägte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine räumliche Arbeitsteilung stärker als bisher aus. West- und Mitteleuropa belieferten Süd-/Osteuropa sowie die übrige Welt mit gewerblich-industriellen Halb- und Fertigwaren und bezogen von dort landwirtschaftliche Produkte und mineralische Rohstoffe. Selbst wenn diese Beschreibung des Handels nur als Tendenz zu verstehen ist, entwickelten sich doch zunächst Großbritannien und dann die nordwest- und mitteleuropäischen Länder zu Lieferanten von Industrieerzeugnissen für die übrige Welt.
Die hier behandelten Jahrzehnte können also als Transformationsphase von der Agrarwirtschaft und -gesellschaft des 18. Jahrhunderts zur Industriewirtschaft und -gesellschaft des 20. Jahrhunderts interpretiert werden. Zwar waren nur in west- und mitteleuropäischen Ländern über einige Jahrzehnte im 19. und 20. Jahrhundert die Mehrheit der Erwerbstätigen im gewerblich-industriellen Sektor tätig – in den meisten Ländern Europas und in den übrigen Teilen der Welt löste in dieser Hinsicht der dienstleistende unmittelbar den landwirtschaftlichen Sektor ab –, dennoch wird das Jahrhundert zwischen den 1870er- und den 1970er-Jahren in Europa als industrielles Zeitalter bezeichnet. Der sogenannte Fordismus mit den auf Massenfertigung angelegten, hochspezialisierten, hochkonzentrierten und hocharbeitsteiligen Produktionsprozessen, die am Privateigentum – insbesondere an den Produktionsmitteln –, Beruf, Einkommen und Vermögen ausgerichtete sozialen Schichtung und die in Parteien und Interessenverbänden hochorganisierte Gesellschaft bestimmten die Produktionsverhältnisse in dieser Epoche. Mit der sich im ausgehenden 20. Jahrhundert abzeichnenden Dienstleistungswirtschaft und -gesellschaft mit veränderten Produktionsweisen und veränderten sozialen bzw. gesellschaftlichen Strukturen ging dann das industrielle Zeitalter allmählich wieder seinem Ende entgegen.
1.2.2 Nationale (Verfassungs-)Staatlichkeit
Die Französische Revolution von 1789 und die Napoleonischen Kriege am Anfang des 19. Jahrhunderts stellten die entscheidenden Weichen auf dem Weg zu einem neuen Verständnis der politischen Organisation des menschlichen Miteinanders. Ihr Ursprung ist in den Ideen und Idealen der Aufklärung zu finden. Von Jean Bodin in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts über Thomas Hobbes, John Locke bis zu Charles-Louis de Montesquieu in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte sich langsam die Idee vom Staat als Interessengemeinschaft der Bürger durchgesetzt, deren interne Strukturierung am besten einer Dreiteilung von Exekutive, Legislative und Judikative folgte. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern erteilte Jean-Jacques Rousseaus dann Mitte des 18. Jahrhunderts dem Gottesgnadentum der Herrschenden eine Absage und sah die alleinige Basis der politischen Macht im Gemeinwillen (Volunté générale) der Bürger. Mit dem ›Gesellschaftsvertrag‹ (Contrat social) entwickelte er den Gedanken, dass die Gemeinschaft im ›Staat‹ einen Gemeinwillen entwickele, sodass auch die Unterwerfung des Einzelnen unter diesen Gemeinwillen legitimiert sei. Damit einher ging die Vorstellung vom Wandel des Untertanen zum Bürger, der es erlaube, die im Herrschaftsvertrag des absolutistischen Staates implizierten Schutzrechte vor und von Gefahren in den Anspruch auf Teilhabe und Mitwirkung am ›Staat‹ im Gesellschaftsvertrag umzudefinieren. Francois-Marie Arouet de Voltaire begründete zudem die Gleichheit aller Mitglieder der nationalen Gemeinschaft ›Staat‹.
Mit der Französischen Revolution wurde das Gleichheitspostulat dann eine eigenständige Kraft, welche die Welt verändern sollte. Egalité stellt bis heute die Messlatte gesellschaftlicher Zustände und Veränderungen dar. In der hier behandelten Epoche waren die politische Gleichheit und die Gleichheit vor dem Recht die zentralen Forderungen der Reformer von Staat und Gesellschaft. Alle Mitglieder (Bürger) einer nationalen Gemeinschaft sollten in gleichem Umfang an der Macht teilhaben können, d. h. die oberste Gewalt sollte gemeinsam legitimiert werden (Volkssouveränität statt Gottesgnadentum). Alle sollten prinzipiell die gleichen Rechte und Pflichten haben. Sonderrechte und Privilegien – egal ob politisch, sozial, religiös oder anders begründet – fanden in einer derart gedachten Nation bzw. Gesellschaft keinen Platz mehr.
Die Französische Revolution wurde seit Anfang des 19. Jahrhunderts zum Referenzpunkt für alle folgenden Umwälzungen. Revolutionsfurcht und Revolutionsbegeisterung trieben die Befürworter der Restauration ebenso an wie die Reformer. Zeitgenossen sahen den Begriff der Revolution als einen Kampfbegriff und die Revolution selbst als ein Symbol für eine neue Ordnung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Fast gleichzeitig wurde die ›Nation‹ zum politisch-gesellschaftlichen Strukturprinzip erhoben und von Europa ausgehend in die ganze Welt übertragen. Dabei stellte sie ein Phänomen dar, mit dem jeder Europäer in Berührung kam, das er aber kaum erklären und noch weniger beschreiben konnte. Die Nation nahm eine Sonderrolle ein, nachdem sie spätestens durch die Französische Revolution für die Legitimation von Staatlichkeit und politischer Zugehörigkeit zentrale Bedeutung erlangt hatte, ohne tatsächlich in einem klar definierten Verhältnis zu den unterschiedlichen Formen von Staatlichkeit zu stehen. Vielfältige Definitionen bzw. Ausprägungen des Begriffs der Nation entstanden, doch keine konnte das Phänomen in all seinen Schattierungen erfassen. Die Nation wurde vielmehr zu einer variablen Größe und einem besonders effektiven Mittel, um Identifikation mit der politischen, gesellschaftlichen und/oder kulturellen Gemeinschaft zu erzeugen. Sie wurde im 19. Jahrhundert als ›säkulare Religion‹ zum verbindenden Element der Bevölkerung und zur Legitimation von Staatlichkeit, wobei sich unter dem Konzept der Nation bestehende Herrschaftssysteme bzw. autonome Territorien wie in Italien 1861 oder Deutschland 1871 zu einem neuen Nationalstaat zusammenschlossen oder in einzelne Nationalstaaten oder föderale Systeme wie im Osmanischen Reich oder in der Habsburgermonarchie zerfielen.
Das Modell national verfasster Staatlichkeit trat in den Jahren vor 1870 seinen Siegeszug durch Europa an und sollte mit den großen Friedensprojekten (dem Völkerbund und den Vereinten Nationen) im Anschluss an die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert zum überall auf der Welt akzeptierten Strukturprinzip erhoben werden. Gleichzeitig wurde die nationale Staatlichkeit durch den ›sozialistischen Staat‹ oder die Europäische Union in ihrer Legitimation und Substanz immer wieder herausgefordert. So sehr etwa die Europäische Union spätestens seit den 1990er-Jahren den Nationalstaat in seinem Rechtsbestand und seiner Legislativtätigkeit zu einem Mitgliedsstaat transformierte, so sehr blieb die Nation für die überwältigende Mehrheit der europäischen Bevölkerung identitätsstiftend. Auf diesem Weg nahm der Nationalstaat aber ab 1870 keine geradlinige Entwicklung. Das Konzept des Nationalstaats brachte zwar im Westen Europas den demokratisch verfassten Nationalstaat hervor, führte aber – die darwinistische Evolutionstheorie auf den nationalen Konkurrenzkampf übertragend – ebenso zum (diktatorisch verfassten) extremen Nationalismus als die ideologische Grundlage von Kriegen und Völkermorden, die Europa letztlich im 20. Jahrhundert seiner exponierten Stellung in der Welt beraubten.
1.3 Kontinuität, Transformation und Diversität in Europa
Im Folgenden wird ein Überblick über die grundlegenden Entwicklungen von Staat, Recht, Gewalt, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft gegeben, wobei wie erwähnt die beiden Großregionen ›Nord-/Westeuropa‹ und ›Süd-/Osteuropa‹ gegenübergestellt werden. Aus gesamteuropäischer Perspektive bestand trotz aller länderspezifischen Differenzen innerhalb dieser Regionen der fundamentale Entwicklungsunterschied wohl zwischen diesen beiden Teilen Europas.
1.3.1 Nord-/Westeuropa
Die Radikalität und Gewalt, mit denen in den Jahren zwischen 1792 und 1815 um die Ideen der Französischen Revolution gerungen wurde, lösten einen bis ins 20. Jahrhundert andauernden Prozess der Transformation aus, der in ganz Nord-/Westeuropa allmählich den liberalen Verfassungsstaat und den ausdifferenzierten Verwaltungsstaat hervorbrachte. Wenngleich sich nach 1815 kurzfristig restaurative Phasen mit politischen Repressionen und revolutionäre Phasen mit politischen Unruhen abwechselten, so änderte dies nichts am einmal eingeleiteten fundamentalen Wandel. Sogar die politischen Leitideen der Zeit – egal ob sie sich selbst als liberal oder als konservativ bezeichneten – strebten allesamt eine Veränderung des politisch-gesellschaftlichen Status quo an. Umstritten waren nur die Radikalität und das Tempo, mit denen diese verfolgt werden sollte. Lediglich Großbritannien wich von diesem Muster ab, hatte es mit der Reform des Staatswesens, wie z. B. der Stärkung des Parlaments doch schon im 17. Jahrhundert begonnen. Wie bei der Industrialisierung nahm Großbritannien auch bei der Transformation des Staats einen langfristigen, evolutionären Weg.
Besonders deutlich zeigte sich die Veränderung der Staatlichkeit an der Stellung des Monarchen im politisch-staatlichen Gefüge. Er blieb zwar das dominante Strukturprinzip, gab aber in der politischen Praxis die gestaltende Macht zunehmend an eine sich nach Personal und Arbeitsbereichen ausdifferenzierende Verwaltung, v. a. spezielle Ministerien, und an Parlamente ab. Verwaltungen und Parlamente waren die eigentlich innovativen Elemente der Veränderungen, selbst wenn sie zum großen Teil mit der alten aristokratischen Elite besetzt wurden. Eroberten die Parlamente dabei zunächst eher Mitspracherechte wie die Haushaltskontrolle, so drang der Staat dann mit Hilfe der Verwaltungen und einer sich ausweitenden Legislativtätigkeit in immer mehr Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft ein. Der Bürger kam dadurch immer öfter in seinem Alltag mit dem Staat in Berührung, wenngleich das Wahlrecht und damit die Legimitation der Volksvertretung auf marginale Teile der Bevölkerung beschränkt blieben. Damit einher gingen nach innen eine Harmonisierung der staatlichen Strukturen, die in den unterschiedlichen Staaten regional wie lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt gewesen waren, und nach außen eine stärkere Abgrenzung der Staaten.
Nord-/Westeuropa stellte keine rechtspolitische Einheit dar. Es besaß zwar eine gemeinsame römische Rechtstradition, umfasste aber unterschiedliche Rechtskreise mit ihren jeweiligen Besonderheiten und zwar den romanischen, deutschen und nordischen Rechtskreis sowie den des britischen Common Law. Die römische Rechtstradition teilte es mit Süd-/Osteuropa. Dennoch kam es zu unterschiedlichen rechtspolitischen Entwicklungen. Die geringsten Entwicklungsunterschiede lassen sich beim Verfassungsrecht feststellen. Das Zeitalter des Konstitutionalismus begann zwar mit der französischen Revolutionsverfassung von 1791 im »Westen«, bei der folgenden Ausbreitung der Verfassungsstaatlichkeit lässt sich aber kein ausgeprägtes Gefälle zwischen Nord/West- und Süd-/Osteuropa feststellen, allenfalls zwischen den westeuropäischen Ländern wie Frankreich und Belgien und den südosteuropäischen wie Serbien und Griechenland. Vielleicht waren die nord-/westeuropäischen Staaten eher bereit, persönliche, politische und wirtschaftlich-soziale Grundrechte zu gewähren, wobei aber auch bei ihnen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit auseinanderklafften. Immerhin dürfte sich der Rechtsstaat mit der Gleichheit vor dem Gesetz und der Rechtssicherheit in einer Reihe nord-/westeuropäischer Staaten relativ früh durchgesetzt haben. Das galt insbesondere auch für die Entfeudalisierung der Agrar- und Gewerbeordnungen. Die unmittelbaren Bindungen zwischen Grundherrn und Bauern, zwischen Meister und Gesellen bzw. Lehrling mit ihren vielfältigen feudalrechtlichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit und der wirtschaftlichen Verfügungsrechte über Land und Produktionsmittel wurden hier schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts allmählich aufgelöst. Generell wird man ebenso auf anderen Rechtsgebieten einen Vorsprung der nord-/westeuropäischen Staaten bei deren »Modernisierung« feststellen können. Die großen zivilrechtlichen Gesetzeswerke des französischen Code civil von 1804 und des Code de Commerce von 1807, die das Recht der neuen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft mit der Freiheit und Gleichheit des Bürgers, der starken Stellung des Privateigentums, mit offenen Märkten und fast unbeschränkter Vertragsfreiheit schufen, wurden zunächst von den nord-/westeuropäischen Staaten übernommen, die sich damit vergleichsweise früh von ihren feudalen Rechtsbeständen befreiten. Die süd-/osteuropäischen Staaten übernahmen das neue bürgerliche Recht deutlich später oder gar nicht. Die nord-/westeuropäischen waren auch diejenigen, in denen der Staat trotz grundsätzlicher Liberalisierung seit den 1830er-/1840er-Jahren damit begann, neue Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft zu übernehmen. Das zeigte sich auf unterschiedlichen Rechtsgebieten, insbesondere beim Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Der technische Fortschritt, die industrielle Entwicklung und die Liberalisierung der Arbeitsverhältnisse wirkten sich zunächst in den nord-/westeuropäischen Ländern aus und führten zu Arbeitsbedingungen, die schon damals nicht nur als gefährlich, sondern als unmenschlich empfunden wurden. Mit dem Arbeitsschutz und der Gewerbeaufsicht, ebenso mit dem Technik- oder Wettbewerbsrecht wurde neues Recht geschaffen, das seit der Jahrhundertmitte die Wirtschaftsordnungen der nord-/westeuropäischen Staaten mitprägte. Aber nicht nur bei der Rechtsetzung schritten sie voran, auch bei der Rechtsprechung waren sie es, die sich vergleichsweise früh bemühten, die Gewaltenteilung eines Verfassungs- und Rechtsstaates durchzusetzen und eine unabhängige Justiz zu schaffen. Trotz aller Widerstände, Rückschläge und Differenzen begann sich im hier behandelten Zeitraum in den nord-/westeuropäischen Ländern der Typ des bürgerlichen Verfassungs- und Rechtsstaates herauszubilden, mit dem traditionelles Recht entfeudalisiert, neues Recht geschaffen und die rechtlichen Grundlagen einer liberalen Wirtschaft und bürgerlichen Gesellschaft gelegt wurden.
Wie immer in der Geschichte ist auch in den hier behandelten Jahrzehnten inner- und zwischenstaatliche Gewalt wichtig – einerseits für die Stabilisierung und andererseits für die Veränderung der politisch-staatlichen und sozioökonomischen Verhältnisse. Die Ausbreitung des nationalen (Verfassungs-)Staates erfolgte vom napoleonischen Frankreich ausgehend gewaltsam durch Kriege – also durch zwischenstaatliche Gewalt – und durch teilweise bürgerkriegsartige Revolutionen – also durch innerstaatliche Gewalt. Gleichzeitig wurden Veränderungen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft durch Gewalt aber auch unterbunden, so etwa in Frankreich unter Napoleon, der die Gendarmerie impériale im Inneren einsetzte, um seine Herrschaft abzusichern. Nach französischem Vorbild schufen die anderen nord-/westeuropäischen Staaten in der Folgezeit Polizei und Gendarmerie, um den politisch-gesellschaftlichen Status quo (Restauration) zu erhalten. Es ist geradezu ein Kennzeichen der 1820er- bis 1840er-Jahre, dass in praktisch allen nord-/westeuropäischen Staaten die Regierungen äußerst repressiv bzw. gewaltsam gegen politische Gegner vorgingen, um revolutionäre bzw. reformerische Veränderungen zu verhindern. Innerstaatliche Gewalt diente aber genauso dazu, den politisch-staatlichen Wandel (Reform) mit all seinen Unsicherheiten für Wirtschaft und Gesellschaft zu erzwingen und abzusichern.
Gewaltsam wurde französisches Recht beispielsweise in die Rheinbundstaaten oder nach Spanien exportiert. Nach 1850 war dann in den sich industrialisierenden Staaten Nord-/Westeuropas die militärische Überlegenheit die Basis dafür, dass sich die nationale (Verfassungs-)Staatlichkeit in- und außerhalb Europas ausbreitete. Insbesondere die neuen logistischen Möglichkeiten durch den Einsatz von Eisenbahnen und die waffentechnischen Innovationen wie den gezogenen Hinterlader resultierten in qualitativ wie quantitativ neuen Dimensionen von Gewalt, die in den europäischen Kriegen der 1850er-/1860er-Jahre offen zu Tage traten. In einigen Staaten Nord-/Westeuropas mündeten die industriellen Produktions- und Transportpotentiale geradezu in einen kriegstechnischen Überbietungswettlauf.
Fasst man die west- und mitteleuropäischen Länder bzw. (Volks-)Wirtschaften zu einer Gruppe zusammen, betrug ihr Anteil an der gesamteuropäischen Bevölkerung um die Jahrhundertmitte etwa 47 % (ohne Russland 59 %) und am gesamteuropäischen Sozialprodukt 57 % (ohne Russland 68 %). Sie besaßen durchgängig die höchsten Wachstumsraten und den höchsten Wohlstand. Dabei waren allerdings die Unterschiede im wirtschaftlichen Entwicklungsniveau zwischen den Ländern dieser Gruppe und innerhalb der einzelnen Länder erheblich. Die im Vergleich zum übrigen Europa insgesamt aber höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit resultierte aus einem Modernisierungsprozess der Landwirtschaft und des Gewerbes, der Großbritannien schon im 18. Jahrhundert, die anderen west- und mitteleuropäischen Länder dann seit Anfang des 19. Jahrhunderts ergriff. Allerdings war es ein mühsamer Prozess.
In der Landwirtschaft setzten sich neue Zucht- und Anbaumethoden und technische Innovationen nur zögerlich durch und ließen die agrarische Produktivität nur langsam steigen. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es daher immer wieder zu dramatischen Hungerkrisen. Von einer ›Agrarischen Revolution‹ kann jedenfalls nicht oder nur dann gesprochen werden, wenn man damit auch Umbrüche erfasst, die sich über viele Jahrzehnte hinzogen. Das gilt auch für die ›Industrielle Revolution‹, die in Großbritannien ebenfalls bereits im 18. Jahrhundert einsetzte, ihren endgültigen Durchbruch im west/mitteleuropäischen Raum aber erst in den 1850er-/1860er-Jahren erlebte. Es dauerte häufig Jahrzehnte, bis der technische Fortschritt in praktischen Innovationen zur Anwendung kam. Dabei war die Industrialisierung insofern ein regionales Phänomen, als sich nicht ganze (Volks-)Wirtschaften industrialisierten, sondern einzelne Regionen, die dann aber zunehmend auf andere ausstrahlten. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Die nord-, west- und mitteleuropäischen (Volks-)Wirtschaften blieben agrarisch-kleingewerblich strukturiert. Allein Großbritannien besaß um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine in größeren Bereichen industrialisierte Wirtschaft. Ursache und Folge bzw. Teil der wirtschaftlichen Modernisierung waren der Ausbau des Verkehrs- und Kommunikations-, des Geld- und Bankwesens sowie eine sich vorsichtig intensivierende Arbeitsteilung im nord-/westeuropäischen Wirtschaftsraum. Der Handel basierte zunehmend auf dem gegenseitigen Tausch von gewerblich-industriellen Halb- und Fertigwaren, aber weiterhin gleichfalls auf dem von landwirtschaftlichen Produkten und mineralischen Rohstoffen. Die ganz überwiegende Mehrheit der arbeitenden bzw. wirtschaftenden Menschen blieb dabei ihrem lokalen Umfeld von Dörfern und Städten verhaftet. Stärker als in den süd-/osteuropäischen Regionen Europas wirkten sich aber die Agrar- und Gewerbereform, die Industrialisierung mit ihrer arbeitsteiligen Fertigung und die sich verändernde räumliche Verteilung der Produktion dahingehend aus, dass immer mehr Menschen in überlokale, anonyme Märkte eingebunden wurden und zwar sowohl im Hinblick auf den Verkauf ihrer eigenen Arbeitskraft als auch bezüglich des Verkaufs der erzeugten Güter. Es waren die nord-/westeuropäischen (Volks-)Wirtschaften, die als erste mit dem Übergang in eine industriell-kapitalistische Produktionsweise begannen.
Im Zentrum der Industrialisierung stand der technische Fortschritt. Technische Basisinnovationen wie die Dampfmaschine fungierten als Katalysatoren, da die Entwicklung, Implementation und Diffusion von dampfgetriebenen Technologien wie der Eisenbahn, dem Dampfschiff oder den Pumpen im Bergbau die Ausbreitung der industriellen Produktionsweise und mit ihr die Veränderung der sozioökonomischen Verhältnisse befeuerten. Sogar die zwischenstaatliche Gewalt konnte ihre Funktion als Transmissionsriemen nationaler (Verfassungs-)Staatlichkeit nur ausüben, weil aus neuen Kriegstechnologien neue Machtverhältnisse resultierten. So sehr die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Dampfmaschine von Großbritannien ausgehend ihren Siegeszug zunächst durch Nord-/Westeuropa antraten, so sehr versetzten sie Großbritannien in die Lage, eine technologische Überlegenheit in Wirtschaft und Militär zu erlangen.
Es waren aber nicht nur dampfbetriebene, sondern alle Arten von Maschinen, die von Großbritannien aus die Industrialisierung in Nord-/Westeuropa antrieben. Sie führten allmählich zur Ausbreitung mechanisierter, arbeitsteiliger Produktionsprozesse, die die Produktivitätsfortschritte im gewerblich-industriellen Sektor erst ermöglichten. Der Einsatz von Maschinen veränderte das Verhältnis von Mensch und Produktion dramatisch. Komplexere Technik erforderte mehr technisches Wissen und weniger menschliche Arbeitskraft, wodurch der Bedarf an Bildung stieg. Angefangen im Textilgewerbe wurden traditionelle Arbeitsplätze und Arbeitsbereiche – wie z. B. im Heimgewerbe – überflüssig, andere entstanden neu, jedoch zumeist geographisch entfernt und einige Jahre oder Jahrzehnte später. Große Migrationsbewegungen ebenso wie Maschinenstürmereien, die im frühen 19. Jahrhundert erstmals in Großbritannien auftraten, waren das sichtbarste Zeichen dafür, wie sehr technischer Wandel die Gesellschaft in Bewegung brachte. Wenn man technischen Fortschritt in das Zentrum der Industrialisierung rückt und diese nicht nur als technisch-wirtschaftliche, sondern auch als sozial-gesellschaftliche Transformation begreift, kann man letztlich alle sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen auf sie zurückführen. Es kam daher sicherlich nicht von ungefähr, dass der technische Fortschritt zunächst in Nord-/Westeuropa Fuß fasste und gleichzeitig die sozioökonomischen bzw. sozial-gesellschaftlichen Veränderungen, die die Industrialisierung begleiteten, zunächst hier begannen.
Dass der technische Fortschritt bereits im 18. Jahrhundert in Großbritannien und dann im frühen 19. Jahrhundert in Belgien und Nordfrankreich – u. a. mit der Weiterentwicklung von Webstühlen und Spinnmaschinen – einsetzte, hatte viele Gründe. Ein wesentlicher Grund dürfte die relativ liberale Gesellschafts-, insbesondere Gewerbeverfassung gewesen sein, die das freie Denken und die Experimentierfreudigkeit sowie den Typus des innovationsfreudigen, risikobereiten Unternehmers förderte. Die technische Entwicklung übte einen enormen Anpassungs- und Adaptionsdruck auf benachbarte Regionen aus, wobei offen bleiben muss, ob sich dadurch die sozioökonomischen Gegensätze zwischen den Regionen innerhalb der einzelnen Länder bzw. innerhalb Europas eher abschwächten oder eher verstärkten.