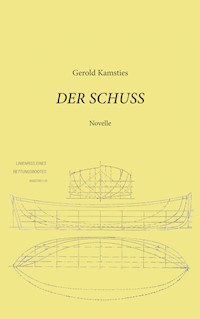Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor beschreibt - mit hintersinnigem Humor bisweilen - das verzweifelte Bemühen seines Protagonisten, durch Schreiben nachhaltig tätig zu werden. Nach etlichen gescheiterten Versuchen, hierbei seinen Ansprüchen zu genügen, liefert ihm ein geheimnisvoller Todesfall im Freundeskreis den Anlass, einen weiteren Versuch zu starten. Mit nicht nachlassendem Optimismus macht er sich erneut an die Arbeit. In der zweiten Erzählung, die an manchen Stellen einer Autobiographie ähnelt, wird der Werdegang eines eher zufällig in das Blickfeld geratenen Menschen geschildert, der ziellos und mit geringem Ehrgeiz von einem Lebenswendepunkt zum nächsten stolpert, bis er sich schließlich, erkennbar, zu einer erwähnenswerten, wenn auch sinn- und wirkungslosen Aktion aufrafft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner unglücklichen Schwester Irene
Der Autor bedankt sich bei seiner Ehefrau Jutta für die überaus nützlichen Einwände und Hilfen. Darüber hinaus hofft er bei der Bewertung auftretender orthografischer Mängel auf Großmut beim Leser.
Inhaltsverzeichnis
Doktor Faustulus Versuch und Irrtum
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Intermezzo
Schmidt und die Plagiatoren
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Doktor Faustulus Versuch und Irrtum
I
Die Umstände waren schuld und die durch das lange Alleinsein entstandenen verschrobenen Gedankengänge, denn eines Abends, fast genau ein Jahr nachdem ihn seine Frau aus der gemeinsamen Wohnung gewiesen hatte, drängte es Ulrich, ohne widerstehen zu können, sich auf die Straße zu begeben und unter das Volk zu mischen.
Er verließ seine beengende Zweizimmerwohnung, die in einer schmalen Abzweigung einer belebten Einkaufsstraße lag und reihte sich ein unter die Menschen, die sich in beinahe idealer Unordnung auf dem Trottoir bewegten und kurz vor Torschluss versuchten, ihre Einkäufe unter Dach und Fach zu bringen.
Wie immer begeisterten ihn die vielen weiblichen Passanten, die, der sommerlichen Temperatur angepasst, leicht bekleidet, mit wippenden Röcken, tief dekolletiert vielfach – let swing auf der ganzen Linie – zum Eingang des dort gelegenen Kaufhauses eilten.
Zum Teufel, dachte er, warum immer wieder diese merkwürdige Faszination, obwohl man weiß und es jedermann sieht, dass Unterhautfettgewebe, Fettzellen also, für die reizvollen weiblichen Formen, Leonce und Lena nannte er sie ein wenig albern, verantwortlich sind. Liegen die Evolutionsbiologen richtig, wenn sie behaupten, dass wir armseligen unbewusst gelenkten Kreaturen auf diese Weise gelockt werden, weil wir bei gut anzuschauenden Individuen und deren wohlproportionierten Geschlechtsmerkmalen die besten genetischen Voraussetzungen erwarten? Aber warum, dachte er, warum kann diese rätselhafte Anziehung bisweilen sich umkehren so, dass das Erscheinungsbild uns abstößt?
Ohne über diese Frage länger nachzudenken betrat Ulrich das große Kaufhaus.
Was ist über ihn zu sagen? Nach seiner Vorstellung war er ein Mann in den besten Jahren, im Leben stehend, belastbar.
Ein Wunschbild? Zu seinem Bedauern, denn er wusste es, wich sein Aussehen und seine Außenwirkung in der Realität von seinem Traumbild deutlich ab – seine Haltung insgesamt ließ Stolz und Selbstbewusstsein vermissen; er war ein unscheinbarer, zurückhaltender Mensch, den man im übernächsten Moment wieder vergaß.
Nun durchstreifte er in der Einkaufsstätte unschlüssig dessen Gänge, in denen auf beiden Seiten, hinter großen Schaufensterscheiben Waren ausgestellt waren. Wir beobachten ihn aus der Ferne. Was hat er vor, unser Held? Wir rätseln; sein Verhalten ist nicht zielgerichtet, es lässt immer noch mehrere Deutungen zu. Nun hat er eine weibliche Person, welche offensichtlich der Tiefgarage zustrebt, ins Auge gefasst. Ein Opfer?
Die Frau ist mittelgroß, von regelmäßiger Statur, etwa Anfang fünfzig, also mehr als zehn Jahre jünger als er, schlank, dunkelhaarig, sympathisch. Er folgt ihr; sie hört wahrscheinlich seine Schritte, erahnt, dass es die eines Verfolgers sein könnten und beschleunigt ihren Gang in dem ansonsten menschenleeren Flur.
Soeben vernimmt man die weibliche Stimme der Ansage: Das Einkaufszentrum werde umgehend geschlossen.
Die Flüchtende, Ulrichs Opfer, hastet den Gang entlang auf die Tür zu, die zur Tiefgarage führt. Der Zugang ist zu ihrem Schrecken bereits verschlossen. Die Frau macht kehrt und kommt auf ihren Verfolger zu. Er sieht ihr ins Gesicht, das hübsch ist, unübersehbar etwas angstvoll. Er zögert, er überlegt erkennbar sein weiteres Vorgehen; noch bevor er damit zum Ende kommt, erhält er von der Frau einen Tritt gegen sein rechtes Schienbein. Er krümmt sich zusammen, hält sich das schmerzende Bein; die Verfolgte entflieht.
Der körperliche Schmerz brachte ihn zur Besinnung; er verwandelte sich zu seelischem Unwohlsein derart, dass sein Gewissen heftig schlug. Er schämte sich, denn ihm waren – vermutlich durch Erziehung, weniger durch Vermächtnis – moralische Maßstäbe eingepflanzt worden, die ihn das Verwerfliche seiner Gedanken, zu einer frevelhaften Tat war es ja nicht gekommen, erkennen ließen.
Er bereute sein Verhalten, das war offensichtlich.
Was dachte er, wie ist seine sichtbare Betroffenheit zu deuten?
Möglicherweise bat er in diesem Augenblick darum, solche Versuchungen, solche unmoralischen Anwandlungen in Zukunft von ihm, von seiner Person, fernzuhalten.
Wenn dies zuträfe, an wen wohl richtet er solch eine Bitte? An die eigene Natur, das Schicksal, Gott im Himmel? - Gibt seine Erziehung einen Hinweis?
Oder war das Beobachtete womöglich ganz harmlos? Führt uns diese Extrapolation und die sich ergebende Fährte in die Irre? Schließlich bestimmen viele geheime Beweggründe das menschliche Tun und ihre Gesamtheit ist einer physikalischen Kraft ähnlich, welche als Resultierende vieler unterschiedlicher Kräfte den Weg eines Massenpunktes, eines Lebewesens bestimmt.
Andererseits hatte er Gedanken solcher Art, wie sie zu seinem beobachteten Verhalten in dunklen Gängen passen, früher bereits seiner Ehefrau zu deren großem Erschrecken offenbart. Sie hatte ihn gewarnt, ihm ins Gewissen geredet, ihm großen Ärger prophezeit. Seiner, ihrer Ehe jedenfalls, das sei noch erwähnt, war diese Aufrichtigkeit nicht gut bekommen; man trennte sich letztlich.
Dann liegen wir gegebenenfalls doch richtig, dann ist dieser Hilferuf doch denkbar, eventuell auch ein Hilferuf an Gott im Himmel?
Man ist geneigt, an dieser Stelle ungläubig den Kopf zu schütteln, mehr wahrscheinlich über solcherart vermutete naive Frömmigkeit als über jenes geschilderte vermeintlich triebhafte Verhalten. Möglicherweise wird man sich sogar weigern, all diese Andeutungen zu übernehmen und Beweise, zumindest aber überzeugende Aufklärung einfordern.
Nun also: Unser Held war in seiner Jugend zu einem gläubigen, ja frommen Menschen erzogen worden. Dies geschah weniger in der kirchenkritischen Familie – schließlich hatte damals, in seiner Kindheit, eine neue Zeit begonnen – als im Unterricht in den Grundschulen, Zwergschulen, die er nacheinander, Umstände halber, in zwei bayrischen Dörfern besuchte.
Kriegswirren, Ausbombung und Flucht hatten seine Mutter, seine Geschwister und ihn in die Nähe eines katholischen Wallfahrtsortes verschlagen, in dessen Nähe auch ein späterer Papst Lebensjahre verbrachte. – Sollten sie sich über den Weg gelaufen sein?
In seinen ersten Schuljahren wurde der Religionsunterricht, ein wichtiges Fach neben Lesen, Schreiben und Rechnen, von dem Dorfpfarrer erteilt. Ulrich war eine Stütze dieses Unterrichts. Und der Geistliche förderte den Jungen nach Kräften, nicht nur durch lobenswerte, jedoch unverfängliche Hinwendung, sondern auch durch Taten dergestalt, dass er dem ewig hungrigen Flüchtlingskind und seiner Familie Essbares zusteckte.
»Ich fühlte mich wohl in meiner Dorfschule«, erzählte Ulrich, wenn im Freundeskreis Kindheitserinnerungen ausgetauscht wurden. Und sehr ausführlich, wegen der Wiederholungen nicht immer zum Vergnügen mancher Zuhörer, berichtete er bei solchen Gelegenheiten aus seiner Schulzeit und den Lebensumständen in bayrischen Landen.
»Ich hatte einen mehr als einstündigen Schulweg, vier Kilometer, mit Nachbarskindern, bei Wind und Wetter. Im Klassenraum, in dem die ersten beiden Klassenstufen gemeinsam unterrichtet wurden, war es im Winter dank eines großen geheizten Ofens wohlig warm; an den Geruch, es roch nach trocknenden Kleidungsstücken, die wir im Winter an ihm aufgehängt hatten, kann ich mich gut erinnern. Der Unterricht in der Zwergschule war überaus kurzweilig, konnte man doch als Jüngerer am Unterrichtsgespräch der Älteren teilnehmen und sich mit diesen messen.
Im Religionsunterricht führte uns der Dorfpfarrer häufig über den Friedhof in die benachbarte Kirche, in der wir, nach Geschlecht getrennt, seinen Worten lauschten. Ich kann mich gut an den auf mehreren Bildern dargestellten Kreuzgang, den man unter den strengen Blicken des Pfarrers inbrünstig betrachtete, erinnern, auch an die im Eingangsbereich, in einem Vorraum der Kirche, hinter einem Gitter aufgestapelten mit Namen versehenen Totenschädel, die bei uns Kindern fromme Schauer auslösten.
Diese Umstände, auch der hilfsbereite, mir zugewandte katholische Geistliche, auch die Frömmigkeit meiner Schulwegkameraden, mehrere halfen beim Gottesdienst als Ministranten, bewirkten – kurz, ich wollte konvertieren, um es meinen morgendlichen Begleitern, die später tatsächlich Pfarrer wurden, nachzumachen.
Meine evangelisch – lutherischen Eltern aus der aufgeklärten, hanseatischen Großstadt in Norddeutschland protestierten und widerstanden dem schmeichlerischen Werben des Priesters.«
So lebte sie auf, die Vergangenheit, und gerne erzählte Ulrich, wenn sich die Gelegenheit ergab, weiter aus seiner Kindheit: Dass er und seine Familie einmal den Bauernhof gegen einen anderen tauschten, weil unter der neuen Adresse der angebotene Wohnraum größer war, dass er deswegen die Grundschule in einem Nachbardorf besuchte, dass sie häufiger, zu Fuß versteht sich, den benachbarten, jedoch weit entfernten Wallfahrtsort besuchten, weil es hier ein Kino gab, weil Bekannte, ebenfalls Flüchtlinge, dort wohnten. Und schließlich, dass er am Ende seines Aufenthalts in Bayern – die Familie kehrte aus Süddeutschland zurück in die norddeutsche Heimatstadt – noch für ein halbes Jahr das Gymnasium in der historisch bedeutsamen Kleinstadt B. besuchte.
»Ich war Fahrschüler; den Bahnhof erreichten wir mit dem Fahrrad, eine Zugfahrt und ein Fußmarsch aus der Neustadt in die Altstadt des Zielortes schlossen sich an. Der Zug war um diese Zeit angefüllt mit Schülern. An jeder Station wurde ihre Anzahl größer, man kannte sich, man spielte miteinander, die Älteren vervollständigten während der Fahrt ihre Hausaufgaben. Es war schön und interessant, eine neue Welt tat sich auf für mich, eine richtige Stadt, die große, geheimnisvolle Schule, die direkt an dem Fluss lag, der Österreich und Bayern trennte, die neuen Schulfächer, eine Fremdsprache, Sportunterricht in einer richtigen Turnhalle, die vielen neuen Lehrer. Im Religionsunterricht wurde die Klasse aufgeteilt, weil ein großer Teil der Schüler evangelischen Unterricht beanspruchte – durch die vielen bildungsbeflissenen Flüchtlingsfamilien waren die Katholiken in einigen Klassen sogar in der Minderheit.«
II
Die Worte und Taten weniger Auserwählter, Männer wie Frauen, bestimmen das Weltgeschehen. Das jedenfalls können wir manchen Aussagen der Geschichte, auch manchen Geschichten entnehmen. Von diesen Menschen, wir sollten sie bedeutend nennen, wird uns in Wort und Schrift berichtet; von ihrem Leben wird erzählt, das sie in jener Zeit führten, in der sie, wie bei einem rollenden Rad, in dessen Speichen man bremsend oder beschleunigend hineingreift, den Lauf der Geschichte veränderten.
Seltener hingegen wird uns das Tun derjenigen geschildert, die in den Augen der Chronisten nicht zu den Häuptlingen gehörten, das Wirken der so genannten kleinen Leute nämlich; jene werden uns meistens vorenthalten. Ja, sogar die frühen Worte und Taten der späterhin Berühmten bleiben für viele von uns im Dunkeln, ganz zu schweigen von denjenigen, deren Bedeutung für den Geschichtsverlauf von den Zeitgenossen nicht erkannt wurde.
Darüber hinaus gibt es neben den kaum Erwähnenswerten solche, deren Dasein wir abtun, weil es allzu lächerliche, wenn auch oft tragische Züge aufweist.
Im Zusammenhang mit dem Untergang des Weströmischen Reiches, man legt dieses Ereignis etwa auf das Jahr 476 nach Christi Geburt, wird von den Geschichtsschreibern der Name Romulus erwähnt. Er war der Sohn des Heerführers Orestes; dieser hatte seinen Spross als zukünftigen Kaiser vorgesehen. Romulus trug, soweit bekannt ist, in den Jahren 475/476 politische Verantwortung. Seine Truppen hatten seinem Namen zusätzlich den Namen Augustulus hinzugefügt, Kaiserchen. Romulus Augustulus nannten sie ihn voller Spott, im Unterschied zu den Herausragenden, den Bedeutenderen in der römischen Geschichte.
Das Kaiserchen also! Einer Sternschnuppe ähnlich erschien und verglühte sein Name; in einem Satz wird sein Auftauchen und sein Verschwinden in den Büchern erwähnt und ein nasser Schwamm genügt, um seine Spuren zu entfernen. Oder wissen wir Weiteres von ihm, über ihn? Spezialisten, Experten vielleicht, wir jedenfalls schütteln den Kopf.
Doch halt! Sollten wir den nassen Schwamm nicht doch aus der Hand legen, ist unser arrogantes, abwertendes Urteil – lächerlich – bei ihm und bei anderen nicht vorschnell?
Das Leben solcher Menschen verläuft oft tragisch, das mag richtig sein. Aber machen sie sich immer lächerlich? Wäre es nicht denkbar, dass große Zweifel sie bei ihrem Tun begleiten, sie lobenswert bescheiden sind und sich niemals anmaßen, die Welt beglücken zu können.
Vielleicht wollen sie nur ihre Pflicht tun oder etwas Angefangenes zum Ende bringen.
Dies gelingt nicht immer; manchmal, wenn widrige Umstände bremsen, reicht die Zeit nicht, manchmal stehen andere Dinge im Wege.
III
Nach wie vor leitete Herr Professor Dr. B. das Krankenhaus, das sich auf Gelenkersatz spezialisiert hatte und das, von seinem rechtlichen Stand her zwar gemeinnützig, jedoch keine Einrichtung der öffentlichen Hand war.
Professor Dr. B., ein Pionier in der Orthopädie, wegweisend bei der Bekämpfung der Gelenkdegeneration, ein älterer Herr um die Siebzig von hagerer, großer Gestalt, hatte das Skalpell vor einigen Jahren aus der Hand gelegt. Trotzdem war er tagtäglich im Krankenhaus anzutreffen; er durchstreifte das Haus, denn es war sein Lebenswerk, kümmerte sich um Neueingewiesene, verströmte Optimismus und beriet in seiner noch regelmäßig abgehaltenen Sprechstunde zaudernde Patienten, überzeugte sie von den hervorragenden Eigenschaften der Kunstgelenke und erzählte vom hohen Stand der Implantationstechnik.
Auch Ulrich hatte ihn kennen gelernt. An der dem Chefarzt eigenen weißen Hose, an seinem weißen Kittel war er unschwer als solcher zu erkennen. Er trug ein am Hals offenes weißes Hemd; da er den Kittel nicht zugeknöpft hatte, konnte man erkennen, dass die Hose durch einen Gürtel gehalten wurde, der oberhalb der leichten Leibeswölbung, die man bei schlanken, älteren Männern oft beobachtet, verlief. Er war glattrasiert, uneitel schien er zu sein, denn bei näheren Hinsehen konnte man so manches längere Haar, das vom Rasiergerät nicht erfasst worden war, erkennen.
Ulrich sah sich damals genötigt, diese Klinik aufzusuchen. Er war gerade 52 Jahre alt geworden und litt seit längerer Zeit an seiner schmerzhaften linken Hüfte; die Behinderung nahm von Jahr zu Jahr zu, sodass er sich einen stark hinkenden Gang angewöhnt hatte. Er erhoffte sich vom Einbau eines kunstvoll angefertigten Ersatzhüftgelenks eine gesteigerte Lebensqualität; ja, er hoffte im Stillen sogar, mit dieser Prothese sein früheres Leben – wir müssen hierauf noch zu sprechen kommen – in großer Annäherung weiterführen zu können.
Ulrich zog also mit dem nötigen Handgepäck zwei Tage vor dem angesetzten Operationstermin in diese Klinik ein und unterwarf sich willig den von den Ärzten als nötig angegebenen Untersuchungen. Vor allem die Belastbarkeit des Herzens wurde geprüft, denn die Ausschaltung der Schmerzempfindungen und die Operation selbst mit dem damit verbundenen Blutverlust beanspruchen dieses Organ erheblich. Ulrich bestand alle Tests ohne Beanstandungen und verbrachte zwei geruhsame Tage bei komfortabler Betreuung in seinem Zimmer im Krankenhaus. Die Zeit wurde ihm nicht lang, standen ihm doch zur Unterhaltung etliche Zeitschriften, über Golf berichteten sie, und ein Band mit Kurzgeschichten zur Verfügung.
Die anschließende Operation gelang; als Ulrich aus seinem dämmrigen Zustand – er war nur lokal betäubt worden – gänzlich erwachte, nahm das Unglück seinen Lauf.
Ihn fröstelte derart, dass seine Zähne aufeinander schlugen; ein Präparat, eine Flüssigkeit, er meinte, den Namen Dolantin gehört zu haben, wurde in die Braunüle, die in seinem Arm steckte, geträufelt. Ulrich wurde schläfrig, große Übelkeit setzte ein. »Mir ist so schlecht«, sagte er noch, sieht, wie sich Schwestern ihm zuwenden, wohlige Müdigkeit übermannt ihn, eine sonnige Gartenlandschaft, wunderschön anzuschauen, breitet sich vor ihm aus. Wohlbefinden.
»Sie hatten einen Herzstillstand«, sagte jemand zu ihm, als er erwachte.
»Herzmassage haben sie bekommen, wir haben sofort Atropin gespritzt. Der Vagusnerv, der den Herzschlag steuert, hat den Stopp veranlasst.«
Mit dieser Information, beruhigend zunächst, versank Ulrich in einen Halbschlummer. Was war das, grübelte er, du warst deinem Ende nahe?
Unser Ulrich überdachte sein Leben, ähnlich den Sterbenden, denen man nachsagt, dies im Zeitraffer zu tun. »Was ist deine Lebensleistung«, fragte er, und »es ist so herzlich wenig«, antwortete er. Und er sah nach oben gen Himmel und flehte darum, ihm zu helfen. Wobei? Ein bedeutender Mensch zu werden, auf dass Zufriedenheit einkehre in sein Herz.
Träumte er das Weitere? Auf alle Fälle kam ihm zustatten, dass er genauso wie ein Träumer, die sperrigen Hindernisse der Wirklichkeit entweder nicht bemerkte oder sie mit Leichtigkeit umschiffen konnte. Jedenfalls sah er sich, als sei es ein Traum, erkennbar um Lebenshilfe bittend im Gespräch mit einer Person um die Siebzig, von hagerer großer Gestalt, bekleidet mit weißen Hosen, einem weißen, am Kragen offenem Hemd, einem nicht zugeknöpften weißen Kittel, das Gesicht glattrasiert.
Sein Gesprächspartner, der Mann in Weiß, lachte, er lachte ihn geradezu aus. »Wo denkst du hin«, sprach er und duzte ihn ungeniert, »soll ich dir etwa helfen, deine Lebensträume zu verwirklichen. Ich habe soviel zu tun, ich kann doch nicht jeder Bitte einer einzelnen Person nachkommen. Ganze Völker erflehen meine Hilfe. Du weißt doch sicher, dass sich zur Zeit gerade die Serben und Kroaten streiten. Beide Völker glauben an mich, ihre Priester beten im Namen ihrer Gläubigen zu mir und bitten um meinen Beistand bei ihren Grenzstreitigkeiten. Wie soll ich mich hierbei entscheiden? Das sind die Probleme, die mich umtreiben – und dann kommst du mit deinem Anliegen! Hilf dir selbst, so bin ich auf deiner Seite.«
Tief enttäuscht, die vertröstenden Worte im Ohr, wachte Ulrich auf. Wenn auch seine körperlichen Schmerzen geringer geworden waren – er hatte Tränen in den Augen. Waren es Tränen der Enttäuschung über diese Abfuhr oder waren sie hervorgerufen, fragen wir uns, durch sein Erschrecken über seinen Herzstillstand.
IV
Lange Tage, lange Jahre folgten. Ulrich verbrachte sie in seiner Heimatstadt so, wie es sein Beruf von ihm erwartete: Erklärend, lesend, schreibend, berichtigend, ohne Extrema, als da sind Hoch- bzw. Tiefpunkte. Seine Lebensarbeitszeit endete schließlich; leidenschaftslos trat er in den Ruhestand.
Um seine Tage zu füllen, als sei die Lebenszeit unbegrenzt, vergnügte er sich nun häufiger beim Tennisspiel. Er hatte diese Sportart, die auf körperbetonte Zweikämpfe oder Auseinandersetzungen ganz verzichtet und vor allem Technik, Laufvermögen und Geduld abverlangt, in jüngeren Jahren lange und leidenschaftlich ausgeübt, so lange, bis die Anfälligkeit seiner Hüftgelenke ihn zwang, wortwörtlich, kürzer zu treten. Obwohl Ulrich wusste, dass seine Sportleidenschaft seiner Gesundheit abträglich war, verabredete er sich regelmäßig mit einem Clubkollegen, einem Zahnarzt im Ruhestand, einem der letzten Ärzte, der noch nicht zum Golf abgewandert war, zur sportlichen Auseinandersetzung auf dem Tennisplatz.
Zum einen war sein Gegner besiegbar, nicht unwichtig für einen ehrgeizigen Menschen, zum anderen war der anschließende Umtrunk mit ihm meistens höchst vergnüglich. Der Arzt im Ruhestand erzählte gerne lustige Erlebnisse; auch Witze, die er irgendwo aufgeschnappt hatte, gab er gekonnt zum Besten. Denn er hatte die erwähnenswerte Fähigkeit, sich diese gut merken zu können:
»Die Frauenbeauftragte des Hamburger Senats, eine Grüne, hatte in Wilhelmsburg einen Arbeitskreis ins Leben gerufen; man erörterte bei den Zusammenkünften Fragen zur Stellung der Frau in der Gesellschaft und in der Familie. Regelmäßig trafen sich nun Frauen verschiedener Nationalitäten am Donnerstag um 20 Uhr im Wilhelmsburger Gemeindezentrum, im Raum B.
Man hatte beim letzten Treffen darüber diskutiert, wie man den Ehemann im Haushalt einbinden könne und z.B. zur Hausarbeit heranziehen könnte. Es wurde heftig debattiert, viele Beiträge wurden eingebracht. Einig war man sich letztlich darin, dass dem Manne Zeit gegeben werden müsse, sich von seiner angelernten, gewohnten Rolle zu verabschieden.«
Zwei weitere Mitglieder des Sportvereins hatten sich als Zuhörer der Gruppe hinzugesellt. Der Erzähler fuhr fort, weitschweifig, es schien ihm Spaß zu machen:
»Vierzehn Tage später, einmal war die Veranstaltung wegen eines Geburtstages eines Kindes in der Familie der Frauenbeauftragten ausgefallen, traf man sich wieder im Gemeindehaus in Wilhelmsburg, im Raum B. ›Ob schon jemand erprobt habe, was das letzte Mal besprochen wurde?‹
Eine Beteiligte meldet sich, Anastasia, Kasachin: ›Igor, habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst Wäschemaschine leer räumen auch einmal und aufhängen Wäsche auf Leine!