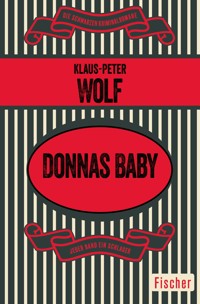
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Donna wächst behütet auf, in einer intakten Familie. Doch dann verliebt sich Donna in Jens. Der wäre am liebsten Saxophonist bei den Motherfuckers, dann müßte er auch nicht mehr Autos knacken, um an Kohle zu kommen. Donna wird schwanger. Aber die Frauenärztin hat ihre eigene Sicht der Dinge: Frauen, bei denen sie eine Abtreibung befürchtet, sagt sie erst nach dem dritten Monat, daß sie schwanger sind. Dann ist es für einen Eingriff zu spät. Für Donna und Jens hat das noch ganz andere Konsequenzen. Sie geraten in ein mörderisches Spiel ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Klaus-Peter Wolf
Donnas Baby
Roman
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei Fischer Digital
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-560394-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
1
Für einen Moment sieht es so aus, als ob alles gutgehen könnte. Es ist still in der Straße. Über ihm versuchen Motten, ins Licht der Laterne zu fliegen. Die dumpfen Töne, mit denen sie sich die Köpfe am Glas einschlagen, nerven ihn.
Er legt den Bohrer an das Schloß der Autotür. Nur eine Handbreit höher auf der Fensterscheibe leuchtet der Aufkleber: Dieses Fahrzeug ist mit einer Alarmanlage gesichert.
Mit solchen Dingern bepflastern die Leute ihre Autos, um Diebe abzuschrecken. Nur wenige Fahrzeuge haben tatsächlich eine Alarmanlage. Jens Simon weiß das. Die Wagen der S-Klasse sind alle damit ausgestattet. Dieser BMW 850i natürlich auch.
Jens schluckt trocken. Er vertraut auf Yogis Worte: «Mein Vater hat sie ausbauen lassen. Das Ding ist viermal versehentlich losgegangen. Wir haben einen Mordsärger mit den Nachbarn gekriegt. Ich garantiere es dir: Die Alarmanlage ist aus, die Papiere liegen im Handschuhfach.»
Sie haben halbe-halbe vereinbart. Jens soll den Wagen nur bis zum Rastplatz Ohligser Heide fahren, dort wird ein Syrer ihn übernehmen. Jens soll zwanzigtausend in bar bekommen. Zehn für sich und zehn für Yogi. Zehntausend Mark! Das reicht, um alle Probleme für eine Weile zu lösen. Er wird seine Schulden bezahlen und …
Er sieht auf die Uhr. In zwei Stunden muß er den Wagen übergeben. Es wird Zeit. Er drückt den Bohrer fester gegen das Blech.
Noch einmal schaut er sich um. Das Haus hinter ihm liegt völlig im Dunkeln. Hier gehen die Leute früh ins Bett. Nur ganz am Ende der Straße, wo die Eichen stehen, guckt jemand im oberen Stock noch den Spätfilm.
Eine betäubte Motte fällt Jens in die Haare. Er schüttelt sie ab.
Plötzlich jault die Alarmanlage. Das Geräusch fährt ihm in den Magen wie ein Faustschlag.
Jens springt aus der Deckung hoch und läßt sein Werkzeug fallen. Es gibt zwei Möglichkeiten: hinein in den Wagen, so schnell er kann, und die Alarmanlage unterbrechen oder einfach abhauen. In jedem Fall aber muß er sein Werkzeug mitnehmen. Er klaubt es vom Boden auf.
Jetzt sind die Häuser um ihn herum hell erleuchtet. Schuhsohlen knirschen auf dem Asphalt. Taschenlampen werden auf ihn gerichtet. Jens ist sofort umzingelt.
Das kann doch nicht wahr sein, denkt er. Eine Falle? Wer macht so etwas? Yogi?
Sie stehen breitbeinig da. Sie haben Knüppel dabei.
Jens benutzt den Bohrer als Stichwaffe und macht einen Fluchtversuch. Von der Polizei erwischt zu werden ist schon ein Alptraum. Viel schlimmer aber wird es, wenn aufgebrachte Bürger den Autodieb zu fassen kriegen. Ein stumpfer Gegenstand trifft ihn am Ohr.
Jemand kreischt: «Der hat eine Knarre!»
«Das ist ein Bohrer! Haltet ihn fest!»
Jens stößt einen Mann um und rennt. Fünf, vielleicht sechs Kerle verfolgen ihn. Er weiß, daß er dieses Tempo nicht lange durchhalten kann.
Hinter ihm keift eine hysterische Stimme: «Ich schlag dich tot!»
Jens stolpert. Er springt über eine Hecke. Diese Scheißvorgärten! Die geordneten Blumenbeete bieten nicht den Hauch eines Verstecks. Klettergerüste. Ein Sandkasten. Eine Schaukel.
Verdammte Raucherei. Er, der Saxophonspieler, kriegt keine Luft mehr. Wieder stolpert er. Diesmal schlägt er lang hin. Er landet mit dem Gesicht auf einem Gullydeckel.
Der Deckel wackelt.
Vielleicht ist das seine Chance.
Jens sieht sich um. Lichtkegel tasten nervös die Straße ab. Sie haben ihn verloren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn hier entdecken.
Er krallt die Finger in den Gullydeckel und hievt ihn hoch. Ein Schmerz trifft ihn in der Wirbelsäule. Er läßt den Deckel fallen und tastet nach der schmerzenden Stelle. Für einen Augenblick glaubt er, jemand habe ihm eine Kugel in den Rücken geschossen, doch dann merkt er, es ist nur die ungewohnte Bewegung. Er hat den Deckel zu sehr aus dem Kreuz gehoben. Er ist an schwere Arbeit nicht gewöhnt.
Jens ignoriert den Schmerz und gleitet vorsichtig ins Innere der Kanalisation. Er kann seine Beine von den Knien ab nicht mehr sehen. Er zieht den Deckel über sich. Jetzt sitzt er fast im Dunkeln.
Die Schritte kommen näher.
Jens atmet nur flach, um keine Geräusche zu machen, zieht die Beine an den Körper und krampft die Hände um zwei glitschige Haltegriffe.
Dann steht einer breitbeinig auf dem Deckel. Er läßt den Lichtkegel seiner Taschenlampe kreisen. Ein paarmal fallen sogar Strahlen in den Gully. Doch der Verfolger kommt nicht darauf, daß Jens sich unter ihm befindet. Vielleicht ist er auch ganz froh, daß Jens ihnen entwischt ist.
«Na ja, dann eben nicht», mault er leise. Seine Kumpane haben ihm angst gemacht. Einen Autodieb zu stellen ist eine Sache. Ihn zum Krüppel zu schlagen etwas anderes. Er versteht nicht, woher diese Brutalität kommt. Er hofft, daß es nur Maulheldentum ist, aber er ist sich nicht ganz sicher.
«Laß dir das eine Lehre sein», ruft er in die Nacht und schaltet seine Lampe aus.
Warum hast du mich verraten, Yogi? denkt Jens. Von wegen, du wolltest deinem Alten eins auswischen. Du wolltest mir eins reinwürgen! Bloß weil ich es ein paarmal mit deiner Perle gemacht hab? Mein Gott, Yogi, das kann doch nicht wahr sein. Dafür lieferst du mich ans Messer? Was ist los mit dir? Das ist ja krankhaft. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Aber eines versprech ich dir, Yogi: Das wird dir noch leid tun.
Er wartet fast eine Stunde. Inzwischen hat sein Herzschlag sich beruhigt. Zweimal fährt ein Auto über den Gullydeckel. Jedesmal hat er das Gefühl, über ihm könnte alles nachgeben. Die Angst, zerquetscht zu werden, wird übermächtig. Er muß hier raus.
Jens drückt mit den Schultern gegen den Deckel, kriegt ihn aber nicht hoch. Er sucht mit den Füßen Halt, rutscht aber immer wieder auf den Steigringen ab.
Ein fauliger Geruch steigt von unten auf. Es sticht in der Lunge. Wenn Jens atmet, hört er ein Fiepen, das ihm angst macht. So hat sich sein Meerschweinchen angehört, kurz bevor es starb.
Unter ihm huscht etwas vorbei. Ratten vielleicht. Oder eine Einbildung. Aber es verleiht ihm neue Kraft. Der Gullydeckel scheppert in die Höhe. Er fällt wieder runter, verkantet sich aber so, daß Jens ihn zur Seite schieben kann.
Er zwängt sich heraus. Für ein paar Sekunden liegt er schwer atmend, zusammengerollt wie ein Embryo, neben dem dunklen Loch und starrt hinein.
2
Donna muß die Sachen gut verstecken. Monika darf sie auf keinen Fall finden. Selbst wenn sie hier oben putzt – und die Gefahr besteht am Wochenende. Unter dem Bett würde sie das Zeug sofort entdecken. Im Spiegelschrank ist auch nichts sicher. Monika hat die Angewohnheit, die frisch gewaschene Wäsche gleich in Donnas Schrank einzuräumen. Donna will das nicht. Es ist zwar bequem, aber sie fühlt sich auch kontrolliert. Wie soll sie ihrer Mutter das klarmachen? Die lacht nur: «Aber das tue ich doch gern für dich, mein Kind. Außerdem hält mich das Treppensteigen fit.»
Donna steht in der Mitte des Raumes und dreht sich langsam um. Ihre Blicke tasten die schrägen Wände ab. Sie hat hier oben unter dem Dach zweiundsechzig Quadratmeter ganz für sich allein, aber kein sicheres Versteck für ihre Tennisklamotten.
Hier, wo die Schräge in die Gerade übergeht, müßte ein Hohlraum sein. Als ihr Vater das Dach ausbauen ließ, ging die Schräge an dieser Seite noch bis zum Boden.
Donna erinnert sich genau daran, wie es hier früher aussah. Sie hatte immer Angst, auf den Dachboden zu gehen. Als sie klein war, hörte sie die Eltern über die hohe Belastung stöhnen, die auf dem Haus lag. Vater flüsterte das Wort erdrückend. Donna stellte sich die Belastung als riesigen, schweren Felsblock vor. Sie sah ihn nicht, doch er mußte dasein. Irgendwann sagte ihr Vater, die Last werde nach und nach abgetragen. Sie befürchtete immer, das Dach könnte unter dem Druck zusammenkrachen, und folglich war sie empört, als die Eltern ihr vorschlugen, sie solle dort oben ihr eigenes kleines Reich bekommen. Sie wollte unten bleiben, in Sicherheit. Neben dem elterlichen Schlafzimmer.
Jetzt kann sie darüber lachen, aber damals waren ihre Angst und ihre Enttäuschung darüber, daß ihre Eltern sie so einer Gefahr aussetzen wollten, sehr real.
Donna klopft gegen das Plakat von den Red Hot Chilli Peppers. Tatsächlich, es klingt hohl.
Sie löst das Poster vorsichtig von der Wand und tastet die Tapete ab. Sie spürt die Nahtstellen der dünnen Rigipsplatten. Direkt darüber knibbelt sie die Tapete ab. Dabei kommt sie sich verschlagen vor. Ausgebufft und listig wie ein Ausbrecherkönig. Sie liebt Steve McQueen als Papillon, der von der Teufelsinsel flieht. Als sie den Film zum erstenmal sah, konnte sie seine Ausweglosigkeit körperlich spüren. Sie saß, Kekse kauend, allein auf der großen Couch im Wohnzimmer, aber der Raum wurde ihr zu eng. Sie öffnete die Terrassentür, doch die Luft kam ihr immer noch stickig vor. Sie hat den Film auf ihrem eigenen Videorecorder zigmal gesehen, bis sich das Band verwurstelte und der Apparat es regelrecht zerfetzte.
Seitdem hat sie kaum einen Gefängnis- oder Ausbrecherfilm verpaßt. Sie weiß selbst nicht genau, was sie daran fasziniert. Aber sie identifiziert sich immer mit den Gefangenen, egal, welcher Verbrechen sie beschuldigt werden. Egal, ob schuldig oder unschuldig. Sie hält zu denen, die raus wollen.
Die Rigipsplatte läßt sich mühelos nach hinten drücken. Ihr Vater hält sich zwar für einen begabten Handwerker und macht fast alles selbst, aber sie weiß, er ist nur zu geizig, eine Firma zu bezahlen. Oder hat er wirklich nicht genug Geld?
Hinter der Platte riecht es nach Holzwolle. Es ist dunkel. Dort könnten Ratten hausen. Ein Versteck für Riesenspinnen. Vielleicht haben dort die Wespen ihr Nest, die seit zwei Sommern ständig ums Haus kreisen? Sie kommen morgens, wenn die Obstkisten dekorativ draußen vor dem Schaufenster aufgestellt werden, aus dem Nichts und verschwinden abends genauso rasch wieder. Sie müssen in der Nähe des Hauses in einem Erdloch wohnen, oder sie fliegen durch eine undichte Stelle zwischen zwei Dachpfannen in die Innenwandverkleidung.
Donna möchte das Loch so schnell wie möglich wieder verschließen. Sie wirft ihre Tennissocken hinein. Die zwei flauschigen Handtücher, das Ersatzröckchen und die neuen Nikes. Sie wird statt dessen ihre alten, ausgelatschten schwarzen Reeboks tragen. Die, die sie schon zweimal aus dem Müll gerettet hat.
Sie hebt die Rigipsplatte wieder an und hängt das Red-Hot-Chilli-Peppers-Poster wieder über die Stelle, an der sie die Tapete abgeknibbelt hat. Sie fühlt sich wie der Graf von Monte Cristo beim Buddeln des Tunnels. Die Platte wackelt, aber das wird Mutter beim Putzen nicht bemerken. Nie würde sie ein Poster von Donna abhängen. Sie runzelt nicht einmal die Stirn darüber. Sie ist tolerant und aufgeschlossen. Vielleicht hätte sie sich früher auch Bilder von halbnackten Männern ins Zimmer gehängt, die ein Mikrophon in der Hand halten, als sei es ihr Penis, wenn es damals so etwas schon gegeben hätte, wenn sie ein eigenes Zimmer gehabt hätte und wenn ihre Eltern nicht so kleinkarierte Spießer gewesen wären.
Donna stopft das Igluzelt in die Tennistasche. Dieses silbergraue Sonderangebot für DM 99 ließe sich bequem in einer Plastiktüte transportieren, wenn sie die Stangen einmal mehr knicken könnte. In der Tennistasche verschwinden sie ganz. Der Schlafsack macht ihr mehr Sorgen. Er ist mit Daunenfedern gefüllt. Im Beipackzettel stand, man könne damit problemlos im Schnee übernachten. Sie will es lieber nicht ausprobieren. Es wäre ihr lieber, wenn man das Ding statt dessen leichter zusammenknubbeln könnte. Ohne Schlafsack will sie nicht fahren. Dann schon lieber ohne Zelt. Sie glaubt sowieso nicht daran, daß sie viel schlafen wird.
Endlich ist der Daunensack Polar untergebracht. Die Reeboks noch, und mehr geht wirklich nicht rein. Ein Tennisschläger muß aus der Seitentasche herausgucken, wenn sie nicht sofort auffliegen will.
Noch ein Blick in den Spiegel. Donna wirft die langen, goldblonden Haare zurück. Egal, welches Shampoo, egal, welche Spülung, egal, welche Kuren sie macht, egal, wie oft sie sich die Spitzen schneiden läßt: Sie hat immer Spliß.
Sie bleckt die Zähne. Ihre Freundinnen trugen noch bis vor kurzem quälende Zahnspangen. Donna hatte so etwas nie nötig. Einmal hat der Schulzahnarzt sie als Beispiel dafür vorgeführt, wie toll sich Zähne entwickeln, wenn sie richtig geputzt werden. Sie hätte ihn leicht lächerlich machen können, tat es aber nicht. Was ging es die anderen an, daß sie sich nur selten abends vor dem Zubettgehen die Zähne putzt? Meist nur morgens, um einen frischen Atem zu haben und gut auszusehen. Wenn die anderen so mit ihren Zähnen umgehen würden, säßen sie noch öfter in den Wartezimmern der Zahnärzte. Donna weiß, es liegt nicht am Putzen. Es liegt am gesunden Essen. Wie sollen Zähne stabil bleiben, wenn man ihnen nicht genügend Mineralien zuführt?
Ihre Eltern achten genau darauf, daß Donna sich richtig ernährt. Manchmal gehen sie ihr auf die Nerven mit dem Gerede über ausgewogene Kost. Aber Donna weiß, sie haben im Grunde recht. Manchmal lehnt sie sich dagegen auf, ißt absichtlich etwas, von dem Mama sagt, es sei schädlich. Es ist eine Art Selbstbehauptung. Danach fügt sie sich um so williger dem Ernährungsplan. Sie liebt die Küche ihrer Mutter. Niemand kann eine Gemüselasagne zubereiten wie sie. Ihre Salate sind Kunstwerke. Manchmal geniert Donna sich fast, die bunten Arrangements zu zerstören.
Donna tänzelt die Treppe hinunter und durchquert den Laden. Sie will auf keinen Fall, daß die anderen hier hereinkommen und sie abholen. Sie muß vorher an der Straßenecke sein. Jetzt darf nichts schiefgehen. Einfach rauslaufen kann sie nicht. Sie muß sich von ihren Eltern gebührend verabschieden. Sie würden das nicht verstehen, sich Sorgen machen, verletzt sein. Ohne Abschiedsküßchen hat sie sich noch nie von ihnen getrennt.
Sie schaut auf die Swatch. Die Zeit wird knapp.
Ihr Vater steht hinter der Theke und unterhält sich mit seinem Stammkunden, dem pensionierten Finanzbeamten Gerhardt, über sein Lieblingsthema: die Steuern. Die beiden streiten sich täglich mindestens eine Viertelstunde lang. Jedesmal, wenn Herr Gerhardt kommt, seine Zeitung kauft, zwei Flaschen Bier und ein paar frische Lebensmittel fürs Mittagessen.
«Ach, Gerechtigkeit! Hören Sie doch auf! Steuern haben mit Gerechtigkeit nichts zu tun!»
Herr Gerhardt hebt den Zeigefinger. «Lieber Herr Huse! Es gibt achtunddreißig verschiedene Steuern. Niedergelegt sind sie in hundertzwanzig Gesetzen mit fünfundzwanzigtausend Paragraphen und hundertachtundsiebzig Verordnungen mit mehr als zwanzigtausend juristischen Exegesen. Hinzu kommt eine Flut von Kommentaren, Erlassen, Anweisungen und Gerichtsurteilen. So versucht man jedem Steuerbürger gerecht zu werden.»
Peter Huse wischt die angegraute Locke aus der Stirn. «Ach, Unsinn. Das alles hat nur einen Sinn: Es soll verschleiern, daß wir ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans. Mehr nicht.»
Donna will sich jetzt nicht einmischen. Sie hat gelernt, danebenzustehen und abzuwarten, bis die Leute ausgeredet haben. Wer höflich mit anderen umgeht, kann von ihnen das gleiche erwarten. Sie ist in diesem Geschäft groß geworden. Sie weiß, daß Kunden und Kundengespräche immer Vorrang haben. Jedes kleine familiäre Problem kann man zurückstellen, bis die Kunden den Laden verlassen haben. Aber diesmal drängt die Zeit.
Donna spürt ihr Herz pochen. Hoffentlich sieht Papa nicht, wie nervös ich bin.
Mutter befreit die Salatköpfe von ein paar nicht mehr ganz so ansehnlichen Blättern. Donna läuft zu ihr, um sich wenigstens von ihr schon mal zu verabschieden.
«Die Schaumweinsteuer wurde neunzehnhundertzwei eingeführt, um die kaiserliche Marine aufzubauen. Stimmt’s, oder nicht?»
«Ja, das stimmt.»
«Sehen Sie! Die Schiffe sind längst gesunken. Den Kaiser gibt es nicht mehr. Aber die Steuer, die ist uns erhalten geblieben.»
Donnas Vater zählt die Steuerkuriositäten an den Fingern ab. Er tut es geradezu genüßlich.
Donna sieht ihm gern dabei zu. Er wirkt gar nicht wie ein Verkäufer in seinem eigenen Lebensmittelladen. Er trägt seine verwaschenen Jeans, ein bißchen zu knapp am Bauch. Die obersten drei Knöpfe am Baumwollhemd stehen auf. So, wie er doziert, kann sie sich ihn gut als Lehrer vorstellen.
«Zar Peter der Große verhängte eine Bartsteuer. Wer als Bartträger keine gültige Steuerquittung vorweisen konnte, wurde auf der Stelle rasiert. In England wurde die Fenstersteuer erfunden. Bald darauf wurde sie auch in Holland und Deutschland beliebt. Es gab eine Spatzensteuer, sogar eine Nachtigallensteuer. Eine Ofensteuer …»
«Aber Herr Huse, das hat man doch lange abgeschafft.»
«Ja, und durch neuen Blödsinn ersetzt. Der Weidmann zahlt Jagdsteuern. Die Hinterbliebenen Erbschaftsteuern. Die Freigebigen Schenkungssteuern. Die Besitzenden Vermögenssteuern. Der Gläubige Kirchensteuer. Bier-, Kino-, Benzin-, Tabaksteuer – alles klar! Aber wissen Sie, wir Deutschen, wir zahlen sogar Steuern auf die Steuern. Das ist doch ein bißchen viel, nicht wahr?»
«Das stimmt ja nun wirklich nicht!»
«Ach, zahlen wir nicht Umsatzsteuer auf die Benzinsteuer? Wissen Sie, daß der Staat an den zwei Bierflaschen hier mehr verdient als ich? Mit welchem Recht eigentlich?»
Donna legt ihrer Mutter die rechte Hand zwischen die Schulterblätter und sagt: «Tschüs, Mami.»
Monika Huse dreht sich um. «Aber Kind, so kannst du doch nicht gehen!»
«Warum nicht?»
«Es ist viel zu kalt. Es soll regnen.»
«Mutti, es ist ein Hallenturnier.»
Frau Huse greift zielsicher ins Obstregal, wählt ein paar der besten Früchte aus, wirft sie in einen Einkaufskorb. Zwei Orangen, eine Pampelmuse, drei Kiwis, ein paar Bananen.
«Warte, Kind, du mußt was zu essen mitnehmen!»
«Mutti, wir essen dort.»
«Aber die Autofahrt ist lang. Und du kennst doch die Preise bei den Turnieren. Willst du etwa diesen sündhaft teuren Weißmehlkuchen essen?»
In ihrer Stimme liegt Spott, so als könne nur ein Wahnsinniger in Erwägung ziehen, diesen Kuchen zu essen. Schon ist sie mit dem Korb bei den Getränkedosen.
«Mama, ich brauche keine Isodrinks.»
«Wenn du schwitzt, verliert der Körper Mineralien. Du mußt ihm neue zuführen, sonst …»
«Mama, ich weiß. Ich mag das Zeug aber nicht. Ich trinke lieber eine Cola.»
«Da ist viel zuviel Zucker drin.»
«Mama, bitte. Ich muß jetzt gehen.»
Peter Huse kassiert den pensionierten Finanzbeamten ab und wendet sich seiner Tochter zu. Während ihre Mutter noch zwei Müsliriegel einpackt, drückt er ihr augenzwinkernd einen zusammengefalteten Zwanzigmarkschein in die Hand. Er schließt ihre Finger fest darum, so als dürfe ihre Mutter nicht sehen, was er ihr gerade gegeben hat. Dabei weiß Donna genau, er wird ihr gleich sagen: «Moni, ich hab zwanzig Mark aus der Kasse genommen, für Donna, damit unser Mädchen sich nicht aushalten lassen muß.»
Donna umarmt ihren Vater und küßt ihn. Seine Bartstoppeln kratzen. Er benutzt ein dezentes Rasierwasser. Sie riecht es erst, als sie sich schon wieder von ihm gelöst hat. Es ist, als würde der Duft an ihrem Gesicht haftenbleiben. Er hat nie ein anderes Rasierwasser benutzt. Sie erinnert sich daran, daß sie ihn früher manchmal um sein Kopfkissen bat. Wenn sie bei der Oma waren und dort übernachteten, nahm sie abends sein Hemd mit ins Bett. Sie liebt diese kuscheligen Baumwollhemden, in denen sein Geruch hängt. Heute nimmt sie sie nicht mehr mit ins Bett, aber sie erinnert sich gern daran. Der Duft vermittelt ihr so etwas wie Geborgenheit. Wenn ihr der Vater so nahe war, daß sie ihn riechen konnte, dann gab es für sie keine Gefahren mehr.
In dieser Gewißheit ist sie aufgewachsen. Wenn sie auf seinem Arm war, konnte ihr niemand etwas. Nicht die frechen Jungs aus der Schwanenstraße und auch nicht der ewig kläffende bissige Köter von Frau Lange. Eines Tages ist das Vieh überfahren worden. Donna glaubt noch heute, daß ihr Vater das für sie getan hat. Er hat es immer geleugnet, aber sie ahnt die Wahrheit.
Draußen hupt ein Golf.
«Mama, Papa, ich muß jetzt wirklich.»
«Warum kommen sie nicht rein?»
Ahnen sie etwas? Liegt Mißtrauen in diesen Worten? Donna befürchtet, rot zu werden. Sie rennt zur Tür. Dort dreht sie sich noch einmal um und winkt.
«Tschüs! Tschüs! Macht euch keine Sorgen! Ich ruf morgen mal an.»
«Schöne Grüße an Herrn Wolters!» ruft Peter Huse seiner Tochter hinterher. «Schau sie dir an, da läuft sie», sagt er stolz zu seiner Frau. Er klatscht sich auf den Bauchansatz und lacht. «Wie kann so ein häßlicher Mann so ein schönes Kind zeugen? Bist du sicher, daß ich es war?»
Diesen Spruch hört Monika Huse mindestens einmal pro Woche. Wie immer antwortet sie auch heute mit gespielter Unsicherheit in der Stimme: «Wenn ich mich recht entsinne, doch.»
Herr Gerhardt guckt zwischen beiden hin und her. Er weiß, daß sie diese Szene für ihn gespielt haben. Es kommt ihm manchmal so vor, als würden die beiden diesen Lebensmittelladen wie eine Bühne benutzen. Die Kunden sind die Zuschauer. Die Huses haben kleine Sketche zum Thema Glückliche Familie einstudiert. Witzige Wortwechsel, amüsante kleine Szenen, die sie vor ständig wechselndem Publikum spielen. Als müßten sie immer wieder nach außen demonstrieren, daß sie sich alle lieben.
Herr Gerhardt war zweiundzwanzig Jahre lang verheiratet. Dann starb seine Frau. Auch er hat eine Tochter. Natürlich liebt er sie. Aber er hat nie so eine Show darum gemacht. Jetzt tut es ihm ein bißchen leid. Es ist zu spät, um noch damit anzufangen. Das demonstrative Familienglück der Huses versetzt ihm einen Stich. Er muß daran kratzen, ihm wenigstens etwas von seinem Glanz nehmen. Er ärgert sich darüber, daß er es sagt, aber er tut es trotzdem: «Ich hätte meine Tochter in dem Alter nicht so einfach über Nacht weggelassen.»
Für den Bruchteil einer Sekunde spürt er Feindseligkeit im Blick von Monika Huse. Verdächtigt hier jemand ihre Tochter? Will hier jemand Flusen auf das Kissen des Vertrauens werfen?
Bevor sie in unverblümter Schärfe antworten kann, hebt Peter Huse beschwichtigend die Hand und winkt ab. «Sie ist mit einer befreundeten Familie zum Tennisturnier, den Wolters. Das ist doch völlig harmlos.»
«Na ja, heutzutage, mit Aids und so … Da reicht es nicht mehr, die Kinder einfach aufzuklären. Es geht ja gleich um Leben und Tod. Ich möchte jedenfalls nicht noch einmal jung sein.»
Monika spürt, daß ihr Magen augenblicklich übersäuert. Was nimmt sich dieser Mann heraus? Ihre schlimmsten Alpträume spricht der einfach so aus, mit zwei Flaschen Bier und einem Salatkopf in der Hand. Im Laufe der Jahre hat sie gelernt, immer freundlich zu bleiben. Aber sie läßt sich nichts gefallen. Wenn jemand eine bestimmte Grenze überschreitet, weist sie ihn dahinter zurück. Wenn man ihrer Tochter eins auswischt, trifft man sie damit mehr, als wenn man an ihr herumkritisiert. Dieses Kind war einst ein Teil von ihr. Noch heute, 17 Jahre nach Durchtrennung der Nabelschnur, fällt es ihr manchmal schwer, Donna als eigenständige Person zu sehen. Ein bißchen ist sie wie ein Körperteil von ihr, der sich selbständig gemacht hat. Solche Gedanken äußert sie nie. Nicht mal ihrem Mann gegenüber. Aber sie hat dieses Gefühl manchmal, und wenn es kommt, ist es so heftig, daß sie sich kaum dagegen wehren kann. Wenn sie friert, will sie Donna etwas Warmes überziehen. Wenn sie Hunger hat, für Donna kochen. Das Essen schmeckt nur halb so gut und sättigt auch nicht wirklich, wenn Donna nicht mit am Tisch sitzt.
«Wir können unserer Tochter voll und ganz vertrauen», sagt sie mit der Stimme von jemandem, der versucht fröhlich und freundlich zu bleiben, obwohl man ihm den Hals zudrückt.
Herr Gerhardt hat das Gefühl, sich entschuldigen zu müssen, er weiß aber nicht genau, wie er es anstellen soll. Der tägliche Kontakt zu den Huses ist ihm wichtig. Die Diskussionen übers Steuerrecht mag er nicht missen. Dieser Laden, das Einkaufsritual, die gespielten kleinen Szenen, das alles ist seit langem Bestandteil seines Lebens wie die abendliche Tagesschau und das Öffnen der ersten Flasche Bier bei der Wetterkarte. Er will das Ganze nicht größer machen, als es ist, aber er möchte gern ohne Blessuren herauskommen.
«Nichts für ungut», sagt er und weiß, daß es falsch ist.
Peter Huse lächelt. Es sieht nicht verkrampft aus, aber eingeübt. So lächelt er auch, wenn jemand kritisiert, daß die Preisschilder auf dem Joghurt das Verfallsdatum überdecken.
«Donna weiß, daß sie uns alles erzählen kann. Wir haben wirklich ein Vertrauensverhältnis. Wir sprechen wie Freundinnen miteinander. Wenn man den Kindern alles verbietet, machen sie nur heimlich Dummheiten», sagt Monika entschieden und faßt sich an den Magen.
Herr Gerhardt hofft, daß die Sache damit ausgestanden ist. Er entscheidet sich, noch eine Packung Mentholzigaretten mitzunehmen.
«Die machen Kopfschmerzen», sagt Monika Huse. «Das Menthol wirkt direkt auf die Nervenenden und …» Sie merkt, wie schnippisch ihre Stimme klingt. Sie sagt das nicht wirklich, um dem Frühpensionär einen Gesundheitsratschlag zu geben. Sie will ihm eins auswischen. So etwas darf einer Geschäftsfrau nicht passieren. Sie hat sich sofort wieder im Griff. «Ach, Sie werden schon selbst am besten wissen, was gut für Sie ist, Herr Gerhardt. Tschüs, bis morgen.»
Sie nimmt die abgezählten Münzen und wirft sie in die dafür vorgesehenen Kästchen in der Kasse. Sie haßt es, wenn Zweimarkstücke bei den Fünfern liegen, Pfennige bei den Groschen oder Münzen bei den Scheinen.
Monika Huse schaut nach unten. Da steht er. Der Korb mit Früchten, Isodrink und Müsliriegeln. Donna hat ihn vergessen. Monika schüttelt den Kopf.
«Schussel.»
3
Die Security-Leute tragen schwarze Blousons mit golden aufgenähter Schrift – Security –, Springerstiefel und Kurzhaarschnitte. Von weitem wirken sie wie eine Nazi-Schlägertruppe, aber damit haben sie nichts zu tun. Sie sichern die Bühne backstage ab, als ob Michael Jackson und Tina Turner sich hier gemeinsam umziehen würden. Dabei würgen sich dort nur die Real Motherfuckers die ihnen vertraglich zugesicherte Portion Gyros mit Krautsalat und Pommes rein. Sie würden gern ein paar Groupies vernaschen oder wenigstens dem Lokalsender ein Interview geben, doch so weit sind sie noch lange nicht. Sie werden immer nur als Vorgruppe verheizt und irgendwann von den Fans der wirklichen Stars von der Bühne gebuht.
Jens Simon hat das Saxophon lässig um den Hals hängen. Er schiebt seine Jeans herunter, so daß sie tief auf den Hüften hängen und zwischen den Beinen herumschlabbern. Er findet dieses Aussehen total lächerlich. Aber seit einige Teenybands sich damit erfolgreich von den Opas abgrenzen, treten die Real Motherfuckers nur noch so auf.
Jens ist stolz auf seinen knackigen Hintern. Warum soll er ihn so unkenntlich machen? Für den fetten, biersaufenden Frontsänger der Motherfuckers ist diese neue Mode sehr vorteilhaft. So sieht er nicht mehr aus wie einer, der sich im Büro den Arsch breitgesessen hat, sondern wild und in.
Jens klemmt sich die langen schwarzen Locken hinter die Ohren. Die so entstehenden Segelohren sind auch längst zum Markenzeichen der Real Motherfuckers geworden. Er schabt sich mit der Hand über die Bartstoppeln. Er ist zufrieden. Er hat sich gut eine Woche lang nicht rasiert, um endlich einen «Dreitagebart» zu kriegen. Lässig geht er auf die Security-Leute zu und hängt sich dabei die letzte filterlose Zigarette zwischen die Lippen. Er knüllt die Packung zusammen und läßt sie fallen. Der Security-Mann trommelt mit den Fingern einen nervösen Rhythmus auf seinen Elektroschocker. Er trägt ihn nicht wie die anderen in der Hose versteckt, sondern absichtlich offen, wie einen Colt. Jens spürt, daß der Typ nur darauf wartet, mit dem Ding losschlagen zu können.
Warum hab ich eitles Arschloch mir gestern noch die Haare gewaschen? Die Motherfuckers laufen immer mit fettigen Haaren rum. Sie sehen alle aus, als hätte ihnen einer eine Flasche Olivenöl über die Rübe gekippt.
Jens bleibt vor dem Security-Mann stehen und schaut ihm gerade in die Augen. «Hast du mal Feuer?»
Als der Typ in die Brusttasche greift und sein langes Plastikfeuerzeug mit eingebautem Flaschenöffner hervorzieht, weiß Jens, daß er gewonnen hat. Er wippt lässig von einem Fuß auf den anderen, läßt sich beim Anzünden der Zigarette Zeit und sagt dann, um noch eins draufzusetzen: «Wenn so eine rothaarige Tussi kommt, Haare bis zum Arsch, laß sie nicht durch.»
Der Security-Mann nickt Jens komplizenhaft zu und gibt den Weg frei. Jens hat es geschafft. Ja, darin ist er gut: so tun als ob.
Vielleicht hätte ich als Schauspieler auch eine Chance. Für einen Moment gefällt ihm der Gedanke. Dann überprüft er das Mundstück des Tenorsaxophons. Das Holzplättchen sitzt nicht richtig, es ist zu stramm. So wird der Ton blechern. Wahrscheinlich hören die Deppen das nicht mal, aber er weiß, wie ein T-Sax klingen muß.
Sie sitzen da, starren auf ihre Plastikteller und stochern mit den Holzpickern die letzten Reste auf. Sie beachten ihn nicht.
Jens beginnt zu schwitzen in der Lederjacke. Er überlegt, ob er ein Saxophonsolo hinlegen soll, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber die vier Typen hier sind sowieso uninteressant. Bei den Motherfuckers entscheidet Willy The Death, der Frontsänger, alles allein. Die Band ist sein Kind. Er heuert und feuert die anderen, wie er sie braucht. Nur Bobo, der schweigsame Bassist, ist von Anfang an mit dabei gewesen. Bobos Eltern haben den größten Teil der Anlage über Kredit finanziert. Willy The Death kann es sich nicht leisten, ihn zu feuern. Jeder weiß das, aber weil Bobo kein Aufhebens von der Sache macht, kann Willy damit leben.
Bobo ist dreiunddreißig, behauptet aber, dreiundzwanzig zu sein. Er bemüht sich um eine pubertäre Sprache (falls er überhaupt mal etwas sagt), wird aber immer mürrischer, weil man ihn inzwischen allzu oft auf vierzig schätzt.
Da steht Willy The Death. Er fuchtelt aufgeregt mit den Händen herum und redet auf Mark ein. «Du mußt uns erwähnen, Mark. Bitte. Wir sind doch Kumpels!»
Mark wehrt ab. «Hier spielen zwei Dutzend Bands. Und dann die Red Hot Chilli Peppers.»
«Fünfzehn», korrigiert Willy The Death, der es sonst mit Zahlen gar nicht so genau nimmt.
«Na gut. Meinetwegen. Fünfzehn. Aber ich soll über die Red Hot Chilli Peppers schreiben.»
«Du kannst uns doch in einem Nebensatz erwähnen. Als herausragende Vorgruppe oder so.»
«Mensch, Willy, dann sind alle anderen sauer auf mich. Außerdem streichen sie mir den Satz in der Redaktion sowieso heraus.»
Das ist meine Eintrittskarte, denkt Jens. Mark. Alter Kumpel Mark. Er stellt sich zu den beiden.
Willy will ihn gleich mit einer unwirschen Geste verscheuchen. «Nicht jetzt!»
Doch Mark streckt seine Hand aus. «Jens? Spielst du jetzt etwa hier mit?»
«Möglich.»
Bobo, der die Szene aus den Augenwinkeln mißtrauisch beobachtet, schießt hoch. «Äi! Wir brauchen keine Bläser. Ich kann dieses Blechzeugs nicht leiden. Am Ende holen wir uns noch irgendwelche Fiedler ins Haus. Diese ganze softe Scheiße geht mir schon lange auf den Keks. Sind wir ’ne Heavy-Metal-Band, oder machen wir Guildo Horn?»
Für Bobo war das eine lange Rede. Er setzt sich und muß erst mal verschnaufen.
«Als ich euren Tourneebus repariert habe, hörte sich das aber ganz anders an», schimpft Jens. «Ich dachte, ihr braucht dringend ein Sax! Ihr habt mich geleimt! Wißt ihr überhaupt, was die Reparatur euch woanders gekostet hätte? Unter zweitausend wärt ihr nicht weggekommen.»
«Jaja, du kannst gleich vorspielen», beschwichtigt Willy The Death mit Blick auf Mark.
Jens spürt sofort, was hier läuft. Mark ist für die Motherfuckers unglaublich wichtig, daß er scheinbar einen freundschaftlichen Draht zu ihm hat, macht ihn für sie wieder interessant. Sie hatten nie vor, ihn als Saxophonspieler in ihre Band aufzunehmen. Sie haben ihm das Blaue vom Himmel versprochen, weil er den Bus wieder auf Vordermann bringen sollte.
Und ich Idiot bin noch nachts auf den Schrottplatz gefahren und habe Ersatzteile für sie ausgebaut. Im Grunde wußte ich doch, daß sie mich reinlegen. Warum falle ich immer auf so ’n Mist rein? Ich stand nicht mal wie versprochen auf der Gästeliste zu diesem Scheißkonzert. Sogar die Eintrittskarte mußte ich mir kaufen. Sechsunddreißig Mark. Und wofür das alles?
«Ein guter Bläser würde eurer Truppe guttun», sagt Mark, nicht weil er davon überzeugt ist, sondern um Jens einen Gefallen zu tun.
«Erwähnst du uns dann in deinem Artikel?»
Mark lacht bitter. «Hör mal, Willy, ich schreibe nicht für die Lokalzeitung, sondern für den Musical Express. Da brauche ich schon eine richtige Story. Was Handfestes. Was, bei dem die Leute sagen: Wow! Das wußten wir nicht. Schade, daß wir nicht dabei waren.»
Schulterzuckend knackt Willy eine Dose Bier. Sauer fährt er Mark an: «Was willst du? Soll ich ihn auf der Bühne rausholen?!»
«Ach, das ist alt. Damit lockst du keinen Hund mehr hinterm Ofen vor.» Mark tippt mit dem Zeigefinger auf Willys fette Brust. «Wenn du auf der Bühne onanierst, Junge. Das ist es!»
«Häh?»
«Hol dir vor versammelter Mannschaft einen runter. Darüber kann ich schreiben. Das läßt mein Chefredakteur drin. Ich kann es in meinem Artikel zwar nicht gut finden, ich muß sogar über dich herziehen, aber was macht das? Alle werden über euch reden. Und bei eurem nächsten Konzert drängen sie sich vorn an der Bühne in der Hoffnung, daß du es nochmal tust.»
«Du spinnst ja!»
«Willst du nun in den Artikel oder nicht?» Mark zeigt auf die Bühne. «Was glaubst du, warum die da draußen so viel Eintritt bezahlen? Was glaubst du, was die hier wollen? Die wollen was Besonderes. Die wollen was sehen. Die wollen was zum Erzählen haben. Und weil gar nichts passiert, dröhnen sie sich zu. Geh raus. Zeig ihnen was. Gib ihnen das Gefühl, daß sie bei einer einzigartigen Show sind.»
Willy fühlt sich plötzlich unwohl in seinem T-Shirt, als hätte ihm jemand Juckpulver hineingestreut. Er kratzt sich. Er weiß nicht, ob das hier die große Chance ist oder ob er einfach nur verarscht wird. Wenn er es tut, macht er sich dann lächerlich oder ist er auf dem Weg zu Weltruhm?
Mark winkt ab. «Ich seh schon. Ihr bringt’s sowieso nicht.»
Jetzt, da Willy so frustriert ist, sieht Jens kaum noch eine Chance für sich, jemals mit den Motherfuckers auf der Bühne zu stehen. Trotzdem ist er noch bereit vorzuspielen. Nicht wirklich für sie. Mehr für Mark. Mark kennt viele Bands. Marks Rat ist gefragt. Vielleicht wird er irgendwo erwähnen, daß er einen guten Saxophonisten kennt.
«Was ist jetzt? Kann ich vorspielen?» fragt Jens.
«Na los, zeig ihnen mal, wie das ist, wenn es richtig groovt.»
Jens hat sich einige gute Soli von Knaller abgeguckt, als der noch bei den Soulcats war und natürlich von der Saxophonmafia. Er fängt an. Legt sein ganzes Gefühl hinein, um ihnen zu zeigen, wieviel Trauer und Freude ein Saxophon ausdrücken kann.
Wenn die Säue doch nur Perlen fressen würden!
Mit ausdruckslosen Augen sehen sie ihn an. Die Roadies von Terrorvision machen einen Soundcheck. Die nervigen Rückkopplungen aus den übersteuerten Boxen entmutigen Jens sofort. Er hört auf.
«Ihr habt es versprochen. Gebt mir eine Chance.»
Unverblümt sagt Willy The Death, was er denkt: «Okay. Wenn du unseren Tourneebus durch den TÜV kriegst, bist du bei den nächsten fünf Gigs dabei.»
Vor lauter Empörung fällt Jens keine Antwort ein, die scharf genug wäre. Willy deutet das als Einverständnis und legt gleich die Bedingungen fest.
«Hotelzimmer gibt’s nicht. Das geht von unserer Gage ab. Pennen im Tourneebus. Boxen schleppen wir selbst, Roadies haben wir nicht.»
Mark legt seinen Arm um Jens’ Schultern.
Vielleicht fügt Willy deshalb in plötzlicher Großzügigkeit hinzu: «Hundertzwanzig pro Gig. Getränke im Bus zahlst du selbst. Aber ein Essen am Abend ist immer mit drin.»
Als sei das sein Stichwort, schnippt Bobo seinen mit Tsatsiki verschmierten Plastikteller auf den Boden.
Mark zieht Jens mit sich. «Komm, Alter. Mach dir nichts draus. Vielleicht klappt’s woanders. Aus denen wird sowieso nichts. Die waren schon out, bevor sie jemals in werden konnten. Denen fehlt jeder Funken Spirit – wenn du weißt, was ich meine.»
Jens weiß es nicht genau, aber er nickt. Mark zieht ihn mit nach draußen, an den Security-Leuten vorbei. Jetzt steigt Jens in deren Ansehen noch mal um einige Zentimeter, denn Mark kennen sie alle, und sie buhlen um seine Gunst.
Mark will ein Bier ausgeben und auf alte Zeiten anstoßen. Wahrscheinlich meint er es ehrlich. Doch in Jens setzt sich der Verdacht fest, daß auch Mark nichts weiter von ihm will als eine billige Autoreparatur.
Rund um den Platz stehen Bier- und Würstchenbuden, Schmuck- und T-Shirtstände. Bier gibt es nur in Plastikbechern. Jens findet das eigentlich auch gut. Wie viele Becher er bei Konzertbesuchen schon an den Kopf gekriegt hat, weiß er gar nicht mehr. Wären das Bierkrüge oder Flaschen gewesen, läge er vermutlich längst unter der Erde.
Allerdings sind die Becher nur halb voll, der Rest ist Schaum. Zwar zahlt sein alter Kumpel die zehn Mark, doch Jens braucht ein Ventil für seine Wut. Er schnauzt los, hier werde nur beschissen, die Konzertmafia habe die Leute hier eingekesselt und lasse sie nun verhungern oder kassiere gnadenlos ab.
Mark läßt ihn toben. Er kennt das. Musiker sind cholerisch. Was Jens für einen Wutausbruch hält, findet Mark harmlos. Unterhalb jeder diskussionswürdigen Schwelle.
Die erste Vorgruppe beginnt. Es ist gerade erst Mittag, und die Band ist so unbekannt, daß sich niemand die Mühe macht, ihren Namen zu nennen. Sie stehen da und kämpfen mit ihren offensichtlich neuen Musikinstrumenten.
«Guck dir die an!» schimpft Jens und verschüttet dabei das ohnehin knappe Bier. «Das sind doch noch Kids! Die Teenys ziehen da ihre Show ab. Und ich? Ich werde immer älter und krieg nix auf die Reihe!»
«Mensch, Jens, wie alt bist du?»
«Dreiundzwanzig», antwortet Jens zerknirscht.
Mark grinst. Er selbst ist gerade zweiundzwanzig geworden. In der schreibenden Zunft hat er es schon ziemlich weit gebracht. Ein Radiosender und zwei Musikzeitschriften kaufen ihm hin und wieder Artikel ab. Solange er bei seiner Mutter in Tübingen wohnt, kommt er damit gut zurecht. Er beschließt, noch einen auszugeben.
Da sieht Jens sie: Donna.
4
Augenblicklich vergißt Jens alles. Wer sind schon die Motherfuckers oder Willy The Death?
Er hört die Teenyband nicht mehr, sondern ein sehnsuchtsvolles Sax. Besser, als er es je blasen könnte. Er beachtet sein Bier nicht mehr. Sein T-Sax lehnt er achtlos gegen den Getränkestand. Seine schlaffe Körperhaltung verändert sich. Er spürt Energie vom Magen in die Gliedmaßen sausen. Auf Mark wirkt er wie ein aus dem Schlaf erwachtes Raubtier, das seine Beute wittert.
Die Bedienung reicht zwei frische Bier rüber. Mark nimmt das für Jens mit an, hält es ihm hin und stellt amüsiert fest, daß er nicht den Hauch einer Chance hat, wahrgenommen zu werden. Er schaut in die Richtung, in die Jens starrt. Wer kommt dort? Heike Makatsch Arm in Arm mit Madonna?
Das Open-air-Gelände ist weiträumig abgesperrt. Wer in den inneren Kreis der Verkaufsstände hinein will, braucht eine gültige Eintrittskarte, und Security-Leute durchsuchen jeden nach Waffen. So etwas hat Donna noch nie erlebt. Solche Gitter hat sie mal im Fernsehen gesehen, sie standen vor dem Bundestag, als Demonstranten die Bannmeile durchbrechen wollten.
In der maulenden, rauchenden Menge hat sie geduldig fast eine halbe Stunde lang gewartet. Man kommt nur einzeln herein, über eine Art Drahtbrücke und ein Meer von leeren Coladosen. Unter ihren Füßen knirschen die Weißblechbüchsen wie lebende Muscheln und Schnecken, die am Strand zertreten werden.
Ulf wird zur Seite gebeten und abgetastet.
«Ich hab nichts dabei. Ich brauch nichts. Ich hab den blauen Gürtel im Judo.»
«Ich den braunen», antwortet der Security-Typ und läßt Ulf durch.
Sina geht vor Donna durch die Absperrung. Sie hebt die Arme hoch. Donna ist gespannt, ob der Kerl sich erdreistet, Sina genauso abzutasten, wie er es mit Ulf gemacht hat. Bereitwillig öffnet Sina ihr Gürteltäschchen und gibt ihr Reizgas ab. Donna erwartet, daß es jetzt Ärger gibt, doch zu ihrem Erstaunen nickt der Security-Typ bloß, klebt eine Nummer auf die Spraydose, wirft sie ein paar Meter weit nach hinten, wo ein schmalbrüstiger, milchgesichtiger Junge mit hängenden Schultern sie geschickt auffängt und in einen blauen Müllsack gleiten läßt. Er sieht überhaupt nicht aus, als würde er zur Sicherheitstruppe gehören. Er trägt auch nicht deren Uniform. Trotzdem bewacht er alle eingesammelten Waffen.
Sina erhält einen Schein, auf dem die Nummer ihrer Spraydose steht. Während dieses für Donna erschütternden Vorgangs wird kein Wort gesprochen. Eine Selbstverständlichkeit. So, wie man beim Verlassen des Supermarkts seine Waren zeigt und bezahlt.
Donna tut es Ulf gleich. Sie versichert: «Ich hab nichts.»
Ohne auch nur einen Ton zu sagen, nimmt der Typ ihr die Tennistasche ab, zieht den Schläger heraus, klebt eine Nummer drauf und wirft ihn dem Milchgesicht zu. Donna erhält die Quittung. Er öffnet die Tasche und durchwühlt sie. Mit der Faust drückt er in den Schlafsack, um zu überprüfen, ob dort ein harter Gegenstand versteckt ist. Die Zeltstangen und Heringe interessieren ihn nicht. Dann befühlt er Donnas Ersatzunterhose. Während er den Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger reibt, schaut er sie an. Der Blick kommt ihr unanständig vor. Sie findet das Ganze erniedrigend und ist gleichzeitig froh über die Kontrolle. Diese Sicherheitskräfte geben eine gewisse Garantie dafür, daß es auf dem Platz nicht zu Messerstechereien kommt. Aber der Kerl soll gefälligst ihre Unterwäsche in Ruhe lassen. Sie staunt selbst über ihren Mut. Mit einem Ruck nimmt sie ihm die Tennistasche ab. Er geht zur Seite und läßt sie durch.
Wenige Meter weiter, am zweiten Eingang, versucht jemand, seine japanischen Kampfhölzer hereinzuschmuggeln. Er wird erwischt, weigert sich, sie abzugeben, und kniet Sekunden später auf dem Boden und übergibt sich.
Sina zieht Donna mit sich fort, hinein in die Menschentraube vor der Bühne. Donna hat schon einige Livebands gehört. Bei Schul- und Stadtteilfesten, im Jugendzentrum und im Gemeindesaal. Aber noch nie hat sie die Bässe so gespürt. Sie ist noch gut hundert Meter von den Lautsprechertürmen entfernt, aber es ist, als würden die Töne sie durchbohren. Stampfende Laute übernehmen den Rhythmus in ihrem Körper. Der Magen vibriert. Die Bässe klopfen von außen gegen ihre Brust und versuchen einzudringen. Mit jedem Schritt, den sie näher kommt, durchstoßen sie die Haut und lassen das Herz flattern, bis es sich dem Rhythmus angepaßt hat.
«Ist das nicht geil?» schreit Sina und hüpft hoch, um besser sehen zu können.
Hinter Donna schließen sich die Reihen. «Ja, geil!» ruft sie nach vorn. Das hört Sina schon nicht mehr. Einen Moment fürchtet Donna, sie zu verlieren, doch da sieht sie sie wieder springen. Ihre langen, rotbraunen Haare flattern über den Köpfen der anderen. Donna hält nach den Jungs Ausschau. Akki, mit dem Sina irgendwie zusammen ist, und Ulf, der hintenrum Pizzagesicht genannt wird, weil er so viele Pickel hat. Ulf ist in Donna verknallt. Aussichtslos. Sie sind zu viert hergekommen, im Golf von Akkis Vater.
Als sie weder Ulf noch Akki entdecken kann, sieht Donna wieder nach vorn. Der Sänger hält das Mikro mit beiden Händen umklammert und brüllt mit krebsrotem Gesicht seinen Text hinein. Es ist kein Wort zu verstehen. Gegen die übersteuerten Instrumente und die voll aufgedrehten Boxen hat die Gesangsanlage keine Chance.
Jens wieselt nach vorn. Sie muß dort irgendwo sein. Er hat noch nie ein Problem damit gehabt, Frauen anzuquatschen. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, kommt er meistens schnell zum Zuge. Er kann charmant sein, und er weiß es. Trotzdem bekommt er jetzt einen trockenen Mund. Es kratzt im Hals. Er hat das Gefühl, unbedingt etwas trinken zu müssen, aber er kann jetzt nicht zu seinem Bier zurück. Er fürchtet, sie in der Menge zu verlieren.
Je näher er der Bühne kommt, desto dichter stehen die Menschen. Er kann nur noch drängeln und quetschen. Er sieht höchstens zwei Meter weit. Da hält Mark ihn am Ärmel der Lederjacke fest.
«Hey, Alter, mach kein’ Scheiß! Dein Saxophon!» Mark hält es hoch.
«Paß so lange für mich drauf auf.»
Mark läßt nicht los. «Kommst du dir nicht ein bißchen blöd vor, hier nach der Perle zu suchen?»
Jens schüttelt den Kopf. «Nee. Überhaupt nicht.» Dann arbeitet er sich weiter vor.
Mark geht zum Bierstand zurück. «Spinner», sagt er kopfschüttelnd. Dabei ist ein kleiner Teil in ihm, der Jens beneidet. Jens kann total ausrasten, wenn ihm ein Musikstück gefällt, eine Frau oder ein Stück Kuchen. Mark hat noch nie jemanden getroffen, der so begeisterungsfähig ist. Es hält nie lange an bei Jens. Es kommt anfallartig, wie starkes Fieber oder Schüttelfrost. Mark weiß nicht, ob es eine Krankheit ist oder eine Gabe. Aber manchmal hätte er selbst gern etwas davon. Er möchte das auch mal können, und sei es nur für eine Nacht: sich so richtig verlieben, daß alle Sicherungen durchbrennen und kein Ja aber zurückbleibt.
Der Kleine da oben hopst rauf und runter, als sei die Bühne ein Trampolin. Und er löst bei seinen Zuhörern den unwiderstehlichen Drang aus, das gleiche zu tun. Ganz vorn beginnen die ersten zu hüpfen. Begeistert von seiner Wirkung, feuert der Kleine alle an, ihm zu folgen. Sie hören ihn nicht, doch seine Gesten sind eindeutig. Die Musik paßt dazu. Es macht Spaß.
Lange Hüpfwellen, die erst an den Würstchenbuden langsam verebben, schlucken Donna. Jens versucht, sich gegen die Wellen zu bewegen. Er springt hoch, wenn die Körper vor ihm herunterkommen. Er geht in die Knie und holt Schwung, wenn die anderen hochsausen. Trotz seiner Gegenbewegungen verliert er Donna, denn jetzt werfen die Leute auch noch die Arme in die Luft.
Dann glaubt er, sie zu haben, und stupst sie von hinten an. Er verläßt sich darauf, daß ihm sofort ein Spruch einfällt, auf den sie abfährt, doch sie dreht sich nicht um. Wie soll das zarte Schulterklopfen ihr auch auffallen, so sehr, wie sie herumgeschubst und gestoßen werden?
Zum Glück, denkt er plötzlich, denn ihm, dem Sprücheklopfer, fällt nichts ein. Dann drückt die nächste Welle sie ganz einfach gegen ihn. Noch bevor er ihr Gesicht sieht, weiß er: Sie ist es nicht. Ihren Haaren fehlt der Glanz, ihr Ringel-T-Shirt wirkt ordinär, ihr knackiger Arsch in den roten Jeans scheint zu brüllen: Fuck me, Baby! Sie hat nichts Engelhaftes. Solche wie die kann er in jeder Disco kriegen.
Sie kann sich schon längst außerhalb des Pulks befinden. Vielleicht hat sie Backstagekarten. So eine lassen sie garantiert durch. Vielleicht steht sie am Würstchenstand – oder knutscht längst mit ihrem Freund herum. Der Gedanke trifft ihn wie eine heiße Nadel im Magen. Er ist eifersüchtig. Jetzt schon. Und dabei weiß er nicht mal, wie sie heißt.
Er kratzt sich überm Bauchnabel, über der Stelle, wo die heiße Nadel in ihn eingedrungen ist. Dann grinst er. Ich bin eifersüchtig. Ausgerechnet ich! Das darf ja nicht wahr sein. Was läuft hier eigentlich ab? Hat Mark mir was ins Bier getan?
Jens entscheidet sich, jetzt nicht hektisch weiterzusuchen. Das Festival dauert drei Tage. Er wird die Augen offenhalten und sie sicherlich noch einmal erwischen.
Langsam bewegt er sich aus der Menge heraus. Der Sänger oben hat längst den Rhythmus gewechselt und spielt einen neuen Song, doch seine Zuhörer hüpfen weiter im alten Takt. Das ärgert den Schlagzeuger, der wütend einen Stock zerbricht.
Endlich sieht Jens sie wieder. Nur wenige Meter von ihm entfernt. Bei den Schmuckständen.
Jens ist schon fast bei ihr, da hält ihn jemand von hinten am T-Shirt fest. Hotte. Ausgerechnet jetzt. Hotte sieht nervös aus. Mit seinen eingefallenen Wangen hat er etwas Süchtiges an sich. Wenn es irgendwo eine Razzia gibt, wird Hotte garantiert gefilzt. Dabei hat er schon seit Jahren nichts mehr genommen. Hotte trinkt nicht mal Bier. Er ist auf dem Gesünder-leben-Trip, seit seine Mutter, mit der er immer nur Ärger hatte, an Krebs gestorben ist.
«Hotte, laß mich! Ich muß dringend …»
«Du bist mir noch was schuldig, Alter. Schon vergessen?»
«Du kriegst dein Geld.»
Hotte schüttelt ungläubig den Kopf. Die fünfzig Mark sind ihm scheinbar gar nicht so wichtig. Es geht um etwas anderes.
«Ich bin alleine. Ich brauch ’ne Ablöse!»
«Später, Hotte, später. Dann setz ich mich für dich hintern Stand. Kein Problem.»
«Jetzt, Mensch. Ich muß pissen!»
«Hotte, ich kann jetzt nicht!»
Hotte läßt nicht los. Cool bleiben, denkt Jens, ganz cool. Sie geht ja an den Schmuckständen vorbei. Eine bessere Gelegenheit gibt’s gar nicht.
Er nickt. «Okay, Hotte. Okay.»
Schon sitzt Jens hinter Hottes Stand. Hotte öffnet die Geldkassette und greift rein. Er nimmt alle Scheine heraus.
«He, ich brauch Wechselgeld!»
Hotte schüttelt den Kopf. «Es dauert nicht lange. Ich bin gleich wieder da.»
Jens findet die Geste beleidigend. Okay, Hotte kriegt Geld von ihm. Seit einem halben, vielleicht einem ganzen Jahr. Fünfzig Mark, was ist das schon? Muß er deswegen so eine Show abziehen?
«Glaubst du, ich will dich beklauen?» fragt Jens.
Hotte zuckt nur mit den Schultern. «Die Stücke sind alle ausgezeichnet. Wenn jemand zwei Teile kauft, kannst du Rabatt geben. Zehn Prozent. Okay?»
Jens nickt. Hotte greift sich ans Geschlecht und kratzt sich ungeniert. Er steht jetzt vor seinem Schmuckstand und betrachtet ihn noch einmal kritisch. Er sieht sehr genau hin, so als wolle er ihn vor seinem geistigen Auge fotografieren. Er fächert die Holzketten auf, damit sie besser zur Geltung kommen, und zupft das indische Tuch zurecht, das den schnöden Tapeziertisch verbirgt, auf dem er seine Kostbarkeiten aufgebaut hat.
Hotte ist stolz auf seinen Schmuckstand. Er sieht aus wie ein Altar. Hat etwas Verehrungswürdiges an sich. Etwas Erhabenes. In der Mitte sitzt ein lachender Porzellanbuddha, auf dem kleine Kinder herumkrabbeln. Der Buddha zieht die Leute an. Sie bleiben stehen, schauen, lachen. Ist der nicht süß? Natürlich kauft ihn niemand. Porzellanfiguren gehen nicht auf Open-air-Konzerten. Aber wenn die Leute erst mal stehengeblieben sind, schenken sie dem Stand auch Beachtung.
Auf einem dreieckigen Sperrholzstück, das mit schwarzem Samtimitat überklebt ist, hängen Hottes indianische Ohrringe. Alles Einzelstücke. Auch hier in der Mitte als Blickfang das schönste und edelste Stück, bestehend aus Stachelschweinborsten, Perlmutt und der Spitze einer Adlerfeder. Von fünfzig Frauen, die an seinem Stand etwas aussuchen, greifen vierzig zuerst nach diesem Ohrring, halten sich ihn an, bitten um einen Spiegel, finden ihn toll, lassen sich von ihrem Freund bewundern oder von ihrer Freundin in dem Wunsch bestärken, ihn zu kaufen, greifen dann aber doch zu einem anderen, kleineren, billigeren Stück. Sie sagen, der sei ihnen doch ein bißchen zu auffällig und zu groß. In Wirklichkeit, das weiß Hotte genau, ist es der Preis. Die anderen kosten acht Mark, zehn Mark, einige besondere Exemplare fünfzehn Mark. Der da achtzig.
Hotte zeigt Jens den erhobenen Daumen. Jens erwidert die Geste und sucht mit den Augen die anderen Stände ab. Da irgendwo muß sie sein.
Nur ein paar Meter links neben ihm werden Grillwürstchen und Pommes verkauft. Der Geruch von brodelndem Fett und kokelndem Schweinedarm weht herüber und dominiert alles. Die Räucherstäbchen vor dem lachenden Buddha haben dagegen keine Chance.
Jens beugt sich über den Stand und schaut, ob sie vielleicht beim Schwenkbraten ist oder bei den T-Shirts. Fasziniert von dem dicken Buddha, kommt Donna von der anderen Seite näher. Jens bemerkt sie nicht.
Donna hält die Nase nah an die Räucherstäbchen und sagt: «Wo indische Tücher und solch schöner Schmuck angeboten werden, da sollte es anders riechen. Nach Sandelholz, Opiumkerzen, Gewürzen. Aber nicht nach Pommes.»
Er weiß, daß die Stimme zu ihr gehört, noch bevor er sich umdreht und sie anschaut. Er braucht keinen flotten Spruch mehr.
Sie wedelt die dünnen Rauchfäden in ihre Richtung und saugt sie ein.
Unter dem Tisch liegt eine ganze Kiste mit Räucherstäbchen. Jens greift rein und hält ihr mehrere Packungen hin. «Ich habe alle Sorten.»
Sie schüttelt leicht den Kopf. Sie ist verschwitzt. Ihr Haaransatz ist feucht, eine dünne Schweißschicht überzieht ihr gerötetes Gesicht. Sie läßt ein paar Ketten durch die Finger gleiten, scheint aber nicht wirklich interessiert.
Jens fühlt sich, als sei er stumm. Er möchte sie fragen: Was sollen wir zwei eigentlich hier? und dann einfach mit ihr weggehen.
Wieder diese Handbewegung. Sie wedelt sich Luft zu. Jetzt sieht sie die japanischen Fächer. Er öffnet den ersten mit einer eleganten Bewegung. Auf tiefdunklen und hellen Blautönen eine Brücke über einen Fluß, dazu Kirschblüten, die wie Schnee herunterfallen. Er macht mit dem Fächer ihre Handbewegung nach, und dann hält er ihn ihr hin. Reden wäre jetzt sowieso sinnlos.
Noch nie hat Jens Musik als so laut und störend empfunden. Er kann doch jetzt nicht schreien. Flüstern wäre schön.
Nein, sie will den Fächer nicht. Enttäuscht zuckt Jens mit den Schultern und weist mit großer Geste über den ganzen Tapeziertisch. Er sieht dabei auf merkwürdige Weise majestätisch aus. Wie ein König, der um seine Braut wirbt. Schau her, schönes Kind. All diese Ländereien sollen dir gehören, wenn du meine Frau wirst, scheint er zu sagen.
Sie findet ihn witzig, will aber trotzdem gehen. Sie hat sich mit den anderen abgesprochen. Wenn sie einander verlieren, treffen sie sich zu jeder vollen Stunde links neben der Bühne bei den Boxen wieder. Da will sie jetzt hin.
Die Boxen schweigen. Der Sänger verbeugt sich, doch statt Blumen fliegen Coladosen und halbvolle Bierbecher in seine Richtung. Er zeigt dem Publikum den Mittelfinger, schreit «Fickt euch!», aber das hören die Leute nicht.
Dann sieht Donna den Indianerohrring. Jens spürt ein angenehmes Kribbeln im Bauch. Sie nimmt den Ohrring vorsichtig vom Brett. Er hat noch nie im Leben so schnell einen Spiegel in der Hand gehabt. Dabei sagen seine Augen doch schon alles. Sie hält die Adlerfeder nur an ihr Ohr. Die Stachelschweinborsten klopfen gegeneinander. Sie findet, es klingt wie ferne Trommeln im Urwald.
Endlich hat Jens einen Grund, sie anzuschauen. Niemand kann ihm jetzt vorwerfen, daß er sie einfach nur anglotzt.
«Die passen nicht zu mir», sagt Donna und schüttelt den Kopf.
«O doch», widerspricht Jens. «Sie sind wie für dich gemacht.»
«Ja, aber für solche Ohrringe muß man Hippieklamotten tragen. Guck mich doch an. Ich …»
Das Leuchten seiner Augen irritiert sie. Er scheint wirklich begeistert zu sein. Vorsichtig, als sei sie eine zerbrechliche Porzellanpuppe, berührt er ihr Gesicht und dreht es hin und her, um sie von allen Seiten zu bewundern.
«Phantastisch! Perfekt! Du siehst auch irgendwie indianisch aus. Hast du indianische Vorfahren?»
Meint der das ernst, oder will der mir nur den teuersten Ohrring verkaufen, den er am Stand hat?
Donna zeigt auf den Stift. «Ist das überhaupt echt Silber? Ich bin nämlich allergisch. Ich kann nur echte Sachen tragen.»
Er sieht sie ein wenig beleidigt von der Seite an. «Selbstverständlich ist das echt. Ich verkauf hier doch keine Blechdosen! Alles handgemacht und …»
«Jaja, schon gut.»
Sie will ihn wirklich nicht beleidigen, und jetzt, da die Indianerfeder an ihrem Ohr wippt, beginnt sie das leise Geräusch der gegeneinanderstoßenden Stachelschweinborsten und Perlmuttpättchen zu lieben. Leise Urwaldtrommeln.
«Ich hab nicht soviel Geld.»
Jens lacht. «Du mußt ihn tragen. Er ist nur für dich gemacht.»
Jens gefällt ihr. Er hat ein leicht italienisches Aussehen mit seinen braunen Augen und den fast schwarzen Haaren. Der Stoppelbart gibt ihm etwas Verwegenes. Er hat ein bißchen was vom abgemagerten Steve McQueen in seiner Zelle. Ihre Gedanken schweifen ab. Der hier kommt überall raus. Der ist nicht zu halten. Papillon. Das französische Wort für Schmetterling.
Im ersten Moment wirken seine Gesten wild auf sie, doch das ist nicht das richtige Wort. Er hat etwas von einem Piraten, denkt sie. Ja, so wie er aussieht, hat sie sich als Kind Piraten vorgestellt. Der fröhliche Optimismus, mit dem er darangeht, ihr einen Ohrring zu verkaufen, den sie weder haben will noch bezahlen kann, nimmt sie für ihn ein.
Er weiß jetzt nicht wohin mit seinen Fingern. Er kann unmöglich länger ihr Gesicht betatschen. Zum Glück hat irgendein Kunde seinen Tabak an Hottes Stand liegenlassen. Ohne auch nur hinzugucken, nimmt Jens den Beutel und beginnt sich eine Zigarette zu drehen. Es ist nicht mal mehr ein Gramm drin. Nur noch Krümel und ein paar Blättchen. Jens fischt sie heraus und streut den Tabak darauf. Er dreht sich die Zigarette geradezu hingebungsvoll. Er leckt das Papier mit einem Zungenschnalzen an, als sei der Klebestreifen eine Köstlichkeit.
Sie stellt sich vor, wie er als kleiner Junge auf Bäume klettert, herunterfällt und lachend wieder aufsteht. Bestimmt war er das, was ihre Mutter einen Wildfang nennt. Einer von denen, mit denen sie nicht spielen sollte, weil sie zu gefährliche Dinge trieben. Jungs wie er schlichen heimlich hinter Papas Auto und zogen einen Luftballon über den Auspuff. Sie spielten Klingelmännchen in der ganzen Nachbarschaft und übten mit Wurfpfeilen, bis der Obstbaum harzig blutete.
Sie will den Ohrring schon zurückhängen, da hält er ihre Hand fest. Die selbstgedrehte Zigarette wippt zwischen seinen Lippen auf und ab.
«Bitte, laß dein Glück nicht so achtlos liegen. Dieser Ohrring will zu dir. Ah! Er ist dir zu teuer. Also gut! Siebzig – sagen wir siebzig?»
«Nein, wirklich nicht.»
«Sechzig?»
Sie schüttelt den Kopf.
«Meinetwegen, sechzig. Aber sag es nicht weiter.»
Er läßt ihre Hand nicht los. Es ist ihr ein bißchen unangenehm. Andererseits gefällt ihr seine Hartnäckigkeit. Er will wirklich, daß sie den Ohrring trägt. Hat er ihn vielleicht sogar selbst gemacht?
«Bitte, du mußt ihn nehmen. Jedes andere Ohr wäre eine Beleidigung für dieses Schmuckstück.»
Sie befreit ihre Hand und schaut sich den Ohrring noch einmal an. Fast ist es, als würde sie Jens kränken, wenn sie ihn zurückhängt.
«Sag, wieviel willst du dafür geben? Fünfzig? Vierzig?» Er legt den Kopf schräg. «Dreißig?»
«Das kann ich nicht annehmen.»
«Du verstehst das Spiel nicht. Du mußt mich runterhandeln, und dann muß ich sagen: Willst du aus mir einen armen Mann machen?»
«Nein, das will ich nicht», lacht sie.
«Aber ich möchte, daß du den Ohrring trägst.»
Sie zählt ihr Geld. Sie muß vorsichtig sein. Sie weiß nicht, wie teuer das alles wird. Sie muß etwas essen, etwas trinken, und doch – sie möchte den Ohrring kaufen. Mehr für ihn als für sich selbst. Sie will ihn lachen sehen, will sehen, wie er es genießt, ihr das Schmuckstück verkauft zu haben. Es ist, als könnte sie ihn damit glücklich machen.
«Der Ohrring hat auf dich gewartet. Du wirst es spüren.»
Sie nickt. «Ja, ich … ich weiß. Ist es auch wirklich echtes Silber?»
Sie wünscht sich, daß er ihr den Ohrring ansteckt. Sie freut sich auf die Berührung durch seine Fingerspitzen. Sie rechnet noch einmal nach. Überschlägt, wieviel sie brauchen wird für das Wochenende. Jetzt ärgert sie sich, daß sie Mamas Freßpaket nicht angenommen hat.
Er spürt, was in ihr vorgeht, und senkt den Preis noch einmal.
«Zwanzig?»
Sie schüttelt den Kopf. «Aber das ist geschenkt. Machst du das immer so? Dann bist du bald pleite.»
Er faßt mit spitzen Fingern den Zehnmarkschein an und zieht ihn aus ihrer Hand. «Zehn. Einverstanden?»
«Ist das dein Ernst?»
«Ja. Ja. Nimm ihn. Es ist eine Ehre für diesen Ohrring, wenn du ihn trägst.»
Und wieder macht er diese Geste, wie ein König, der sein Land verschenken möchte.
Er steckt ihr den Ohrring an. Noch nie ist jemand so sanft zu ihr gewesen. Er spürt, wie sie unter seinen Fingerkuppen erschauert.
Er lacht. «Hast du dort erogene Zonen?»
![Ostfriesenkiller [Ostfriesenkrimis, Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/dbd8a314f66948901aaa600a8c4b15f3/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenblut [Ostfriesenkrimis, Band 2] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6b5a4619bee82380ac4b783fbd8a5858/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenwut [Ostfriesenkrimis, Band 9 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d449130c695ea6a9907a9ea91fa7248d/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenfalle [Ostfriesenkrimis, Band 5] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4042741b3a9aa08fcc77449f2070c1bb/w200_u90.jpg)
![Ostfriesengrab [Ostfriesenkrimis, Band 3] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9a5c8f0bf03c26533a54f512ff342109/w200_u90.jpg)

![Ostfriesenangst [Ostfriesenkrimis, Band 6] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/34271859184fc863a6885723313d82cf/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d3958465827dd46646bbdbea0658d80b/w200_u90.jpg)
![Ostfriesentod [Ostfriesenkrimis, Band 11 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0cbd7afab4c4f0767956186621b50dae/w200_u90.jpg)
![Totenstille im Watt. Sommerfeldt taucht auf [Band 1] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4f2087e48a583b582212567c9a28a6a0/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenschwur [Ostfriesenkrimis, Band 10] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0c2377f30527a0cf66dd220218c3d294/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f7d8467eb4703c48ed48db68c0516d2f/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenfeuer [Ostfriesenkrimis, Band 8] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c256875a5ae7a11697130fc4974ec2c0/w200_u90.jpg)
![Ostfriesensünde [Ostfriesenkrimis, Band 4] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b1d85201215670f9610ba2920d58d75/w200_u90.jpg)
![Ostfriesenmoor [Ostfriesenkrimis, Band 7 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18097dd3d217a1e2ca8fe50d64068b0f/w200_u90.jpg)

![Todesspiel im Hafen. Sommerfeldt räumt auf [Band 3] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/04fb798a55c759505dbed5f88be19287/w200_u90.jpg)

![Ostfriesengier [Ostfriesenkrimis, Band 17 (Ungekürzt)] - Klaus-Peter Wolf - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/dd092e493fc6e39498ffd17de3301947/w200_u90.jpg)









