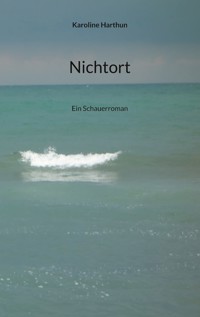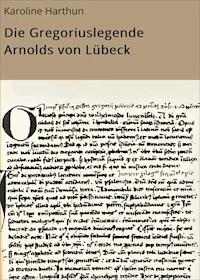11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mittelalterromane müssen nicht wie die "Wanderhure" oder der "Medicus" sein. Den "Namen der Rose" kennt schon jeder. Hilary Mantel ist toll, aber schwer zu lesen. Karoline Harthuns Roman ist historisch genau, philosophisch anspruchsvoll und trotzdem ein Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Karoline Harthun
Doppelte Wahrheit
Roman über den Beginn der Wissenschaft
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Messer
Drei Finger
Vagantenleben
Eine Perle auf der Straße
Über Engel
In taberna
Der Sieger
Hortus conclusus
Ein Stern geht auf
Erste Verurteilung
Die Ewigkeit der Welt
Grüner Lorbeer
Kindermund
Spitzel
Der Antichrist
Lied der Liebe
Vesper
Sterbliche Reste
Dunkle Wolken
Die Hydra
Hochzeit im freien Geist
Canossa
Mann gegen Mann
Die alte Stadt
Die Kommission
Zweite Verurteilung
Das Gesetz
Der Teufel steckt im Detail
Aufräumen in Paris
Philosophisches Exil
Ein junger Dichter
Wahnsinnstat
Die andere Welt
Winter
Vergangene Zukunft
Epilog
Impressum neobooks
Das Messer
Næstved, den 21. April 1264 (Ostermontag, 2017. Jahrestag der Gründung Roms)
Bo ging ein Messer stehlen. Er konnte nicht den Hirschfänger seines Vaters nehmen, das hätte er pietätlos gefunden. Pietätlos. Ohne pietas. Er wäre kein pius vir. Kein Mann, kein Held, niemand, der allein für seine Taten einsteht, der seinem Schicksal folgt, weil er ihm folgen muss. Wie Aeneas, dessen Mut ihn sogar im Grammatikunterricht begeistert hatte. Aeneas hatte den wehrlosen Turnus getötet, obwohl auch Turnus ein Held gewesen war. Das Schicksal wollte es so. Aeneas musste seinen Waffenbruder Pallas rächen. Aeneas musste Rom gründen. Aeneas musste töten.
Bo musste nicht töten und auch keine Stadt gründen. Er musste nur fortgehen von hier. Dafür brauchte er ein Messer. Er steuerte geradewegs auf die Schmiede zu. Aus der Esse, die im Hof stand, quoll beißender, schwefelgelber Rauch, der nach billigem, schlecht verkoktem Brennstoff aussah. Es war nicht gut, hierher zu kommen. Dieser Ort erinnerte an die Feuerstätte der Kyklopen. Zu allem Überfluss hatte der Schmied nur noch ein Auge, seit ihm ein fehlgehender Strahl glühenden Erzes das andere ausgelöscht hatte.
Der Schmied wandte Bo den Rücken zu. Er bediente abwechselnd den Blasebalg und drosch mit dem Hammer auf ein Klobenband ein, ein anspruchsloses Werkstück, das er bald zur Seite legen würde. Bo hatte nicht viel Zeit. Er duckte sich hinter einen Holzmeiler und wartete auf den erlösenden Impuls zur Tat. Jung, wie er war, wusste er noch nicht, wie er ihn herbeizwingen konnte. Da kam ihm der Zufall zur Hilfe. Von derber Hitze umschlungen verspürte der Schmied drängenden Durst und schöpfte Wasser aus einem Kessel, der am Rauchfang an einem Haken hing. Zweifelnd betrachtete er den Inhalt der Kelle, in den er wohl kurz zuvor ein zischendes Werkstück getaucht hatte. Die herumschwimmenden Metallsplitter schreckten selbst einen Haudegen wie ihn ab und er pfefferte die Kelle zurück in das Gefäß. Leise vor sich hin schimpfend wischte er sich die schmutzstarrenden Pranken an seinem Lederkittel ab und ging ins Haus, um sich ein kühles Bier zu holen.
Dies war der Moment. Bo sprang wie eine Katze – nein, wie ein kämpfender Löwe im Circus – aus seinem Versteck und ließ seinen Blick fieberhaft über die Reihe von Schneidwerkzeugen irren, die säuberlich an der Hauswand aufgereiht hingen. Sie blinkten und waren gepflegter als alles andere in diesem Dreckloch. Da waren Beitel, Schnitzeisen, Hobel, Federmesser, Schabeisen, Takelmesser, Scheren, Sicheln, Hippen, Rasiermesser, Dolche, Jagdmesser, Kurzschwerter, landestypische Langsaxe und ein moderner Malchus, ja sogar eine schmale Damaszenerklinge.
Er musste sich rasch entscheiden. Sollte er den Malchus nehmen, weil er nach dem Diener des Kaiphas benannt war, dem Petrus ein Ohr abgehauen hatte? Oder doch lieber die heftlose Damastwaffe, die einem edlen Krieger wohl angestanden hätte? Doch beide waren so groß und schwer und sahen so todbringend aus … Da hörte er den Schmied in seiner Bude rumoren. Panisch zuckte Bos rechte Hand vor und packte wahllos die nächstbeste Schneide, so ungeschickt, dass er sich damit die Hand verletzte. Er stopfte das Werkzeug in sein Kleid, zerfetzte und besudelte den Stoff mit seinem Blut, warf sich herum und flitzte davon wie ein gejagter Hase.
Er rannte, bis seine Lungen fast zersprangen. Als er das Ufer der Suså erreicht hatte, hielt er inne. Hier war sein geheimer Rückzugsort. Der gewundene Fluss zog sich an dieser Stelle um eine breit gezogene Halbinsel herum, die von mächtigen Buchen bewacht wurde. Sein Vater war oft mit ihm hierher zum Jagen und Fischen gekommen. Aus jungen Stämmen hatten sie sich nahe dem Ufer einen Unterstand gezimmert. Dort kauerte er sich nieder, umwickelte seine blutende Hand mit frischen Blättern und zog vorsichtig die Beute aus dem klaffenden Gewand. Bis jetzt hatte er nicht einmal gesehen, was er da gegriffen hatte. Jähe Enttäuschung durchfuhr ihn, als die Klinge vor ihm auf dem nassen Laub lag. Es war ein Federmesser, das kleinste und unbedeutendste Werkzeug aus dem Warenangebot des Schmieds.
Klein, ja, aber scharf. Bo untersuchte seine Verletzung. Das Messer hatte ihm das Häutchen zwischen Daumenwurzel und Zeigefinger durchtrennt. Nun, in seiner Lage und eingedenk dessen, was ihm bevorstand, war diese Wunde unerheblich.
Der Stahl reflektierte die Strömung des Flusses. Zwei Blutschlieren auf der Schneide warfen dunkle Schatten auf das durchscheinende Bild des bewegten Wassers. Nachdenklich starrte Bo auf das Gewölk, das aus seinem geöffneten Fleisch geronnen war. Heute würde noch mehr davon fließen. Das Blut würde seine Sorgen wegspülen. Sein Opfer würde ihn in einen neuen Menschen verwandeln, einen, der mehr Geist als Blut war.
Bo stand auf und tauchte die Klinge in das widerständige Wasser. Beinahe wäre sie ihm aus der Hand geglitten. Als er sie wieder herauszog, war sie blank wie seine Verzweiflung. Er hielt sie hoch in die Luft. „Pallas' Rache!“, rief er beschwörend aus. Dann kniete er sich nieder und ohne eine weitere Sekunde zu zögern, presste er die ausgestreckten Finger seiner rechten Hand auf einen flachen Stein an der Böschung. Es war schwer, mit Links zu schneiden. Er verfluchte sich, dass er keine Hiebwaffe wie den Malchus erwischt hatte. So wäre es wenigstens schnell gegangen. Andererseits konnte er mit dem zierlichen Skalpell präziser arbeiten, Stück um Stück. Er wollte sich schließlich nicht aus Versehen die ganze Hand abhacken.
An Schärfe konnte das Federmesser es durchaus mit dem berühmten Stahl aus Damaskus aufnehmen. Bo begann mit der Kuppe seines Zeigefingers. Da die linke Hand nicht sehr kräftig war, musste er das Messer schräg ansetzen. Es glitt ab und grub sich tief in die Beugegelenke des Mittel- und Ringfingers. Dort blieb es stecken. Ein Ruck aus lauter Willensanstrengung und es löste sich, säbelte dabei aber fast den ganzen kleinen Finger ab. Der Daumen, der sich an die Unterseite des Steins klammerte, blieb verschont.
Das Messer, das dafür geschaffen war, Gänsekiele zu schärfen, schnitt mühelos durch Haut und Muskeln. Beim Knochen aber versagte es. Und Aeneas sprach, nachdem sich seine Augen am Stachel seines wilden Schmerzes, an Pallas' gestohlenem Waffengurt, festgesaugt hatten, von Rachedurst und schrecklichem Zorn entbrannt: „Sollst du mir etwa entkommen, bekleidet mit Beutestücken der Meinen? Pallas opfert dich mit dieser Wunde, Pallas nimmt Rache an deinem verbrecherischen Blut!“
Entschlossen wuchtete Bo einen spitzen Flusskiesel hoch und zertrümmerte den schieren Knochen, bis der rohe Stein von Splittern wie mit Elfenbein bestäubt war. „Dies ist mein Tiber!“, brüllten sein Schmerz und sein Zorn und er schleuderte die abgetrennten Körperteile weit in den Fluss. Dann wurde er ohnmächtig. Die verstümmelte Hand glitt in den Strom und blutete malerisch aus.
Es war Bos Glück, dass der Fluss im April noch eisig war. Die Kälte schnürte die Gefäße zusammen und stillte die Blutung, sodass er sich immer noch am Leben fand, als er viele Stunden später wieder zu sich kam. Seine Hand fühlte sich taub an. Mühsam kroch er in den Unterstand und tastete in der Dunkelheit nach seinen Sachen, die schon seit Tagen bereit lagen. Das Bündel, das er nach dem letzten Streit mit seinem Vater heimlich gepackt hatte, warf er über die linke Schulter und tauchte alsbald in der vertrauten Schwärze des Waldes unter. Gleich hinter dem Hügel lag das Benediktinerkloster, das einer seiner Vorfahren gestiftet hatte.
Er wusste nicht viel über Wundheilung, so etwas lernten sie nicht in der Klosterschule, aber die Mönche würden ihm helfen. Was Arznei nicht heilt, heilt das Messer. Was das Messer nicht heilt, heilt das Feuer, sagt Hippokrates. Das Messer hatte ihn hoffentlich von seiner falschen Berufung geheilt, nun war es an den braunen Brüdern, seine Wunde kunstgerecht mit Essig und Honigsalbe zu versorgen und die Spuren seiner früheren Gestalt mit der Flamme des Heiligen Geistes zu veröden.
Drei Finger
Næstved, den 19. Juni 1264 (Kanonisierung des Fronleichnamsfest durch Urban IV.)
Vier Generationen vor der Flucht des jungen Bo Bodilsen stiftete der Großgrundbesitzer Peder Bodilsen, Bos Ururgroßvater, ein Benediktinerkloster, das zwar dem heiligen Petrus geweiht war, aber im Volksmund nur Skovkloster, Waldkloster, hieß, weil es zwei Kilometer nördlich der Stadt am Ufer der Suså gelegen war. Den Bewohnern von Groß-Næstved am linken Ufer und Klein-Næstved am rechten Ufer erschien die baumbestandene Wildnis, von der sie umzingelt waren, zu dieser Zeit noch recht unwirtlich und so waren sie stolz auf ihre Großstadt, deren Name so viel wie „Rodung jenseits der Flusswindungen“ bedeutete und den Sieg der Zivilisation verhieß.
Erzbischof Eskild von Roskilde, der die Stiftung befürwortet hatte, war ein persönlicher Freund des in ganz Europa umschwärmten Bernhard von Clairvaux. Die Bedeutung des rasch wachsenden Konvents für die Stadt ließ sich allein daran ermessen, dass der jeweilige Abt auch das Amt des Bürgermeisters versah. Ein gewisser Niels Pink war der derzeitige Amtsinhaber.
Es war erst fünf Jahre her, dass die Konventsgebäude niedergebrannt waren. Seither waren sie in bestürzender Hast fast vollständig neu errichtet worden, mehr oder minder im modernen gotischen Stil. Der Reichtum der wohltätigen Familie Bodilsen und die kluge Besitzwaltung der Äbte schlugen sich in den Ausmaßen der neuen Pederskirke nieder, deren wenig elegantes, einschiffiges Kirchenschiff zumindest als das breiteste in ganz Dänemark gelten durfte. Zum Zeitpunkt des Wiederaufbaus nannte das Kloster über hundert Besitztümer auf Seeland und anderswo sein Eigen. Viele Laienbrüder mussten geworben werden, die Feldarbeit zu verrichten.
Ohne das Faustpfand der jungen Oblaten hätte das Kloster nicht über die Stadt und ihr Hinterland herrschen können. Sie waren für alle Seiten ein Gewinn. Die Familien gaben dem Kloster ihre Söhne, das Kloster nahm den Familien eine Sorge und schenkte ihnen die Zuversicht, etwas für ihr Seelenheil getan zu haben. Was für ein gelungener Tausch! Sogar die Zöglinge selbst hatten etwas davon. Sie lernten Dinge, von denen sie sonst nie gehört hätten. Und sie entkamen einem Leben, das von Anfang an nichts als Nachteile für sie vorgesehen hatte.
Wie wichtig dieser stete Zufluss frischen Blutes für das Blühen der alten Gemeinschaft war, konnte Bo bald ermessen. Vor allem waren die Oblaten dazu da, die Grangien, die landwirtschaftlich genutzten Klostergüter, zu bestellen und zu verwalten. Sie erledigten aber auch fast jede andere Arbeit, die im Kloster anfiel. Sie fegten die Zellen, ernteten Gemüse und Kräuter aus dem Klostergarten, hackten kübelweise Zwiebeln in der Küche, trugen die schweren Gesangbücher in die Kirche, hielten die Kerzen am Brennen, wuschen die Gewänder auf den Steinen am Fluss, fütterten die Hühner, brauten Bier, besserten die Klostermauern aus, fischten das Laub aus dem Brunnen und erhitzten Ziegelsteine, die sie Abt Niels ins Bett legten, damit er keine kalten Füße bekam.
Einige Auserwählte durften das älteste und vornehmste Handwerk der Benediktiner erlernen: die Kunst des Abschreibens. Wegen seiner Behinderung – und vielleicht auch wegen seiner vornehmen Herkunft, die der Abt ihm schließlich doch entlockt hatte – stieß Bo unerwartet schnell in diesen Kreis vor. Von Küchen- und Feldarbeit blieb er verschont und wurde stattdessen eingeteilt, im Skriptorium wertvolle Bücher zu vervielfältigen. Immer nach dem Mittagessen, wenn die anderen in den Garten geschickt wurden, und bis zur Vesper, wenn das Tageslicht schwand, hockte er dort und vergrößerte das Wissen der Menschheit.
Im Skovkloster schrieb man hauptsächlich auf Pergament. Der weitaus billigere, aber weniger haltbare neue Schreibstoff aus Frankreich, das Papier, hatte sich in der fernen Provinz noch nicht durchgesetzt, obwohl die Viehzucht in dieser waldigen Gegend mühselig und wenig ertragreich war. Glücklicherweise musste Bo das Pergament nicht selbst herstellen. Dazu wäre er mit seiner geschwächten Hand auch kaum in der Lage gewesen, denn es kostete viel Kraft, die in Kalklauge gebeizten Häute auf Rahmen zu spannen, mit dem Eisen die starren Borsten abzuschaben und das wulstige Leder mit dem Messer zuzuschneiden. Dies war die Aufgabe eines älteren Laienbruders, der vor seiner Konversion Ochsentreiber gewesen war. Daher kannte er sich gut mit jener Sturheit aus, die vom Tier auf das Material übergegangen war.
Bruder Olaf, der für die materielle Seite der Buchproduktion Sorge trug, war ein Berg von einem Mann mit einem drohenden Prophetenbart und Händen wie Grabplatten. Er war der unumschränkte Herrscher des Skriptoriums, obwohl seine Schriftbildung trotz der jahrelangen Beschäftigung mit Büchern nie über das Auswendiglernen des Ave Maria hinausgekommen war. Kein altkluger Novize wagte seine Autorität mehr als einmal in Frage zu stellen. Spätestens wenn er Bekanntschaft mit dem halbrunden Schabeisen machte, das der Armarius wie ein Kriegsbeil im Gürtel trug, verstummte die Kritik. Den meisten genügte ein Blick in das Gesicht des Gehilfen an Olafs Seite, das von tiefen Kerben verunziert war.
Bo kam gut mit ihm zurecht, aus dem einfachen Grund, weil er nicht mit ihm über Bücher zu sprechen versuchte. Olaf interessierte sich ausschließlich dafür, wie man sie herstellte, und nicht dafür, was man dann mit ihnen anfangen konnte. Lag ein Codex erst einmal fertig auf dem Tisch, vergaß er ihn sofort wieder. Er existierte einfach nicht mehr in seiner Gedankenwelt.
Außer Tierhäuten gehörte dem Holz seine Leidenschaft. Schönes hartes Buchenholz, aus dem man robuste Buchdeckel schnitzen konnte, und zwar nicht für niedliche Perlbibeln – das war Weiberkram –, sondern am liebsten für Antiphonare, so groß wie Fensterläden, damit auch die Mönche in der letzten Reihe beim Singen noch die Neumen erkennen konnten. Hatte er einen solchen Buchdeckel geschnitzt, brauchte es einen ganzen Ochsen dafür, um ihn mit Leder zu bespannen.
Die Bearbeitung der einzelnen Buchseiten überließ er lieber Jüngeren, dafür mangelte es ihm an Fingerfertigkeit und Augenlicht. Aber wenn es um das Falzen und Binden der Lagen ging und zum Schluss darum, das fertige Buch mit Beschlägen, Schließen und Buchketten so unzugänglich wie möglich zu machen, war er nicht zu zügeln. Am liebsten hätte er an jedes Buch drei Schlösser angebracht und die Schlüssel weggeworfen. Das fertige Ding war ohnehin unnütz in seinen Augen. Doch er wusste, dass die Oberen des Klosters anderes von ihm erwarteten. So hatte er gelernt, die Fragen der Schreiber mit Geduld zu ertragen und mit gespielter Selbstverständlichkeit die seltsamen Titel der vervielfältigten Werke im Munde zu führen. „Sind die Psychomachie und Moralia in Iob noch nicht fertig?“, konnte er durch die Werkstatt brüllen, ohne rot zu werden.
Von den Arbeiten, die große Körperkraft erforderten, war Bo freigestellt, und selbst wenn er zwanzig Finger gehabt hätte, hätte Olaf eifersüchtig über seinen Bereich gewacht und ihn lieber mit der Axt in den Wald geschickt. Anders sah es bei den vielen kleinen Geheimnissen der Buchherstellung aus, die keine Kraft, aber Geduld, Geschick und Kenntnisse in Alchimie und Geometrie verlangten. Unter der Anleitung eines subalternen Bruders namens Wido, der viel mehr über Bücher wusste als Olaf, aber dieses Wissen aus Angst vor dem Schabeisen für sich behielt, lernte Bo, wie man mit dem Zirkel die Seiten gleichmäßig aufteilte, mit dem Griffel gerade und möglichst unsichtbare Linien zog, mit dem Federmesser die Gänsefedern so anspitzte, dass sie nicht abbrachen, wie man das Rasiermesser so leicht über das Pergament führte, dass Fehler zwar verschwanden, aber die Struktur nicht beschädigt wurde. Und natürlich lernte er, Tinte zu kochen: Tinte aus Schlehendornen, Tinte aus Galläpfeln, Tinte aus Ruß, Tinte aus Mennige.
Die Malschule des Skovklosters war nicht sehr berühmt, aber die Abtei war reich und konnte sich jede Menge Blattgold, Purpur und Lapislazuli leisten. Während die verhältnismäßig einfache Zubereitung der Schreibtinten, mit der Bo eine Zeit lang beschäftigt war, Olafs Obhut unterstand, lief die Zubereitung der Malfarben nach eigenen Gesetzen ab, die von den Eingeweihten streng gehütet wurden. In der Küche des Skriptoriums stank es wie auf dem Fischmarkt in Næstved. Hier wurden Schwimmblasen von Stören ausgekocht, um daraus Bindemittel für die Pigmente zu gewinnen, mit denen die Buchmaler ihre eigenen Vorzeichnungen farbig überhöhten. An einem großen Steintisch saßen schwitzende Konversen mit muskulösen Unterarmen, die mit dem Stößel Arsensulfid, Bolusgestein und Malachitbrocken pulverisierten. Auf einem Bord an der Wand ruhten kleine Tiegel voll abgestandener Flüssigkeiten und geheimnisvoll funkelnder Schwebstoffe.
Die Alchimisten, die im Skriptorium arbeiteten, gehörten einem ganz anderen Schlag an als die Handwerker unter Olafs Aufsicht. Sie betrachteten sich selbst als Künstler und ihre Arbeit als Wissenschaft, die ein Höchstmaß an Konzentration erforderte und keinen Raum für gewöhnliche Bedürfnisse ließ. Ihrer Experimentierlust waren keine Grenzen gesetzt, wie Bo bald feststellte. Statt Essig oder Wein benutzten sie gerne ihren eigenen Urin als Lösemittel, um aus jeglicher Substanz die farbige Essenz herauszuzwingen. Auf ihre Gesundheit nahmen sie dabei ebenso wenig Rücksicht wie auf Ekelgefühle, die sie sich schon lange abgewöhnt hatten. Sie kochten Quecksilber und Blei, sie verätzten Schildläuse und Schnecken mit Alaun, Kalk und Schwefel, sie hantierten mit Galle, Schleim und verdorbenen Nahrungsmitteln. In kleinen Holzkästchen, die sie unter dem Misthaufen vergruben, ließen sie den Grünspan wuchern.
Ständig probierten sie etwas Neues aus, um haltbare und leuchtende Farben zu kreieren, doch nur selten war ihr Bemühen von Erfolg gekrönt. Entweder das Pigment war nicht lichtbeständig oder es zerfraß das Pergament, irgendetwas ging immer schief. Dem Forscherdrang der Quacksalber tat dies keinen Abbruch, obwohl sie um der Effizienz willen doch meist auf bewährte Rezepte zurückgreifen mussten. Seit Generationen versuchten sie beispielsweise die Indigopflanze, die von der Hanse für teures Geld aus fernen Ländern importiert wurde, durch heimische Gewächse wie die Heidelbeere oder das Rotkraut zu ersetzen. Aber was auch immer dabei herauskam, niemals war die Farbe lichtecht und von so mystischer Tiefgründigkeit wie das Original.
Der Ehrgeiz der wie besessen arbeitenden Alchimisten, die selten ein Wort an ihn richteten, die überhaupt nur eine Regung zeigten, wenn einer von ihnen einen Glasballon mit einem vermeintlich neuen Farbton ins Sonnenlicht hielt, war Bo fremd. Er betrachtete seine Arbeit als lästige Bedingung, um in den Besitz neuer Argumente zu gelangen, Argumente, die ihn eines Tages aus diesen Klostermauern herausführen würden. Er war ein schlechter Schreiber, nicht nur wegen seiner fehlenden Finger, sondern auch weil ihm jeder Sinn für Ordnung und Schönheit abging. Sein Augensinn war unterentwickelt, auch wenn er scharf sah wie ein Adler. Er konnte schlichtweg die vielen Kursiven und Bastarden, die sein Lehrer ihm beizubringen sich mühte, nicht unterscheiden. Die gleichförmigen Hasten der gotischen Handschrift marschierten vor ihm auf und wie Söldner unter einem Pfeilhagel purzelten sie übereinander, bis nur noch lauter leblose Striche, die ihm nichts sagten, das Blatt schwärzten. Mit den großzügigen quadratischen Buchstaben früherer Zeiten kam er gut zurecht, aber den jetzigen Schreibmethoden, dank deren man angeblich viel schneller und ausdauernder schreiben konnte, war er nicht gewachsen. Sie erinnerten ihn an die langweiligen Stickereien seiner Mutter, mit denen sie Stunden am Kamin zugebracht hatte, statt mit ihm Fangen und Verstecken zu spielen.
Wido war ein geduldiger und einfühlsamer Lehrer. Er erkannte, dass das teure Pergament an seinen Schüler verschenkt war, aber er wollte ihm die Möglichkeit geben, weiter in der Schreibstube zu arbeiten, da er sein Talent für den Ackerbau noch geringer einschätzte. So gab er ihm keine Prachthandschriften mehr zum Kopieren, nichts, wobei es vor allem auf Schönheit und Leserlichkeit ankam, keine Bibeln und Gesangbücher und auch nicht die ehrwürdigen Schriften der Kirchenväter. Stattdessen ließ er ihn unscheinbare Bücher von ungewissem Wert abschreiben, die zufällig in den Besitz des Klosters gelangt waren, weil ein fahrender Scholar sie gegen etwas Brauchbareres eingetauscht oder ein Kaufmann damit seine Steuern bezahlt hatte. Jedes Buch, egal was darin stand, war im materiellen Sinne teuer, sodass das Kloster solche Abgaben und Geschenke gerne entgegennahm, und sei es, um die Schrift auf dem Pergament zu löschen und bewährtere Texte darauf zu überliefern.
Leider verbot sich diese Methode bei vielen der neuen Bücher, weil sie auf Papier geschrieben waren. Nicht einmal Widos Hand zitterte so wenig, dass es ihm gelungen wäre, eine ganze Papierseite auszuradieren, ohne ein Loch hineinzureißen. Papier taugte nicht viel in den Augen der meisten Schreiber. War es erst einmal beschrieben, konnte man es nicht weiterverwenden, es sei denn, man trennte die einzelnen Lagen eines Buches auf und nahm die Blätter als Verpackungsmaterial. Früher, als die Viehzucht des Klosters noch reiche Erträge abwarf – und es noch nicht so viele Bücher zum Kopieren gab –, da hatten die Mönche so viel Pergament übrig gehabt, dass sie Fische aus der Suså darin einwickelten und sie in die Glut des Herdfeuers legten. Wenn die Tierhaut dann verkohlt war, waren die Fische gar und zart wie Sahnetröpfchen.
Wido war ein Mann des Wortes und es schüttelte ihn bei der Vorstellung, mit Büchern so umzugehen. Er verstand zwar nicht viel von dem, was diese neuen Schriften mit großspurigen Titeln wie Die goldene Summe behandelten, aber wer wusste schon, ob sie nicht von späteren Generationen ganz selbstverständlich benutzt werden würden wie heute die großen Enzyklopädien des vergangenen Jahrhunderts? Als er diese Wälzer das erste Mal in der Hand hielt oder vielmehr vor sich auf den Tisch wuchtete, denn lange in der Hand halten konnte man sie nicht, hatte selbst er gedacht: Wer soll das lesen? Aber man konnte nie wissen. Wenn sich jemand die Mühe gemacht hatte, all dies aufzuschreiben, hatte es bestimmt für irgendjemanden einen Wert. Und weil es von jedem Buch grundsätzlich immer zu wenig Exemplare gab, beauftragte er Bo damit, alles Abseitige und Unbekannte zu vervielfältigen, so gut es ihm eben möglich war. Ganz allmählich eignete sich der unbegabte Schüler unter Widos Anleitung eine sehr bescheidene Kunstfertigkeit an und weil er so viel übte und weil sich nur wenige Besucher für dieses kleine Format unscheinbar gebundener Bücher interessierten, konnte er nicht viel Schaden anrichten.
„Heute gebe ich dir etwas ganz Neues zum Kopieren. Abt Niels meint, dass Leute kommen und danach fragen könnten. Dann wäre es gut, wenn wir mehrere Ausgaben hätten. Zur Zeit ist dies die einzige Abschrift in Dänemark.“ Wido lächelte Bo aufmunternd an und drückte ihm einen ausnahmsweise schmalen, leichten Codex in die Hand, dessen Seiten unregelmäßig gebunden und über den Satzspiegel hinaus mit flüchtigen Häkchen wie mit Fliegendreck bedeckt waren. Es gab keine Initialen und kein Schmutzblatt. Jede Seite war bis zum Letzten ausgenutzt. Am Rand und zwischen den Zeilen hoben sich in Rot mathematische Chiffren ab, die wohl die Kapiteleinteilung vorgeben sollten.
Als Bo die krude Handschrift, diesen formlosen Buchstabensalat sah, den er abschreiben sollte, kam ihm die Klageformel der Schreiber in den Sinn: Drei Finger arbeiten, der ganze Körper leidet. Oder, in seinem Fall: Drei Finger fehlen, der ganze Körper streikt. Aber die Neugier, die Widos Ankündigung in ihm geweckt hatte, war stärker als seine übliche Mutlosigkeit. Sein Blick holperte über Zeilen, die er kaum flüssig lesen konnte, und blieb an zwei einzelnen Wörtern hängen, die er hier am allerwenigsten vermutet hätte. Sofort befiel ihn fröstelndes Unbehagen. Stand da nicht etwas von einem Messer und von einem Schmied?
In seinem Kopf fügte sich die Erinnerung zusammen wie die Glieder einer zertrümmerten Puppe. Er wandte den Blick ab, der unwillkürlich auf seine rechte Hand gefallen war. Seine Augen wanderten zum Beginn des Absatzes: „Zum Beispiel sind zum Sein eines Messers einige an sich bewegende Ursachen erforderlich, wie etwa der Schmied und das Werkzeug; und dass diese unendlich wären, ist unmöglich, weil daraus folgte, dass Unendliches gleichzeitig wirklich wäre. Dass aber ein von einem alten Schmied, der viele Male seine Werkzeuge erneuert hat, gefertigtes Messer auf eine sukzessive Menge von Werkzeugen folgt, das ist beiläufig; und nichts hindert, dass es unendlich viele Werkzeuge gäbe, die diesem Messer vorausgingen, wenn der Schmied von Ewigkeit her da gewesen wäre.
Bo musste sich eingestehen, dass er nicht wusste, was ihm dieses Beispiel sagen wollte. Er dachte an seine eigene Erfahrung mit Messern und konnte keinen Zusammenhang entdecken. Aber etwas an diesen Sätzen faszinierte ihn. Dass man sich auf derart abgehobene Weise mit etwas so Alltäglichem beschäftigen konnte! Wofür man Messer brauchte, schien dem Autor ganz unwichtig zu sein. Es ging ihm darum, woher das Messer kam und alle anderen Werkzeuge, die der Mensch im Laufe der Zeit gemacht hatte. Bisher hatte sich Bo nicht vorstellen können, die Schneidigkeit seines Verstandes, den Gott ihm geschenkt hatte, dafür zu benutzen, um über ein so viel unbedeutenderes Hilfsmittel von viel geringerer Schärfe nachzudenken. Seltsamerweise erfüllte ihn dieser Widerspruch, der Abstand zwischen seinem Denken und dem Gegenstand seiner Betrachtung, mit stiller Freude. Er allein konnte bestimmen, worüber er nachdenken wollte. Gott hatte ihm diese Macht geschenkt, und er wollte sie nutzen. Er wollte Messer nicht mehr nur zum Schneiden hernehmen – am liebsten nie mehr –, sondern sie in ihrem Sein erforschen. In ihrem Sein und in ihrem Wesen. Was machte denn ein Messer zu einem Messer? Worin bestand also die Messerhaftigkeit an sich?
Bo lief ein Schauer über den Rücken, als er gleichsam innerlich stotternd und nach mehreren Anläufen dieses fremdartige Wort für sich gefunden hatte: Messerhaftigkeit. Er ließ es ein paar Mal über seine Zunge gleiten, mal lauter, mal leiser. Es zischte, wenn man es flüsterte. Wie verschieden die beiden Worthälften klangen: Die eine schoss scharf und schnell aus seinem Mund, die andere quoll nur schwerfällig und stückchenweise heraus. Er versuchte das Wort zu kauen, wie es die Mönche bei der Meditation der Psalmen einübten. Das gelang ihm nicht ganz so gut.
Hastig las er jetzt weiter. Doch je mehr Zeilen er aufsog, desto mehr schwand die Aufregung, die ihn ergriffen hatte, und machte dem anfänglichen Gefühl der Ahnungslosigkeit Platz. Es ließ ihn kraftlos und müde werden. Am liebsten hätte er seinen Arbeitsplatz im Stich gelassen und einen Spaziergang gemacht, um nach der ungewohnten Anstrengung ein wenig Luft durch seine verhärtete Hirnhaut wehen zu lassen. Bis zur Vesper waren es jedoch noch zwei Stunden und er hätte Wido sein Fortbleiben schwer erklären können.
Er legte den Kopf auf den Tisch und schob die Handschrift mit dem Ellenbogen beiseite, nur um einen Moment später wieder danach zu greifen. Die Faszination stellte sich wieder ein, vor allem, wenn er den rätselhaften Text mit seiner nächsten Schreibvorlage verglich, den einfältigen Predigten des Kardinals Jakob von Vitry. Solche Machwerke, die von Polemik und erfundener persönlicher Betroffenheit trieften, ödeten ihn an. Sie offenbarten keine glaubwürdige Struktur, keine innere Logik. Der Autor gab einfach das wieder, wovon er glaubte, dass seine Hörer es ab und an brauchten. Mit einem Wort, er befriedigte die niedersten Instinkte.
Jakobs aufgesetzte moralische Empörung war so durchscheinend wie der helle Tag. Die unscheinbare Kladde mit der merkwürdigen Diktion dagegen knisterte im Dunkeln wie ein verheißungsvolles Mittsommernachtsfeuer. Auch wenn er noch nicht wissen konnte, wohin ein solches Denken führte, beschloss Bo, keine Ruhe zu geben, bis er die spröde Schale aufgebrochen hatte und der Kern vor seinen Augen lag, bis er jeden einzelnen Gedankenschritt zählen konnte wie die Windungen einer Walnuss oder die Rippen eines Flussbarschs.
Von da an ließ er nicht mehr locker. Er bat den Abt, auch die Vormittage im Skriptorium verbringen zu dürfen, was ihm dank Widos Fürsprache bewilligt wurde. Ausdrücklich verlangte er die ausgefallensten und neuesten Schriften. Mit jedem Band hatte er das Gefühl, der unbekannten Wahrheit ein Stück näher zu kommen.
So kam es, dass Bo im Skovkloster der Mann für die neue Wissenschaft wurde, die auf stummem Papier unbemerkt Einzug hielt. Wido war wohl der Einzige, der Bos Beitrag zum Klosterleben zu schätzen wusste. Als verantwortungsbewusster Lehrer sorgte er sich jedoch um die Allgemeinbildung seines eigenwilligen Zöglings. Er wusste um die Macht des Wissens und befürchtete, der weltfremde Autodidakt Bo Bodilsen könnte auf Dauer der Verlockung des Hochmuts und den Anfechtungen des allgegenwärtigen Bösen nicht widerstehen, wenn er sein Spezialwissen nicht auf die solide Grundlage christlicher Erziehung stellte. Eines Tages, fast zwei Jahre, nachdem Bo an die Pforte des Klosters geklopft hatte, zwang er ihm eine Unterredung auf, in der er ihn vor die Wahl stellte: entweder das Noviziat anzutreten und den obligatorischen Unterricht in der Bibel, den Kirchenvätern sowie Kirchengeschichte zu besuchen oder das Kloster zu verlassen, um an einer richtigen Hochschule wie Paris zu studieren. Ohne Zögern entschied sich der Junge für das Zweite.
Der Abt wollte zunächst nicht zustimmen. Er fürchtete den Zorn der einflussreichen Familie Bodilsen. Noch immer hofften Bos Eltern, ihr Sohn werde schließlich zu ihnen zurückkehren und die Geschäfte übernehmen, besonders seit sein älterer Bruder Jørgen einem Reitunfall zum Opfer gefallen war. Die Angst vor dem toten Punkt, dem Absterben der Ahnenlinie, trieb Knud Bodilsen in regelmäßigen Abständen vor die Klosterpforte, wo er die Herausgabe seines Stammhalters forderte. Durch seine Selbstverstümmelung hatte Bo den Plan der Eltern vereitelt, ihn mit der sechzehnjährigen Mathilde Bendtsen zu vermählen. Ein beschädigter Schwiegersohn kam für das reiche Ringsteder Kaufmannsgeschlecht, das nur eine Tochter zu vergeben hatte, nicht in Frage. Und auch für seine eigene Familie war Bos mutwilliger Akt eine schmerzliche Provokation. Zwar konnte man einen Abakus mühelos mit der linken Hand bedienen, aber ob er als Krüppel jemals das Ansehen und den Einfluss seines Vaters hätte wahren können, war mehr als zweifelhaft.
Trotzdem war ein Bodilsen mit sieben Fingern besser als gar kein Bodilsen. Niels Pink war insgeheim derselben Meinung, doch war er nicht minder interessiert an jedem einzelnen Rekruten, der seine Armee christlicher Seelen vergrößerte, und einen echten Bodilsen in seinen Reihen zu wissen konnte dem Kloster nur nützen. Darum setzte er die Einkleidung des Patriziersohns fest, ohne auf Widos Einwände zu hören.
Als Bo davon erfuhr, überlegte er kurz, ob er sich noch weitere Finger abschneiden sollte, vielleicht sogar die ganze Hand. Doch dann hätte er nie mehr im Skriptorium arbeiten können. Stattdessen fasste er zum zweiten Mal in seinem jungen Leben den Plan zu fliehen. Um keinen Verdacht zu erregen, weihte er niemanden ein, nicht einmal Wido, der ihm ein treuer Freund geworden war. Diesmal bereitete er sich gut vor. Lange vorher versteckte er unbemerkt sein Reisebündel in seinem Strohsack, der ohnehin nur alle paar Monate gelüftet wurde. Darin verwahrte er neben notwendigen Utensilien für unterwegs auch ein paar Bücher aus der Bibliothek, deren Fehlen, wenn überhaupt, nur Wido auffallen würde und das auch erst nach einigen Wochen. Schmerzlicher würde man die reichliche Handvoll silberner Denare vermissen, die er vorsichtshalber erst am Vorabend seiner formellen Aufnahme als Novize aus der Kasse des Kellerers stahl.
Die Zeremonie der Einkleidung, die rasch und formlos im Kapitelsaal abgewickelt wurde, ließ Bo gleichmütig über sich ergehen. Einzig die Wahl seines Ordensnamens brachte ihn vorübergehend aus dem Gleichgewicht. Der Einfachheit halber hatte der Abt beschlossen, seinen dänischen Rufnamen zu latinisieren, und war gegen alle morphologischen Gesetze auf Boetius verfallen, ohne die tiefere Ironie dieser Namenswahl zu bemerken. Wahrscheinlich war ihm weder bewusst, dass die mathematischen und musikalischen Schriften des altehrwürdigen Boethius an den Hochschulen als Einführung dienten noch dass dessen Aristoteles-Übersetzungen jahrhundertelang die Erinnerung an jenen umstrittenen Philosophen wach gehalten hatten. Ebendiesen Aristoteles wollte Bo ja in Paris studieren, doch ebendieses Wissen, für das der römische Konsul Boethius einstand, sollte dem Novizen ja nach dem Willen des Abtes verschlossen bleiben.
Er nahm seinen neuen Ehrentitel als gutes Omen, auch wenn ihn der Gedanke an das schaurige Ende seines Namenspatrons frösteln ließ. Auch dies war Niels Pink wohl entgangen, dass Boethius im Kerker gesessen hatte und von einem tyrannischen Herrscher gemeuchelt worden war, der die Wahrheit des dreifaltigen Gottes ebenso verabscheute wie die Liebe zur Philosophie. War solch ein Schicksal das rechte Vorbild für einen jungen, aufstrebenden Gelehrten?
Am Morgen des kommenden Tages trat Bo, nunmehr Boetius, seinen Dienst im Skriptorium nicht an. Wido suchte ihn im Dormitorium, in der ganzen Klausur, in der Küche, im Gästehaus, in der Latrine, im Brauhaus, in den Werkstätten, ja sogar in der Kirche. Vergeblich. Recht bald ließ er die Hoffnung fahren, den Ausreißer jemals wieder zu sehen. Er hatte sich eben doch nicht getäuscht in dem Jungen!
Vagantenleben
Seeland, den 29. Juni 1266 (Peter und Paul)
Sechs Wochen zu Fuß. Die ersten Tage waren die härtesten. Nicht nur, dass seine jungen Beine noch nicht die Muskulatur ausgebildet hatten, die ein Mensch seiner Zeit dringend benötigte, wollte er nicht in einem staubigen Winkel der Welt versauern. Nein, ganz objektiv stellten ihn die Trampelpfade seiner seeländischen Heimat, die man im wehrhaften Unterholz der unendlichen Wälder mehr erahnen als benutzen konnte, vor Schwierigkeiten, wie man sie auf dem weithin erschlossenen Kontinent nicht kannte. Diesen Vergleich konnte er allerdings erst später ziehen, als er auf vier bis fünf Meter breiten Straßen von einer erstaunlichen Stadt zur nächsten wanderte.
Oft genug war er sich nicht sicher, ob da wirklich ein Weg war, ob sich auf dieser menschenleeren Insel überhaupt jemand vom Fleck bewegte oder ob nicht vielmehr ein jeder stumpf auf seiner Scholle hocken blieb und die Erde mit den Händen umgrub. Aber er wusste, dass ganz an der Spitze der südlich gelegenen Insel Laaland der Fährhafen Ruthby lag, von dem aus man über den baltischen Sund übersetzen konnte. Er opferte ein paar Groschen seiner Barschaft für die Überfahrt und fühlte, dass er den ersten wichtigen Schritt getan hatte. Am Nordstrand der Insel Fünen, wo ihn das Fischerboot absetzte, stand eine Kapelle für die dänischen Jakobspilger, Sankt Peter und Paul geweiht. Es war das erste Mal, dass ihm bewusst wurde: Von nun an wandelte er auf Pilgerpfaden. Er hoffte, dass ihm dieser Status Vorteile bringen würde, kostenlose Herberge und Pilgerbrot, arglose Begegnungen mit Menschen, die sich Gutes von ihm erhofften. Natürlich wurden auch Pilger überfallen, aber selbst ein Straßenräuber musste schon recht abgebrüht – oder verzweifelt – sein, um seine sichere Verdammnis dafür in Kauf zu nehmen.
Vor der Strandkapelle lag ein grober steinerner Opferstock im Sand. Üblicherweise steckten die Pilger aus Laaland ein Geldopfer in den Schlitz, als Dank für die sichere Überfahrt. Boethius stand eine Weile zweifelnd davor. Viel Geld blieb ihm nicht für die lange Reise und gemessen an dem, was ihn noch erwartete, hatte er erst einen kleinen Teil zurückgelegt. Auch war er ja gar kein richtiger Pilger. Aber da ihn die seeländischen Fischer beobachteten, die am Strand ihren Fang sortierten, trennte er sich schließlich schweren Herzens von ein paar Münzen. Wenigstens drohten ihm zu Wasser keine Gefahren mehr. Das Meer wollte er ein für alle Mal hinter sich lassen. Er war in seiner Nähe aufgewachsen und es war ein merkwürdiger Gedanke, es für immer hinter sich zu lassen. Dennoch glaubte er nicht, dass er es vermissen würde. Es war ihm selbstverständlich und doch fremd, wie die Haare auf seinen Unterarmen oder der Schmutz unter seinen Fingernägeln. Etwas, das immer um einen war, obwohl man es nicht brauchte. Er warf noch einen letzten leeren Blick in diesen grauen Spiegel und schritt dann energisch an den wenigen hinter dem Strand liegenden Häusern vorbei, auf der Suche nach dem nächsten und besten Weg.
Fünen sah nicht viel besser aus als Seeland. Zwar lichteten sich die Wälder etwas und er kam schneller voran, doch von einem Weg konnte weiterhin keine Rede sein und die Dornenhecken der Brombeeren zerrissen ihm häufiger die Hosen, als dass sie ihn satt machten. Als Stadtbewohner hatte er nie richtig gelernt, sich in freier Natur zu versorgen. Dazu hatte er jetzt reichlich Gelegenheit. Bei jeder Frucht, jedem Pilz und jeder Wurzel zweifelte er, ob er sich der Gefahr aussetzen sollte, sie zu verzehren, aber der Hunger verlieh ihm Kühnheit und die Beschützer der Reisenden, die Heiligen Christopherus, Nikolaus und Jakobus, meist die richtige Intuition. Nur einmal wurde er sehr krank und konnte drei Tage nicht einmal einen Schluck Wasser bei sich behalten. Glücklicherweise war er so geistesgegenwärtig gewesen, aus dem Kloster Feuerzeug und ein geknüpftes Netz mitzunehmen, mit dem er Fische fangen konnte. Seen und Bäche gab es überall, so wurde gegrillter Fisch seine Hauptspeise. Sie schenkte ihm Kraft und Zähigkeit.
Als er Fünen von Ost nach West durchquert hatte, war es nur noch ein Sprung über den Kleinen Belt nach Jütland. Bald stieß er auf den schlammigen Heerweg, der ihn südwärts nach Flensburg führte und weiter in die Hauptstadt der Hanse. Lübeck war für ihn in umgekehrter Richtung als für die übrigen Reisenden ein Tor zur Welt, strebte er doch nicht danach, die wüsten Gefilde des Nordens zu erkunden, sondern im Gegenteil endlich in die europäische Zivilisation einzutauchen. In Lübeck begann ein Hauptstrang des nördlichen Jakobswegs und so konnte er nun mit dem Strom der Pilger schwimmen, einfach Fuß vor Fuß setzen, vom Morgengrauen bis zum Zenit der Sonne, vom verblassenden Nachmittag bis zur Dämmerung, ungehindert von Irrwegen, Nahrungsengpässen und natürlichen Hindernissen. Von da an ging es nur noch geradeaus.
Nachdem er eine Nacht in der Gertrudenherberge verbracht und sich still und leise in einen Jakobspilger verwandelt hatte, den niemand nach dem Grund seiner Wallfahrt fragte, begann seine eigentliche Reise. Er sah das weltmännische Hamburg, das reiche Bremen, das vieltürmige Münster, das liebliche Namen an der Maas, das ehrwürdige Laon mit seiner einzigartigen Kathedrale. Dank seines Pilgerzeichens war überall für Kost und Logis gesorgt. Er lernte viele Menschen kennen und erfuhr die erstaunlichsten Dinge. Mit der Zeit wuchs sein Verständnis für die Kultur, deren Teil er schon immer gewesen war, obwohl er sie nur aus Büchern gekannt hatte. Aber was er verstanden hatte, waren Gedanken gewesen. Was er jetzt vor sich hatte, war greifbar, lebendig, sinnlich.
Der erste Vorbote des ersehnten Ziels war die Cluniazenserabtei St. Martin auf dem Felde. Sie war von besonderer Größe und Schönheit. Aber Bo hatte nun schon viel gesehen und war nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Er hatte sich den Anstrich des Weltläufigen gegeben, stellte Vergleiche an, schätzte das eine so ein und das andere so. So glaubte er, gerade weil er vom Rande Europas kam, von weiter her als die meisten Gebildeten, die früher oder später nach Paris kamen, könne er alles besonders gut beurteilen. Daher fand er den Kirchenbau von St. Martin unbedeutender als einen ähnlichen, weniger gedrungenen in Chaalis und suchte rasch die Herberge auf.
Bei Benediktinermönchen, die er die ganze Reise über nach Möglichkeit gemieden hatte, verbrachte er die letzte Nacht. Am nächsten Morgen, es war ein sonniger, aber nicht zu heißer Tag, musste er noch mehrere staubige Meilen auf einer schier endlosen Straße dahintrotten, die schließlich zum römischen Cardo wurde. Seltsamerweise dehnte sich hier, so kurz vor dem Ziel, der Weg wieder ins Unermessliche. Es kam ihm vor, als ob er sich mit jedem Schritt weiter entfernte. Einmal stieß er mit dem Fuß an einen großen Stein, den er gedankenlos übersehen hatte, und hätte sich beinahe in den letzten Stunden noch den Knöchel gebrochen. Über seine jungenhafte Ungeschicklichkeit fluchend saß er eine halbe Stunde am Straßenrand und kühlte und massierte das Gelenk.
Am späten Vormittag schritt er über die alte Römerbrücke und setzte den Fuß auf die Insel der Gelehrten.
Und nun war er hier. Aus dem Gewirr der verschränkten Gassen auftauchend, die das Herz der Stadt wie feine Adern durchzogen und belebten, stand er ratlos vor der gewaltigsten Kirche, die er je gesehen hatte. Dagegen war die Pederskirke in Næstved eine Scheune, obwohl ihr Kirchenschiff so breit war, dass man, wenn man mit dem Rücken zur Südwand stand, nicht erkennen konnte, welchen Gegenstand jemand auf der Nordseite hochhielt. Dieses Spiel hatten die Oblaten oft zum Zeitvertreib gespielt, und wer dreimal daneben lag und nicht erriet, ob es sich um ein Ostensorium mit einem geweihten runden Wachsbild darin oder um einen Kochlöffel handelte, der hatte verloren und musste vor dem Altar seinen nackten Hintern entblößen. Wenn er dabei vom Küster oder einem der ordinierten Benediktiner erwischt wurde, hagelte es unter dem Beifall der anderen Schläge und obendrein gab es Essensentzug.
Die Kirche, die Boetius nun doch mit gesteigerter Aufmerksamkeit betrachtete, um die Erhabenheit des Moments auszukosten, war nicht nur viel breiter und höher als die Pederskirke, sie sah auch völlig anders aus. Ihre Fassade schien nicht aus Stein gemauert, sondern aus verwittertem Treibholz oder Elefantenzähnen geschnitzt zu sein. Drei Portale von gleicher Größe gliederten sie nach Art der alten Kirchen, die Boetius schon oft gesehen hatte. Aber etwas war anders. Es waren nicht die gewaltigen Turmblöcke, die sich links und rechts erhoben, auch nicht die gigantische vielfarbige Blume, die wie ein Schatz aus glitzernden Edelsteinen im Zentrum der Fassade erblühte. Offenbar war dahinter das Kirchenschiff noch nicht geschlossen, sonst wäre nicht so strahlendes Licht durch sie gefallen. Große Rosetten hatte Boetius schon in Laon und anderswo gesehen. Ungewöhnlich kam ihm dagegen die Galerie vor, die mit gekrönten Figuren von exquisiter Eleganz bestückt war. Was für ein bestechender Einfall!
Aber was ihn verwirrte, ja bestürzte, waren die merkwürdigen Zahnstocher, die seitlich aus dem halb fertigen Chor herausragten. Er konnte sich nicht recht vorstellen, welchem Zweck sie dienten und ob man sie absichtlich dort platziert hatte. Vielleicht handelte es sich um eine Konstruktion, die den Steinmetzen die Arbeit erleichtern sollte, weil sie darauf in lichte Höhen steigen konnten. Bestimmt würden die Verstrebungen nach der Fertigstellung des Baus abgebrochen werden. Schön waren sie jedenfalls nicht.
Diese Kirche musste die Kathedrale Unserer Lieben Frau sein. Die Kathedralschule war einst das Gründungszentrum der Universität gewesen, das wusste Boetius von einem verrückten Bettelmönch, den er vor ein paar Tagen in einer Herberge getroffen und den er ein bisschen nach Paris und der Universität ausgefragt hatte. Er hatte ihm von Petrus Abaelard erzählt, der vor hundert Jahren in Notre-Dame gelehrt hatte. Allerdings hatte den seltsamen Bruder vor allem die Geschichte von Abaelards Entmannung interessiert, weniger dessen Lehre. Boetius hatte sich gar nicht vorstellen können, wie man eine derart schwere Verletzung des Körpers und der Würde überleben konnte. Während der Mönch die barbarische Bestrafung haarklein ausmalte, stöhnte er in einem fort wie ein brünstiger Elch. Mit leichtem Grusel hatte Boetius sich von ihm verabschiedet und war zu Bett gegangen.
Doch jenes unangenehme Gespräch hatte ihm den ersten Eindruck von der Pariser Topografie vermittelt und er wusste nun, dass er sich in der Civitas befand, auf einer Insel mitten in der Seine, und dass die Universität nur einen Steinwurf entfernt sein konnte. „Ich bin angekommen“, flüsterte er und war einen Moment lang sehr ergriffen. Er setzte sich auf eine Türschwelle am Rande des großen Vorplatzes und überlegte. Am vordringlichsten war jetzt wohl, eine Unterkunft zu suchen. Seine bisherigen Erfahrungen ließen ihn vermuten, dass in der Großstadt nichts umsonst war, und er musste haushalten, wenn sein Geld das ganze Studium über reichen sollte. Im Moment war seine Barschaft sehr überschaubar. Er besaß er nur noch ein paar Hohlpfennige von dem Geld, das er aus dem Kloster hatte mitgehen lassen. Aber er hatte ja noch die Bücher, die er schweren Herzens verkaufen konnte, wenn es nötig war. In jedem Fall sollte er nicht auf allzu großem Fuß leben. Dafür war er auch nicht hergekommen. Das hätte er schließlich als stormand Bo Bodilsen einfacher haben können.
Um eine einfache Unterkunft zu finden, fragt man am besten einen einfachen Mann, sagte er sich. Er musterte die zahlreichen Passanten, die den Kathedralplatz überquerten. Erstaunlich, wie schnell man sich an diesen unaufhörlichen Strom von Menschen gewöhnte. In den zwei Stunden, die er für den Marsch von der Abtei St. Martin auf dem Felde bis ins Herz der Stadt gebraucht hatte, waren ihm wahrscheinlich mehr Menschen begegnet als in seinem ganzen bisherigen Leben. Wen sollte er herausgreifen und fragen? Da waren Bauarbeiter aus der Dombauhütte, kräftige, vom Steinstaub ganz bemehlte Kerle, die ihre Brotzeit auf der Straße verzehrten, Händler, die an Ständen oder in Bauchläden exotische Süßigkeiten feilboten, feine Damen im Pelz, die mit ihren Hündchen auf dem Arm ohne erkennbares Ziel auf und ab stolzierten, zerlumpte Bettler, die sich vor ihnen in den Staub warfen, Straßenkinder, die Bälle gegen die Hauswände warfen, sehr zum Ärger der Bewohner, die ab und zu ihre Köpfe aus den Fenstern streckten und laut schimpften, Handwerker in teuren Kleidern, die nicht mehr selbst arbeiten mussten, Dienstboten und Gesinde jeglicher Art, die eiligen Schritts ihren Besorgungen nachgingen, fette Matronen, die zum Fischmarkt am Seineufer watschelten, Sänftenträger, die die Vornehmen der Stadt präsentierten, Schreiber, die aus den zahlreichen Büros lautstark ihre Dienste anpriesen, Buchhändler, die vor ihren Läden in der Sonne saßen, junge Mädchen, die untergehakt in Grüppchen kichernd über den Platz liefen, Burschen, die ihnen erst bewundernd, dann abfällig hinterherschauten, und natürlich jede Menge Geistliche. Und alle miteinander gingen ständig durch die Kirchenportale ein und aus, als befände sich im Inneren eine geheimnisvolle Maschine, die Menschen in ihr Gegenteil verwandelte und wieder ausspuckte.
Keiner schenkte Boetius auch nur die geringste Beachtung. Schließlich stand er auf und wandte sich an einen Lastenträger, der seine schweren Ballen gerade abgeworfen hatte, um aus einem Brunnen zu trinken. „Gott zum Gruße. Könnt ihr mir sagen, wo es eine Unterkunft für Studenten gibt, guter Mann?“ Der Mann richtete sich auf und grinste überlegen. „Gott zum Gruße, Herr Scholar. Es hat über fünfzig Bursen in Paris. Und einen Haufen Hospize, Kollegien und weiß der Teufel, wo sich das Pack versammelt. Ich gebe dir einen Rat, Kleiner, und der ist umsonst: Mach auf dem Absatz kehrt und verschwinde aus diesem Viertel. Drüben, auf dem rechten Ufer, da kannst du was Vernünftiges anstellen. Da gibt es Kneipen und Freudenhäuser. Das sind Orte, die deinesgleichen interessieren. Wozu sonst hast du deine Eltern verlassen und bist nach Paris gekommen?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, schulterte der Mann seine Last und ließ ihn stehen.
Betreten sah Boetius sich um, ob jemand gehört hatte, wie der Arbeiter ihn beleidigte. Diese Stadt und ihre Bewohner waren ganz schön anstrengend. Es musste doch jemanden geben, der bereit war, ihm weiterzuhelfen. An Menschen war kein Mangel, aber er wusste nicht, wie er ihre Aufmerksamkeit gewinnen sollte. Vielleicht waren die Frauen höflicher als die Männer. Da bog gerade eine nicht mehr ganz Junge in einem einfachen grauen Kittel aus einer schmalen Gasse. Boetius verbeugte sich schnell, sodass sie es sehen konnte, und sprach sie an: „Verehrte Dame, wisst ihr, wo ich ein Bett zum Schlafen finde?“
Wie merkwürdig: Die Frau sah ihn derart entrüstet an, dass er sofort zurückzuckte. Es fehlte nicht viel und sie hätte ihm ins Gesicht geschlagen. Dies schien jedenfalls ihre ausladende Gebärde zu bedeuten, bei der sie den rechten Arm über die linke Schulter warf. Eine andere Antwort erhielt er nicht.
Boetius hob hilflos die Schultern. Er war müde und hatte keine Lust mehr, auf der Straße herumzustehen. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, hierher zu kommen. Von all den fremden Gesichtern um ihn herum schwirrte ihm schon der Kopf. Ob er auch so werden würde, wenn er eine Weile hier bliebe? So abweisend und von sich selbst besessen? Er sehnte sich nach der Ruhe seiner Klosterbibliothek, nach dem hypnotischen Kratzen des Radiermessers auf Pergament, bei dem man so gut die Augen schließen und ein kurzes Nickerchen halten konnte. Aber er war nicht wochenlang zu Fuß gegangen, um sich so kurz vor dem Ziel ins Bockshorn jagen zu lassen. Wenn mit der Stadtbevölkerung nichts anzufangen war, musste er auf die Studenten vertrauen. Schließlich war er jetzt einer von ihnen und sie hatten die Pflicht, ihn aufzunehmen. Bestimmt liefen hier massenhaft Studenten herum. Nur wo? Und woran erkannte man sie?
Von Klerikern schien es nur so zu wimmeln. Jeder Zweite, der vorbeikam, trug einen lange schmutzige Kutte und eine Tonsur. So viele Bettelmönche konnte es doch in ganz Paris nicht geben, auch wenn die Stadt Schule der Christenheit genannt wurde. Boetius fing an zu zählen. Als er bis dreißig gezählt hatte, waren mindestens doppelt so viele Betbrüder vorbeigelaufen, die Mindestbesetzung von fünf Konventen. Nur sahen alle ein wenig unterschiedlich aus, sodass er sie nicht recht zuordnen konnte. Alle waren sie tondiert und trugen einen Habit, aber die Farbe und Textur des Gewandes zeigte alle Facetten zwischen gebrochenem Weiß und tiefstem Schwarz, zwischen steifem Filz und durchscheinendstem Leinen. Sogar ein paar rote Gewänder waren dabei, die an den Beinen aufreizend hoch geschlitzt waren, doch die meisten waren hell und mehr oder weniger farblos. Manche der durchweg jugendlichen Männer waren gegürtet, andere nicht, und die Art der Gürtel variierte noch stärker als die der Kleider. Kordeln mit einem, drei, mehr oder gar keinem Knoten, schmale und breite Lederriemen, geknüpfte Bänder in nur einer oder mehreren Farben, Stoffstreifen, gefärbte Schnüre, gewickelte Schweinsdärme, ja sogar Silberketten hielten die sackartigen Gewänder zusammen.
Dahinter konnte nicht die strenge Kleiderordnung eines gemeinsamen Ordens stehen. Offensichtlich wurde die Wahl der Bindemittel von einer geheimen Mode diktiert, durch die sich die einzelnen Kuttenträger zu Gruppen zusammenfanden oder voneinander abgrenzten. Endlich wurde Boetius klar, dass er sich die ganze Zeit mitten unter Studenten befand, nicht unter Mönchen. Er brauchte ihnen nur zu folgen und zu sehen, wohin sie gingen. Sofort heftete er sich an die Fersen eines zierlichen bartlosen Jünglings, der kaum der Amme entwachsen schien, aber zielstrebigen Schritts voraneilte, als wisse er genau, was er im Leben wolle. Boetius hoffte, dass er auch wusste, wo es die billigsten Schlafplätze und das beste Essen gab.
Beinahe hatte er Mühe, mit dem Knaben Schritt zu halten. Aber lange musste er ihm nicht nachlaufen. Schon nach wenigen Metern blieb sein Opfer stehen und sah ihn herausfordernd an. „Ist was?“, fragte er kurz. Wegen seiner mädchenhaften Tonlage klang er nicht ganz so barsch wie der Lastenträger.
„Ist das die Universität?“, fragte er den schnellen Jüngling und zeigte auf ein mächtiges steinernes Gebäude mit riesigen Fenstern gegenüber der Kathedrale. Der Student brach in gekünsteltes Gekicher aus. „Nee, das ist das Hospital. Du bist wohl gerade erst angekommen, was?“ Immerhin, eine Antwort. „Pass auf, wenn du mir ein paar Bier spendierst, führe ich dich ein bisschen herum.“
Boetius seufzte. In dieser Stadt schien jeder nur an sich zu denken. Trotzdem, er war auf Hilfe angewiesen. „In Ordnung. Zwei Runden für uns beide und du zeigst mir alles, was ich wissen muss, wo man schläft, isst, studiert und so weiter.“
„Abgemacht. Komm mit!“ Der Junge hakte sich bei ihm ein und zog ihn mit sich, ohne seinen Schritt zu verlangsamen. „Ich dachte schon, du bist ein Freier. Ich bin zwar jung, aber so etwas habe ich nicht nötig. Ich habe ein Stipendium, weißt du. Ich heiße übrigens Heinrich Bate und komme aus Mecheln. Das liegt bei Antwerpen. Zu welcher Nation gehörst du?“
Heinrich fragte ebenso hastig, wie er lief. Boetius war erleichtert, dass er sich jetzt einfach diesem energischen Zwang unterwerfen konnte und seine Schritte nicht mehr selbst lenken musste.
„Zur dänischen“, sagte Boetius, was sein Gegenüber erneut zu einem Heiterkeitsausbruch veranlasste. „Welche Nationen sind denn hier überhaupt vertreten?“, schob er unsicher hinterher.
„Was für ein Gelbschnabel!“, jubelte der naseweise Knabe. „Dabei siehst du gar nicht mehr so jung aus. Also gut, fangen wir bei Null an. Es gibt vier Nationen: die Franzosen, das sind fast alle hier. Die Normannen, das sind die Ruhigen, Verträumten von der Küste, die ein bisschen komisch reden – wenn sie überhaupt was sagen. Dann die Picarden oder Flamen, das sind die rebellischen Draufgänger aus dem Osten. Und zuletzt die guten alten Engländer, die sind, wie sie sind: jedermanns Freund und niemandes Feind. Wenn ich dich recht betrachte, scheinst du mir eine eigenwillige Mischung zu sein. Du siehst aus wie ein Holländer: blond und rosig, aber du benimmst dich wie ein Normanne: schüchtern und unbeholfen.“
Boetius hörte sich mit gewollter Gelassenheit die bissigen Kommentare des Jüngelchens an und lächelte freundlich dazu. Entweder hatte der kleine Gernegroß schon wieder vergessen, was er gerade über seine Herkunft gesagt hatte, oder er konnte es sich einfach nicht entgehen lassen, ein Bonmot anzubringen. Augenscheinlich pflegten die Menschen hier einen anderen Umgang miteinander und er war entschlossen, damit irgendwie zurechtzukommen.
„Ich bin weder das eine noch das andere. Eigentlich komme ich aus Seeland“, antwortete er ruhig.
„Das ist ganz schön weit weg. Du wirst sicher einer der eifrigsten Studenten werden, wenn du so eine weite Reise auf dich genommen hast. Nordleute gibt es in Paris nicht so viele, darum bilden sie keine eigene Nation. Ich glaube, ihr werdet zu den Engländern gezählt, das liegt auch irgendwo da oben. Die Franzosen halten sich für den Nabel der Welt, weißt du, und alle, die nicht zu ihnen gehören, werfen sie einfach in einen Topf. Bist du denn schon eingeschrieben?“
„Nein, ich habe mich noch überhaupt nicht zurechtgefunden. Darum bin ich dir ja nachgelaufen.“
„Das ist also das Erste, was wir erledigen müssen. Dann wissen wir auch, wo du schlafen kannst. Und wie heißt du nun, Fremder?“
„Mein Name ist Boetius, wie der große Tröster.“
Mit dem untergehakten Arm stieß Heinrich ihn vergnügt in die Seite. „Na, mit dem Namen kann man ja nur Philosophie studieren. Wahrscheinlich willst du die Arbeit deines Patrons fortsetzen, in der er so jäh unterbrochen wurde, und die Werke des Aristoteles übersetzen, was? Pass nur auf, dass du nicht zu erfolgreich bist dabei, sonst nimmt es auch mit dir ein böses Ende.“
Boetius schwieg. Er war nicht glücklich mit der lateinischen Schreibweise seines Namens. Jedes Mal wenn er ihn nannte, machte irgendjemand dumme Bemerkungen. Und dieser Heinrich Bate war offenbar ein echter Spaßvogel. Dennoch war er froh, jemanden gefunden zu haben, der sich um ihn kümmerte.
„Also gehen wir jetzt zum Prokurator der englischen Nation und immatrikulieren dich. Dann suchen wir dir eine passende Unterkunft. Es gibt eine ganze Menge davon: Hospize für arme Schlucker, Bursen für die Rechtschaffenen wie dich und mich, Kollegien für die, die selbst mal Professor werden wollen, und Privatzimmer für feine Pinkel aus gutem Hause. Ob du auf Stroh oder in einem Bett schläfst, hängt von deiner Finanzkraft ab. Hauptsache, du quartierst dich nicht bei den Rechtsverdrehern ein. Sonst wachst du morgen früh nackt auf: ohne Börse in der Burse!“ Wieder gickelte Heinrich über seinen eigenen Witz.
Die Burse. Eine Mühle, die Tag und Nacht nicht stille steht. Ein Ameisenhaufen, ein babylonischer Hühnerstall, ein bewegtes, verwinkeltes Schneckenhaus. Das Wohnheim der Studenten, zu dem Heinrich seinen Schützling führte, war nichts anderes als ein riesiger Bretterverschlag aus waghalsig aufeinander getürmten Stiegen und Kämmerchen, eins schiefer als das andere und allesamt gefüllt mit menschlichen Körpern, die leblos in den Ecken lagen wie Strohpüppchen. Boetius argwöhnte, ob die Studenten diesen fragwürdigen Bau vielleicht selbst errichtet oder ob Kinder von Riesen mit Bausteinen gespielt hätten und zufällig dies dabei herausgekommen sei. Gewöhnt an die ausladenden Steinmauern des Skovklosters, die in seiner kalten Heimat Wind und Wetter trotzten, zögerte er, das wackelige Gebilde zu erklimmen. Doch wenn seine zukünftigen Kommilitonen hier wohnten, wollte er kein Privileg genießen und viel kosten konnte die Miete nicht. Also fasste er sich ein Herz und ertastete mit dem Fuß vorsichtig die krummen Stufen, die in die Burse hineinführten. Das Anklopfen erübrigte sich, es gab ohnehin keine Tür. Im Treppenhaus herrschte völlige Finsternis und es stank nach scharfer Säure. Hilfe suchend und nach Luft schnappend sah er sich nach Heinrich um.
Der war auf der Straße stehen geblieben und wechselte in einer fremden Sprache ein paar Worte mit einem etwas älteren rothaarigen Franziskaner. Dann sprang er Boetius nach und rief: „Warte, Nordmann, du musst dich erst dem Quartiermeister vorstellen und deinen Einschreibungsbogen empfangen.“
Der Rothaarige war also der Obmann der Engländer. Boetius machte auf der engen Treppe umständlich kehrt, trat aufatmend wieder ins Freie und grüßte den Franziskaner ehrerbietig. Zu seiner Überraschung drückte ihn dieser an seine starke Brust, und zwar so, dass Boetius die Luft wegblieb. Wieder ein neuer Eindruck und ein Verhalten, das er nicht einzuordnen wusste.
„Willkommen an der bedeutendsten, ältesten, ja der einzig wahren Universität Europas! Die Universität ist im Haus Davids, ein offener Brunnen, zu dessen Wassern die Durstigen eilen, um in Freuden aus den Quellen des Erlösers zu schöpfen. Wie Rachel die Kamele getränkt hat, so erfrischt mit ihrem Trank die Universität die Sünder, die mit dem Höcker ihrer Verfehlungen beladen zu ihr kommen. Die freien Künste sind ihre Mägde und Türhüterinnen, die den einlassen, der die wahre Weisheit sucht. Dies hat unser Heiliger Vater, der große Innozenz IV., gesagt. Leider hat unsere Zeit nicht mehr solche Päpste wie ihn.“
Boetius starrte den Mönch verwirrt an. Was wollte er ihm damit sagen?
„Ich weiß auch ein schönes Zitat, sogar von einem Landsmann“, warf Heinrich ein. „Hier ist es: Ich habe einen Umweg über Paris gemacht. Als ich dort die Fülle von Lebensmitteln, die Fröhlichkeit des Volkes, die Ehrfurcht vor dem Klerus, die Majestät und Glorie der ganzen Kirche und die mannigfaltige Regsamkeit der Jünger der Philosophie sah, die mich staunen machte, gleich der Jakobsleiter, deren Spitze an den Himmel rührt und auf der die Engel auf- und niedersteigen, da erfüllte mich große Freude über diese Reise, und ich fand mich gedrängt zu bekennen: Gewisslich ist der Herr an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Auch das Wort des Dichters kam mir in den Sinn: Glücklich der Verbannte, dem dieser Aufenthalt gewährt wird. Diesen Reisebericht sandte Johannes von Salisbury dem unglücklichen Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket.“
Als wäre dies sein Stichwort, verstummten seine beiden neuen Bekannten und blickten ihn gespannt an. Boetius räusperte sich verlegen. Erwartete man von ihm, dass er auch ein Zitat beisteuerte? Handelte es sich um ein Begrüßungsritual unter angehenden Wissenschaftlern, von dem er allein nichts wusste? Er kramte in seinem Gedächtnis, doch da war nichts. Einfältig glotzte er zurück. Irgendetwas musste er jetzt zum Besten geben, wenn er nicht wollte, dass sie ihn für einen Dorftrottel hielten.
Nichts zu machen, außer einem gestotterten „Ich bin noch sehr müde von der Reise“ kam nichts über seine Lippen.
Darauf wandte sich der Franziskaner großzügig ab, um ihm die Qual der Bloßstellung zu ersparen, und sprach über die Schulter weiter: „Dann wollen wir uns erst einmal deiner Einschreibung zuwenden, mein Junge, damit du dich bald ausruhen kannst. Komm mit in mein Büro. Für den persönlichen Austausch ist später noch genug Zeit. Nur eine Kleinigkeit muss ich noch nachholen: Ich bin Meister Wilhelm von Chester, der Prokurator der englischen Nation, der du ab heute angehörst, und zudem Quartiermeister dieser schönen Burse, vor der du stehst.“ Er führte eine umarmende Bewegung aus, doch diesmal schien er nicht Boetius zu meinen, sondern die Studentenbaracke, auf die er ernstlich stolz zu sein schien.
Boetius wollte schon wortlos und beschämt hinterher trotten, da fiel ihm plötzlich doch noch etwas ein. Er richtete sich auf und räusperte sich erneut. „Jetzt bist du, von der Liebe zur Wissenschaft getrieben, in Paris und hast dieses von so vielen ersehnte Jerusalem gefunden. Es ist die Wohnstatt Davids und des weisen Salomo. Ein solcher Andrang, eine solche Menge an Klerikern trifft dort zusammen, dass sie allmählich die vielköpfige Bevölkerung der Laien überrunden. Glückliche Stadt, in der die Heiligen Bücher mit so viel Fleiß gelesen und ihre komplizierten Geheimnisse mit den Gaben des Heiligen Geistes gelöst werden, wo es so viele erlauchte Professoren und eine so hervorragende Wissenschaft gibt, dass man sie die Stadt der schönen Künste nennen könnte.“
Der Urheber dieses Zitats, ein gewisser Philipp von Harvengt, war ihm völlig unbekannt. Er hatte es in einem Itinerarium, einem Reiseführer, gelesen, den er unterwegs in einer Klosterbibliothek eingesehen hatte, um sich eine Marschroute zurechtzulegen.
Unverzüglich drehte sich Wilhelm um. Die Sonne ging auf in seinem kantigen Gesicht. Noch einmal drückte er Boetius an seine Brust.
Als dieser aus dem kernigen Griff entlassen wurde, sah er, wie Heinrich mit verschränkten Armen dastand und feixte. „Ich geh dann mal, Nordmann“, flötete er, „und überlasse dich dem mütterlichen Gewahrsam unseres unvergleichlichen schottischen Meisters. Vergiss nicht, dass du mir noch zwei Runden schuldest. Ich hole dich heute Abend ab und dann erkläre ich dir den Rest.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, hob er lässig die Hand zum Gruß und trabte in seinem forschen Schritt davon.
„Frecher Bengel“, rief Wilhelm ihm nach, aber es klang eher zärtlich als verärgert.
„So, dann wollen wir mal. Ich brauche von dir: Name, Herkunft und Stand. Du bist nicht mehr so jung, wie es scheint. Vielleicht können wir dich schon in das vierte Trimester eintragen, falls du Latein lesen und schreiben kannst. Des Weiteren benötige ich die Einschreibgebühr und ein aufmerksames Ohr, damit ich dir die Statuten und sonstigen Gepflogenheiten des Universitätslebens nahebringen kann. Meine Schreibstube ist gleich dort drüben.“
Nach den Formalitäten der Einschreibung geleitete Meister Wilhelm den neuen Studenten zu seiner bescheidenen Unterkunft in der dritten Etage der Burse. Von Stockwerk zu Stockwerk wurde es stickiger und heißer in dem Kabuff. Boetius graute vor der Vorstellung, hier die nächsten Jahre zu verbringen. Hochgewachsen, wie er als Mann des Nordens war, konnte er sich in seiner Zelle nicht einmal aufrichten oder beide Arme ganz ausstrecken. Außer einer Strohschütte befanden sich darin nur eine schmale Bank, ein Blecheimer und ein wackliges Bord, das mit Holzdübeln mehr schlecht als recht an der Wand befestigt war. Ein Fenster hatte die Kammer nicht, nur einen schmalen Lüftungsschlitz.