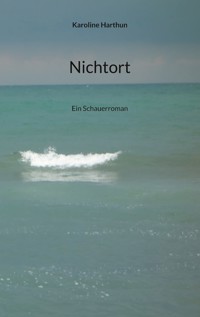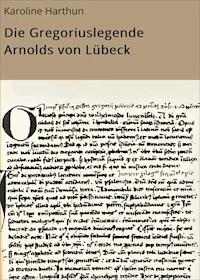13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie sieht es in diesen Regenbogenfamilien aus? Wie reagiert das soziale Umfeld? Und wie bekommen eigentlich zwei gleichgeschlechtliche Partner miteinander Kinder?
Karoline Harthun erzählt die spannende Geschichte ihrer eigenen Regenbogenfamilie. Von beschämenden und riskanten Erfahrungen auf dem Weg zum Kind bis hin zur rechtlichen Umsetzung der Doppelmutterschaft. Aber nicht nur um den eigenen Kinderwunsch und den langen Weg zu dessen Verwirklichung geht es in dem Buch, sondern natürlich auch um die Kinder selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Regenbogenfamilien sind Familien, in denen Eltern lesbisch, schwul, bisexuell oder transgeschlechtlich sind – und noch eine Besonderheit: Von rund 14 Millionen Kindern in Deutschland wachsen schätzungsweise 18000 mit gleichgeschlechtlichen Eltern auf. Wie außergewöhnlich und wie normal ein Regenbogenfamilienleben ist, davon erzählt Karoline Harthun: Von riskanten Erlebnissen auf dem Weg zum Kind über die rechtliche Anerkennung der Doppelmutterschaft bis hin zu Herausforderungen im Kindergartenalltag. Ein bemerkenswerter Erfahrungsbericht über die Rechte und Realitäten einer modernen Familienform.
Karoline Harthun studierte Mittellateinische Philologie, Germanistik und Kunstgeschichte. Sie ist tätig als Dozentin für Medizinische Terminologie und Deutsche Literatur. Sie lebt in einer Eingetragenen Partnerschaft. Das Paar hat zwei Töchter und wohnt in Berlin.
Karoline Harthun
NICHT VON SCHLECHTEN MÜTTERN
Abenteuer Regenbogenfamilie
Kösel
Copyright © 2015 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: Weiss Werkstatt, München
ISBN 978-3-641-16804-9
Die Erinnerungen von Karoline Harthun bilden die Grundlage für die in diesem Buch enthaltenen Dialoge. Die Gespräche werden sinngemäß wiedergegeben, ein Anspruch auf eine wörtliche Übereinstimmung mit den tatsächlich erfolgten Dialogen wird nicht erhoben.
Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unter
www.koesel.de
INHALT
Aufbruch zum anderen Ufer
Der lange Weg zum Kind
Ein Segen von Amts wegen
Mann nicht inbegriffen
Abstecher in den moralischen Sumpf
Die Rechtslage – welche Rechtslage?
Auf dem Sklavenmarkt
Heimarbeit
Überstürzte Geburten
Staatliche Fürsorge
Ausgerechnet katholisch
Das Leben der anderen
Aufklärung in besonderer Mission
»Zum Glück ist es ein Mädchen«
Von Blut und Banden
Leben im Viermäderlhaus
Im Fünfmäderlhaus?
Regenbogen und andere Farben
Hinweis in eigener Sache
AUFBRUCH ZUM ANDEREN UFER
Meine Frau und ich begegneten einander auf einer Party zum 30. Geburtstag eines gemeinsamen Freundes. Ich wäre beinahe nicht hingegangen, weil dieser Novemberabend ungemütlich frostig war und es mir an diesem Tag und in dieser Zeit überhaupt nicht gut ging. Drei Jahre nach dem Abschluss meines Studiums und kurz vor meinem eigenen 30. Geburtstag waren die Aussichten in jeder Hinsicht düster. Auf meiner kärglichen halben Stelle an der Universität wurde ich ausgebeutet, nicht gefördert. Meine Promotion war in den Anfängen stecken geblieben. Seit Jahren war es mir nicht gelungen, eine Affäre länger als ein paar Wochen aufrechtzuerhalten. Meine Parterrewohnung in einem Kreuzberger Hinterhof war kalt, dunkel und verschimmelt. Ich musste mich noch finden, wie man so sagt.
Aber mein guter Freund, mit dem ich seit der Schulzeit die anregendsten Gespräche geführt und die aufregendsten Orte erforscht hatte, feierte Geburtstag und darum raffte ich mich auf, hüllte mich in existenzialistisches Schwarz und ging zu der Party.
Ich war eine der Ersten, ließ mich in der Küche nieder und plauderte matt. Kurze Zeit später betrat eine Frau den Raum, bei deren Anblick ich dachte: Die ist cool. Und schön. Mehr nicht. Die Erschütterung kam eine Stunde später, als sie sich zu einem anderen Freund und mir setzte und mit ihm ein langes Gespräch begann. Den ganzen Abend sprach sie nur mit ihm und sah mich dabei kein einziges Mal an, aber ich hatte das untrügliche Gefühl, jedes ihrer Worte sei allein an mich gerichtet. Es war Liebe auf den ersten Klang, nicht auf den ersten Blick. Ihre Stimme berührte etwas tief in mir und die ganze Zeit über war es, als hörte ich mich selbst reden. Wie konnte es sein, dass mir jemand, den ich noch nie gesehen hatte, so aus dem Herzen sprach? Die Geschichte, die sie erzählte, war völlig anders als meine eigene. Sie schilderte ihre Kindheit in der DDR und ihre Ausgrenzung als Christin. Ich war glaubensfern im materialistischen Westen aufgewachsen.
Viel später gestand sie mir, dass sie eigentlich mich habe ansprechen wollen und nicht meinen Freund Philipp, sich aber nicht getraut habe. Diese Schüchternheit hatte Folgen. Natürlich glaubte ich, sie sei an ihm interessiert. Ich war augenblicklich eifersüchtig, deutete aber meine eigene Reaktion völlig falsch. Philipp nämlich, mit dem sie so eine leidenschaftliche Unterhaltung führte, war damals der wichtigste Mann in meinem Leben, gewissermaßen die zweite Hälfte meines platonischen Kugelmenschen. Wir waren fünf Jahre ein Paar gewesen und hatten es geschafft, auch nach der Trennung eng verbunden zu bleiben.
Ich erkannte sofort, dass Philipp auf die geheimnisvolle Unbekannte abfuhr. Ich sorgte und ärgerte mich zugleich, weil er sich Hals über Kopf in eine Liaison stürzte. Diese Frau, Esther, schien mir viel zu jung für ihn, viel zu lebhaft, viel zu undurchdringlich. Von Anfang an hatte ich den Eindruck, dass er sie missverstand. In den wenigen Monaten, die Philipp und Esther zusammen waren, erzählte er mir Dinge über sie, die in völligem Gegensatz dazu standen, wie ich sie erlebte. Er behauptete, sie wolle möglichst schnell Kinder bekommen, und zwar gleich mehrere. Mir sagte sie, sie könne sich im Moment auf nichts festlegen.
Aber nach der schweren Amputation von meiner Kugelhälfte Philipp hatte ich mir vorgenommen, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. So versuchte ich die beiden zu ignorieren, was mir umso schwerer fiel, als ich einen Monat später die verschimmelte Wohnung hinter mir ließ und mit Philipp in einem engen Reihenhaus im Süden der Stadt eine WG gründete – und Esther gleich mit einzog, weil ihre Wohnung renoviert wurde.
Trotzdem machte ich gute Miene zum bösen Spiel, hatte ich doch kurz vor Weihnachten selbst einen Mann kennengelernt, in den ich mich Hals über Kopf verliebte. Stefan wohnte im fernen Zürich und so hatte ich eine gute Ausrede, das Paar in Berlin häufig allein zu lassen.
Meine eigene junge Liebe legte ein beängstigendes Tempo an den Tag. Nach kurzer Zeit waren wir schon dabei, vorsichtige Andeutungen über Hochzeit und Ehe zu machen, und ich rechnete jederzeit mit einem Antrag. Als Esther für vier Wochen nach Vietnam reiste und ich sie schmerzlich vermisste, erkannte ich noch nicht, was mit mir los war. Wie auch? Diese Gefühle verstießen gegen so viele Regeln, die ich für unumstößlich gehalten hatte. Zum Beispiel hatte ich nie geglaubt, dass man sich in zwei Menschen zugleich verlieben kann, noch dazu unterschiedlichen Geschlechts.
Ende Juni, in den kürzesten und heißesten Nächten des Jahres, veränderte sich das Leben von vier Menschen. Wie in einem Kammerspiel kamen lange verdrängte Wahrheiten erst Stück für Stück, dann explosionsartig ans Licht.
Philipp war zusehends in eine Krise geraten, denn Esthers Verhalten wurde immer sprunghafter und unerklärlicher. Eines Abends dann sagte er ihr auf den Kopf zu, dass sie in Wahrheit in mich verliebt sei – und sie stritt es nicht ab. Sie gab es zu und beendete die Beziehung.
Ich war empört, als mir das zu Ohren kam. Was stellte Esther eigentlich mit uns an? Sie verletzte Philipp, der mir so wichtig war, und außerdem war ich doch selbst gerade glücklich verliebt in Stefan. Ich beschloss, ihr die Meinung zu sagen, und verabredete eine Aussprache. Dazwischen lag ein Wochenende, an dem Stefan anreiste. Ich war abwesend und zerstreut, was er natürlich bemerkte. Er wollte wissen, was los war, und ich erzählte es ihm. Seine alarmierte Reaktion bestärkte mich in dem Gefühl, es müsse etwas geschehen, um die verworrene Situation aufzulösen. Stefan kündigte an, am nächsten Wochenende wiederzukommen, und ich hoffte, dass bis dahin alles geklärt wäre. Ich sehnte mich nach Ruhe und einem Ende der emotionalen Achterbahnfahrt.
Am Montag machte Esther Schluss mit Philipp. Und zwar unabhängig davon, was mit mir sei, wie sie betonte. Am Dienstag fuhr ich zu ihr, in ihre mittlerweile wiederhergestellte Wohnung. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir ganz allein waren. Meine Empörung war im Nu verraucht, als ich sie erblickte. Wir redeten lange. Irgendwann hörte ich mich sagen, dass ich mich auch in sie verliebt hätte, aber Stefan auf keinen Fall verlassen würde. Dann küssten wir uns. Es war, als wäre ein Damm gebrochen. Dass sie sich von Philipp getrennt hatte, erleichterte mich. Ich hatte das Gefühl, die größte Last sei bereits von uns genommen.
Blieb noch meine eigene Beziehung zu Stefan. Ein faszinierender Mann, der verrückt nach mir war und mir eine gemeinsame Zukunft bot. Den ich liebte. Der beruflich überaus erfolgreich war. Das wirft man nicht einfach weg. Mit letzter Kraft, buchstäblich unter körperlicher Selbstüberwindung verließ ich Esthers Wohnung und machte mich auf den langen Heimweg; und es kam mir vor, als wäre ich ein halbes Leben lang unterwegs.
Am nächsten Tag war ich mit einer Freundin verabredet. Ich war dankbar für diese Auszeit. Mein Kopf kämpfte gegen die rätselhafte Unvernunft, die mich befallen hatte. Ich erzählte ihr, was bisher geschehen war. Sie staunte. Als sie fragte, was ich tun würde, erklärte ich mit großer Bestimmtheit, natürlich würde ich bei Stefan bleiben. Einen Mann wie diesen treffe man nur einmal im Leben. Schon bald würde sie eine Einladung zur Hochzeit bekommen. Am Donnerstag war ich wieder mit Esther verabredet. Warum, wusste ich selbst nicht. Es war doch alles gesagt! Wir waren erst fünf Minuten in ihrer Wohnung, da kamen unsere Worte tatsächlich an ihr Ende. Ich verbrachte eine berührende, verstörende, unwirkliche, zauberhafte Nacht mit ihr. Wie ein zweites erstes Mal.
Als ich diesmal nach Hause fuhr, war schon die Sonne aufgegangen. Dort erwartete mich Philipp, dessen Verfassung sich noch verschlechtert hatte, nachdem ich am Abend zuvor nicht mehr aufgetaucht war.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Erschöpft legte ich mich ins Bett und versuchte zu schlafen. Bald musste ich wieder aufstehen, um mit meiner zweijährigen Nichte Geburtstag zu feiern. An diesem Tag war ich zu nichts imstande, nicht einmal dazu, ein Geburtstagslied zu singen. Es ist typisch für meine Familie, dass mich keiner auf meinen offensichtlich desolaten Zustand ansprach.
Wenn ich an diese Schicksalswoche zurückdenke, erinnere ich mich vor allem daran, dass ich die meiste Zeit völlig neben mir stand. Es war, als würde mich eine unsichtbare Hand an- und ausknipsen. Von einer Minute zur anderen tat und sagte ich Dinge, die ich selbst nie für möglich gehalten und für die ich keine Erklärung hatte. Dann fiel ich wieder in eine Art geistiges und seelisches Koma, wusste nicht, ob ich wach war oder schlief, wo ich mich überhaupt befand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in dieser Woche überhaupt etwas gegessen habe.
Aber die Tour de Force war noch nicht zu Ende. Am folgenden Tag stand Stefan vor der Tür, argwöhnisch, unruhig. Ich tat, was ich tun musste. So viel war mir inzwischen klar geworden, dass ich mein eigenes widersprüchliches Verhalten nicht länger ignorieren konnte. Dass es etwas gab, was stärker war als ich, wie man so schön sagt.
Ich sagte die Wahrheit, beschönigte nichts und so ergab eins das andere. Stefans Verhalten machte es mir leichter, so unangenehm es auch war. Er machte keinen Versuch, mich umzustimmen. Wahrscheinlich war es einfach zu viel für ihn. Innerhalb einer einzigen Woche waren nicht nur die Geigen verstummt, die in unserem siebten Himmel gehangen hatten, sondern ich hatte gleich die sexuelle Orientierung gewechselt. Das war wirklich schwer zu verstehen, auch für mich selbst.
Stefan schüttete all seine Wut und seine Kränkung über mich aus. Ich ließ es über mich ergehen und zählte die Stunden. Zwei Tage lang inszenierten wir im Zeitraffer das Leben, das wir nie zusammen führen würden, obwohl es so hätte sein können. Es war das längste Wochenende meines Lebens. Dann war es vorbei. Am Montag sammelte Esther das auf, was von mir übrig war, und setzte alles Stück für Stück neu zusammen. Auf geheimnisvolle Weise hat sie damals den Bauplan verbessert, glaube ich. Seitdem halte ich mich einfach besser aufrecht.
DER LANGE WEG ZUM KIND
Als ich selbst ein Kind war, in den 1980er-Jahren, sagten viele: »In diese Welt kann man keine Kinder setzen.« Welches Unheil sich hinter der Formulierung »in dieser Welt« verbarg, wagte man kaum auszusprechen, als würde es bei seiner Anrufung Wirklichkeit werden, so wie die fantastischen Geschöpfe, die Bastian Balthasar Bux in der Unendlichen Geschichte bei ihrem Namen nennt. Es war die Zeit der Unkenrufe und des magischen Denkens. Das Unaussprechliche war dennoch jedem bekannt: Wettrüsten, Waldsterben, Tschernobyl, Überbevölkerung, Hungersnöte, AIDS … Heute könnte man dafür einsetzen: Klimawandel, Finanzkrise, Genmanipulation, Globalisierung, Terrorismus, Fukushima …
Ich habe nie verstanden, wie man aus der Entscheidung für oder gegen Kinder ein moralisches Prinzip machen kann. Kinder erfüllen ein menschliches Grundbedürfnis. Es gibt Extremsituationen, in denen Menschen auf Kinder verzichten, aber die Geschichte lehrt, dass das Ausnahmen sind. Selbst im Gefängnis werden Kinder geboren.
Heutzutage scheinen ohnehin andere Gründe zu überwiegen, warum immer weniger Menschen in Europa Kinder bekommen. Seien es finanzielle Unsicherheit, beruflicher Stress, zerbrechliche Bindungen, wachsende Unfruchtbarkeit, mangelhafte Kinderbetreuung, der Anspruch auf individuelle Freiheit – unsere gesellschaftlichen und persönlichen Lebensumstände sind oft eher hinderlich. Die wenigsten Menschen bekommen einfach so Kinder, sie planen dieses Vorhaben, so wie sie ihre Karriere planen – allerdings oft erst an zweiter Stelle. Andere entscheiden sich zwar nicht gegen Kinder, aber auch nicht dafür, sondern warten auf die richtige Gelegenheit. Bis es vielleicht zu spät ist.
Lange Zeit ging es mir ebenso. Andere Dinge waren wichtiger: lernen, ausprobieren, an die Grenzen gehen. Tagsüber strenge Wissenschaft, nachts Austoben im Berliner Technohimmel. Tatsächlich begann ich mich erst dann ernsthaft mit dem Gedanken an Kinder auseinanderzusetzen, als ich meinen beruflichen Ehrgeiz Stück für Stück über Bord warf. Und so bestätige ich das Vorurteil, dass Kinder und Karriere eben nicht miteinander vereinbar sind.
Es liegt eine besondere Ironie darin, dass ich meinen Kinderwunsch schließlich nicht etwa mit einem Mann, sondern mit einer Frau verwirklicht habe. Petra Thorn, eine auf Regenbogenfamilien spezialisierte Therapeutin in Frankfurt am Main, bezeichnet lesbische Mütter als »Pioniere«. Meine Frau und ich haben tatsächlich einige der Schwierigkeiten überwunden, die gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kinderwunsch oder Kindern im Wege stehen. Vielleicht hätte ich all das mit einem Mann nicht geschafft.
In der ersten Hälfte meines Erwachsenenlebens ging ich, wie das in meiner Generation üblich war, selbstverständlich davon aus, dass ich heterosexuell sei. Homosexuelles Begehren muss sehr stark sein, damit ein junger Mensch von vorgegebenen Mustern abweicht. Natürlich war man tolerant. Meine Mutter war mit Lesben befreundet, auch ich kannte welche. Ich respektierte sie. Aber ich selbst war doch nicht so!
Zehn Jahre lang hatte ich ausschließlich Beziehungen zu Männern, zum Teil sehr erfüllende, zum Teil recht oberflächliche. Es war nicht so, dass ich damals nie an Kinder dachte. Gerade in der Anfangszeit einer Beziehung, wenn ich schwer verliebt war, begleiteten mich unbeschwerte Tagträume von meinem zukünftigen Leben mit Kindern und dem jeweiligen Mann an meiner Seite. Ernüchterte sich die Liebe dann, so schmolzen sie zusammen wie Schaum in kalt gewordenem Badewasser. In diesen Phasen hätte ich schwören können, dass ich niemals einen Kinderwunsch verspürt hatte.
Nun war ich jung, hatte meinen 30. Geburtstag noch vor mir und das Ticken der biologischen Uhr war noch nicht zu vernehmen. Wer weiß, wie sich alles entwickelt hätte, wenn ich den Männern treu geblieben wäre. Hätte ich wie einige meiner Freundinnen mit wachsender Verzweiflung einen Freund nach dem anderen aufgegeben, weil keiner jemals das Stadium erreichte, Ja zu Kindern zu sagen? Die Jahre zwischen 30 und 40 sind kostbar und wenn zwischen Kennenlernen und Zukunftsplanung eine angemessene Frist verstreicht, ist es nach drei gescheiterten Beziehungen zu spät zum Kinderkriegen.
Oder hätte ich zwar ein Kind bekommen, aber kein zweites, weil mich mein Mann in den schwierigen Jahren der Kleinkindzeit wegen einer jüngeren Frau verlassen hätte? Auch das ist nicht wenigen Frauen in meinem Bekanntenkreis passiert.
Aber es kam ganz anders.
Den Ausdruck »Coming-out« habe ich nie geschätzt. Es mag sein, dass er für viele genau das beschreibt, was sie empfinden, aber auf mich hat er nicht gepasst. Coming-out, das ist ein polemischer Begriff, die Verkürzung von Coming out of the closet. Solange man mit seiner Homosexualität im Schrank hockt, versteckt man sich – und genau so war es ja noch vor wenigen Jahrzehnten, als der Begriff geprägt wurde. Vor allem aber legt er nahe, dass mit dem Leben vor dem Coming-out etwas nicht in Ordnung war. Bei mir war das nicht so. Ich habe mich mit Männern nie unwohl gefühlt.
Gerade darum traf es mich wie ein Keulenschlag, als ich mich in eine Frau verliebte. Warum diese Komplikation?, fragte ich mich. Wozu brauchst du das? Das Leben wird nicht einfacher dadurch. Dachte ich. In Wirklichkeit wurde es einfacher, weil ich endlich einen Menschen gefunden hatte, mit dem ich glücklich sein konnte. Ohne dass ich es vorher geahnt hätte, sprang in meinem »Schrank« eine Schublade auf, deren geheimnisvollen Inhalt ich zum ersten Mal bewusst betrachtete und in die Hand nahm wie einen verborgenen Schatz.
Wenn ich auf mein vorheriges Leben zurückblicke, war das alles wenig vorhersehbar. In der Schule schwärmte ich für manche Lehrerinnen, aber durchaus auch für bestimmte Lehrer. Meine beste Freundin liebte ich mit rasender Eifersucht, aber nicht anders, als viele Mädchen in der Pubertät ihre Freundinnen lieben. Ein Ereignis hätte mich aufhorchen lassen können: Es gab zwei lesbische Mädchen in meinem Jahrgang, die sich gefunden hatten und ein Paar waren. Sie traten an unserer liberalen Schule mit großer Selbstverständlichkeit auf, was noch ungewöhnlich war in den 1980er-Jahren. Eine der beiden verliebte sich in mich und sagte mir das auch. Nicht nur das, sie sagte sogar, dass sie mich auch für lesbisch halte. Ich war konsterniert und wies ihr Begehren freundlich, aber bestimmt zurück. Keine Sekunde dachte ich darüber nach, ob sie vielleicht recht haben könnte.
Ich bin wohl das, was man bisexuell nennt. Das hat es mir so schwer gemacht, meine Veranlagung zu erkennen. Es gab Zeiten, da war es schick, sich als bi zu bezeichnen: die 1920er, die 1970er. »Ein bisschen bi schadet nie«, sagte man. Mick Jagger tat es, David Bowie tat es. Bei manchen entpuppte es sich als Attitüde.
Für die Mehrheitsgesellschaft stellt Bisexualität eine Bedrohung dar, weil Uneindeutigkeit die Grenzen zwischen Normalität und Perversion verwischt. Doch auch Homosexuelle grenzen sich häufig von Bisexuellen ab. Bekennt man sich dazu, wird man von vielen als Verräter angesehen, als Klemmschwuchtel, als unehrlich. Obwohl die Lesben- und Schwulenbewegung offiziell bemüht ist, alle möglichen sexuellen und identitären Spielarten zu vereinnahmen, und ihrem internationalen Kürzel jedes Jahr einen Buchstaben hinzufügt – erst LG, dann LGB, dann LGBT, jetzt LGBT* (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und das Sternchen für alle anderen Identitäten) –, spielt bisexuelles Leben im Selbstausdruck der Bewegung so gut wie keine Rolle. Das mag allerdings auch an den Bisexuellen liegen, die sich teils selbst isolieren, teils unauffällig verhalten. Sie passen sich ihrer jeweiligen Umgebung an wie Chamäleons. Auch das ist ein gängiger Vorwurf. Das kann ich sogar gut verstehen. Ich habe gelernt, mich mit den Interessen von Lesben und Schwulen, wo es geht, zu identifizieren, wo es nicht geht, zumindest zu solidarisieren. Ich weiß, dass ich von meiner Umgebung als lesbisch wahrgenommen werde, obwohl ich mich nicht so fühle, und mir bricht deswegen kein Zacken aus der Krone.
Manche behaupten, Bisexualität gebe es gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Menschen mehr oder weniger ausgeprägt bisexuell sind oder sein könnten, wenn sie unter den entsprechenden Umständen lebten. Was mich betrifft, führe ich seit 16 Jahren ein rein lesbisches Leben. Vorher war ich, was meine ausgelebte Sexualität anging, fast ebenso lange heterosexuell. Trotzdem bleiben beide Seiten meiner sexuellen Identität erhalten. Dass so etwas möglich ist, ja sogar eine echte Option mit vielen Vorteilen darstellt, ist eine Errungenschaft unserer toleranten Gesellschaft, für die ich sehr dankbar bin. Durch die Offenheit meiner Mitmenschen und die Vielfalt individueller Entwicklungsmöglichkeiten in der heutigen Zeit habe ich auf diesem Weg mein Glück gefunden und möchte mich anderen, die auf der Suche sind, ganz unbescheiden als Vorbild anbieten.
Identität ist ein Prozess und Prozesse brauchen ihre Zeit. Damit, meine andere Seite zu entdecken, war ich ein paar Jahre beschäftigt, nachdem ich mich in eine Frau verliebt hatte. In dieser Zeit dachte ich nicht an Kinder. Esther ging es anders. Sie war sich von Anfang an viel sicherer als ich. Auch sie hatte vor mir ausschließlich Beziehungen zu Männern gehabt, eine langjährige und mehrere kürzere. Diese Männer waren nicht die Richtigen gewesen, aber zu ihrem Lebenskonzept gehörten Kinder einfach dazu, und zwar möglichst viele.
Zu meinem eher nicht. Das hat vermutlich mit unseren familiären Vorbildern zu tun. Bei ihr: fünf Kinder und eine alles in allem glückliche Ehe, die mittlerweile in ihr sechstes Jahrzehnt geht. Bei mir: zwei Scheidungen und eine Mutter, die ihre beiden Kinder im Grunde nicht wollte. Mir wurde als höchstes Gut mitgegeben, unabhängig zu sein. Schon meine emanzipierte Großmutter beschwor mich, nie zu heiraten. Vielleicht konnte ich mich ja auch deshalb leichter auf eine Frau einlassen, weil patriarchalische Versklavung hier nicht zu befürchten stand.
Anders als in der Zeit, die ich mit Männern verbracht hatte, blieben die Tagträume von gemeinsamen Kindern in den ersten Jahren mit Esther aus. Ich nehme an, mein Unbewusstes fand es abwegig, mit einer Frau Kinder zu zeugen. Man könnte dieses Ausbleiben als biologische Reaktion deuten; ich denke eher, dass unsere Fantasien erlernte Muster abbilden, und für ein Leben mit Frau und Kindern gab es in meiner Erfahrung keine Blaupause.
Wegen meiner mangelnden Erfahrungen auf dem Gebiet der Homosexualität zweifelte ich ohnehin noch an der Dauerhaftigkeit unserer Beziehung und erst recht an meinem Gemütszustand. Es dauerte Monate, bis ich meinen Gefühlen halbwegs über den Weg traute. So glücklich ich auch war, so sicher war ich mir, dass es bald enden musste. Dies würde eine Episode in meinem Leben sein, weil ich eben alles einmal ausprobieren musste. Es passte zu meinem Weg.
Nicht Monate, sondern Jahre dauerte es, bis ich spürte, dass außer für uns beide, meine Frau und mich, noch für etwas anderes Platz war. Bis dahin musste ich Sicherheit gewinnen, alte Lebensschulden abtragen, zum Beispiel meine Promotion abschließen und mich beruflich neu orientieren. So glitt auch ich unmerklich in das kritische Alter hinüber, das man bekanntlich nutzen sollte, bevor es zu spät ist. Wie jedem Menschen, der sein Leben einigermaßen überblicken kann, stellten sich mir zwei bohrende Fragen. Erstens: Willst du überhaupt Kinder? Und zweitens: Wirst du es bereuen, wenn du keine bekommst?
Die Tagträume kehrten nicht wieder. So waren es am Ende diese beiden Fragen, die mich dazu brachten, mich mit dem Kinderwunsch meiner Frau auseinanderzusetzen. Mir wurde klar, dass sie ihre Sehnsucht unterdrückte, weil sie mit mir zusammenbleiben wollte. Sie setzte mich nicht unter Druck, aber ich befürchtete, dass sie sich irgendwann für Kinder und gegen mich entscheiden würde.
Was mir zugutekam, war meine Neugier. Wenn schon Kinder, dann wollte ich am eigenen Leib erfahren, wie es ist, welche zu bekommen. Schließlich ist eine Geburt eine Grenzerfahrung, die sich nicht vermitteln lässt, es sei denn, man erlebt sie. Ich spürte eine vage Ahnung, dass ich erst dadurch zu einem ganzen Menschen werden würde.
Was mir Angst machte, war das, was danach kam. Ich war nicht so naiv, dass ich mir nicht der Verantwortung bewusst gewesen wäre, die es bedeutet, Kinder in die Welt zu setzen. Eine Schwangerschaft dauert neun Monate, mit Kindern hat man sein ganzes Leben zu tun. Geburt als Selbsterfahrung – schön und gut. Aber könnte ich eine gute Mutter sein? Nach zwei Psychotherapien war ich über meine Defizite einigermaßen aufgeklärt. Ich hatte Angst, mein Kind zu verkorksen, wie ich selbst verkorkst worden war.
Esther bemühte sich nach Kräften, meine Selbstzweifel zu zerstreuen. Und sie hatte ja recht! Man muss nicht perfekt sein, um Kinder zu erziehen. Und man darf nicht etwa glauben, dass die Kinder perfekt werden. Man gibt ihnen alles Mögliche mit, Gutes und Schlechtes. Was es ist, kann man sich nicht aussuchen und es lässt sich auch nicht verhindern. Heute entdecke ich an meinen Kindern Züge, die ich ihnen gern erspart hätte. Aber wäre es besser, wenn sie gar nicht existierten?
Früher hätte ich gesagt: Ja. Das ist wenigstens konsequent. Doch wenn ich mein Herz befrage, muss ich mir eingestehen, dass ich selbst in meinen dunkelsten Stunden immer dankbar dafür war, auf der Welt zu sein. Warum sollte ich meinen Kindern dieses Glück verweigern?
Meine Ängste haben sich nie ganz verloren. Aber mein Selbstverständnis hat sich geändert, seit ich für meine Kinder verantwortlich bin. Eltern haben keine Wahl: Sie müssen sich behaupten. Sie müssen an sich glauben, weil ihr Kind an sie glaubt. Kinder zu haben hat mein Selbstbewusstsein mehr gestärkt als jeder berufliche Erfolg. Dabei hatte ich in der Zwischenzeit endlich meine Promotion über die Bühne gebracht. Nur, Befriedigung verschaffte mir dies nicht. Der Weg dorthin war mühsam gewesen und mit Enttäuschungen und Kränkungen gepflastert. Sieben Jahre hatte ich dafür gebraucht und nachdem ich so lange darauf hingearbeitet hatte, fiel ich in ein tiefes Loch, als ich es endlich geschafft hatte. Vier Doktorväter hatte ich verbraucht und die Fremdeinschätzung meiner Arbeit schwankte zwischen »herausragend« und »gerade noch akzeptabel«. Jedenfalls war es nicht der große Paukenschlag gewesen, den man sich insgeheim immer erhofft. Ich fragte mich, wozu ich so viel Lebenszeit vergeudet hatte. Meine wissenschaftliche Karriere dümpelte vor sich hin. Der Titel war gut fürs Ego, aber noch heute muss ich grinsen, wenn ich im Wartezimmer einer Arztpraxis als »Frau Doktor« aufgerufen werde.
Außerdem hatte ich die Wissenschaft im Grunde meines Herzens schon aufgegeben. Doch eine brauchbare Alternative zeigte sich nicht. Seit einem halben Jahr arbeitete ich in einem Verlag – und langweilte mich schon. So sah es in meinem Leben aus, als meine Frau und ich 2003 nach Italien reisten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir seit vier Jahren zusammen. Jahre, die wir ganz für uns gehabt hatten. Museen, Ausstellungen, Theater, Clubs, fremde Städte, das ganze Programm. Anfangs behielt Esther noch ihre Wohnung in der Stadt, sodass wir nach der Arbeit frei zwischen einem Bad im Schlachtensee oder dem Gang in die Cocktailbar wählen konnten. Das Leben war schön und alles war möglich. Und doch, so glücklich wir waren, etwas fehlte. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich Kinder waren, aber wer konnte das wissen? Ich lehnte mich an die Sicherheit an, die meine Frau in dieser Frage ausstrahlte, und beschloss, es auf den Versuch ankommen zu lassen.
Von diesem Augenblick an besserte sich meine Stimmung. Während drei Wochen auf Sizilien hatte ich mich von Tag zu Tag niedergeschlagener gefühlt, bis ich kein Wort mehr herausbrachte. Da ich für die italienische Konversation zuständig war, brachte uns meine Maulfaulheit in Schwierigkeiten. Oft verfuhren wir uns oder standen vor verschlossenen Türen. Meine Frau war missgestimmt.
Auf dem Marktplatz in Taormina war es schließlich so weit. Ich weinte und sagte: »Lass es uns versuchen«, ohne dass wir vorher überhaupt über das Thema Kinder gesprochen hatten. Aber unsichtbar und unhörbar stand es die ganze Zeit zwischen uns. Mein Gefühlsausbruch änderte alles. Ich fasste Mut, war voller Vorfreude, erkannte plötzlich, wie schön alles um mich herum war, die Blüte der Macchia im Mai, das azurne Meer, die schroffen Berge, die abendliche Ausgelassenheit der Dorfbewohner, die sich in der Bar trafen.
Wir fuhren nach Deutschland zurück, aber die Zuversicht verließ mich nicht mehr. Zehn Jahre später reisten wir wieder nach Sizilien und ich knipste wie eine Besessene Fotos von meiner älteren Tochter, wie sie über den Marktplatz von Taormina rannte. Für sie war es einfach nur ein schöner Platz, aber ich war fasziniert und gerührt davon, sie gewissermaßen an dem Ort ihrer geistigen Zeugung zu erblicken.
Nun wusste ich, was ich wollte. Aber ich wusste nicht, wie ich es anfangen sollte. Wir wollten Kinder. Aber wie sollten wir das fertigbringen? Wir, zwei Frauen mittleren Alters, ohne Mann und ohne Hilfe?
Es sollte zwei Jahre dauern, bis unsere erste Tochter geboren wurde. Das klingt nach einer kurzen Zeit. Viele heterosexuelle Paare müssen genauso lang oder noch länger warten, bis sich ihr Kinderwunsch erfüllt. Aber anders als wir wissen sie wenigstens, was sie zu tun haben. Esther und ich wussten nichts. Auch ob uns jemals Erfolg beschieden sein würde, konnten wir nicht einschätzen. Allein ein Jahr verging, bis wir eine reale Chance bekamen. Das lange Herumirren auf der Suche nach der geeigneten Möglichkeit glich einer Odyssee, die von Ungeheuern und falschen Verführern in die Länge gezogen wurde.
Von dieser Odyssee will ich erzählen. Und von den Kindern selbst. Ihre Entstehung ist nicht weniger ungewöhnlich und spannend als das Leben mit ihnen. Was für alle Kinder gilt, trifft auf unsere beiden Regenbogenkinder erst recht zu. Wie fühlt es sich für sie an, unter lauter Mutter-Vater-Kind-Familien mit zwei Müttern aufzuwachsen? Sehen sie sich als etwas Besonderes? Was wird ihre Geschichte aus ihnen machen? Und wie wird ihre Geschichte die Gesellschaft um sie herum verändern?
EIN SEGEN VON AMTS WEGEN
Nach jener aufregenden Woche im Juni, in der sich die Ereignisse überschlugen und in der wir zusammenkamen, erlebten Esther und ich eine Zeit, wie sie wohl alle verliebten Paare kennen. Ein langer, rauschhafter Sommer, in dem wir eher über das Firmament flogen als auf dem Erdboden wandelten. Nächte ohne Schlaf, endlose Gespräche, Grenzerfahrungen frei von Angst, namenloses Glück. Wir verfügten über Ausdauer wie Marathonläufer und unerschöpfliche Kräfte, die nicht durch Essen, Trinken oder Schlafen wiederhergestellt zu werden brauchten. Esther arbeitete in einer Klinik und musste jeden Morgen früh raus. Ich blieb faul im Bett liegen, versuchte ihr aber das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Wir kochten, gingen tanzen, fuhren mit dem Fahrrad aufs Land. Bei einem dieser Ausflüge, wir waren ungefähr sechs Wochen zusammen, blickte ich auf den in der Augustsonne funkelnden Liepnitzsee und wusste auf einmal, dass ich Esther wirklich liebte. Ich sagte es ihr und für mich selbst war dieser Moment vielleicht noch erhabener als für sie.