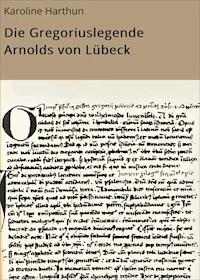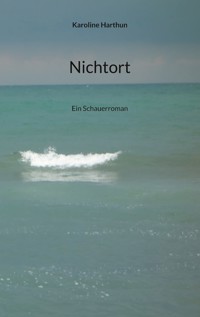
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die keine Frau sein will, aber auch kein Mann. Ein Mann, der will, dass alle Regeln eingehalten werden, vor allem die Regeln der Genetik. Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder selbst bestimmt, wer er oder sie oder xie sein will? Und was bleibt eigentlich vom Menschen, wenn er keinen Körper mehr braucht? Kann diese Frage im Himmel beantwortet werden? Oder gar hier auf Erden? Oder am Ende überhaupt nicht? Karoline Harthuns Roman ist ein Verwirrspiel der Identitäten, eine posthumane Farce über Menschen, deren letzte Gewissheiten den Bach runtergehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Sei mal kurz still, Tobi.“ „Was ist denn?“ „Hörst du das?“ „Was höre ich? Ich hör nichts.“ „Er singt. Gott singt.“ „Tatsächlich. Er singt.“
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
I. KIM
Kapitel a*
Kapitel b*
Kapitel c*
Kapitel d*
Kapitel e*
Kapitel f*
Kapitel g*
Kapitel h*
Kapitel i*
Kapitel j*
Kapitel k*
Kapitel l*
Kapitel m*
Kapitel n*
Kapitel o*
Kapitel p*
Kapitel q*
Kapitel r*
Kapitel s*
Kapitel t*
Kapitel u*
Kapitel v*
Kapitel w*
Kapitel x*
Kapitel y*
Kapitel z*
II. TOBIAS
ᚠ*
ᚢ*
ᚦ*
ᚨ*
ᚴ*
ᚱ*
ᚼ*
ᚾ*
ᛁ*
ᛅ*
ᛋ*
ᛏ*
ᛒ*
ᛘ*
ᛚ*
ᛦ*
III. RAFA
Α*
Δ*
Τ*
Ω*
IV. WALTHER
א *
PROLOG
Die Sonne schien. Wie immer. Rafa trat vor die Tür des Labors und blinzelte in das Licht. Selten genug bekam er es zu Gesicht. Welche Ironie: Ein Geschöpf des Himmels wie er, aus Luft und Liebe erzeugt, und er verbrachte fast seine ganze Zeit im Dunkeln, im Inneren dieses verstörenden Raumes, wo unbeschreibliche Dinge geschahen.
Weil der Alte es so wollte.
Der Alte.
Mikal und er waren ihm zu absolutem Gehorsam verpflichtet, wie übrigens jeder andere auch, aber die Menschen dort unten interessierte das ja nicht mehr. Sie würden den Alten nicht erkennen, selbst wenn er vor ihnen stünde und mit ihnen spräche. Oder ihnen ein Lied vorsänge.
Die Menschen waren von sich selbst besessen. Sie beschäftigten sich nurmehr mit der Frage, wer sie eigentlich waren, und nicht damit, was und wen es außer ihnen in der Welt sonst noch gab. Zum Beispiel ebenso zerbrechliche wie wandelbare Wesen wie ihn selbst, Rafa.
Menschen waren ausschließlich an Menschen interessiert. Und zwar jeder Einzelne von ihnen an sich selbst oder bestenfalls noch an einzelnen anderen, nicht etwa an der Menschheit als Ganzem. Dieser Gedankensprung war schon zu hoch für sie.
Auch wenn er sie gernhatte, verstand Rafa nicht, welche Faszination diese unerschöpfliche Selbstbespiegelung auf die Menschen ausübte. Sahen sie nicht immer das Gleiche? Natürlich, jede Blüte, jede Schneeflocke sind anders, aber bleiben es nicht immer Blüten, Schneeflocken? Warum hatte der Alte ihnen diese sinnlose Beschäftigung aufgegeben, statt sie mit anderen, nützlicheren und vor allem beglückenderen Fähigkeiten auszustatten. War das damals auch schon eines seiner perversen Experimente gewesen, das ihn dazu veranlasst hatte?
Er selbst durfte es sich gar nicht erlauben, ständig über sich selbst nachzudenken. Ein so leichtes Gebilde wie sein Körper – wenn man ihn denn so bezeichnen wollte – würde zerplatzen und seine Gedanken würden davonschweben, würden sich in alle Richtungen über die ganze Welt verteilen.
Wäre das so schlecht?
Immerhin bestand er zu 50 Prozent aus Liebe. Vielleicht konnte seine Liebe die Menschheit heilen, wenn sie sich nur engmaschig, feinporig und kleinteilig genug über diese ergoss, wenn sie in alle Ohren und Augen und Gehirne eindrang wie eine Droge, die für immer abhängig macht. Rafa konnte nicht anders, als sich von Zeit zu Zeit genau das zu wünschen: dass er sich opferte, um die Menschen zu retten. So war er gemacht. Dafür war er geschaffen.
Aber da war noch der Alte.
Der Alte wollte es nicht.
Der Alte wollte nicht, dass die Menschen gerettet würden. Nicht mehr. Er hatte es einmal versucht, und zwar auf ganz ähnliche Weise, wie Rafa sich das gerade eben vorgestellt hatte, aber er war gescheitert. Danach hatte er sich zurückgezogen. Meistens hockte er in seinem Hinterzimmer und trällerte vor sich hin, traurige, sinnlose Melodien. Und statt den Menschen die Hand zu reichen, dachte er sich lauter willkürliche Experimente für sie aus. Experimente, die er, Rafa, gemeinsam mit Mikal dann durchzuführen hatte.
Mikal. Früher waren sie zu dritt gewesen, aber Gabo hatte Mikals rechthaberische und misanthropische Art nicht ausgehalten. Rafa wusste gar nicht, wo er steckte. Vielleicht hatte er sich in eine Parallelwelt davongemacht, in der er selbst über andere bestimmen konnte. Gabo war immer sehr ehrgeizig gewesen. Als ihn der Alte immer seltener auf Mission schickte, hatte er begonnen, sich nutzlos zu fühlen. Und nachdem der Alte dann den Kontakt zu den Menschen vollständig abgebrochen hatte, brauchte er Gabo einfach nicht mehr als soziales Medium, als Übermittler seiner Nachrichten. So redete Gabo nicht mehr mit den Menschen, aber mit dem Reden aufhören konnte er auch nicht.
Sein ungebremster Erklärungsdrang war allen auf die Nerven gegangen, vor allem Mikal, der eindeutig von der schweigsamen Sorte war. Gabo redete ohne Punkt und Komma, weil er beim Sprechen über alles Mögliche nachdachte – über den Rückzug des Alten und die Gründe dafür und wie man jetzt weitermachen sollte. Mikal dagegen brauchte Ruhe, Sicherheit, Beständigkeit, um mit der Situation fertigzuwerden. Die fand er in der Arbeit.
Das konnte auf Dauer nicht gutgehen. Und Rafa, die gute Seele, zwischen den beiden zerrieben, und der Alte kam nicht einmal aus seinem Hinterzimmer hervor.
Gut, dass Gabo gegangen war. Aber einen Plan brauchten sie trotzdem, oder? Sollten Sie immer so weitermachen, den Launen des Alten freien Lauf lassen, während die Menschen tiefer und tiefer in ihrem höchstselbst angelegten Sumpf versanken, dem einzigen, den sie noch nicht ausgetrocknet hatten?
Rafa blinzelte in die Sonne. Das Licht zersplitterte in seinen grünen Augen. Waren sie grün? Er wusste es nicht mehr.
Die Welt war doch schön. Mit oder ohne Menschen.
Aber er spürte die Liebe in sich, das Verlangen zu helfen. Seine Bestimmung.
Er musste mit Mikal reden. Auf den Alten war ja nicht zu zählen. Aber Mikal, der gewissenhafte Mikal, würde ihn vielleicht anhören, vorausgesetzt, dass er ihn nicht zu sehr bedrängte.
Entschlossen riss er die Tür zum Labor auf und stieß unversehens mit Mikal zusammen, der die Tür im selben Moment von innen geöffnet hatte. Wenn das kein Zeichen war.
„Mikal!“
„Wo bleibst du denn so lange? Die Embryonen verdorren.“
„Ja, ich ..., tut mir leid, ich habe über etwas nachgedacht.“
Mikal schaute ihn mit seinen magnetischen dunklen Augen stumm an. Den dunklen Augen des Gesetzes.
„Ich möchte dir einen Vorschlag machen“, stieß Rafa aufgeregt hervor. „Erinnerst du dich noch an Hiob? Oder Faust? Oder diesen russischen Schriftsteller, den Dings, äh, Schostakowitsch?“
„Natürlich erinnere ich mich. Ich bin das Gedächtnis, wie du weißt. Unter anderem. Was willst du mir vorschlagen?“
„Lass uns einen neuen Pakt auflegen. Oder eine Wette, mir egal. Aber nicht genauso wie damals mit Hiob. Anders, moderner. Lass uns einen Menschen finden, der bereit ist, uns zuzuhören. Oder sogar zwei Menschen. Das wäre doch großartig: Wenn wir wenigstens einen oder zwei davon abbringen könnten, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen, und sie stattdessen uns zuhören und vielleicht sogar verstehen würden, was wir sagen. Wer weiß, mag sein, dann wacht auch der Alte wieder auf, wenn wir sie erst so weit gebracht haben. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich meine, was sonst sollte ihn aus seinem Hinterzimmer herauslocken? Was sonst, als wenn die Menschen endlich einmal zu ihm kämen statt er zu ihnen? Das hatten wir schon. Bringt nix.“
Mikal hatte sich den Rafas Redefluss aufmerksam angehört. Nun schüttelte er sacht den Kopf.
„Das klingt alles sehr schön, Rafa. Ich sehe nur ein Problem: Wie willst du die Menschen dazu bringen, uns zuzuhören? Willst du sie zwingen?“
Rafa schaute zu Boden, dann in die Ferne. Das Licht der Sonne schien schwächer zu werden. Als ob es Abend würde. Doch hier oben ging die Sonne niemals unter. Es musste eine Täuschung sein.
„Ich weiß es nicht. Wenn ich sie zwinge, nützt es wohl nichts, oder? Oder vielleicht doch? Was meinst du denn, wie man sie dazu bringen könnte?“
Mikal legte ihm, ganz gegen seine Art, die Hand auf die Schulter. Mit der anderen beschattete er seine furchtbaren Augen.
„Mit fällt nur ein einziges Mittel ein, mit dem wir die Menschen dazu bringen, dass sie uns zuhören.“
„Ja, welches?“
„Schmerz.“
I. KIM
a*
Kim Irbachs Identität ist ertrunken. Abgesoffen in zu großer Tiefe. Vielleicht litt sie an zu viel Gedankenschwere und die Last hat sie hinabgezogen. Abgrund ruft nach Abgrund, mahnt der Psalter, der alles schon immer gewusst hat. Vielleicht genügte für ihren Untergang aber auch der metallene Ballast an ihrem Hals. Vielleicht ist sie an diesem merkwürdigen Objekt erstickt, dessen phallische Zuspitzung ihren Kehlkopf, der kein Adamsapfel sein durfte, durchbohrte und ihren ohnehin nur mühsam plätschernden Sprachfluss versiegen ließ. Ohne Sprache kein Ich. So bleibt nur ihr namenloser Körper übrig, der jetzt eine Weile von den Wellen hin und her geworfen wird. Ihr Hinterkopf taucht ab und zu auf. Das Gesicht ist nicht zu sehen, so beschwert ist es von einer grausigen Maske aus Stahl. Wie ein missgestalteter Superheld mit Rüssel sieht sie damit aus, wie Elephant Man. Nur die Körpermaße passen nicht dazu. Wie überhaupt so manches nicht stimmt an diesem Körper, der viel zu schwach ist für das, was er tragen muss.
Da kommen zwei Fischer aus São Bartolomeu vorbei. Sie sind in der Nacht mit ihrem Kutter ausgefahren und kehren nun am Vormittag zurück. Etwas Besseres als ein Netz voll Sardinen haben sie nicht gefangen. Im Wasser trieb ein zernagter Thunfisch, aber den können sie nicht verkaufen, höchstens selber essen. Trotz ihrer mageren Beute folgen ihnen die Möwen und übertönen mit ihrem Gekreisch sogar den zermürbenden Krach des Windes und der Wellen. Die Fischer hören den Krach nicht. Sie sind ganz ruhig und gelassen. In ihren Ohren klingen das Tosen und die schrillen Schreie nicht wie das Läuten der Totenglocke, sondern wie etwas, das ihr Leben grundiert, so wie ihr eigener Atem oder die Geräusche ihres Darms, wenn sie am Abend zu viel Knoblauch gegessen haben.
Die Geräuschkulisse ist wie immer, die Wasseroberfläche nicht. Da schwimmt etwas im Wasser, das nicht hierher gehört. Ein lang gezogener, schmaler Schatten, der auftaucht und verschwindet. Noch ein Thunfisch, diesmal vielleicht unverletzt? Manchmal verirren sich die eindrucksvollen Fische zu nah ans Ufer und werden leichte Beute. Das wäre ihr Glückstag, wenn die beiden Fischer ihn herausziehen könnten. 300 kg rotes Fleisch, das feinste im ganzen Atlantik, wenn man einmal von Haien und Walen absieht.
Die Fischer drehen bei und steuern auf den Schatten zu. Als sie näherkommen, legt sich eine Klammer um diesen Tag, der so normal gewesen ist. Jemand stellt das Programm um. Plötzlich hören sie das wütende Klatschen der Wellen. Genüsslich und herausfordernd klingen die Schläge, wie wenn ein Padrón auf einen Sklavenrücken eindrischt und die Haut zum Platzen bringt. Nicht dass sie selbst so etwas schon einmal gesehen hätten. Aber ihre Väter haben ihren Militärdienst in Mosambik geleistet, wo noch in den 1970er Jahren mit ähnlichen Methoden Zwangsarbeiter zusammengetrieben wurden. Diese Erfahrung gaben sie an ihre Söhne weiter. Wie die Fruchtfliege unreife Oliven mit ihren todbringenden Eiern impft, tragen die Männer diesen unguten Keim in sich. Gerät irgendetwas aus den Fugen, wird zum Beispiel der Ozean plötzlich zu laut, dann juckt der Keim in ihnen und will wachsen. Die Männer hassen diesen ererbten Reiz, aber sie können sich nicht Ohren und Augen verstopfen. Sie sind schon zu nah an der Unglücksstelle. Und sie sind zu zweit. Einer allein wäre vielleicht umgekehrt, aber zweien droht der Gesichtsverlust.
„Das ist ein Mensch“, konstatiert der eine Fischer. „Das sehe ich“, entgegnet der andere.
„Glaubst du, es ist ein Afrikaner?“
„Wie soll der denn hierherkommen? Viel zu weit westlich. Die bleiben an Gibraltar hängen.“
„Vielleicht ist er ja schon lange tot.“
Der eine wirft dem anderen einen beunruhigten Blick zu.
„Wir müssen ihn rausholen.“
„Ja. Müssen wir wohl.“
Wellen und Wind sind verstummt. Die Fischer gehen wieder ihrer gewohnten Arbeit nach. Sie werfen ihr kleineres Netz aus und ziehen den Körper an Bord. Da liegt er neben den toten Sardinen und füllt kaum den Schiffsboden. Ein kümmerlicher Fang. Der eine Fischer löst das Netz, dreht den Körper um und glotzt. Der Keim juckt in ihm und er möchte am liebsten mit Gummistiefeln auf dem flachen Leichnam herumtrampeln, ihn so breittreten, dass nur noch eine leere Hülle übrigbleibt. Tut er aber nicht. Stattdessen kratzt er sich am Bauch und sagt: „Ist das ein Mann oder eine Frau?“
„Jedenfalls kein Afrikaner. Was hat er denn da am Hals?“
„Eine Figur? Ein… Keine Ahnung.“
„Scheiße, das ist eine Bombe. Sieht genauso aus wie eine Bombe. Ein Scheißterrorist! Wirf ihn schnell wieder über Bord.“
„Warte, der sieht nicht aus wie ein Terrorist. Hast du schon mal einen blonden Terroristen ohne Bart gesehen?“
„Aber das ist eine Bombe.“
„Das ist keine Bombe. Das ist … Ich ruf die Küstenwache an.“
Der Weltläufigere der beiden, der eine Tante in Lissabon hat, die er manchmal besucht, zückt sein Telefon und alarmiert die Küstenwache. Dann sehen sie zu, dass sie rasch an Land kommen und sich von dem unbekannten Gegenstand entfernen. Mit ein paar Zigaretten gehen sie gegen den Mittagshunger an und warten stoisch auf Hilfe. Sie haben ihre Pflicht getan. Das Meer hat sich in seine Bahnen zurückgezogen und sie müssen ihm keine Beachtung mehr schenken. Der Juckreiz ist verflogen. Der Keim gibt wieder Ruhe.
b*
Kims Leichnam wird überführt. Ihr Bruder muss ihn in Portugal abholen. Es dauert zwei Wochen, bis der Körper freigegeben wird. Die Polizei hat eine Obduktion angeordnet, da es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Martin hätte dies zu verhindern versucht, aber es ist schon passiert, als er am nächsten Abend in Lissabon eintrifft. Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit seiner Schwester bedrückt ihn. Er hätte ihr einen sanfteren Übergang in eine andere Daseinsform gewünscht.
Die Untersuchung ergibt Folgendes: Tod durch Ertrinken, begünstigt durch einen massiven Gegenstand am Hals, der sowohl das Atmen als auch das Schwimmen erschwert hat. Abgesehen davon ist keine Gewalteinwirkung erkennbar. Unverwester Zustand. Die Tote war in guter körperlicher Verfassung, Ernährungszustand normal, keine Deformationen, kein Hinweis auf schwerwiegende Erkrankungen. Auch kein Anhalt für eine hormonelle oder invasive Geschlechtsanpassung oder eine angeborene Chromosomenverschiebung. Die Tote ist weiblich.
Die deutschen Medien platzen fast vor Neugier und Schadenfreude. Zwitter-Professor beim Sexspiel ertrunken! Die Beschaffenheit des Gegenstands, den die Leiche um den Hals trug, ist von der Polizei mit Rücksicht auf die Angehörigen nicht bekanntgegeben worden, aber so etwas lässt sich nicht geheim halten. Kims Freunde sind ebenso erschüttert wie ihr Bruder. Ihre Mutter spricht drei Monate lang mit niemandem mehr. Sie schämt sich und hat Angst, angestarrt zu werden, sodass sie nur noch im Dunkeln aus dem Haus geht. Tagsüber sitzt sie in ihrer Küche und lässt das Telefon klingeln. Wenn es aufhört, ist es mehrere Minuten vollkommen still um sie herum, bis der Kühlschrank wieder anspringt. Selbst die Küchenuhr ist stehen geblieben. Alles ist stehen geblieben. Nur Kim nicht, die ist weiter gegangen als jeder andere.
Keiner ihrer Bekannten glaubt an die Theorie vom ausgefallenen Sexspiel, alle wissen, dass Kim einen symbolischen Akt vollzogen hat. Mit letzter Konsequenz.
Judith Butler schreibt einen Aufsatz über diese Konsequenz. Sie nennt ihn „On the heroism of acting per formam“. Kims Tat wird international rezipiert. Das in Gründung befindliche Forschungszentrum einer schwedischen Universität wird in Kim Irbach Centre for Gender Identity Studies umbenannt. Eine zuvor immer wieder auf Eis gelegte Stiftungsprofessur an Kims Heimatuniversität kann dank eines privaten Mäzens endlich finanziert werden.
Die Sprachregelung dagegen, die Kim im akademischen Senat für alle Veröffentlichungen der Universität durchgesetzt hat, wird zurückgenommen. Der Sprecher des Präsidenten erklärt dies mit den erhöhten Druckkosten und dem gestiegenen Verwaltungsaufwand. Er stellt in Aussicht, dass man möglicherweise in Zukunft zu der Regelung zurückkehren könne, wenn andere vordringliche Reformaufgaben bewältigt worden seien.
Kim wird in Berlin-Schöneberg beerdigt, auf einem Friedhof, der von besonders schillernden Toten bevölkert wird, obwohl diese in ihrem aktuellen Lebensabschnitt nicht mehr viel Glanz abstrahlen. Hätte man Kim vorher gefragt, wäre sie gern auf dem Selbstmörderfriedhof im Grunewald zur Ruhe gekommen, neben ihrem Jugendidol Nico, doch ist diese Begräbnisstätte mittlerweile stillgelegt. Die Trauerfeier ist gut besucht; es gibt keine christliche Zeremonie, dafür eine Art Aussegnung nach dem Wicca-Kult, die von Kims Freundin und Vermieterin Malina vollzogen wird. Die Beistehenden erfassen die Worte in einer der zahlreichen Maya-Sprachen nicht und auch Malina hat sie nur auswendig gelernt. Danach hält der Präsident der Universität eine Rede. Er hebt die Radikalität von Kims Forschung hervor und ihr liebenswürdiges Wesen. Seine stark beklatschten Schlusssätze kursieren eine Zeit lang in den sozialen Netzwerken: „No more hate, no more fate! Je suis Kim.“
Am Tag nach der Beerdigung liegen menschliche Exkremente auf Kims Grab. Der Grabstein ist noch nicht aufgestellt worden und wird daher von bleibenden Spuren der Schändung verschont. Vorläufig. Alle paar Wochen kehrt Ludmilla auf den Friedhof zurück und putzt mit säurefreiem Steinreiniger die Inschriften weg, die ungebetene Gäste hinterlassen haben.
Ludmilla ist die Einzige, die nicht vergisst. Für alle anderen gerinnt die Erinnerung an Kim zur Ikone. Sie ist nützlich, weil ihr Name ein Etikett zur Verfügung stellt, über das man streiten kann. 60 Jahre nach dem Tod von Alan Turing bekommt auch die deutsche Bewegung eine Märtyrin geschenkt, die am Zwang der akademischen Gesellschaft zugrunde ging.
Als ob es das bräuchte. Als ob nicht täglich im Iran oder in Tschetschenien Menschen wegen ihrer sexuellen Identität gequält und getötet würden.
Ludmilla hat Kims Platz am Schreibtisch eingenommen. Sie blickt durch das Fenster auf die Straße, wo der Bus vorbeifährt, und stellt ihre innere Uhr auf dessen Takt ein. Wenn Malina, nach rohem Fleisch brüllend, das Büro verlässt, folgt sie ihr wie ein Schatten. Sie hat sich von der Berichterstatterin zum Opfer gewandelt.
Eines Nachts hat sie einen Traum, in dem sie von lauter berühmten Frauen, die sie zu kennen glaubt, die sich ihr aber nicht vorstellen, beschimpft wird. Als sie aufwacht, lüftet sich kurz der Nebel, durch den sie seit Wochen watet. Nun kennt sie Kims Ängste. Wie so oft, wenn man plötzlich aus einem Traum gerissen wird, wirkt er nach und verwirrt Ludmillas Gefühl für sich selbst. Doch als ihr einfällt, dass sie nicht Kim ist, weint sie lange. Weil sie keinen Schimmer hat, wie es sich anfühlt, Kim zu sein. Weil nicht einmal Kim selbst wusste, wie es sich anfühlt, Kim zu sein.
Den Schleier des Nichtwissens durchstoßen. Bin ich, was die anderen mir zuschreiben? Ich sehe meine Freunde wie durch einen Vorhang. Sie sind nicht unterscheidbar, nicht anders als die Nazis überall. Freund oder Feind, was für ein Unterschied, wenn du nicht einmal ihre Gesichter erkennen kannst? Ich bin eine Raumstation.
An diesem Morgen geht Ludmilla nicht ins Büro und auch an den folgenden nicht. Malina wird sich neue Mieterinnen für ihren Co-Working-Space suchen müssen. Jemand fehlt und wird ersetzt.
c*
Vor ihrem spektakulären Tod war Kim Irbach Professorin für Gender Studies an einer Berliner Hochschule. Als solche wurde sie berufen; es steht schwarz auf weiß auf ihrer Verbeamtungsurkunde, wenn auch unter anderem Namen. Neuerdings – noch ist sie am Leben – ist sie nicht mehr Professorin, sondern Professorin. Oder, im Alltag, kurz: Prof (ohne Punkt). Sie hat ihr Geschlecht eliminiert, so wie man eines Tages beschließt, keine weißen Socken mehr zu tragen, weil sie immer so schnell schmutzig werden. Auch ihr Geschlecht ist zu schnell schmutzig geworden, findet Kim. Zu oft wurde es angeschaut und begutachtet. In den Berufungskommissionen haben die Kollegen ihre Blicke daran abgewischt und Spuren hinterlassen, die einfach nicht mehr abgehen wollen. Ihr Geschlecht hat dabei Flecken und weiche Stellen bekommen wie ein Pfirsich im Supermarkt, den die Leute befummeln und zurücklegen, weil er noch nicht reif ist. Vielleicht ist genau das das Problem, dass sie nicht rechtzeitig reif geworden ist. Schon bevor sie herausfinden konnte, wer sie war, wussten andere Bescheid. Ihre Mutter hatte sich immer ein Mädchen gewünscht. Ein Mädchen reichte; ein Mädchen war gerade mehr als sie allein und doch weniger als eine Familie. Kim war ein Leichtgewicht.
Wenige Jahre später wurde noch ein Bruder geboren, der das Gleich-Leicht-Gewicht empfindlich störte. Fortan musste Kim ihre Mutter vor dem schwerwiegenden Verlangen des Bruders in Schutz nehmen. Sie selbst hätte sich mit weniger zufriedengegeben, wenn der Junge sie nicht so gedauert hätte. So kümmerte sie sich um ihn und allmählich dämmerte ihr, dass es von Vorteil sein konnte, nicht ganz allein auf dieser Welt zu wandeln, sondern sich und andere zugleich zu wandeln.
Bis zu ihrer eigentlichen Verwandlung dauerte es freilich noch eine ganze Generation. Erst mit 37 Jahren legte sie ihren ungeliebten Vornamen ab, erfand einen neuen und forderte die Öffentlichkeit heraus, sie künftig weder als Frau noch als Mann zu betrachten.
Diese neue Identität, die sie annahm, ließ sich jedoch erwartungsgemäß nicht von der zwingenden Eigenheit des Geschlechts rein halten. Mehr als zuvor musterten sie die Leute mit neugierigen und aufsässigen Blicken, um sich Klarheit zu verschaffen, was sie denn nun eigentlich sei, gewesen sei oder sein werde. Immer hartnäckiger haftete der fremde Schmutz an ihr und obwohl sie nicht so blauäugig gewesen war, dies nicht vorauszusehen, stöhnte sie unter dem Kreuz, das sie sich aufgeladen hatte, unter dem sie immer wieder strauchelte und in den allgemeinen Dreck fiel. Nicht selten sehnte sie sich zurück nach der Zeit, als sie die große Schwester gewesen war und nichts sonst. Wie ein Fleisch gewordenes Fragezeichen schlich sie durch die Uni und sie konnte noch so viele heimliche Reinigungsrituale vollziehen, etwas irritierte sie doch immer, wenn sie mit sich allein war. Was jeden Menschen irgendwann durchfährt, dieser furchtbare Schreck, sich selbst plötzlich für einen kurzen Augenblick nicht mehr wiederzuerkennen, im Spiegel, auf Fotos, in den Blicken der anderen, das erlebte sie Tag für Tag.
Irgendwann begann sie sich daran zu gewöhnen und Trost in der Philosophie zu suchen. Identität ist ein Trugbild, natürlich. Warum sich darüber aufregen? Sie war mutig genug, die Ungewissheit auszuhalten. Irgendjemand musste es doch einmal wagen. Die Zeit war reif, sie selbst war es immer noch nicht ganz. Aber fast.
Ihr Bruder behandelte sie, als wäre nichts geschehen. Ihre Mutter machte sich Sorgen. Ihre Freunde – ja, sie hatte Freunde – bewunderten sie. Manche hatten Mitleid mit ihr. Und viele, sehr viele hassten sie.
Den Hass hatte sie nicht ganz so deutlich kommen sehen. Sicher, der Backlash war eine Tatsache, alle Jahre wieder. Das Kennzeichen des Wandels ist, dass er unbeständig ist. Auch damit tröstete sie sich, dass ihre Entscheidung ja nicht unumkehrbar war. Eines Tages würde sie vielleicht wieder eine Frau sein. Oder ein Mann. Oder etwas Drittes. Die Zahl Drei war eine Verheißung, ein geheimer Abzweig auf dem abendländischen Karrenweg vom Dualismus zum Monismus und zurück. Auf dem Schleichweg der Dreiheit konnte sie sich ins Gebüsch schlagen, querfeldein marodieren, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und nicht nur sie konnte es tun, wenn sie wollte, alle Menschen. Sie müssten nur wollen.
Andere Kulturen kennen das dritte Geschlecht: Indien, Mexiko, Polynesien, Thailand. Die nordamerikanischen Ureinwohner nannten es Two-Spirit, Zweigeist. Ein poetischer Ausdruck, über den man schier aus dem Häuschen geraten könnte vor Glück. Endlich ein Name und was für einer! Aber er bringt die gesamte Misere der Zweigeschlechtlichkeit auf den Punkt: Eins plus eins ist zwei. Nicht drei. Nicht frei.
Selbst die nicht gerade für ihre Zivilisiertheit geschätzten Germanen hatten sich gegenüber dem Zahlenspiel aufgeschlossen gezeigt. Gott Tuisto, in dessen Namen sich ebenfalls die Zwei versteckt hält, erstand ungeschlechtlich aus der Erde. Kraft seiner Doppelgeschlechtlichkeit gebar er aus sich selbst Mannus, der als Erster Menschennatur besaß und drei Söhne zeugte. Ebenfalls durch Autogamie, oder aber der Name seiner Gattin wurde wie so oft nicht überliefert, da unbedeutend. Drei Söhne! Zufall? Wohl kaum.
Kim Irbachs Problem sind demnach nicht die flatterhaften Vor-Bilder, die sie überall in der menschlichen Kultur aufschnappt. Kims Problem ist die routinierte Faulheit der Sprache. Sprachgewohnheiten sind wie ansteckende Krankheiten: Einmal aufgeschnappt, schwupps, und schon wird man sie nicht mehr los. Aber nur, wenn die kritische Masse erreicht, wenn die Ansteckungsgefahr groß genug ist. Umgekehrt gilt nämlich auch: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die meisten Leute wechseln ihre Kleider täglich, ihre Adjektive nie.
Sprache ist dumm. Sie kann nicht einmal bis drei zählen. Bei ihr heißt es: eins, zwei, viele. Und leicht muss man es ihr machen, so simpel wir möglich. Sonst kriegt sie Migräne. Kims Kollege Niklas Robenau, Professor für Klassische Philologie an derselben Hochschule, ist ganz ihrer Meinung. Er beklagt schon den Niedergang von der Antike zum Mittelalter, sogar von Griechisch zu Latein. Diese neurasthenische Schlaffheit, die alle Sprachen irgendwann überkommt: Kasusflexion, Zeitenfolge? Nein danke, viel zu kompliziert. Lieber ein bisschen drum herumreden und zur Not die Lücken füllen: hier ein Pronomen, da eine Präposition. Vielleicht noch ein Hilfsverb? Oder auch zwei? Ach ja, warum nicht. Es darf auch ein bisschen mehr sein. Und ein paar Jahrhunderte später wird es noch schlimmer, da heißt es dann: Unregelmäßige Verben? Nicht heute, Schatz, ich habe solche Kopfschmerzen.
Sprachhygiene ist nicht Kims Aufgabe, sagt sie. Ihretwegen kann die Sprache ruhig ein bisschen stinken. Kims Ziel ist, die Sprache klug machen. Sie will sie dazu bringen, über sich selbst nachzudenken. Das ist nicht gerade die Stärke der Sprache. Lieber sagt die Sprache sich selbst vor, wenn sie geprüft wird. Liest den alten Quark von ihrem Spickzettel ab, der dadurch nicht richtig wird, sondern bekanntlich nur breit. Die Sprache will nicht hören. Schon gar nicht auf Kim. Dabei hat sich Kim so ein schönes Lernprogramm für sie ausgedacht. Sie soll endlich begreifen, dass es mehr gibt, als die Sprache denkt. Und das soll sie ausdrücken, indem sie weniger sagt, als sie denkt. Statt „eins, zwei“ soll sie jetzt _ oder * sagen. Oder etwas anderes, das man nicht sagen kann.
Doch das ist zu kompliziert für die Sprache, weil nahezu paradox. Wie soll die Vielheit durch Vereinheitlichung dargestellt werden? Das kapiert die Sprache nicht. Das will ihr nicht in den Kopf. Und sie steht nicht allein da. Die Menschen, die sie am Leben erhalten, verstehen es auch nicht.
Unterstrich, Sternchen! Noch mehr grafische Zeichen, mit denen die Sprache nicht umzugehen weiß. Als müsste sie sich nicht schon mit Rauten, Klammeraffen, falschen Schrägstrichen und den guten alten Kommata herumschlagen, die ohnehin kein Mensch richtig setzen kann. Das Semikolon ist ausgestorben und der Unterstrich soll durch künstliche Befruchtung zum Leben erweckt werden. Ein Zwitter aus dem Reagenzglas. Halt, Zwitter darf man nicht sagen. Da steckt wieder die vermaledeite Zwei drin.
Also, noch einmal: Der Unterstrich steht nicht für die Zweiheit, sondern für das Unbenennbare. Geschickter als dieser erfüllt der Asterisk diese Aufgabe. Der Unterstrich wirkt zu verbindlich, er verbindet A mit B – wie ein Scharnier – und tappt so wieder in die Dualismusfalle. Dagegen verweigert sich der Asterisk jeglicher Brückenfunktion. Er zwingt zum Innehalten, er schickt einen in die verordnete Denkpause. Noch dazu erfreut seine Symbolik das Auge. Hier werden die Sterne vom Himmel geholt und in den Text verpflanzt. Per astra ad aspera.
Versucht man das Sternchen jedoch auszusprechen, kommt ein unschöner Schluckauf dabei heraus, der fachsprachlich Glottalverschluss genannt wird. Praktisch bedeutet er einen Angriff auf die Geschmeidigkeit des Sprechens. Schon bevor sich die Zunge einem Wort mit Sternchen nähert, ja in dem Moment, in dem es am geistigen Horizont auftaucht, bereitet man sich bereits innerlich darauf vor: „Dieses Wort wird mir nicht so glatt über die Lippen gehen wie die übrigen“, denkt der Sprecher. „Obacht! Ohne es zu wollen, taumele ich schon vor dem Wort in eine Sprechpause. Ich konzentriere mich, setze an, bringe den ersten Teil des Wortes glücklich hinter mich, zwinge mich zur erneuten Pause, schiebe das Suffix hinterher wie den trockenen Rand der Pizza, den ich nicht auf dem Teller liegen lassen will, weil er sonst weggeworfen wird.“
In der Praxis klingt das dann so: „In dieser Frage – erstes Zögern und Erinnern an den zu spät gelernten Sprachgebrauch – sind sich die – zweites Zögern, gleich ist es so weit, jetzt nur keinen Fehler machen – Wissenschaftler – jetzt die Pause, aber nicht zu lang, keinesfalls darf sie so deutlich wie die Pause zwischen zwei Wörtern sein – *innen – uff, geschafft – weitgehend uneinig.“
Kleist hat den Bindestrich in der Marquise von O. einst eleganter eingesetzt.
Interessant ist auch, wie andere Sprachen mit dem Glottalverschluss zurechtkommen, die damit viel zurückhaltender umgehen als das Deutsche, ihn vielleicht gar nicht so gut beherrschen. Gut, ein deutscher Muttersprachler redet dann einfach noch ein bisschen abgehackter als ohnehin schon; den Unterschied hören die anderen wahrscheinlich nicht einmal heraus. Aber wie sollen eine Französin oder ein Vietnamese das hinkriegen? Und wenn sie es nicht hinkriegen, was nützt einem in Zeiten der Globalisierung ein sprachkosmetischer Trick, der nur im Deutschen funktioniert?
Anhänger dieses Verfahrens behaupten, man würde sich daran gewöhnen und irgendwann gar nicht mehr merken, wie sich der Kehlkopf verschließt. Aber wie kann man überhaupt als Erwachsener einen physiologischen Vorgang internalisieren, der sich unserem Bewusstsein entzieht wie das Atmen oder der Herzschlag? Klar, ich kann mich auf meinen Atem konzentrieren, aber dadurch verändert er sich auch. Die Heisenbergsche Unschärferelation gilt auch für die Sprache. Was ja an sich nicht schlimm ist, nur dem Fortschrittsoptimismus etwas im Weg steht.
Statt Versprechen gibt es nur noch Versprecher.
Kim hat ein eleganteres Bild als dies vor Augen. Kim wünscht sich, dass Geschlechter in der Sprache überhaupt nicht mehr vorkommen. Aber warum will Kim Geschlecht eigentlich nicht mehr benennen? Immerhin handelt es sich dabei nicht um den Namen Gottes. Der kommt uns mittlerweile recht leicht über die Lippen, umso leichter, je weniger wir tatsächlich an Gott denken. An das menschliche Geschlecht indes denken wir ständig und eben darum scheint es uns nicht mehr so leicht über die Lippen zu gehen. Stattdessen prickelt es auf der Zunge wie Brausepulver und wird immer zäher und klebriger, bis man Schaum vor dem Mund hat und würgen muss. So geht es zumindest Kim, aber sie ist bestimmt kein Einzelfall.
Kim wird auch oft schlecht, wenn sie sieht, wie manche Leute ihr Geschlecht auskotzen, am Badestrand zum Beispiel, wo verwirrte Halbwüchsige sich messen und ihre Passform aneinander ausprobieren, sogenannte Jungen und Mädchen. So deutlich will sie es gar nicht vor sich sehen, wie zweidimensional die Menschen sich selbst erleben. Wenn sie trotzdem gelegentlich im Strandbad Wannsee liegt, stellt sie sich vor, wie sie all die Körper ringsherum auseinanderbaut und die einzelnen Teile vertauscht. Wie gern würde sie die Gesichter sehen, wenn Malte plötzlich Lindas große Brüste hätte und Linda dafür Maltes kleinen Kopf.
Vorerst kann Kim nur Wörter sezieren, keine Körper. Den Unterstrich und den Asterisk hat sie verworfen, ebenso das Binnen-I und den Schrägstrich. Neue Besen kehren besser, sagt sie sich, und außerdem will sie weg von all dem Entweder/Oder. Eine einzige Form muss genügen. Abwege und Zwischenformen sollen vermieden werden. Die These von der kontinuierlichen Bisexualität der Menschen ist Kim suspekt, setzt sie doch voraus, dass man dem Magnetfeld zwischen heterosexuellem Nordpol und homosexuellem Südpol niemals entrinnen kann.
Kim hält es mit Angela Merkel: Die geschlechtliche Umgestaltung der Menschheit ist alternativlos und darum braucht man darüber nicht zu reden. Nicht reden heißt: Wir verbannen alles Geschlechtliche, alles Unterscheidende und Scheidende aus unserer Sprache. Schluss, Punkt. Gestrichen. Ein für alle Mal.
Namen Ändern ist leicht. Aber was ist mit all den unbehaglichen, schummerigen Nischen in der Sprache, in die das Geschlecht ständig hineinkriecht? Angefangen mit dem Artikel: Da haben es die Deutschen wieder einmal besonders schwer. Allerdings sind sie nicht die Einzigen, die dieses Problem haben.
Immerhin lassen sich im Deutschen die meisten Probleme damit beheben, dass du konsequent auf die dritte Person verzichtest. Sprich einfach alle Menschen direkt an und du musst nie mehr gendern! Überhaupt ist das Übereinandersprechen, diese Domäne der dritten Person, unmenschlich, weil es der Diskriminierung (Unterscheidung) Tür und Tor öffnet. Sprecht nicht übereinander, sprecht miteinander! Nur – wie sollen das Spanier, Italiener etc. hinkriegen, die jedes verdammte Adjektiv gendern müssen. Die können eigentlich gleich mit dem Sprechen aufhören.
Gegenüber den Römisch sprechenden Völkern haben die Deutschen einen weiteren Vorteil: Immerhin kennen sie ein drittes Geschlecht, das Neutrum. Was ist naheliegender, als dieses Neutrum zu besetzen, es für Kims Zwecke zu vereinnahmen? Leider scheidet diese Möglichkeit aus. Jemand ist ihr zuvorgekommen. Die Genderhasser, die Rechten, die Ewiggestrigen haben das Neutrum bereits usurpiert. Wann immer sie ihren Unrat über Kim auskippen, nennen sie sie „das Mensch“. Zweifellos wollen sie sie damit herabwürdigen, obwohl es Kim nicht einmal besonders stören würde, als Neutrum bezeichnet zu werden, wenn es denn harmlos gemeint wäre. Aber leider ist es ein erprobtes Mittel des Terrors, Menschen zu versachlichen und wie Dinge zu behandeln. So geht es also nicht. Kim muss sich etwas anderes überlegen.
In Schweden wurde per Gesetz ein neues Personalpronomen eingeführt, das weder sie noch er noch es bedeutet. Dort geht so etwas, weil der Staat Autorität hat. Schließlich kann man in Schweden auch nicht einfach so zum Arzt gehen oder sich eine Wohnung suchen. In Deutschland interessiert sich der Staat einen Dreck für die kollektive Freiheit. Zwar kursieren zahlreiche Vorschläge für neue Personalpronomina im Internet, aber sie durchzusetzen scheitert schon daran, dass es so viele sind (xie und en und iks und ey und sier und le und x und …), noch dazu eines unbeholfener als das andere. Mit derlei Kinderkram gibt sich Kim nicht zufrieden.
Wenn das grammatische Geschlecht genauso in Verruf gerät wie das biologische, an welchen Strohhalm soll man sich klammern? Welche Hilfskonstruktion zu zweifelhaften Ehren kommen lassen?
Alternativlos. Darin liegt der Schlüssel. Keine Alternativen mehr. Einer für alle, alle für einen. Alles, was an Sprache geschlechtlich ist, muss abgestreift werden. Es darf jedoch nicht verschwinden. Verschwinden hieße Faschismus, hieße Terror. Da Kim kein Sprachfaschist und kein Wortterrorist sein will, muss das Abstreifen und Streichen sichtbar bleiben. Das geht so: Kim Irbach ist Professorin für Gender Studies an einer Berliner Hochschule. Kim Irbach kennt keine Pronomen und keine Artikel mehr, Kim Irbach kennt nur noch Wörter.
Das fällt gar nicht so auf, meinen Sie? Es gibt auch andere Sätze: Die Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knien hielt.
Oder: Das Wort „Mensch“ ist eine Substantivierung von althochdeutsch „mennisc“, mittelhochdeutsch „mennisch“ für „mannhaft“ und wird zurückgeführt auf einen indogermanischen Wortstamm, in dem die Bedeutung „Mann“ und „Mensch“ in eins fiel – heute noch erhalten in „man“. Das Neutrum („das Mensch“) hatte bis ins 17. Jahrhundert keinen abfälligen Beiklang und bezeichnete bis dahin insbesondere Frauen von niederem gesellschaftlichen Rang.
Schon deutlicher? Gut.
Kim bekommt einen Tennisarm vom ständigen Betätigen der Durchstreichen-Taste und muss zur Physiotherapie gehen. Aber sie gibt nicht auf. Ihren ersten komplett entgenderten Text postet sie in einem Portal, wo sie unter falschem Namen angemeldet ist. Die Reaktion ist überwältigend. Über Nacht ist sie nahezu berühmt. Sie geht immer sehr spät ins Bett und um halb vier in der Frühe hat sie bereits 1.023 Likes und 61 Hasskommentare geerntet. Das mag auch am Inhalt ihres Textes liegen, der nicht ganz frei von pornografischen Abschweifungen ist. Kim schreibt Fan-Fiction, sie entwickelt Szenarien, die ihre Lieblingsbücher erweitern. In dem Fall ging es um die Entjungferung Hermine Grangers durch den vitalen Viktor Krum. So etwas liebt Kim und ihre Abonnenten lieben es auch. Fiktives Geschlechtsleben in korrekter Form, ein Schmankerl für jede offenherzige Person, gleich welcher Herkunft und Richtung.
Der Anfang ist gemacht. Nacht für Nacht überträgt Kim all ihre Schriften in die neue Sprache. Sie spielt mit dem Gedanken, sie auf YouTube vorzulesen, aber das Problem der mündlichen Streichung hat sie noch nicht in den Griff gekriegt. Vielleicht kann sie wenigstens beim Publikationsausschuss der Universität eine Druckkostenhilfe beantragen, um ihr schmales Werk noch einmal in redigierter Form zu veröffentlichen. Wichtig ist vor allem, dass sie schnell ist, schneller als andere, die auch in den Startlöchern sitzen. Da sie das Heft nun einmal in der Hand hält, will sie es nicht so schnell wieder hergeben. Ein komplett neuer Text muss her. Kim muss aus den anonymen Niederungen des Internets auftauchen und den Sprung in eine Welt wagen, in der die Menschen sie von Angesicht zu Angesicht kennen.
Nach einigen Wochen ist es geschafft. Ein Handbuch, eine theoretische Handreichung, wie man den kleinen Hinterlassenschaften des Geschlechts in der Sprache auf die Spur kommt, gespickt mit nützlichen praktischen Tipps. Rasch lädt sie es in die Cloud und schickt den Link an Studentinnen und Fachkollegen, dann noch an den Präsidenten und die Kultusministerkonferenz und schließlich an alle Leute, die sie kennt. Ihr E-Mail-Verteiler ist ihr ganzer Stolz. Damit kann sie die Welt aus den Angeln heben.
Zufrieden geht sie schlafen. Als sie sich auszieht und dabei im Spiegel beobachtet, überkommen sie plötzlich Zweifel. Eine Möglichkeit hat sie nicht in Betracht gezogen: das Kind. Vielleicht ist das Kind das dritte Geschlecht.
Mein Körper ist jedenfalls der eines Kindes. Und ich fühle mich auch so. Schuldlos schuldig. Unschuldig. Mit dem Geschlecht wie mit der Erbsünde befleckt, aber diese Flecken – Brustwarzen, Schamlippen, Haare, winzig und blass – sind nur an der Oberfläche, in die Haut eingewachsen. Darunter bin ich Fleisch, Blut, Knochen, Lebewesen. Man erkennt es, wenn man genau hinsieht. All das schimmert hindurch. Wenn auch die Haut immer dicker wird und sich die Konturen mit dem Alter verwischen, das Gerüst meiner Person bleibt bestehen. Ich kann es ertasten. Ich kann es sogar brechen, wenn ich will.
In der Nacht nach ihrem großen Coup fällt Kim Irbach in den fühllosen Schlaf der Androiden. Sie träumt nicht.
d*
Seit Kims Handreichung viral gegangen war, liefen die Tage im Schnelldurchlauf ab. Tage, die angefüllt waren von Anfragen, Interviews, Presseberichten, lauernden Blicken, überraschenden Begegnungen und einem überquellenden Posteingang. Kim kam sich ganz durchscheinend vor, so viele Menschen versuchten, in ihr Innerstes zu blicken. Und am Abend hingen, bildlich gesprochen, ihre Gesichtsmuskeln schlaff herunter, wenn sie, später als üblich, nach Hause kam. Derart ungeteilte Aufmerksamkeit war sie nicht gewohnt, ebenso wenig das viele Reden und Dauerlächeln. Die Müdigkeit zog sie zu Boden oder zumindest auf das rote Ledersofa.
Aber in ihrem Innern fühlte es sich gut an.
War es das, was sie wollte? Ruhm? Bewunderung? Einen neuen Ruf? Oder ging es um die Sache?
Nein.
Es ging um Reinheit.
Kim hatte endlich einen Weg gefunden, von innen nach außen zu wirken, und nicht umgekehrt, wie es früher so oft gewesen war. Der äußere Schmutz drang nicht mehr in sie ein, weil so viel von ihr nach außen quoll und ihm den Weg versperrte. Es war ihr gelungen, sich auszudehnen, die Welt außerhalb ihrer selbst mit Identität zu füllen, etwas, das sie nie für möglich gehalten hätte. Andere Menschen blieben stehen und warteten darauf, etwas von dem zu aufzufangen, was da aus Kim austrat. So konnte sie sich selbst permanent reinigen, indem sie ihren Schmutz bei anderen ablud statt umgekehrt. Was für eine ungeahnte Erleichterung!
Und auch ihr Geschlecht war sie endlich losgeworden, schien es. Jedenfalls krähte kein Hahn mehr danach, nicht einmal und auch nicht dreimal. Niemand sprach sie mehr mit „Frau Irbach“ oder „Frau Professorin“ oder, Himmel hilf, mit „Petra“ an. Alle hatten begriffen, dass sie Kim war, einfach Kim. Prof Irbach oder die Person Kim.
Geschlechtlich eindeutige Vornamen waren von gestern. Die Globalisierung hatte hier für wohltuende Verwirrung gesorgt, wenn deutsche Mädchen plötzlich Luca oder Mika hießen, obwohl diese Namen in Italien oder Finnland nur an Jungen vergeben wurden. Die Verknüpfung von Name und Geschlecht erinnerte Kim an Sklavennamen. Ebenso gut könnte man einem Namen die Ethnie seines Trägers als Epitheton voranstellen: Schwarz-Victoria, Weiß-Felix, Gelb-Amy…
Durch ihren medialen Erfolg hatte sich Kim endlich das Recht auf Uneindeutigkeit erkämpft, und das nicht nur für ihren Namen. Niemand – oder sagen wir: fast niemand, es gab schließlich auch Publikumsverkehr – reagierte verschreckt, wenn sie mal die eine, mal die andere Toilette aufsuchte, der Ausgewogenheit wegen, solange es in der Uni noch keine Unisex-Toiletten gab.
Eine Weile war die Welt nahezu perfekt. Nach etwa drei Monaten begann Kims Magie jedoch zu schwinden. Mit einem Mal trat so etwas wie eine Realitätsanpassung ein, wie in Mary Poppins, wenn der Wind sich dreht. Auf einmal müssen altbekannte Gesichter herhalten, die Hoffnung zu wahren. Der unzulängliche Vater muss sich von nun an abmühen, seine Kinder nicht allzu sehr zu enttäuschen. Die schillernde Blase, in der die elternlose Utopie, der Durchbruch des Ichs, greifbar vor Augen schaukelte, ist geplatzt und verwandelt sich in wehmütige Erinnerung, über die man später einmal sagen wird, dass sie von einer wirklich wichtigen Zeit im Leben handelt. Kim war in diesem Spiel eine Zeit lang Mary Poppins gewesen und hatte mit weißer Magie die bunten Säfte der Geschlechter in bittere Medizin verwandelt. Doch nun war Mary Poppins davongeflogen und die unansehnliche Suffragette war dageblieben.
Vielleicht war nur der Schweinezyklus der akademischen Nouvelles schuld. Nach drei Monaten war ein Thema im Allgemeinen durch und das nächste stand schon in der Schlange vor dem Spiegelsaal der Eitelkeiten an.
Jedenfalls begannen die Blicke der Studenten wieder ungehindert umher zu schwirren, statt an ihr zu haften, wenn Kim auf dem kurzen Weg von ihrem Büro zur Mensa extra einen Umweg über die Bibliothek wählte. Wenn diese Blicke doch irgendwo haften blieben, dann an ihren gegengeschlechtlichen und gleichaltrigen Kommilitonen, nicht an der kleinen androgynen Person, die wie ein ruheloses Gespenst auf der Suche nach seinem Kopf durch die Gänge spukte.
Auch banale Pflichten erhoben ihre Hydrahäupter von Neuem. Betrat Kim nun ihr Büro, lag zum Beispiel schon eine Einladung des Dekans zur Lehrplankonferenz bereit, mit dem vorsorglichen Hinweis, dass Kim mit den Einführungskursen dran sei und darum in diesem Semester kein Deputat für ein theoretisches Hauptseminar bekomme.
Willkommen im Alltag. Das Beben war kurz gewesen, aber Kim fasste den Entschluss, es nie wieder so weit kommen zu lassen, dass sie einfach übersehen wurde. Sie würde kontinuierlich weiterarbeiten und wenn sie einen guten Einfall hatte, von Zeit zu Zeit für Aufsehen sorgen. Immerhin wusste sie jetzt, dass sie es konnte.
Einführungskurse hatten außerdem auch ihr Gutes. Weniger Arbeit und mehr unschuldige, unerfahrene Studentinnen, die sie auf sich prägen konnte. Eine Insel der Reinheit inmitten des Sumpfs, der wieder näher gerückt war. Speziell eine hatte Kim im Auge, eine Aserbeidschanerin von verwirrender, multiethnischer Schönheit. Kim hatte sie in der Erstsemesterberatung erspäht und nicht mehr vergessen können. Natürlich würde sie im kommenden Semester den Einführungskurs besuchen müssen.
Bis dahin waren noch zwei Wochen Zeit. Fürs Erste gönnte sich Kim ein wenig Erholung. Endlich konnte sie wieder bis zehn schlafen. Wenn sie erwachte, warf sie eine Münze, um zu entscheiden, ob sie noch arbeiten ging oder nicht. Statt zu arbeiten, könnte sie genauso gut mit ihrem Bruder, dem Fitnessgott, in die Therme gehen. Wie Kim auf ihrem Terminkalender sehen konnte, waren sie heute verabredet.
Eigentlich eine gute Idee an einem grauen, kalten Märztag wie diesem. Aber Kim wollte sich nicht dem Anblick der Muskeln aussetzen, die ihr Bruder im Laufe der Jahre sorgsam angesetzt und aufgeschichtet hatte wie die Steine einer Kathedrale. Mauerring um Mauerring zur höheren Ehre des einen Gottes. Yoga, Pilates, Cantienica, Zumba hießen seine Werkzeuge. Martin machte einfach alles mit.
Kim nicht. Kim versuchte, so wenig wie möglich mitzumachen. Darum entschied sie sich, doch noch aus dem Haus zu gehen, statt Martin anzurufen. Aber lieber nicht in die Uni, sondern in ihr eigenes Gemeinschaftsbüro, das sie sich mit zwei Freundinnen teilte. Auf dem Weg dorthin schickte sie Martin eine Nachricht, dass er nicht auf sie warten solle.
Ein Mann, der Zumba tanzt – und doch war Kim absolut sicher, dass Martin nicht schwul war. Er gehörte nur zu der Spezies, die meist unter Frauen, immer häufiger jedoch auch unter Männern vorkommt: Epikureer, denen man die Freude genommen hat. Die sich verbissen gegen die eigene Vergänglichkeit stemmen und an der Verheißung ewiger Jugend abarbeiten, bis die Anstrengung sie verhärmt und ausgezehrt hat. So wie die abgemagerte Joggerin mit dem schlenkernden Monty-Python-Laufstil, die Kim fast jeden Tag und auch heute traf. Vor lauter Gewichtsverlust hatte sie keine Kraft mehr, ihre Extremitäten im Gleichgewicht zu halten.
Frauen rechtfertigen diese Mühe meist damit, dass sie für ihre Männer schön bleiben müssen. Es nützt ihnen aber nichts, weil ihre Zeit doch spätestens mit 50 abgelaufen ist. Immer mehr männliche Freunde und Kollegen kamen plötzlich mit beträchtlich jüngeren neuen Partnerinnen an, oft Studentinnen, die sie im Seminar kennen gelernt hatten. Offenbar ein unausrottbarer Mechanismus, trotz Frauenbewegung und Neuem Mann. Das Einzige, was sich im Vergleich zu den 1950ern geändert zu haben schien, war, dass die Männer deswegen Schuldgefühle hatten und nicht mehr heimlichtaten. Und die Studentinnen wirkten sehr viel selbstbewusster und nicht mehr so servil. Sie ruinierten auch nicht mehr zwangsläufig ihr Leben. Häufig bekamen sie ein Kind und setzten den alten Mann, den die Wucht des Déjà-vus wie ein Keulenschlag traf, vor die Tür. Dann weinte er sich bei Kim, seiner geschlechtslosen, beziehungslosen Freundin, darüber aus, wie viel Unrecht ihm widerfahren, dass er doch diesmal alles habe richtig machen wollen und dass er, nachdem er für das erste Kind so wenig Zeit gehabt habe, so glücklich mit dem neuen Baby gewesen sei. All seine Erfahrung habe er einbringen wollen und nun werde das junge Ding es mit dem Kind verbocken und er müsse zugucken und könne nichts dagegen tun.
Auch ihr Bruder hatte vor Kurzem seine Familie verlassen. Das war wohl der Grund, warum er nach Berlin gezogen war. Sicher hatte seine Frau mit dem kleinen Sohn die Wohnung in Hamburg behalten. Und nun hatte Kim ihn am Hals. Ihn und sein Mansplaining. Seine guten Ratschläge, die auf der Lebenserfahrung eines Mannes beruhen, der durch Schicksalsschläge gereift ist. Auch wenn er jünger war als sie. Er meinte es ja nur gut.
Aber heute nicht. Keine gültigen Weisheiten, keine Fitnesstipps. Kim schloss die Tür zum Gemeinschaftsbüro auf und freute sich über die unrenovierte Muffigkeit, die sie empfing.
e*
„Scheiße“, klang es aus dem Nebenraum. Malina, eine der beiden Frauen, mit denen sie sich die Büromiete teilte. „Ich kann einfach keine verfickten Dialoge schreiben!“