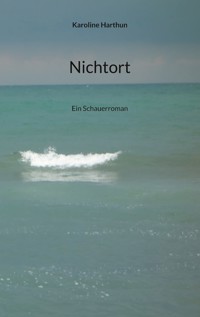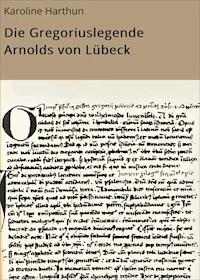
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Thomas Manns letzter Roman, "Der Erwählte", fußt auf einer alten Legende, die die Geschichte des heiligen Gregorius erzählt. Gregorius ist ein mittelalterlicher Ödipus, der, ohne es zu wissen, seine Mutter heiratet. Im Mittelalter war diese Erzählung sehr bekannt. Hartmann von Aue hat sie aufgeschrieben, auch die Legenda aurea überliefert sie. Der Abt Arnold von Lübeck hat den "Gregorius" ins Lateinische übersetzt und mit seinem Werk befasst sich die Untersuchung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karoline Harthun
Die Gregoriuslegende Arnolds von Lübeck
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I. Einleitung
II. Die beiden Textzeugen
III. Forschungsbericht
IV. Der Gregorius-Stoff
V. Der Vergleich
VI. Das Material
VII. Vergleichsbeispiele
VIII. Der Legendencharakter
IX. Die Motivation
X. Zusammenfassung
XI. Literatur
Impressum neobooks
I. Einleitung
Die vorliegende Arbeit wurde am 22. September 1995 an der FU Berlin als Magisterarbeit im Fach Mittellateinische Philologie eingereicht. Betreut wurde sie von Prof. Dr. Fritz Wagner. Für die digitale Veröffentlichung habe ich sie weder aktualisiert noch der neuen Rechtschreibung angepaßt.
Die Untersuchung setzt sich zum Ziel, die mittellateinische Bearbeitung der mittelhochdeutschen Gregoriuslegende durch Arnold von Lübeck in ihrer Systematik zu erforschen. Mit Hilfe von sechs Untersuchungskriterien, die die stilistischen, narrativen und inhaltlich-wertenden Eingriffen Arnolds in die Gregoriuslegende Hartmanns von Aue beschreiben, sollen die Charakteristika seiner eigenständigen Interpretation analysiert werden. Diese sollen aber auch den Schlüssel liefern zu einem besseren Verständnis der Erzählstruktur der Legende. Voraussetzung dafür ist die bereits in der Sekundärliteratur geäußerte Annahme, daß es sich bei Hartmanns Text um eine literarische Mischform1 handelt, die sich narrativer Konventionen aus Roman und Legende bedient, und daß Arnold von Lübeck in seiner Bearbeitung die romanhaften Züge zugunsten einer traditionsgebundeneren legendenhaften Erzählweise unterdrückt.2
Ob Arnolds Methode als repräsentativ für die mittellateinische Legende gelten kann, soll überprüft werden, wenn sich die Arbeit zwei weiteren Texten zuwendet, um darin legendenspezifische Erzählstrategien nachzuweisen. Diese beiden Texte sind die Bernhardsvita Wilhelms von St. Thierry und die Julianlegende Jakobs von Voragine, die hier stellvertretend für die gesamte hochmittelalterliche Hagiographie behandelt werden. Dabei interessieren sowohl die narrativen Strategien der Oberflächenstruktur als auch die der Tiefenstruktur. Zu diesem Zweck wird ein linguistisches Modell William Labovs herangezogen, welches den Zusammenhang zwischen der narrativen Intention eines Textes in seiner Tiefenstruktur und ihrer konkreten sprachlichen Realisation an der Oberfläche des Textes klärt.
Im folgenden widmet sich die Arbeit dem historischen Rahmen der lateinischen Gregoriuslegende. Auf Arnolds Standort in der Tradition der Übersetzungstheorie wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Dafür soll in allgemeineren Ausführungen das Verhältnis von volkssprachlicher und mittellateinischer sowie weltlicher und geistlicher Literatur im Deutschland des hohen Mittelalters zur Sprache kommen. Die hierzu angestellten Überlegungen, vor dem Hintergrund der Bearbeitungsmethode Arnolds von Lübeck betrachtet, dienen als Hinweis auf die Funktion der Gesta Gregorii Peccatoris und auf die Motivation von Auftraggeber und Bearbeiter, mit der sie einen volkssprachlichen Text ins Lateinische übertragen haben. Inwieweit sich Funktion und Intention der Gesta Gregorii Peccatoris in anderen mittellateinischen Texten wiederfinden lassen, die aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt wurden, soll hier nur angedeutet werden.
II. Die beiden Textzeugen
II.1 Entstehung
Der Gregorius Hartmanns von Aue nimmt im Gesamtwerk des Autors zeitlich eine mittlere Stellung ein. Stilanalysen ergaben, daß der Text höchstwahrscheinlich nach der Klage und nach dem Erec-Roman, aber vor dem ArmenHeinrich und dem Iwein-Roman verfaßt wurde.3 Wenn Hartmann tatsächlich an einem Kreuzzug teilgenommen hat, wie man aus der Liedstrophe MF 218, 5 schließen könnte, so dürfte es sich eher um den Kreuzzug von 1189 / 90 als um den von 1197 / 98 gehandelt haben.4 Da der Erec vor dem fraglichen Kreuzzug entstanden zu sein scheint,5 ist es naheliegend, in der Phase nach dem Kreuzzug die Entstehungszeit des Gregorius zu vermuten. Für den Iwein, das letzte große Werk Hartmanns, und somit auch für den Gregorius läßt sich hingegen ein eindeutiger Terminusantequem bestimmen, weil Wolfram von Eschenbach den Iwein in Teilen seines Parzival (253, 10 - 14; 436, 4 - 10) erwähnt, die nicht nach 1205 entstanden sind. Demnach schrieb Hartmann seinen Gregorius zwischen 1190 und 1205, vielleicht sogar zwischen 1198 und 1205.
Die Übersetzung Arnolds von Lübeck läßt sich leichter datieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Arnold sie erst begonnen, nachdem seine Slawenchronik zumindest in großen Teilen vorlag, weil diese Chronik6 dem Auftraggeber vielleicht als Empfehlung für den relativ unbekannten Autor Arnold von Lübeck diente. Außerdem erwähnt er die Gesta Gregorii Peccatoris im autobiographischen Abschnitt ihres Prologes nicht. Sie endet im Jahre 1209. Die Übersetzung des Gregorius dürfte Arnold vor dem Tode seines Auftraggebers, des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg, abgeschlossen haben, weil er im Widmungsprolog als lebende Person begrüßt wird. Wilhelm von Lüneburg schied am 12. 12. 1213 aus dem Leben, Arnold zwischen 1211 und 1214, als seine Testate in Lübecker Urkunden abreißen.7 Sein Nachfolger wird 1214 erstmals als Abt erwähnt.8 Arnold hat also, wenn er denn die Chronik vorher abgeschlossen hat, recht konzentriert und nicht länger als höchstens vier Jahre an der Übersetzung gearbeitet, etwa von 1210 bis 1213.
II.1.1 Auftrag
Wilhelm von Lüneburg trat außer durch den Auftrag für die Übersetzung des Gregorius durch kein weiteres Mäzenatenverhalten hervor, starb aber auch im Alter von nur 29 Jahren. Warum er gerade Arnold als Übersetzer auswählte, ist nicht zu beantworten. Der Abt könnte ihm durch seine Slawenchronik bekannt geworden sein. Dennoch ist zu bedenken, warum Wilhelm nicht einen gelehrteren, berühmteren Mann aufforderte, der bereits Erfahrung mit literarischen, gar metrischen Texten hatte. Im Fürstentum Braunschweig-Lüneburg wären zum Beispiel Mönche des Braunschweiger Ägidienklosters,9 an dem Arnold von dessen weitgereistem Abt Heinrich10 erzogen wurde, oder des Lüneburger Michaelisklosters in Frage gekommen. Die kulturelle Stellung dieser Klöster war dank ihrer Nähe zum herzöglichen Hofe und ihrer längeren Tradition bedeutender als die des Lübecker Johannesklosters, dessen erster Abt Arnold selbst war. Zäck vermutet, daß sich Wilhelm mit jenen in der Frage der Kanonisierung des Gregorius nicht einig wußte und sich darum an den Außenseiter Arnold wandte.11
Dieser war über Wilhelms Anliegen wohl auch überrascht, wie er im Prologuspraeterrem zu verstehen gibt: „opus, quod nobis iniunxistis [Wilhelme de Lunenburch] de teutonico transferre in latinum, nobis satis est onerosum, quia usum legendi talia non habemus et modum locucionis incognitum formidamus.“12 Sicherlich liegt in der Formulierung „modum locucionis13 incognitum“ eine Übertreibung im Sinne topischer affektierter Bescheidenheit,14 mit der sich Arnold dagegen absichern möchte, daß ihm etwaige Übersetzungsfehler zur Last gelegt würden. Insgesamt ist aber von einer topischen Einleitung wenig zu spüren; im Prologusanterem15 vermeidet Arnold affektierte Bescheidenheit oder Captatiobenevolentiae.16
II.2 Überlieferung
Die Überlieferung der Hartmannschen Version des Gregorius ist um ein Vielfaches reicher als die von Arnolds Text. Wir kennen insgesamt elf Handschriften und Fragmente des 13., 14. und 15. Jahrhunderts.17 Die wichtigste Handschrift ist die Leithandschrift A (Vat. regin. lat. 1354) von der Hand eines ostoberdeutschen Schreibers aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts, in der nur der Prolog und der Schluß des Epilogs fehlen. Auf sie stützt sich fast ausschließlich die heutige Edition des Hartmannschen Textes, denn sie ist nicht nur die älteste, sondern auch die beste Überlieferung des Werks.
Arnolds Arbeit scheint dagegen niemals eine nennenswerte Rezeption erfahren zu haben. Sie ist nur durch eine Handschrift P und ein Fragment B in die Neuzeit gelangt, die mittlerweile beide verloren sind. Der Codexunicus18 stammt aus dem westfälischen Augustinerchorherrenstift Böddeken19 und befand sich noch unlängst in der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in Paderborn (P a 54),20 wo er 1981 gestohlen wurde. Er wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben. Daß der Codex über zweihundert Jahre nach der Niederschrift der Gesta Gregorii Peccatoris nur unweit von Lübeck entstand, weist darauf hin, daß Arnolds Werk geographisch nur wenig Verbreitung fand. Schilling nennt die Qualität der Handschrift zwar mäßig, nimmt jedoch nicht an, daß sie den Wortlaut des Archetyps entstelle.21 Die Überlieferungskette dürfte nur kurz sein; möglicherweise lag dem Schreiber von P sogar das Original vor.
Das Fragment B von 38 Versen war Teil einer Handschrift des 13. Jahrhunderts. Es verschwand im 19. Jahrhundert aus der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Schilling schätzt die Qualität der Mutterhandschrift von B geringer ein als die der Handschrift P, obwohl erstere deutlich älter war.22
II.3 Vorlagen
Hartmanns Vorlage war die altfranzösische Verslegende La Vie de Saint Grégoire aus dem zwölften oder noch elften Jahrhundert.23 Zwar sind zwei Fassungen dieses Textes überliefert, doch sind alle vorhandenen Handschriften jünger als Hartmanns Übersetzung. Fassung A ist in einer Handschrift aus der Mitte des 13. Jahrhunderts in Tours und in einer von 1469 in der Bibliothèque Nationale von Paris vorhanden. Fassung B liegt in drei Handschriften vor, nämlich vom Anfang des 13. Jahrhunderts im British Museum London, aus dem 14. Jahrhundert in der Pariser Arsenalbibliothek, aus dem frühen 15. Jahrhundert in Cambrai, und in einem Fragment vom Ende des 13. Jahrhunderts im British Museum. Fassung B steht dem Archetyp näher und gehört dem gleichen Überlieferungsstrang an wie Hartmanns Vorlage. Gleichwohl unterscheiden sich beide Fassungen so deutlich von Hartmanns Übersetzung, daß es sich verbietet, sie für einen Textvergleich als Stellvertreter der verlorenen Vorlage heranzuziehen.24
Die Handschrift von Hartmanns Gregorius, die Arnold für seine Übersetzung benutzte, ist ebenfalls nicht erhalten. Schilling bezeichnet sie im Anschluß an die belegte Gregorius-Überlieferung als Handschrift N. Sie ist enger mit dem Archetyp verwandt als alle uns bekannten Handschriften, wurde sie doch schon vor dem Jahre 1209 und möglicherweise in Hartmanns unmittelbarer Umgebung angefertigt.25 Von allen Handschriften stimmt die Leithandschrift A am ehesten mit ihr überein, doch zeigt die Kapiteleinteilung, die Arnold aus seiner Vorlage übernommen hat, einige Abweichungen.26
II.4 Rezeptionsästhetischer Kontext
Die Frage nach dem Lesepublikum der Gesta Gregorii Peccatoris kann hier zunächst nur angerissen werden. Um sich ihr anzunähern, muß man ohnehin zwischen verschiedenen denkbaren Publika differenzieren. Schon einen konkreten Adressaten zu benennen, stellt sich als schwierig heraus; richtet er sich doch einmal nach der Intention des Auftraggebers, einmal nach der des Übersetzers Arnold von Lübeck. Beide weichen unter Umständen voneinander ab. Dies soll in den Anmerkungen zur möglichen Motivation beider Urheber (Kapitel IX) geklärt werden. Aus Arnolds Bemerkungen im Prolog und im zweiten Epilog können wir schließen, daß er zumindest kein elitäres Publikum ansprechen wollte, sondern auch „einfache, unwissende“ Leser, also Laienbrüder oder gar Adlige.27
Als Rezipient interessiert vor allem das zeitgenössische Lesepublikum des frühen 13. Jahrhunderts. Die Rezeption späterer Jahrhunderte, besonders nach der Entstehung des Codexunicus, kann vernachlässigt werden, weil man angesichts der spärlichen Überlieferung der Gesta Gregorii Peccatoris davon ausgehen kann, daß die Neuzeit vor der wissenschaftlichen Beschäftigung kein Interesse an dem Werk hatte.
Das Interesse des Schreibers der Handschrift P aus dem 15. Jahrhundert kann man am Kontext ablesen, in den die Gesta Gregorii Peccatoris innerhalb des Codex gestellt werden. Es handelt sich um eine historiographische Handschrift mit hagiographischem Schwerpunkt. Außer den Gesta Gregorii Peccatoris findet man darin eine Chronik mit dem Titel Florestemporum, den Liberquadrupertitiapologetici, eine Schrift von Pseudo-Seneca über die vier Kardinaltugenden und die Viten Papst Leos IX. und des Hl. Robert.
III. Forschungsbericht
Die Forschung über die Gesta Gregorii Peccatoris stand immer im Schatten des Interesses an ihrer deutschen Vorlage, die der Literaturgeschichtsschreibung als so viel bedeutender galt. So richten sich die meisten Fragen zu den Gesta Gregorii Peccatoris an ihr Verhältnis zum Ausgangstext. Als eigenständiges literarisches Werk wurden sie bisher nur peripher wahrgenommen.28
Nachdem die Gesta Gregorii Peccatoris im Jahre 1877 wiederentdeckt worden waren,29 stießen sie auf reges Interesse und provozierten mehrere Dissertationen. Nach dem Ersten Weltkrieg erlahmte die Beschäftigung und wurde erst wieder in den siebziger Jahren aufgenommen. In den späten achtziger Jahren erlebte das Werk Arnolds von Lübeck eine noch immer anhaltende Renaissance. In den vergangenen zehn Jahren wurde über die Gesta Gregorii Peccatoris annähernd so viel publiziert wurde wie in den hundert Jahren zuvor.
Die Editio princeps legte Gustav von Buchwald vor. Er gab ihr den Titel „Gregorius Peccator“. Mehrere Rezensenten kritisierten die Edition und boten Textverbesserungen an.30 Generell konzentrieren sich die meisten der frühen wissenschaftlichen Arbeiten über die Gesta Gregorii Peccatoris auf deren Sprache.
Hermann Seegers verglich als erster Arnolds Übersetzung mit Hartmanns Gregorius. Sein Augenmerk galt dabei vor allem der Entstehung der Übersetzung, indem er zu klären versuchte, welche Handschrift Arnold benutzt haben könnte. Er stellte bereits die Nähe der Handschrift P der Gesta Gregorii Peccatoris zur Handschrift A des Gregorius fest und neigte irrigerweise dazu, diese für die Vorlage zu halten.31 Das Fehlen des Prologs in der Handschrift A versuchte er damit zu erklären, daß Arnold der eigentliche Autor des Gregorius-Prologs sei und Hartmann den Prolog erst aus Arnolds Übersetzung übernommen habe.
Die Dissertation Johannes Meys ist der Chronik Arnolds von Lübeck gewidmet. Doch geht Mey in einem Exkurs auch auf die Gesta Gregorii Peccatoris ein. Darin registriert er, nun auf gesicherterer Textgrundlage stehend als seine Vorgänger, strukturelle und inhaltliche Unterschiede zu Hartmann. Er betont vor allem, daß Arnold die Erzählung stark christlich eingefärbt habe.32
Ernst Schuppes Dissertation befaßt sich erneut mit Problemen der Textkritik. Auf der Grundlage einer ausführlichen metrischen und rhythmischen Analyse des Werks äußert er zahlreiche Korrekturvorschläge zu Buchwalds Ausgabe. Methodisch folgt er seinem Lehrer Eduard Sievers. Dabei fügt er in den nur aus einer Handschrift bekannten Text so viele ihm metrisch notwendig scheinende Wörter ein, daß er sich damit radikal gegen die Autorität der Überlieferung stellt.
Nach Schuppes Dissertation bricht die Gesta Gregorii Peccatoris-Forschung aus unerklärlichen Gründen ab. Abgesehen von einer Magisterarbeit von Hedda-Maria Fraunhofer aus dem Jahre 1970 über die lateinischen Übersetzungen aus dem Mittelhochdeutschen,33 legt Peter Ganz 1974 den ersten neueren Aufsatz über das Werk vor. Schon vorher war Hans-Joachim Behr am Rande auf die Gesta Gregorii Peccatoris eingegangen, doch hatte er sie lediglich dahingehend untersucht, welche Rolle der fürstliche Auftraggeber für die Entstehung des Werkes spielte.
Zwei wichtige Dissertationen zu den Gesta Gregorii Peccatoris sind in den achtziger Jahren erschienen, die kritische Edition von Johannes Schilling und der gleichzeitig entstandene literaturwissenschaftliche Vergleich der Prologe Arnolds und Hartmanns von Reiner Zäck.
Schilling liefert die verbindliche kritische Edition, die schon deswegen von unschätzbarem Wert ist, weil er als letzter die verschwundene Handschrift auswerten konnte. Er gibt wertvolle Informationen zu Autor, Auftraggeber, Forschungslage, Textaufbau, Interpretation, Sprache und Stil. Die Gesta Gregorii Peccatoris werden nunmehr als eigenständige literarische Leistung gewürdigt.
III.1 Zäcks Interpretation der Prologe
Reiner Zäck vergleicht die Prologe Hartmanns und Arnolds nach inhaltlich-moralischen Kriterien. Die bei Hartmann und Arnold abweichende Exegese des Samaritergleichnisses nimmt Zäck als Ausgangspunkt für eine Diskussion des jeweiligen Schuldverständnisses der beiden Texte auf der Folie der zeitgenössischen Theologie.
Freilich hat bisher niemand eine schlüssige theologische Interpretation von Gregorius’ Schuld in Hartmanns Erzählung vorgelegt.34 Sie verbietet sich schon deshalb, weil Gregorius’ Heirat mit seiner Mutter im theologischen Sinne nicht einmal unzweifelhaft als persönliche Schuld aufgefaßt werden kann.35 Umso problematischer ist nach meiner Auffassung der Ansatz, nur die Prologe des Gregorius und der Gesta Gregorii Peccatoris auf ihre theologische Fundierung hin zu untersuchen und daraus eine für den gesamten Text gültige und einheitliche Schulddefinition und Interpretationsvorgabe ableiten zu wollen. Eine solche antizipatorische Funktion kann einem Prolog nicht bedingungslos unterstellt werden.36 Hennig Brinkmann hat gezeigt, daß der Prolog in mittelalterlicher Literatur als literarische Textsorte isolierter wahrgenommen wurde als in der Neuzeit.37 Eine Interpretation, die ihm Prolog angedeutet wird, muß nicht zwangsläufig die gesamte Erzählung über tragen. Gerade ein Fidusinterpres38wie Arnold von Lübeck hat zwar die Möglichkeit, im Prolog seinen Schuldbegriff festzuschreiben, im weiteren Verlauf wird er ihn aber nicht immer deutlich machen können, wenn er an seiner Übersetzertreue festhalten will.39
Zäcks Analyse des Hartmannschen Prologs40 ergibt, daß Hartmann seinen Schuldbegriff sehr wohl theologisch fundiert habe, jedoch viel freizügiger als sein Nachfolger Arnold. Einerseits stehe er im Einklang mit umstrittenen Figuren wie Abaelard,41 andererseits habe er die verbreitetere Lehrmeinung der Kirche gemäß seinen eigenen Anschauungen neu akzentuiert. Dies setzt meines Erachtens eine Kenntnis von Literatur voraus, wie man sie selbst einem belesenen Laien wie Hartmann nicht unterstellen kann. Dietmar Ponert gibt zu bedenken, daß die Lektüre theologischer Texte eine äußerst elitäre Angelegenheit war, die man auch bei einem nur durchschnittlich gebildeten Kleriker nicht unbedingt voraussetzen könne. Nach Ponert verschaffte sich der Laie die grundlegende theologische Bildung vor allem über exegetische Literatur zur Bibel und über die Homilienrezeption.42
Hätte Hartmann die Bußtheologie Abaelards oder des Petrus Lombardus rezipiert, so argumentierte schon Dittmann,43 dann hätte er genauer auf deren zentrales Thema eingehen müssen, nämlich auf das Gewicht der einzelnen Bußakte und im besonderen auf die Rolle der priesterlichen Absolution als Konsequenz aus der Contritio.44 Indem er aber auf die Differenzierung dieser Problematik verzichtet und Gregorius seine Buße völlig allein, ohne die Unterstützung der Kirche vollzieht, schließt Hartmann an eine Bußpraxis an, die in der Realität immer angewandt und schon 813 auf der Synode von Châlon diskutiert wurde.45 Hartmanns populäre Darstellung der Buße läßt lediglich eine Distanz zur scholastischen Lehre vermuten; sie rechtfertigt aber nicht die Annahme, daß er im Gregorius oppositionelle Strömungen innerhalb der Theologie verarbeitet habe, zumal diese Strömungen auch auf ein bereits virulentes volkstümliches Bußverständnis zurückgriffen.46
Bejahen kann man Zäcks Ziel, „die starre Orientierung auf ein präsumptiv homogenes Bild mittelalterlicher Religiosität aufzubrechen“.47 Zweifellos hat Hartmann ein anderes religiöses und moralisches Verständnis als Arnold, das sich in seinem individuellen Schuldbegriff und in der Art seines Interesses am Gregorius-Stoff ausdrückt.
III. Forschungsbericht – Fortsetzung
Die neueste Veröffentlichung zu den Gesta Gregorii Peccatoris ist Hartmut Freytags Aufsatz von 1992, der sich mit einer signifikanten stilistischen Eigenart Arnolds beschäftigt, nämlich die zahlreichen Antonomasien seiner Vorlage systematisch zu tilgen oder aufzulösen.48
III.2 Bewertung der Forschungslage
Wie schon die Titel der wissenschaftlichen Publikationen zu Arnold von Lübeck zeigen, wurde dieser Autor bis in die Gegenwart fast ausschließlich im Kontext des Hartmannschen Werks diskutiert. Stand zu Beginn der Arnold-Forschung die Herstellung des kritischen Textes im Vordergrund, so zog man diesen später im wesentlichen dafür heran, ihn auf der Folie der Hartmannschen Sprache und Interpretation wahrzunehmen. Zur philologischen Analyse, die vor allem die Verwandschaft zwischen den Gesta Gregorii Peccatoris und den Gregorius-Handschriften klären sollte, traten die spekulativen Vermutungen Meys oder Zäcks über Arnolds inhaltliche Auffassung der Gregoriuslegende.
Beide Positionen stehen in der Forschung unverbunden nebeneinander, erscheinen doch ihre Zielsetzungen und Methoden so unterschiedlich. Eine Einzeluntersuchung wie die Hartmut Freytags weist den rechten Weg, den die Arnold-Forschung einschlagen sollte, indem sie eine Verknüpfung der bisher gewonnenen Erkenntnisse anstrebt und sich so einer anspruchsvolleren Interpretationsebene nähert. An einer ausgewogenen Gesamtdarstellung der Gesta Gregorii Peccatoris mangelt es bis heute.
Ebenso wurde bisher nur ansatzweise versucht, die Gesta Gregorii Peccatoris in den Kontext der deutsch-lateinischen Übersetzungsliteratur des hohen und späten Mittelalters einzuordnen. Anstrengungen in diese Richtung haben Behr und Kunze unternommen. Behr wird von einem weniger literaturwissenschaftlichen als vielmehr soziologischen Interesse geleitet, während Kunze einen profunden, aber leider nur katalogartigen Einstieg in das Thema der deutsch-lateinischen Übersetzungsliteratur bietet. Auch Berschin und Fischer kommen kaum über eine kurze Erwähnung des Textes hinaus.
Eine Systematik der deutsch-lateinischen Übersetzungstexte konnte bisher niemand aufstellen, weil die Quellenlage nicht hinreichend geklärt ist. Kunzes Untersuchung zeigt am deutlichsten, wie wenig eingrenzbar die Zahl der Textzeugen immer noch ist, fügt er doch den vordem bekannten ganze drei neue Funde hinzu.49 Eine monographische Darstellung der nachweisbaren lateinischen Übersetzungen und anderen Adaptationen volkssprachlicher, insbesondere mittelhochdeutscher Literatur bleibt ein Desiderat. Ponert erhebt mit dem Titel seiner Dissertation den Anspruch, die grundlegenden Beziehungen zwischen beiden Literatursprachen aufzudecken, doch steckt er den Rahmen so weit, daß er über einen literaturhistorischen Überblick hinaus eine kohärente Theorie nicht aufzustellen vermag, zumal er hauptsächlich Einflüsse lateinischer Literatur auf deutsche Texte gelten läßt, kaum jedoch umgekehrte Wirkungen.50
IV. Der Gregorius-Stoff
IV.1 Authentizität der Legende
Die Gestalt der Gregoriuslegende geht auf keine historische Persönlichkeit zurück. Obwohl der Name Gregorius für einen Papst geläufig ist, kann die Geschichte mit keinem Papst in Verbindung gebracht werden. Verschiedene Erzählmotive51 lassen keinen Zweifel daran, daß man es mit einer stark von literarischen und kulturellen Traditionen geprägten Fiktion zu tun hat: Gregorius ist das Kind eines Geschwisterinzests52 (Mot. A 164.1, Mot. A 1331.2, Mot. A 1337.0.7, Mot. A 2006, Mot. G 37, Mot. M 365.3, Mot. Q 520.3, Mot. T 415, Mot. T 471.1)53 und wird daraufhin verstoßen (Mot. S 312.1). Er wird in einem Weidenkorb ausgesetzt wie Moses (2 Mos 2, 1 - 10; Mot. N 211.1.2)54 und von Fischern gefunden (Mot. R 131.4). Er schlägt seinen Stiefbruder wie Judas (Mot. S 73.1.0.1);55 er heiratet seine Mutter wie Ödipus (Mot. A 164.1.1, AaTh 931).56 Er tut siebzehn Jahre Buße wie Alexius. Nach Ohly entspricht diese Zeitspanne dem Strafmaß für Inzest im römischen Recht.57 Der Schlüssel zu seinen Ketten wird im Magen eines Fisches gefunden wie der Ring des Polykrates (Mot. N 211.1.2, AaTh 736 A) und der des Hl. Arnulf,58 aber auch der Schlüssel zu den Ketten des Hl. Metro, der sich ebenfalls an einen Stein gefesselt hat, um zu büßen (Mot. Q 525.1).59Auf einem Felsen schmachten auch Judas60 und der Hl. Martinian.61 Gregorius’ Befreiung ähnelt der des Hl. Genebaudus, der sieben Jahre in einer Zelle eingeschlossen war, weil er als Bischof zwei Kinder gezeugt hatte. Die Tür zu seinem Kerker wird von einem Engel geöffnet, den Gott sendet.62 Schließlich begegnet Gregorius seiner Mutter erst wieder, als er Papst geworden ist (Mot. H 151.3), und vergibt ihr die Schuld des Inzests (Mot. T 412.1). Als Heiliger wirkt er Wunder, die an die Wunderheilungen der Apostel erinnern.
Gregorius ist nicht nur keine historische Figur,63 auch als Heiliger wurde er kaum nachweislich verehrt, weder vor der Niederschrift der Vie de Saint Grégoire oder des Gregorius Hartmanns von Aue noch danach. Keine Kirche ist ihm geweiht, und seine Erzählung wurde nur einmal in die Liturgie aufgenommen, in ein Lübecker Plenar des späten 15. Jahrhunderts.64 Wenige Exempel- oder Legendensammlungen erwähnen ihn, außer den prominenten Kompilationen der Legendaaurea und der GestaRomanorum überliefern nur eine deutsche dominikanische Exempelsammlung aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und die Sammlung Der heiligen leben von 1471 den Stoff.65
IV.2 Gliederung bei Arnold und Hartmann
Arnold unterteilt seine Erzählung in Bücher und Kapitel. Dies tut keine der erhaltenen Handschriften von Hartmanns Gregorius. Gleichwohl kann Arnold die Einteilung seiner Vorlage, der verlorenen Handschrift N entnommen haben. Seine Komposition weist gegenüber der Hartmanns jedenfalls keine entscheidenden Veränderungen auf. Schilling liefert einen tabellarischen Stellenvergleich.66 Die zwei Prologe und drei Epiloge Arnolds verstärken den Eindruck einer planvollen und abgeschlossenen Konzeption. Der Übersetzungstext schwillt nicht an; der Umfang des Übersetzungstextes entspricht in etwa dem der Vorlage.67 Auch qualitativ orientiert sich Arnold an Hartmanns Vorgaben. Chronologische Umstellungen der Erzählung werden nicht vorgenommen, der Erzählfluß wird lediglich bei Arnold häufiger für abstrakte Erörterungen unterbrochen.
Das erste von vier Büchern erzählt die Vorgeschichte, also den Inzest der Eltern des Gregorius, den Tod des Vaters, Gregorius’ heimliche Geburt und seine Verstoßung. Das zweite Buch berichtet seine Kindheit, seinen Auszug in die Welt und die Hochzeit mit der Mutter. Das dritte beschäftigt sich ganz mit der Schuld, die darin aufgedeckt wird. Das letzte Buch thematisiert Gregorius’ Buße und Erlösung. Diese klare und sinnvolle Gliederung weist das Thema von Schuld und Sühne deutlich als den Kern der Erzählung aus.
IV.3 Hartmanns Erzählhaltung
Um Arnolds von Lübeck Eingriffe in die Erzählung der Gregoriuslegende zu erkennen, muß man sich zunächst die Erzählhaltung seiner Vorlage verdeutlichen. Hierbei kann man auf die reiche germanistische Hartmann-Forschung zurückgreifen, die weitaus dezidiertere Ergebnisse erbracht hat als die Beschäftigung mit dem mittellateinischen Text. Sie bezieht ihre Ergebnisse teils aus vergleichenden Stilanalysen der einzelnen Werke Hartmanns, teils aus einer Gegenüberstellung der Vie de Saint Grégoire mit dem Gregorius. Den mittelhochdeutschen Text gegen den altfranzösischen absetzend, erkennt zum Beispiel Hans Schottmann Hartmanns Anliegen darin, „die Motive der Vorlage schärfer zu fassen und zu verbinden, durch Streichungen auszugleichen, durch Umstellungen und Erweiterungen dem Erzählten neue Akzente zu geben“.68 Freilich könnte man ähnliches auch von Arnolds Umgang mit der narrativen Struktur seiner Vorlage formulieren. Daher muß der Versuch unternommen werden, die Erzählhaltung des Gregorius absolut zu umreißen. Diesem Wagnis kommt man am ehesten bei, wenn man die Rolle und den Charakter des Erzählers umreißt.
IV.3.1 Der Erzähler im Gregorius
Norbert Heinze hat eine statistische Untersuchung aller wichtigen Werke Hartmanns vorgelegt, die sich hauptsächlich mit den Gliederungspraktiken beschäftigt, aber auch einige Worte über den Erzähler verliert. Diese Untersuchung ist insofern nützlich, als sie auch die Unterschiede zwischen den Erzählhaltungen der einzelnen Werke andeutet und dadurch indirekt zur Diskussion der Gattungsmerkmale beiträgt, also auch zu der Frage, wie legendentypisch die Erzählstruktur des Gregorius ist.
Das in diesem Zusammenhang wichtigste Ergebnis Heinzes betrifft das Hervortreten des Erzählers. Heinze behauptet für den Gregorius ein so deutliches Hervortreten des Erzählers, wie wir es in den beiden Artusromanen, vor allem im späten Iwein, nicht finden. Tatsächlich tritt der Erzähler im Gregorius nicht unbedingt deutlicher, sondern anders konturiert auf als dort. Er scheint in direkterem Kontakt mit dem Adressaten zu stehen, er bezieht eine subjektiv-perspektivische Erzählhaltung. Von der Funktion des Autors kann die des Erzählers hier weniger eindeutig als im Artusroman getrennt werden, weil die Suggestion eines Vortrags erzeugt wird. Der Erzähler spricht häufiger in der Ersten Person, er redet die Leser oft direkt in der Zweiten Person an, er kommentiert das Geschehen, ohne sich hinter anderen Personen der Erzählung zu verstecken, und stellt dabei gelegentlich einen scheinbar autobiographischen Bezug her.69 Als eigenständige Figur im Sinne Stanzels70 ist er auch dadurch leichter einzugrenzen, daß er seine Kompetenz selbst beschränkt, indem er darauf verzichtet, die Perspektiven erzählimmanenter Personen zu wählen oder deren Gedanken und Reden konjunktivisch wiederzugeben.71 Es herrscht direkte Rede vor.72 Der Autor strukturiert die Erzählung deutlich - die ursprünglichen Abschnittsgrenzen des Gregorius sind durch die Handschriften gut belegt -,73 indem er neue Abschnitte überwiegend mit eindeutigen Partikeln wie „dô“ oder „nû“ beginnt und sie mit einversigen Schlußsätzen beendet, die oft Erzählerkommentar sind.74
Die gesamte Erzählsituation75 ist im Gregorius also unvermittelter als in Hartmanns Artusromanen.76 Sie scheint mehr als der Erec, obwohl dieser vor dem Gregorius entstand, die orale Tradition von Literatur zu atmen. Das Hervortreten des Erzählers als eines alternativen Konzepts zum Autor oder seinem Stellvertreter, der den Text für ihn vorträgt, ist im allgemeinen ein Merkmal der Verschriftlichung weltlicher Literatur.77 Im Falle des Gregorius simuliert die unvermittelte Präsenz des Erzählers, der „Ich“ sagt, den Vortragenden der älteren Rezeptionssituation. Von einem Hervortreten des Erzählers als einer rein literarischen Vermittlerfigur kann deshalb nicht die Rede sein.
Die für das übrige Hartmannsche Werk eher untypische Erzählweise liegt sicherlich zum einen in der Struktur der französischen Vorlage begründet, die man als weniger literarisiert bezeichnen kann als die Werke Chrétiens de Troyes. Zum anderen muß Hartmann aber auch daran gelegen gewesen sein, die Besonderheit des halbsakralen Stoffes, der sowohl rein hagiographische als auch arturische Züge aufweist,78 dadurch zu unterstreichen, daß er eine narrative Mischform zwischen Legende und Roman wählte. Auch wenn sein Gregorius im Umfang, in der metrischen Form79 und in der komplexen Problematik über die normale Anlage von Legenden80 hinausgeht, darf man doch nicht aus den Augen verlieren, daß er in der Erzählhaltung der Legende nicht völlig untreu wird.81Arndt, der andere Aspekte des Erzählens bei Hartmann untersucht als Heinze, stellt zum Beispiel fest, daß der Anteil sentenziöser Bemerkungen im Gregorius dreimal so hoch ist wie im Erec.82 Er vermutet in diesem Phänomen nur eine stilistische Weiterentwicklung Hartmanns, doch es ist naheliegender, die Ursache dafür im Einfluß legendenhaften Erzählens auf Hartmanns Gregorius zu suchen.
IV.4 Die Sünderheiligenlegende
Gregorius gehört zum Typus des Sünderheiligen, der im zwölften Jahrhundert so beliebt wird.83 Er ergänzt als dritte typologische Stufe die hagiographische Geschichte, nachdem in der Frühzeit des Christentums das Martyrium als das kennzeichnende Merkmal der Heiligkeit angesehen wurde,84 später die Nachfolge Christi der Confessores.85 Während letztere den Keim ihrer Heiligkeit oft schon in frühester Kindheit erkennen lassen, verstrickt sich der Sünderheilige zunächst in eine persönliche Schuld, die er dann abtragen muß. Seine Heiligkeit kann sich erst daran beweisen, wie groß seine Buße und wie groß auch die göttliche Gnade ist, die ihn schließlich von seiner Schuld erlöst.
Ein Beispiel für den Typus des Bekenners ist der Hl. Alexius,86 der bereits der ersten Gefahr, die ihn von der ImitatioChristi abbringen könnte, nämlich seiner bevorstehenden Hochzeit, ausweicht und sich in seinem Leben unter der Treppe wie ein Büßer gebärdet, ohne überhaupt Schuld auf sich geladen zu haben. Dieser Typus von Heiligkeit bleibt bis in die Gegenwart bestimmend. Dennoch sind Sünderheilige seit dem Hochmittelalter keine Seltenheit. Gerade das Inzestmotiv ist in der Hagiographie weit verbreitet. Berühmtestes Beispiel neben Gregorius ist Judas Ischarioth.87