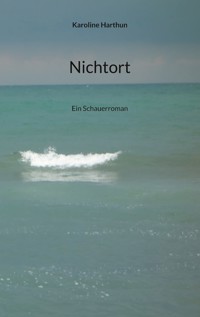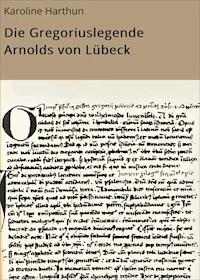Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie verreist man mit einer Fünfzehnjährigen? Was war, als wir alle noch jünger waren? Warum kehren auf Reisen die Erinnerungen zurück? Wie gehen Ferien ohne Urlaub? Fünf Geschichten von der Auszeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Mein Sommer mit Taylor
Sterne von La Palma
Die lange Küste
Rom und Blicke
Coronaferien
MEIN SOMMER MIT TAYLOR
Wir liegen im Nachtzug von Berlin nach Graz. Die Sitze haben wir ausgezogen und eine Liegefläche geschaffen, die an ein Matratzenlager in einer Berghütte erinnert. Bloß, dass wir hier nur zu zweit liegen. Meine Tochter und ich. Für mehr Leute wäre auch kein Platz. Seitlich wölbt sich die Fläche nach oben, sodass ich immer wieder in die Mitte rutsche. Um das zu verhindern, klemme ich mein linkes Bein – das gute Bein – an dem abschüssigen Ende fest, so weit es geht.
Ich will nicht in die Mitte rutschen, um meine Tochter nicht beim Einschlafen zu stören und und um sie nicht unnötig zu berühren. Lange werde ich so nicht liegen bleiben können. Hauptsache, sie schläft erst einmal ein; dann kann ich mich bewegen. Leider gibt es keine Möglichkeit, den Sitzwagen zu verdunkeln. Die Lichter der Bahnanlagen huschen die ganze Nacht über unsere Gesichter. Ich schlafe trotzdem erstaunlich fest.
Am frühen Morgen stelle ich vorsichtig meine Sitzreihe wieder her. Es dauert noch, bis wir in Graz ankommen. Wir haben nur wenig Verspätung. Im Licht der Morgensonne mache ich ein Foto von meiner Tochter. Sie wendet mir den Rücken zu, unter ihrem buntgestreiften Strandlaken als Zudecke, Kopfhörer im Ohr, wie immer.
In Graz bekommen wir den Zug nach Ljubljana. Es wäre sogar Zeit für ein kurzes Frühstück, aber weil es keine Hafermilch gibt, fällt der Kaffee für meine Tochter aus. Sie begnügt sich mit einer trockenen Brezel, obwohl ich versuche, sie zu einem Apfelstrudel in der Konditorei Aida zu überreden. In Istrien kriegen wir wahrscheinlich keinen echten Apfelstrudel. Apfelstrudel kann man nur in Österreich essen.
Dies wird sich später als Irrtum erweisen. Dank hundertjähriger Habsburgerherrschaft schmeckt der istrische Apfelstrudel, den es bei fast jedem Bäcker gibt, köstlich und ohne Zweifel besser als in Berlin.
Der Anschluss in Ljubljana ist knapp bemessen. Doch wie üblich steht der Flixbus im Stau und wir haben mehr als genug Zeit für Mittagessen und erste Langeweile. Mit dem überraschend scharfen Curry, genossen an einer vierspurigen Straße, die an dem Bahnhof mit dem Charme einer unterirdischen Stadionanlage vorbeiführt, verdoppelt sich gleich die Augusthitze, die uns von nun an nicht mehr aus ihren Klauen lassen wird.
Der Bus, als er endlich kommt, steht weitere Stunden im Stau, sodass wir erst am Abend in Poreč sind. Der Busbahnhof empfängt uns mit der typischen Mischung aus Räudigkeit und postsozialistischem Bauwahn. Hoffentlich bleibt es nicht so. Leider liegt unsere Ferienwohnung erstens zwei Kilometer entfernt – darauf habe ich bei der Buchung nicht geachtet –, und zweitens ist Nationalfeiertag in Kroatien, weshalb wir nichts zu essen kaufen können. Gefeiert wird die Rückeroberung der Krajina im serbischkroatischen Krieg, und der Tag trägt den offiziellen Titel „Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit und Tag der kroatischen Verteidiger“, als hätten sich die Namensgeber gegen den zu erwartenden Protest der Nachbarn mit barocker Überlänge wappnen wollen.
Der erste Eindruck ist niederschmetternd. Wir reden nicht darüber. Beide warten wir ab, wollen es nicht schon jetzt zur Krise kommen lassen, bemühen uns, die Notwendigkeiten anzuerkennen. Meine Tochter zieht kommentarlos ihren viel zu vollen alten Zweiradkoffer zwei Kilometer bergauf durch die monotone Neubausiedlung. Ich verliere kein Wort über die tarnfarbene Plastikhecke vor unserer Terrasse. Immerhin, ein richtiges Bett. Wir sinken hinein.
Am Vormittag, ich bin schon ein paar Stunden wach, erhebt sich meine Tochter irgendwann, unaufgefordert, schlurft die paar Schritte zum Bad, doch bevor sie es erreicht, kippt sie der Länge nach um und schlägt mit dem Kopf auf. Mir geht es durch und durch, ich springe auf, beuge mich über sie, versuche als Erstes herauszufinden, an welcher Stelle ihr Kopf aufgeschlagen ist. Neben der Türschwelle ist ein Stopper aus Metall im Fußboden verankert. Panik steigt in mir auf; ich denke, dass ich mich wie so oft nicht über die Notrufnummern im Ausland informiert habe, denke, dass ich kein Kroatisch spreche, denke: Das ist der Augenblick, den ich immer habe kommen sehen. Als Nächstes berühre ich vorsichtig ihren Kopf, suche Blut, finde keines. Dann wandert mein Blick wieder über den Fußboden und ein bisschen höher und ich sehe es: ein flaches Loch in der Wand.
Gott sei Dank. Mein Kind hat nur ein Loch in die Gipswand gehauen und nicht der Metallknopf ein Loch in ihren Kopf! Gips hat eine dämpfende Wirkung, und wirklich regt sie sich schon und schickt sich an aufzustehen. Die ganze Zeit habe ich sie laut bei ihrem Namen und mit Koseworten gerufen wie ein Kind, das beim Laufenlernen aufs Gesicht gefallen ist. Jetzt wird meine Stimme fester.
„Warte, nicht aufstehen. Bleib liegen. Soll ich dir was zu trinken bringen? Kannst du sehen? Ist dir schwindelig?“
Sie bleibt gehorsam sitzen, bedenkt mich aber mit einem Blick, als wäre mein Verhalten besorgniserregend und nicht ihres. Ich halte sie ein bisschen im Arm. Schließlich befreit sie sich und verschwindet für eine Stunde im Bad. Das ist normal, aber ich lausche die ganze Zeit, ob ich ungewöhnliche Geräusche höre.
Loch im Kopf. Auch ein guter Titel für diese Geschichte.
Als sie die Tür, die sie wie immer abgeschlossen hat, wieder öffnet, erblickt sie die gegenüber liegende Wand und sagt: „Oh, ich hab ja ein Loch in die Wand geschlagen.“ Ihre demonstrative Routiniertheit fällt von ihr ab, sie scheint sich mehr um die Wand als um ihren Kopf zu sorgen. Das Apartment war frisch renoviert, bis eben.
„Was machen wir jetzt? Kann man das reparieren?“ Als ich nicht reagiere, weil mir die Wand höchst egal ist, wiederholt sie mit richterlicher Strenge: „Wie repariert man so was?“ Ich weiß, dass solche Fragen ernst gemeint sind, und krame mein geringes handwerkliches Wissen hervor. „Ich schätze, man füllt das Loch mit Gips und spachtelt ihn glatt. Dann streicht man einfach über.“ Damit gibt sie sich zufrieden. Als wir das Apartment am nächsten Tag verlassen, hinterlasse ich diskret 10 Euro. Nicht viel, aber für ein bisschen Gips wird es reichen.
Schon am ersten Tag geht es los, dass sie mich über Taylor abfragt. Ich weiß nichts. Meine Vorurteile sind äußerst pauschal. Ich weiß, dass Taylor sehr jung angefangen hat, Musik zu machen (im Alter meiner Tochter?), dass sie bei der letzten Wahl aufgerufen hat, die Demokraten zu wählen, dass die Klatschzeitschriften mal von einer Fehde mit Katy Perry vibrierten (die sie sich ausgedacht haben). Damals fand ich Katy, die ich mit meiner älteren Tochter live gesehen hatte, besser. Sie war lustig und sexy und hatte schwarze Haare. Taylor kam mir dagegen vor wie eine fundamentalistische Landpomeranze. Mit der Meinung stand ich nicht allein da.
Von den Attacken durch Kanye West habe ich erst vor Kurzem erfahren, obwohl wir „Reputation“ schon im Sommer 21 (nur vier Jahre nach dem Erscheinen ...) im Piemont in unserem Mietwagen gehört haben. Dann fällt mir noch ein, dass meine Nichte, die mittlerweile auf die 30 zugeht, im Alter meiner Tochter ein großer Taylor-Fan war und ich damals dachte: Schade, dass ich die Einzige in der Familie mit gutem Musikgeschmack bin.
So wenig ist das eigentlich gar nicht, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich kann keinen einzigen Song nennen. In den Augen meiner Tochter ist das verachtenswert. Im Laufe des Urlaubs wird sie mich dazu bringen, zumindest alle Alben in der richtigen Reihenfolge samt Erscheinungsjahr aufzuzählen. Und das Verrückte ist: Ich tue es gern. Um ihr einen Gefallen zu tun, um etwas mit ihr teilen zu können – gemeinsames Wissen ist Macht – und weil es mich wirklich interessiert. Weil ich mir wünsche, wieder 15 sein zu dürfen und ein Fan. Mit 55 kann man kein Fan mehr sein. Höchstens für ein paar betrunkene Stunden mitten in der Nacht, die man am nächsten Morgen lieber vergisst.
Ich kann es jetzt noch:
Taylor Swift (2006)
Fearless (2008)
Speak Now (2010)
Red (2012)
1989 (2014)
Reputation (2017)
Lover (2019)
Folklore (2020)
Evermore (2020)
Midnights (2022)
The Tortured Poets Department (2024)
„Red“ vergesse ich meistens, und bei „TTPD“ habe ich am Anfang natürlich immer „Dead Poets Society“ gesagt. Der kundige Kommentar meiner Tochter hierzu: „Dann wäre es ja genauso wie der Film. Das wär ja doof.“
In Poreč bleiben wir zwei Tage. Das Dorf ist wunderschön, aber final begraben unter einer Lawine von deutschen Autos, deutschen Bauchträgern und polyglotten Kellnern, die mithilfe artistischer Höchstleistungen die Touristen in ihre Lokale locken. Erstickt unter Souvenirläden mit Chinaschrott, worunter besonders Gummienten in allen Farben hervorstechen, sowie Süßigkeitenläden, die mit Anspielungen auf Johnny Depp unter falscher Piratenflagge segeln und uns in allen istrischen Ortschaften wieder-begegnen werden. Darin kann man kunstvoll gestapelte Türme aus Lutschern, Marshmel-lows und Badekugeln ähnlichen Objekten bewundern, die allesamt aus der gleichen Grundmasse hergestellt sind: 100% Zucker.
In der frühchristlichen Basilika, die mich zu Tränen rührt, sitzt meine Tochter lange still in der Bank und lässt mich gewähren. Früher hätte sie gemotzt, wann ich endlich fertig bin, die langweilige Kirche anzuglotzen etc. Als wir wieder auf die Straße treten, stolpere ich über eine Schwelle, versuche, mich zu fangen und lande auf beiden Knien. Mir ist das unendlich peinlich, aber meine Tochter eilt mir ganz unironisch zu Hilfe. Das gute Knie ist nur ein klein wenig aufgeschürft. Ich bemühe mich, auf dem schlüpfrigen Travertinpflaster bewusst aufzutreten.
Nachmittags suchen wir einen Ort zum Schwimmen. Doch nicht nur das Dorf ist erstickt, sondern auch das Meer. Die Wassertemperatur beträgt fast 30 Grad, und die Oberfläche ist in Ufernähe mit einem zähen Schleim überzogen, der die Farbe von Milchkaffee hat. Ich googele oder vielmehr ecosiere und finde heraus: Die gestiegene Meerestemperatur und die Einleitung organischer Stoffe begünstigen das Wachstum des Phytoplanktons. Das ist also der Milchkaffee: Trilliarden kleiner Meerespflanzen, die von der Strömung zu Feldern verdichtet und ans Ufer getrieben werden. Stranden können sie hier nirgends, weil es in Istrien keine Strände gibt; darum treiben sie als optische Barriere im Wasser.In der Ferne sehen wir das blaue Meer leuchten.
Verschwitzt liegen wir in der duftenden Pineta. Zwischen den Baumstämmen überall chaotisch geparkte Autos und achtlos hingeworfene E-Scooter, denn Touristen dürfen hier alles. Und das ersehnte Meer ist weiter weg als zu Hause in Berlin. Ein komisches Gefährt mit einem Mann darin, der frische Krapfen verkauft, fährt klingelnd vorbei. Zum Glück liegt fast kein Müll herum.
Das Internet ergeht sich in Beschwichtigungen, nennt das Phänomen euphemistisch „Meeresblüte“, beteuert, dass es für Menschen vollkommen unschädlich, natürlichen Ursprungs und schon aus dem 18. Jahrhundert bekannt sei. Aber meine Tochter und ich wissen beide, was wir nicht auszusprechen brauchen: Es ist die Klimakatastrophe, die daran schuld ist, also wir. Schon wieder könnte ich heulen, aber diesmal nicht aus Angst um meine Tochter oder vor Rührung über 1500 Jahre alte Mosaiken.
Trotzdem begeben wir uns ohne große Lust in die Brühe hinein. Am nächsten Tag wird es besser. Wir reisen gen Süden, nach Rovinj, das Wasser sieht ganz okay aus, und ich verstehe nicht, warum ihre Stimmung jetzt einbricht, nachdem wir uns bislang so gut gehalten haben. Beim Stadtspaziergang geht gar nichts mehr. Obwohl es nicht so heiß ist, dafür schwül, obwohl man direkt von dem Felsen, auf dem die Altstadt erbaut ist, ins Meer springen kann, obwohl wir diesmal mitten im Zentrumwohnen.
„Was hast du denn? Geht es dir nicht gut? Hast du wieder Kopfschmerzen? Hast du genug getrunken? Willst du ein Eis essen?“
„Weiß nicht.“
Wiewohl wir schon ein paar Tage im Urlaub sind und meine Tochter weiß Gott lang geschlafen hat, ist sie blass, hat Augenringe, gähnt in einem fort und schwankt beim Gehen, als würde sie auf Stelzen laufen, sodass ich befürchte, sie könnte wieder umkippen. Vielleicht ist sie unterzuckert. Wundern würde es mich nicht.
Ich breche den Rundgang ab, auch wenn wir nicht einmal zu dem berühmten Kirchturm hinaufgestiegen sind, der im Scheitelpunkt des Dorfes steckt wie eine zum Abschuss bereite Rakete.
„Wollen wir in die Ferienwohnung gehen und Netflix gucken?“
„Was sollen wir denn gucken?“
„Ich habe ‚Miss Americana‘ noch nicht gesehen. Du schon, klar, aber hast du Lust?“
Die dunkle Wohnung in dem spätmittelalterlichen Haus ist eine kühle Grotte. Wir legen uns hinein wie in eine Taucherglocke. Alle Fensterläden sind verriegelt. Kaum ein Laut dringt herein. Wir müssen den Film auf dem Handy gucken, weil wir uns im Fernseher nicht einloggen können. Ich schlage vor, dass wir uns abwechseln, aber sie hält das Handy die ganze Zeit fest in ihren Händen.
Alle zwei Jahre ein Album. Taylor arbeitet präzise wie eine Maschine. Die wenigen zeitlichen Unregelmäßigkeiten sind bezeichnend und erzählen eine eigene Geschichte. Drei Jahre Abstand zwischen „1989“ und „Reputation“ – Taylors Abtauchen nach der überwältigenden Verunglimpfung ihrer Person. Nur ein Jahr Abstand zwischen „Red“ und „Folklore“ und dazu noch zwei Alben in einem Jahr – Corona als Brutkammer der Schöpferkraft und Verinnerlichung, aber auch ein Schrei aus der Einsamkeit. Individuelle und intersubjektive Geschichte greifen ineinander. Ich verstehe ein bisschen besser, worum es bei Taylor geht.
Nach dem Film ist sie wie ausgewechselt. Heiter, aufgeräumt singt sie stundenlang im Bad. „Anti-Hero“: „Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I′m a monster on the hill.“ Von da an singt sie jeden Morgen und jeden Abend. Auf die Musik kann sie sich verlassen. Die Musik ist immer da. Jeden Tag schminkt sie sich eine Stunde lang, als ginge sie zu einem Date oder wenigstens in die Schule. Dabei ist sie nur mit ihrer alten Mutter zusammen. Einmal trägt sie die ganze Kunst sogar auf, bevor wir im Dunkeln die Wohnung verlassen, um eine Lightshow zu sehen, die dann nicht stattfindet.
Wenn wir durch die Straßen schlendern, folgen ihr die Blicke nicht mehr so ungeniert wie letzten Sommer. Sie ist kein bisschen weniger hübsch als damals, aber ich vermute, dass sie nicht mehr so schutzlos wirkt und darum die Männer ihre Blicke verstecken. Wir schlängeln uns durch die überhitzte, nachtfeuchte Altstadt und weichen nackten Körperteilen mit absurden Tattoos aus. Eine Frau hat sich eine menschliche Wirbelsäule auf den Rücken stechen lassen. Alle Restaurants sind voll, obwohl eines an das andere grenzt. Wir haben eh keinen Hunger.
Der nächste Tag wird gut. Völlig überraschend entdecken wir direkt vor unserer Haustür ein Café, wie man es hier nicht erwarten würde. Unversehens fühlen wir uns in die Großstadt zurückversetzt. Überall Hipster mit gepflegten Vollbärten, durchtrainierte blonde Frauen mit vorbildlicher Körperhaltung, verwöhnte Kinder, die ein Frühstück aus Zimtschnecken, Karottenkuchen, veganen Sandwiches und frischen Smoothies zum Preis von 30 Euro verzehren.
Größtes Hochgefühl: Meine Tochter ist in ihrer natürlichen Umgebung angekommen. Plötzlich sitzt sie aufrecht und beobachtet aufmerksam, was um sie herum geschieht. Amüsiert nehme ich die vielen Sprachen wahr, die hier durcheinanderpurzeln. Sogar Amerikanisch ist dabei, das man sonst hier nicht hört. Die dunkelhaarige Kellnerin ist attraktiv und selbstbewusst. Sie lässt sich von den aufgeblasenen Kunden nicht aus der Ruhe bringen. Ihr Englisch ist perfekt. Ich hätte Lust, mit ihr zu flirten. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre. Und wenn ich wüsste, wie das geht.
Wir bestellen den gleichen Luxus wie alle anderen. Es gibt sogar Hafermilch. Die Kellnerin zuckt nicht einmal mit der Wimper, als ich danach frage. Am Tresen steht ein Beaurista mit prächtigem langem Haar, kunstvoll zu einem Knoten geschlungen. Er bedient konzentriert die meterlange Kaffeemaschine, findet aber zwischendurch Zeit, den Kindern, die daran gewöhnt sind, ihre Wünsche zu erfüllen. Er versorgt sie mit Milchschaum, Bonbons und Erläuterungen zu unterschiedlichen Kaffeefarben, an denen man die Sorte und die Röstung erkennt.
Ein Familienvater aus NRW tut so, als wäre er Österreicher, indem er wie ein Mantra alle 30 Sekunden „Subba“ sagt, und löchert den Beaurista mit Fragen. Wie viel kostet die Maschine? Lohnt sich ein Upgrade? Was hält er von der Maschine, die in seinem Büro steht, und von seiner zu Hause? Welche Kaffeesorte nimmt er für den Macchiato und welche für den Latte? Der Magier beantwortet geduldig alle Fragen. Die Maschine funkelt kostbar. Wollen wir sie Taylor nennen? Kaum.
Gestärkt machen wir uns auf die Suche nach einer Badebucht. Mehrere Kilometer weit müssen wir durch eine Hotelanlage laufen, und ich verfluche die Idiotie der Flächenversiegelung. Auf dem gepflasterten Pfad, neben dem in kleinen Pferchen winzige Bäumchen wachsen, ist es mindestens zehn Grad heißer als im Pinienhain, den wir schließlich erreichen. Ganz am Ende der Halbinsel stoßen wir auf eine Bucht, wie ich sie am Mittelmeer erwarte: wild, romantisch, relativ einsam und weitgehend schleimfrei. Dafür nehmen wir in Kauf, auf spitzen Steinen zu liegen. Die Stunden zerfließen, irgendwann gucke ich auf die Uhr und sage: „Wahnsinn, schon halb sechs.“ Das liebe ich am meisten am Sommer im Süden: den totalen Zeitverlust. Und das Salzjucken auf der Haut. Nein, das nicht, aber es gehört dazu.
Meine Tochter ist den ganzen Tag gut drauf, auch als ich sie im Cabo schlage, was selten vorkommt.
„Du assiges Kalb.“
„Du kranker Schuft.“
Das ist die falsche Erwiderung, ich weiß. „Kranker Schuft“ passt nicht zur Situation, aber der Ausdruck gefällt mir so, und ich bin unsensibel für die Nuancen ihrer selbst erfundenen Beschimpfungen. Verstanden habe ich nur: Je rüder es klingt, desto zärtlicher ist es gemeint.
In der Bucht steht den ganzen Nachmittag lang eine Möwe fast unbeweglich auf einer Felsspitze. Eine zweite Möwe, noch mit braunemGefieder, läuft die ganze Zeit herum, als würde sie etwas suchen. Erst nach Stunden registriere ich, dass sie einen gebrochenen Flügel hat. Er steht schräg von ihrem Körper ab.
„Heilt der Flügel wieder?“, fragt meine Tochter.
Ich bezweifele es, angesichts der anatomischen Fehlstellung.
„Vielleicht. Aber das Hauptproblem ist, dass sie keine Fische fangen kann.“
Beklommen beobachten wir, wie die Möwe rastlos hin- und herläuft.
„Kann man sie nicht irgendwo hinbringen? Es gibt doch Auffangstationen und so was.“
„Nur für Schildkröten und andere seltene Tiere, glaube ich.“
Meine Tochter sucht im Internet nach Initiativen zur Möwenrettung, natürlich ohne Ergebnis. Die Möwe schaut uns an, als wolle sie fragen, ob wir nicht etwas zu fressen für sie hätten. Wir haben nicht einmal mehr Kekse. Ich kann den Blick nicht von ihr wenden. Wie lange dauert es, bis eine Möwe verhungert? Hat sie Fressfeinde? Mir fällt keiner ein. Höchstens andere Möwen.
Es gibt nichts, was wir tun können. Ich fühle mich hilflos. Der Tod und die Möwe gehören nun zusammen wie ein altes Ehepaar. Sie werden sich nicht mehr trennen. Trotzdem glaubt die Möwe, es gäbe noch Hoffnung für sie. Sie gibt nicht auf und verhält sich damit nicht anders als ein Mensch, mit dem Unterschied, dass der Mensch es schafft, sein Schicksal in manchen Fällen selbst zu bestimmen.
Als wir die Bucht verlassen und uns auf den Heimweg machen, sagt meine Tochter: „Hier würde ich morgen noch mal hingehen.“ Das ist eine ungewohnt klare Aussage. Ein Erwachsener würde stattdessen sagen: „Hier gefällt es mir.“ Beantwortet meine Tochter eine Frage mit „Weiß nicht“, bedeutet das: „Gefällt mir nicht wirklich, aber wenn du drauf bestehst, würde es mich nicht umbringen.“ „Können wir machen“ heißt: „Ich habe Lust darauf, will mich aber nicht festlegen.“
Nach und nach lerne ich ihre Sprache, da ich jetzt, wo wir nur zu zweit sind und ich will, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen, darauf angewiesen bin. Zu Hause pralle ich meist an diesem Gebirgsmassiv an Verschlossenheit ab, weil ich mich nicht genug anstrenge. Oder weil ich es mit Gewalt zu stürmen versuche, statt mich in die Trittspuren und Felsspalten hineinzuzwängen, die mir Zugang gewähren.
Der Abend vor unserer Weiterreise bleibt gelöst. Wir fühlen uns wohl in unserer Grotte, und es fällt schwer, sie wieder zu verlassen. Aber ich habe eine Bootsfahrt gebucht. Sonnenuntergang mit Delfinen.
Tatsächlich kriegen wir beides zu sehen, Delfine und Sonnenuntergang. Ungefähr 30 Ausflugsboote und private Yachten kreisen auf einer Meeresfläche, zwischen denen ab und zu zwei oder drei Rückenflossen auftauchen. Der Mensch ist ein verrücktes Wesen. 1000 Menschen flippen aus, wenn sie drei Delfine sehen. Das ist das Zahlenverhältnis, das wir der Evolution aufgezwungen haben.
Es ist ein Zirkus. Man kann nur hoffen, dass es den Delfinen egal ist. Vielleicht necken sie uns sogar, denn sobald sie an einer Stelle aufgetaucht sind, sind sie auch