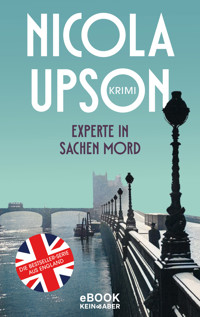17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Krimi
- Serie: Josephine Tey und Archie Penrose ermitteln
- Sprache: Deutsch
Der Schatten des aufziehenden Zweiten Weltkriegs reicht bis in ein idyllisches Dorf in der britischen Provinz, wo Josephine Tey mit ihrer Freundin Marta Zeugin eines weiteren Kriminalfalls wird. Ein historischer Dorfkrimi, der angesichts der heutigen Flüchtlingsbewegungen bedrückend aktuell ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Nicola Upson wurde 1970 in Suffolk, England, geboren und studierte Anglistik in Cambridge. Ihr Debüt Experte in Sachen Mord bildet den Auftakt der erfolgreichen, mittlerweile zehnbändigen Krimi-Reihe. Bei deren Hauptfigur Josephine Tey handelt es sich um eine der bekanntesten Krimi-Autorinnen des Britischen Golden Age. Mit dem Schnee kommt der Tod war nominiert für den CWA Historical Dagger Prize (2021). Nicola Upson lebt in Cambridge und Cornwall.
ÜBER DAS BUCH
1. September 1939: Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen, und Tausende von Kindern verlassen London, um aufs Land zu flüchten. Auch nach Suffolk, wo sich gerade Josephine Tey und ihre Freundin Marta in ihrem geliebten Cottage aufhalten, werden einige Kinder gebracht. Doch als bei der Ankunft ein Mädchen spurlos verschwindet und Detective Archie Penrose anreist, um es zu finden, wird Josephine schnell klar, dass sie längst in ihren nächsten Fall verstrickt ist. Im Chaos und der Ungewissheit des aufziehenden Krieges werden Josephines Sorgen bald überlagert. Wer hätte gedacht, dass die Kriegserklärung nicht das größte Gesprächsthema sein würde? Josephine muss erkennen, dass sich selbst in einer Zeit, in der sich alle vor Eindringlingen fürchten, die wahre Bedrohung in der Vertrautheit des eigenen Zuhauses verbergen kann.
Für meine Mutter und meinen Vater.
Das hier kommt von Herzen.
Die Kinder hatten sich bei den Apfelbäumen in der Mitte des Gartens versammelt und hielten die Köpfe in gespieltem Ernst geneigt, so wie sie es bei der Beerdigung erlebt hatten. Die Puppe – Maisie oder Prudence oder wer auch immer dieses Mal dran war – lag in einer Kiste zu Edmunds Füßen und war in einen Kissenbezug gehüllt, der als Totenhemd diente, und sie beobachtete vom Kinderzimmerfenster aus, wie er sie hochhob und vorsichtig in das flache Grab legte, das am Morgen geschaufelt worden war. Lillian – die stille, ernste kleine Lillian – hatte ihre Sonntagsschulbibel dabei und las eine Passage daraus vor, bekreuzigte sich und presste sich dann die Bibel an die Brust, als gäbe es auf der ganzen Welt nichts Wertvolleres. Florence, die sich nicht von ihren Geschwistern übertreffen lassen wollte, warf ihnen einen verstohlenen Blick zu, schluchzte theatralisch auf und vergrub das Gesicht in dem Taschentuch, das sie aus der Schublade ihrer Mutter entwendet hatte. Zu dritt standen sie trauernd neben dem frisch ausgehobenen Quadrat, das auf seine Bepflanzung wartete, dann griff Edmund erneut nach dem Spaten und füllte das Grab. Als er damit fertig war, rannten sie lachend über den sonnengebadeten Rasen, ohne weiter an die Puppe und ihre Trauer zu denken. Inzwischen lagen dort bestimmt vier oder fünf davon, dachte sie. Liebe kleine Leichen, fein säuberlich aufgereiht.
31. AUGUST1939
1
Angesichts des hellen Vollmonds waren jegliche Verdunkelungsbemühungen überflüssig. Josephine zog die Haustür hinter sich zu und trat in den Garten, wo eine schelmische, hungrige Brise das erste herabgefallene Laub des Jahres jagte. Der unebene Weg unter ihren Füßen war knochenhart und ausgedörrt, die Landschaft rings um das Cottage sichtlich von der Spätsommerhitze erschöpft; sogar jetzt, kurz vor Mitternacht, konnte der leichte Wind der drückenden Schwüle nichts anhaben. Ein Donnergrollen in der Ferne verhieß Erholung von der Anspannung, und sie fragte sich, ob die Glückssträhne, mit der die Erntezeit in Suffolk bedacht worden war, bald reißen würde. Die Felder waren zur Hälfte abgeerntet, und das Verhältnis von Stoppeln zu kräftigen, goldgelben Maispflanzen klaffte mit jedem Tag weiter auseinander, doch im scharfen Silberschein des Mondes schien alles stillzustehen, als warteten die Äcker – ebenso wie die Männer, die sie bewirtschafteten – mit angehaltenem Atem ab, welchen Kurs die Welt einschlagen würde.
Am Gartentor blieb sie stehen und schaute zurück zum Cottage, um die verdunkelten Fenster zu betrachten. Gemeinsam mit Marta hatte sie den gesamten Nachmittag über sorgfältig Vorhänge schwarz gefüttert, wie für eine anstehende Beerdigung. Oft stand sie abends hier und erfreute sich an dem Zuhause, das sie einander aufgebaut hatten, am Duft der Blumen oder an den Überresten einer Mahlzeit auf dem Tisch – Zeichen einer einfachen, gemeinsamen Existenz inmitten zweier komplizierter Leben, die sonst separat verliefen. In dieser Nacht wirkte das Cottage ohne die gemütliche Beleuchtung bereits trist und verlassen, als ahnte es, dass es im Stich gelassen werden sollte, und hätte beschlossen, ihnen zuvorzukommen. Die geringfügige Veränderung des Ortes, der ihr so viel bedeutete, erschreckte Josephine – viel mehr noch als die groß angelegte Umgestaltung Londons, das sich auf den Krieg vorbereitete und Veränderungen vornahm, durch die die geliebte Stadt ihr fremd wurde. Sie betrachtete die nichtssagende Anonymität des Hauses, doch das ersehnte Gefühl der Sicherheit stellte sich nicht ein; stattdessen kam sie sich vor, als würde sie in einen Abgrund rutschen.
Ein Lichtstreifen von der Türschwelle unterbrach ihre Gedanken, und Marta gesellte sich zu ihr. »Das haben wir gut gemacht.« Sie reichte Josephine einen Drink und musterte zufrieden die Fenster. »Da findet selbst der scharfsichtigste Jerry nichts.« Erneut grollte der Donner, diesmal näher, und es fühlte sich an wie ein unheilvoller Probealarm für die ungewissen Monate, die auf sie zukamen. »Wir überstehen das«, sagte Marta leise und nahm Josephine bei der Hand. »Egal, wie lange es dauert oder wie schlimm es wird, wir überstehen das.«
Drinnen klingelte das Telefon und drohte Martas Worten den tröstlichen Effekt zu nehmen. Immer, wenn es klingelte – selbst zu passenderen Tageszeiten –, fürchtete Josephine inzwischen das Schlimmste. »Vielleicht ist es Archie«, sagte sie, während sie wieder hineingingen. »Am Ende ist ihm auf der Arbeit etwas dazwischengekommen, und er kann das Wochenende doch nicht hier verbringen.«
Doch es war Hilary Lampton, die Frau des Pfarrers und eine von Josephines engsten Freundinnen im Dorf. »Entschuldige bitte, dass ich so spät noch störe«, sagte sie. »Habe ich dich geweckt?«
»Nein, wir sind noch wach. Ist alles in Ordnung?«
»Ja, alles gut – zumindest hoffe ich das. Der Mann aus Hadleigh war um kurz nach neun hier. Sie kommen morgen früh.« Die Aussage war nur deshalb verständlich, da Hilary seit Monaten fast ausschließlich über die Evakuierung sprach. Seit dem Fehlalarm im Vorjahr, als der Kriegsausbruch gedroht hatte, dann jedoch mit Chamberlains schicksalhafter Reise nach München in den Hintergrund gerückt war, bereitete sie das Dorf auf einen Zustrom von Stadtkindern vor. Hilary Lampton stand einer Gruppe von Frauen vor, die – nach Josephines Einschätzung – erfolgreich die gesamte Kriegführung hätten übernehmen können. Viel Zeit und Mühe war in das Vorhaben geflossen: Die hoffnungslos veraltete offizielle Volkszählungsliste musste mit der echten Situation im Dorf vereint und potenzielle Unterkünfte besichtigt werden, und Josephine hatte den Sorgen ihrer Freundin mitfühlend gelauscht. Insgeheim war sie jedoch froh, dass sie aufgrund ihres häufig wechselnden Wohnsitzes aus dem Schneider war. »Wir bekommen insgesamt zwanzig«, verkündete Hilary, als hätte sie damit den Hauptgewinn gezogen. »Der Bus kommt gegen halb zwölf an der Schule an. Könntest du vielleicht aushelfen? Ich wäre dir ungemein dankbar.«
Josephine wurde schwer ums Herz. »Es tut mir wirklich leid, Hilary, aber ich habe dir doch erklärt, dass ich niemanden aufnehmen kann. Ich reise bald zurück nach Schottland, und dann müsste ich dich im Regen stehen lassen.«
»Nein, so meinte ich das gar nicht. Wir haben alle untergebracht, theoretisch zumindest, und zwar dort, wo sie erwünscht sind. Das ist das Mindeste, was Kinder verdienen. Es wird sowieso schon schwer genug, zum ersten Mal allein von zu Hause fort zu sein. Von wegen ›fünf Zimmer, dreiköpfige Familie, da ist also Platz für zwei‹. So einfach lässt sich das Leben nicht berechnen, oder?« Hilary klang ständig, als befände sie sich mitten in einer endlosen Aufgabenliste, und Josephine nahm zu Recht an, dass die Frage rhetorischer Natur war. »Insgesamt geben wir eine gute Figur ab. Natürlich ist es leichter, weil wir keine Erwachsenen bekommen. Da bräuchte es schon mehr als nur fünf Shilling von der Post, um eine Fremde in die Nähe seiner Küche zu lassen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber Kinder sind was anderes.« Josephine lächelte. Sie verstand, was Hilary meinte, obwohl sie weniger mit der Dorfgemeinschaft zu tun hatte. Die Leute freuten sich darauf, junge Gesichter zu begrüßen – womöglich wollten sie damit unbewusst die Verluste kompensieren, die ihnen bevorstanden. »Ich bin mir sicher, dass sie sich hier wohlfühlen werden«, fuhr Hilary fort. »Stephen ist gerade mit dem Rad unterwegs und sagt den Leuten Bescheid, dass sie sich bereithalten sollen, und alle ziehen mit.«
Hilary schien ihr zwar keinen Vorwurf machen zu wollen, doch Josephine konnte sich nicht gegen das Gefühl wehren, dass ihre eigenen Kriegsanstrengungen zu wünschen übrig ließen. »Also, was können wir für dich tun?«, fragte sie.
»Ich will ihnen einen ordentlichen Empfang bereiten. Die Armen sind seit Sonnenaufgang unterwegs, und ich brauche ein paar Leute, die ihnen ein bisschen Zuspruch geben, während wir sie den Unterkünften zuordnen. Nur ein bisschen Tee und warme Worte, und es dauert auch gar nicht lange. Ich verstehe natürlich, wenn du keine Zeit hast, und ich habe dir ja auch schon den Samstagnachmittag für das Gemeindefest geklaut, aber ich dachte, ich frage mal nach, falls euch beiden langweilig ist.«
Von Langeweile konnte keine Rede sein. Gerade genoss Josephine die kostbaren letzten Tage mit Marta, bevor sie erneut voneinander getrennt sein würden, doch ihr fiel keine selbstlosere Erklärung ein, und die Stille in der Leitung wurde allmählich unangenehm. »Ja, natürlich«, erwiderte sie schließlich und zuckte entschuldigend mit den Schultern, als Marta von ihrem Buch aufsah. »Wir helfen gerne. Wann sollen wir da sein?«
2
Penrose hätte den Gedanken zwar nie laut ausgesprochen, doch die Leiche hatte eine merkwürdig beruhigende Wirkung auf ihn. Mit diesem Anblick war er vertraut, und bislang war der Tag alles andere als normal verlaufen.
Der Körper des Mannes lag in der Ecke des Treppenabsatzes im zweiten Stock um eine Stoffschere gekrümmt, die ihm jemand in den Bauch gerammt hatte. Offensichtlich war er nicht hier erstochen worden, dafür fehlte es an Blut, und Penrose warf einen Blick zur Treppe. Woher war das Opfer gekommen, und hatte es sich selbst hierhergeschleppt, oder hatte jemand nachgeholfen? Er entdeckte weder Schrammen an der Wand noch verräterische Blutspuren, und das war an sich bereits interessant.
Die Tätersuche dürfte sich in jedem Fall undankbar gestalten; er stellte sich auf geschlossene Türen und einsilbige Antworten ein. Castlefrank House, das auf der Ostseite der Hoxton Street lag, war ein Arbeiterwohnbau, der vor dem Krieg errichtet worden war – vor dem letzten Krieg, wie es bald heißen würde. Inzwischen wohnten die unterschiedlichsten Menschen dort – Eisenbahner, Einzelhandelsangestellte, Mitarbeitende der nahe gelegenen Fleischfabrik –, doch sie alle hatten eine Sache gemeinsam: Sie konnten den Mund halten, wenn es ihnen passte, und ein Polizist an der Wohnungstür würde sicher keinen plötzlichen Mitteilungsdrang auslösen.
Erneut war es unangenehm schwül, und Penrose streifte sich widerwillig die Handschuhe über. Das Treppenhaus kam ihm jetzt schon erdrückend vor. Er ging neben der Leiche in die Hocke, um das Gesicht des Mannes in Augenschein zu nehmen, wobei ihm eine abgestandene Fahne entgegenschlug. Das Opfer war mittleren Alters, hatte mattbraune Haare, die an den Schläfen langsam ergrauten, sowie einen dunklen Bartschatten. Ein zerknittertes Hemd mit schmutzigem Kragen trug zu seiner verwahrlosten Erscheinung bei, doch seine Kleidung war nicht billig; er schien sich bloß nicht darum gekümmert zu haben. Vorsichtig schlug Penrose das Revers seines Jacketts zurück und zog den Inhalt der Innentasche hervor – ein dickes Geldbündel, ein Notizbuch und ein Bleistiftstummel. Eine Liste mit Namen und Wohnungsnummern stand in dem Büchlein, manche waren abgehakt und mit einem Datum versehen. Immerhin dürfte sich die Frage, wer ihn zuletzt gesehen hatte, leicht beantworten lassen.
Hinter ihm kam sein Sergeant schnaufend die Treppe hinauf und murmelte etwas darüber, dass sich nie jemand im Erdgeschoss ermorden ließe. »An Verdächtigen wird es uns jedenfalls nicht mangeln«, sagte Fallowfield, nachdem er wieder zu Atem gekommen war. »Der Kerl war …«
»Mieteintreiber?« Penrose hielt das Notizbuch hoch, bevor Fallowfield ihm hellseherische Fähigkeiten zuschreiben konnte. »Auf das Geld hatte derjenige es jedenfalls nicht abgesehen. Er hatte mehr bei sich, als die meisten Leute in einem Jahr verdienen.«
»Vielleicht war einfach jemand zu weit im Verzug. Hat einen Ausweg gesehen, und zack.«
»Vielleicht. Wie heißt er?«
»Frederick Clifford. Kommt jeden zweiten Freitag, man kann wohl die Uhr nach ihm stellen. Die Frau, die uns gerufen hat, wohnt im Erdgeschoss. Sie war auf dem Weg nach oben zu einer Nachbarin, um einen Topf zurückzubringen. Das war gegen halb zehn, und sie hat uns sofort gerufen.«
»Ich nehme an, sie hat niemanden gesehen oder gehört, und ihr fällt auch nichts ein, das uns weiterhelfen könnte?«
»Natürlich nicht, Sir. Er war heute Morgen schon bei ihr, aber da hat sie nichts Ungewöhnliches bemerkt. ›Gleiches niederträchtiges Arschloch wie immer.‹ Hat verständlicherweise nix für ihn übrig. Spilsbury ist mit seinen Leuten unterwegs. Robertson wartet unten, damit er ihn direkt herführen kann.«
»Gut. Nächste Angehörige?«
Fallowfield zuckte die Achseln. »Noch nichts Persönliches, aber wir haben die Telefonnummer von seinem Chef, da fangen wir an.«
»Das Haus gehört ihm also nicht.«
»Nein, er war nur für die Drecksarbeit zuständig. Die Besitzer –«
Fallowfields Worte gingen im Lärm unter, der plötzlich aus dem dritten Stock ertönte. Türen wurden zugeknallt, und laute Stimmen erklangen, während der dort stationierte Polizist versuchte, seine Anweisungen zu befolgen. »Die Treppe ist im Moment nicht zugänglich, meine Damen«, rief er, doch er hatte keine Chance gegen die zahlreichen Bewohner, die anscheinend alle auf einmal ihre Wohnungen verlassen wollten. Die Schritte wurden lauter, und Penrose wappnete sich für eine Auseinandersetzung. Mehrere Frauen und Kinder kamen auf ihn zu. Die Anführerin, eine Blondine Anfang dreißig, hielt ein kleines Mädchen an der Hand und starrte ihn herausfordernd an, während er und Fallowfield sich größte Mühe gaben, die Leiche abzuschirmen. Auf einmal war Penrose froh um die schlechten Lichtverhältnisse. Bis auf einen der älteren Jungen schien niemand entsetzt oder auch nur neugierig angesichts der Vorfälle, was ihm ungewöhnlich vorkam.
»Wir müssen die Rasselbande zum Bahnhof schaffen«, erklärte die Frau. »Heute werden sie wirklich weggeschickt, und wir dürfen nicht zu spät kommen. Außerdem haben Sie kein Recht, uns hier festzuhalten.«
»Das habe ich auch gar nicht vor.« Penrose wollte sie genauso sehr aus dem Haus scheuchen, wie sie verschwinden wollte, und es traf sie anscheinend unerwartet, dass sie die Schlacht gewonnen hatte, bevor sie überhaupt losgegangen war. Er betrachtete die Kinder, die alle eine kleine Tasche oder einen Kissenbezug trugen, und fragte sich, was wohl in ihren Köpfen vorging. Selbst den Erwachsenen fiel es schwer, diese neue, seltsame Welt zu begreifen. »Mein Sergeant begleitet Sie nach unten«, sagte er. »Aber hinterlassen Sie bitte Ihre Namen und Adressen. Sobald Sie zurückkommen, möchten wir mit Ihnen sprechen.«
»Wieso? Wir haben damit doch nichts zu tun.«
»Das glaube ich gern, aber wir müssen trotzdem mit sämtlichen Bewohnern reden.« Er versuchte, so viel Platz wie möglich um die Leiche zu lassen, und manövrierte die Gruppe im Gänsemarsch vorbei. Wie schnell es doch unmöglich geworden war, die Ausläufer des Kriegs zu vermeiden. Die Kampfhandlungen hatten noch nicht einmal begonnen, doch überall stieß man auf Anzeichen. Auf seinem Weg zum Tatort war er im Chaos an der Liverpool Street stecken geblieben, und die Menschen, die zu Tausenden in den Bahnhof oder hinausströmten, hatten ihn erschreckt, obwohl er mit den Evakuierungsplänen und dem Ausmaß der Operation vertraut war. London hatte sich zwar sichtlich auf Veränderungen eingestellt – Autos schoben sich mit verdeckten Scheinwerfern durch die Straßen, kultivierte BBC-Sprecher erklärten das Verhalten im Falle eines Luftangriffs –, doch das hier war anders. Das hier fühlte sich an, als würde alles Vertraute und Verlässliche zerbrechen. Er sah den Kindern, die ihr Zuhause verließen, tieftraurig hinterher, als würde die Hoffnung auf einen anderen Verlauf mit ihnen verschwinden. Noch vor wenigen Tagen waren sie eine friedliebende Nation gewesen. »Viel Glück«, rief er ihnen in einem seltenen Anflug von Sentimentalität hinterher. »Hoffentlich kommen sie bald wieder zurück.«
Die Mutter am Ende der Gruppe drehte sich um. Offensichtlich hatte sie nicht mit freundlichen Worten gerechnet. Er bemerkte die Qual in ihrem Blick – sie gehörte zu den Tausenden von Eltern, die zu Hause darauf warten würden, dass ihnen jemand den Aufenthaltsort ihrer Kinder verriet. Es berührte ihn, und schlagartig wurde ihm klar, dass er kein unparteiischer Beobachter mehr war. Nun gab es Kinder, die ihm etwas bedeuteten, eine Frau, die ihm immer mehr ans Herz wuchs. Die fremde Mutter tat ihm nicht nur leid, er konnte ihre Angst und Unsicherheit nachvollziehen. Sie schaute kurz zur Leiche und schien etwas sagen zu wollen, doch ein Junge, vermutlich ihr Sohn, zog sie weiter.
Als im Treppenhaus wieder Ruhe herrschte, wandte er sich der Leiche zu, wobei ihn die Vorstellung bedrückte, dass ein Ableben von so wenig Kummer begleitet werden konnte. Vielleicht würde er bei denjenigen, die dem Opfer nahegestanden hatten – sofern sie denn existierten –, auf mehr Mitgefühl stoßen, doch er bezweifelte es. Nach zahllosen leichengefüllten Jahren besaß er einen Instinkt dafür, welche Mordfälle dem Täter mehr zusetzten als dem Opfer. Er hoffte zwar, dass es seine Ermittlungen nicht beeinflussen würde, doch hierbei handelte es sich mit Sicherheit um einen davon. Die Antwort lag hinter einer der verschlossenen Wohnungstüren, und fast hätte er nichts dagegen, sie nie zu erfahren.
Er wusste, dass er dem Opfer damit unrecht tat, und durchsuchte Cliffords restliche Taschen, wobei er einen Führerschein und die Anschrift fand, die er gesucht hatte. Er lebte ein paar Straßen weiter in Hackney, ein gutes Stück gehobener als hier, wo er die Mieten eintrieb. Wahrscheinlich lag Fallowfield richtig, und eine Mischung aus Schulden und Verzweiflung hatte jemanden im Affekt zu der Tat getrieben. In diesem Fall hätte er allerdings damit gerechnet, dass derjenige ihm einen Schlag gegen den Kopf versetzt oder ihn die Treppe hinuntergestoßen hätte. Die tödliche Verletzung schien tief zu reichen, und er konnte sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern, dem kein persönliches Motiv sowie Wut, Angst oder Missgunst zugrunde gelegen hätte. Spilsbury würde ihm genauere Informationen verschaffen, und immerhin war die Schere eine ungewöhnliche Tatwaffe und ließe sich leichter zurückverfolgen als ein Rasiermesser oder ein gewöhnliches Küchenmesser. Wieso der Täter oder die Täterin wohl nicht auf die Idee gekommen war, die Schere zu entfernen?
Vertraute Stimmen erklangen aus dem Erdgeschoss, und er überließ die Tatortfotografen ihrer Arbeit, während er ins Freie ging, um das weitere Vorgehen mit Fallowfield zu besprechen. Jedes zweite Gefährt auf der Hoxton Street war ein Armeelaster, und die Stadt wirkte mit einem Mal zwiegespalten. In manchen Straßen ging es still und zivilisiert zu, während in anderen Militärkonvois unter Bäumen bereitstanden und an Frankreich erinnerten.
»Dieses Mal fühlt es sich anders an, oder?« Fallowfield konnte seine Gedanken mit einer Leichtigkeit lesen, die Penrose im Laufe der Jahre als tröstlich zu schätzen gelernt hatte. Die beiden ähnelten einander kein bisschen, waren das genaue Gegenteil, was Herkunft und Veranlagung betraf, und nicht im selben Alter, doch sie hatten beide im letzten Krieg gekämpft, und die geteilte Vergangenheit sowie das gegenseitige Verständnis, das die Arbeit von ihnen verlangte, ermöglichte ihnen eine Kommunikation ohne große Worte.
»Völlig anders«, erwiderte Penrose. Ein Laster stand an der roten Ampel, und Penrose musterte die abwesenden, grüblerischen Gesichter der Soldaten. Er wusste nicht, ob er sich über den Mangel an hurrapatriotischem Eifer freuen sollte, der bei seiner Einberufung geherrscht hatte, oder ob er die fehlende Naivität bedauerte. Die Männer, die dieses Mal die Uniform überstreiften, misstrauten dem Krieg und ließen sich nicht von der trügerischen Romantik der Schlachtfelder täuschen, und ihre Unsicherheit war nachvollziehbar. Damals, vor über zwanzig Jahren, hatte er keinen Zweifel und kaum eine Wahl gehabt. Mit fünfundvierzig befand er sich nun vier Jahre jenseits der Altersgrenze für die Einberufung, und seine Pflichten waren verschwommener als je zuvor, egal ob in Kriegs- oder Friedenszeiten. Er konnte seine plötzliche Nutzlosigkeit nicht ausstehen. »Gott weiß, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit sind«, seufzte er.
»Apropos, sollten Sie sich nicht langsam auf den Weg zurück zum Yard machen? Ich dachte, Sie haben um elf eine Besprechung mit dem Chef?«
»Stimmt. Was glauben Sie, warum ich hier bin?«
Fallowfield grinste. »Dann machen Sie sich lieber mal davon, Sir. Dank Operation Rattenfänger sind einige Straßen gesperrt. Ich kümmere mich ums Türklopfen und bringe Sie nachher auf den neusten Stand.«
Penrose nickte widerstrebend und ging zu seinem Wagen. Er fuhr über einen Umweg Richtung Embankment, um den Autos und Bussen auszuweichen, die aus der Stadt strömten, und fragte sich, wer auf die glänzende Idee gekommen war, die Evakuierung nach einem Märchen zu benennen, in dem Kinder auf Nimmerwiedersehen von ihren Eltern weggelockt wurden.
3
Maggie Lucas saß auf dem Bett ihrer Tochter und kontrollierte ein letztes Mal, ob der Inhalt des Tornisters mit der Liste übereinstimmte, die sie von der Schule bekommen hatte: ein zusätzliches Paar Socken, Wechselunterwäsche, Nachtwäsche, zwei saubere Taschentücher, Sportschuhe für drinnen, Zahnbürste, Kamm und Handtuch. Die Liste war übersichtlich, und sie war sie bestimmt schon hundert Mal durchgegangen, doch Angela sollte alles haben, was sie brauchte. Seufzend schloss sie den Tornister und stellte den Schultergurt ein. Sie wünschte, sie hätten sich den empfohlenen Rucksack leisten können, aber dieser hier würde reichen, und andere Kinder waren noch schlechter ausgestattet. Es war schon schlimm genug, dass sie überhaupt wegmusste.
Falls sie denn wegmusste.
Da waren sie wieder, die Zweifel, die sie nachts wach hielten und tagsüber plagten. Sie hatte es bis zum Überdruss mit Bob durchgesprochen, doch sie war sich noch immer nicht sicher, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatten – und sie merkte, dass es ihrem Mann genauso ging, obwohl er es sich weniger anmerken ließ. Sie spürte mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie die Familie im Falle des Kriegsausbruchs lieber zusammenhalten sollte, doch die Argumente in dem braunen Umschlag, der hinter der Uhr auf dem Kaminsims auf Bobs Rückkehr von der Arbeit gewartet hatte, waren überzeugend gewesen: Auf dem Land stünden die Chancen besser, hieß es; es gebe zwar keine Garantie – so weit könne man nicht gehen –, doch für die Kinder sei es sicherer als zu Hause. Darauf folgten Versammlungen in der Schulaula, reihenweise fassungslose Eltern, die Vorträgen über Vernichtungsschläge und Toten pro Tonne lauschten, als würden die Bomben bereits herabfallen. Sie konnte sich kaum noch daran erinnern, dass es einmal eine Zeit gegeben hatte, in der sie das Wort »Evakuierung« nicht benutzten; zu Hause unterhielten sie sich über nichts anderes, das Thema füllte sämtliche Zimmer, und schließlich trafen sie eine Entscheidung. Bob war an jenem Abend in den Pub gestürmt, obwohl es erst Montag war, während sie sich in die Küche zurückzog, um das Abendbrot zu richten. Sie klapperte mit dem Geschirr, damit Angela sie nicht weinen hörte.
Der Tornister fühlte sich lächerlich leicht an, lächerlich unzureichend, um ihr Kind zu beschützen. Angela saß am Esstisch und hatte ihr Frühstück nicht angerührt. In der kleinen Küche roch es intensiv nach Speck, und Maggie verdrehte sich der Magen. Der Anblick erinnerte sie an eine Henkersmahlzeit, wobei sie nicht genau wusste, wer von ihnen die Verurteilte war. »Na los, mein Schatz, iss etwas«, sagte sie fröhlich. Sie konnte ihren aufgesetzten Ton nicht ertragen. »Du musst bei Kräften bleiben, und das hier magst du doch am liebsten.«
»Mag ich überhaupt nicht. Das ist ekelhaft.«
»Das ist doch nicht ekelhaft.« Sie setzte sich und griff nach Angelas Hand, die ihr jedoch sofort ruckartig entzogen wurde. Der Speck und die Eier, die eigentlich etwas Besonderes hätten sein sollen, erstarrten auf dem Teller zwischen ihnen. »Du brauchst etwas im Magen, mein Schatz. Du hast einen langen Tag vor dir.« Der Gedanke, Angela könnte das Haus mit leerem Magen verlassen, drohte sie zu überwältigen. »Bitte, Angie. Ein kleines Stück Toast vielleicht?« Sie griff nach der Marmelade, doch Angela schüttelte mit der Sturheit einer Fünfjährigen den Kopf. Sie schob den Teller an den Tischrand, traute sich allerdings nicht, ihn ganz auf den Boden zu stoßen. Maggie schnappte ihn sich und kratzte das Essen in den Mülleimer. »Na gut, wie du meinst. Dann geh dir jetzt die Hände und das Gesicht waschen. Die sollen nicht denken, du wärst unter die Räuber gefallen.«
Kurz sah ihre Tochter verletzt und verängstigt aus, und Maggie wünschte, sie wäre nicht so ungeduldig gewesen, doch da war Angela schon aus dem Zimmer gestürmt, ähnlich wie an dem Abend, an dem sie ihr eröffnet hatten, dass sie ohne ihre Eltern aufs Land geschickt werden würde. Sie hatten es so lange wie möglich hinausgezögert, was rückblickend recht egoistisch gewesen war, da Angela so kaum Zeit gehabt hatte, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Und sie hatte genauso reagiert, wie sie befürchtet hatten, wenn nicht noch schlimmer. Vor Nervosität verhaspelten sie sich, und nachdem einmal das Wort »wegschicken« gefallen war, ließ es sich nicht zurücknehmen. Ein passenderes Wort gab es nicht, aber es klang harsch und ablehnend. An jenem Abend sowie an allen darauffolgenden versuchten sie, ihr zu erklären, dass es zu ihrem eigenen Besten sei, dass ganz viele andere Mädchen und Jungen dabei wären, denen es genauso ginge wie ihr, dass es nicht lange dauern würde und sie das Beste daraus machen müssten, dass es für ihre Eltern, die ohne sie zurückbleiben würden, viel schwieriger sein würde – doch sie glaubte ihnen kein Wort, und Maggie wagte zu bezweifeln, dass ihre Tochter ihnen je wieder vertrauen würde. Sie konnte es ihr nicht verdenken. Alles geschah so plötzlich, und was sollte sie von den Unbekannten halten, zu denen sie geschickt wurde? Fremde wirkten auf Fünfjährige weitaus bedrohlicher als ein paar Metallstücke, die vom Himmel fielen, und Angela ließ sich durch nichts beruhigen. Selbst jetzt konnten sie ihr nicht erklären, wohin sie fahren, bei wem sie unterkommen und wie sie behandelt werden würde. Und warum – das waren die schwierigsten Fragen von allen. Warum muss ich weg? Warum wollt ihr mich nicht mehr? Warum habt ihr mich nicht lieb?
Die Uhr schlug zur halben Stunde und riss Maggie aus ihren Gedanken. Sie konnte es nicht länger hinauszögern: Sie musste Brote für die Fahrt schmieren, und dann mussten sie los. Das Brot war frisch und knusprig, und sie schnitt mehr Käse auf als sonst. Dann packte sie ein paar Kekse und einen Apfel ein – hoffentlich hätte Angela wenigstens darauf Lust. Sie durfte nichts zu trinken mitnehmen, also legte sie noch zwei Stangen Gerstenzucker dazu, falls Angie Durst bekäme oder ihr im Zug schlecht würde. Von ihrer Tochter war immer noch keine Spur. Maggie packte den Proviant in den Tornister und rief die Treppe hinauf: »Na los, mein Schatz. Wir dürfen nicht zu spät kommen.«
Sie wartete zwei Minuten, dann ging sie nach oben. Angela saß umringt von ihren Lieblingsspielsachen auf ihrem Bett, und Maggie zerriss es zum hundertsten Mal an diesem Morgen das Herz. »Mein Schatz, wir haben doch besprochen, dass du nicht alle mitnehmen kannst. Du darfst dir eins aussuchen.« Angie sah sie an, als wäre das der schlimmste Verrat von allen, stand auf und ging mit leeren Händen an ihr vorbei. Anscheinend wollte sie alles oder nichts, also schnappte sich Maggie die blauäugige Stoffpuppe Polly, die Angie seit ihrem dritten Geburtstag begleitete. Vielleicht könnte sie ihr noch ein paar andere schicken, sobald sie erfuhr, wo ihre Tochter untergekommen war, und bestimmt gäbe es dort auch Spielsachen – so würde sie es zumindest halten, wenn sie die Gastgeberin in dieser Situation wäre. Aus irgendeinem Grund weckte dieser Gedanke ihre tiefsten Ängste, die sie nicht einmal Bob anvertraut hatte, um nicht selbstsüchtig zu wirken. Natürlich betete sie, die Familie würde freundlich sein, aber noch intensiver betete sie darum, dass Angela Heimweh hätte und sie vermissen würde. Wenn sie nachts wach lag, mischten sich komplexere Gefühle unter die Traurigkeit darüber, von ihrem Kind getrennt zu sein. Die Vorstellung, die Ersatzeltern könnten Angie Dinge bieten, mit denen ihre echten Eltern nicht mithalten konnten. Sie sah immer noch lebhaft die Freude auf dem Gesicht ihrer Tochter vor sich, als sie an ihrem letzten Geburtstag gemeinsam in den Victoria Park gefahren waren; sie war ganz begeistert von den Blumen und dem Vogelgezwitscher gewesen, und natürlich würde es ihr auf dem Land genauso gehen. Sie hatten nicht genug Ausflüge mit ihr unternommen, und jetzt würde das jemand anders übernehmen und Angie mehr über die Natur beibringen, als sie es je könnte. Warum hatten sie sich nicht mehr Zeit genommen? Im Nachhinein wirkte es immer so einfach.
Unten half sie Angie dabei, die Schuhe zuzubinden und die Knöpfe an ihrem Anorak zu schließen. Die kleinen Details, auf die sie noch vor wenigen Tagen stolz gewesen war, wirkten nun schäbig und zweitklassig: Die Jacke war ihr zu groß, den sorgfältig polierten Schuhen würde sie bald entwachsen, und erneut wünschte Maggie, sie hätten sich einen besseren Rucksack oder sogar einen kleinen Koffer leisten können. Aber sie war sauber und ordentlich gekleidet, und ihr dichtes blondes Haar duftete nach Seife; immerhin wüsste die neue Familie, dass sie geliebt wurde. Bevor Angie sich wehren konnte, drückte Maggie sie fest an sich, sog ihren Duft ein, versuchte, sich an die Berührung und den Rhythmus ihres Atems zu erinnern, damit sie etwas hätte, das sie durch die nächsten Wochen und Monate bringen würde. Sie spürte, wie Angie sich entspannte, ihre Wut der Liebe ihrer Mutter nicht gewachsen war, doch es tröstete sie nicht. Die Verletzlichkeit ihrer Tochter, die womöglich darauf hoffte, in letzter Sekunde verschont zu bleiben, war schlimmer als ihr Trotz, und beinahe musste sich Maggie vor Scham abwenden. Mit einem aufgesetzten Lächeln hängte sie eine Pappschachtel über Angies Schulter. Sie wehrte sich nicht – Gasmasken waren noch eine aufregende Neuerung –, doch der Geruch von Gummi und Desinfektionsmittel beschwor die drohende Gefahr herauf, und Maggie war froh, dass die Maske sicher in der Kiste verpackt war.
Sie öffnete die Haustür, wollte so tun, als handelte es sich um einen normalen Schultag, doch sie schaffte es kaum bis auf den Bürgersteig, bevor die Illusion zerplatzte. Offenbar war sie nicht die einzige Mutter, die das Unausweichliche bis zum letzten Augenblick hinausgezögert hatte, und ihre Verzweiflung spiegelte sich in den Gesichtern ihrer Freundinnen und Nachbarinnen wider, mit denen sie zur Schule strömte. Der Spielplatz war voll von Menschen. Lehrkräfte hakten Namen auf Klemmbrettern ab und verteilten Armbänder und Schilder, arbeiteten fröhlich zu Abzählmelodien aus den Kehlen übermütiger Kinder, die bereits abgehakt waren und darauf warteten, dass es endlich weiterginge. Maggie betrachtete die glücklichen Gesichter. Was sich die anderen Eltern wohl hatten einfallen lassen, um keine Strafe, sondern ein großes Abenteuer daraus zu machen? Sie hielt Angelas Hand fest umklammert und fragte sich, ob es für eine Kehrtwende zu spät war. Anscheinend stand sie eine ganze Weile am Tor, denn plötzlich legte ihr eine Lehrerin, an deren Namen sie sich nicht erinnern konnte, eine Hand auf den Arm. Da merkte sie, dass ihr Tränen über das Gesicht flossen. »Sie können Angela jetzt bei uns lassen, Mrs Lucas«, sagte die Frau, und Maggie starrte auf ihr Namensschild. Genau, Miss Place – Angie war ganz vernarrt in sie, das hätte sie sich merken müssen. »Wir passen gut auf sie auf, versprochen.«
Maggie ging in die Hocke und gab ihrer Tochter einen Kuss. »Du musst jetzt ein tapferes großes Mädchen sein«, erklärte sie, wobei sie sich darüber im Klaren war, dass sie sich selbst kaum wie eine Erwachsene benahm. »Mummy und Daddy kommen dich besuchen, sobald wir können, Ehrenwort, und ganz bald bist du schon wieder bei uns.« Angela brach in Tränen aus, und Maggie wurde dringlicher, als könnten die Worte die Zeit beschleunigen und sie durch den schrecklichen Moment tragen. »Mach ganz viele tolle Sachen, dann kannst du uns davon erzählen, wenn wir dich besuchen. Polly passt auf dich auf, und wir schreiben dir jeden Tag, versprochen.«
»Aber ich will nicht weg. Warum seid ihr böse auf mich? Ich hab doch gar nichts falsch gemacht, und ich bin auch ganz artig, wenn ich bleiben darf.«
»Natürlich hast du nichts falsch gemacht, mein Schatz, und wir sind dir überhaupt nicht böse. Wir hatten bloß …« Sie brach ab, bevor sie behaupten konnte, sie hätten keine Wahl gehabt, da es nicht stimmte und sie ihre Tochter nicht anlügen wollte, wenn sie nicht wusste, wann sie das nächste Mal mit ihr sprechen würde.
»Am besten zögern wir das nicht weiter hinaus«, erklärte Miss Place. »Bei der ganzen Aufregung mit dem Zug vergisst sie das schnell, und wir sind ja auch noch dabei.«
Das war nett gemeint, aber Maggie wollte wirklich nicht hören, dass sie bald vergessen sein würde. Bevor sie etwas darauf erwidern konnte, führte Miss Place ihre Tochter zu den anderen wartenden Kindern. Sie winkte und winkte, doch Angie war zu sehr mit den Anweisungen ihrer Lehrerin beschäftigt und drehte sich nicht um. Maggie warf den anderen Müttern einen Blick zu und war peinlich berührt von der Vorstellung, sie hätten mitbekommen, wie schnell sich Miss Place’ Worte bewahrheitet hatten. Schmerzhaft wurde ihr bewusst, dass sie Angie nicht mehr gesagt hatte, wie lieb sie sie hatte.
Eine andere Lehrerin reichte ihrer Tochter ein braunes Namensschild, und Maggie beobachtete, wie Angie es ungeschickt an ihren Mantel heftete und die Schrift darauf musterte. Dann ertönte eine Pfeife, und es ging los. Die Kinder verließen den Spielplatz als lange, sich windende Schlange, flankiert von Lehrkräften und Freiwilligen, und folgten einem großen weißen Schild, auf dem die Nummer der Schule prangte. Maggie reihte sich ein und war froh, dass Angie eine Freundin an der Hand hielt; immerhin konnten sie einander Mut machen. Fasziniert sah sie zu, wie die Schlange sich mit anderen vermischte, die aus anderen Schulen auf anderen Straßen strömten, bis der gesamte Stadtteil sich seiner Zukunft zu entledigen schien. Fast schon war es überwältigend, und sie fragte sich, wie das Leben von nun an wohl aussehen würde. Die Kinder waren zwar unterschiedlich alt und trugen unterschiedliche Uniformen, doch sie marschierten als Einheit vorbei an den Häusern und Läden, die ihnen so vertraut waren, winkten den Schaulustigen, die ihnen zujubelten, als wären sie eine Armee, die in die Schlacht aufbrach. Die Stimmung erinnerte an ein Volksfest, passte so gar nicht zu den Warnungen und düsteren Vorhersagen, und sie fragte sich erneut, weshalb sie sich das antaten. Es wurde immer enger auf den verstopften Gehwegen, doch sie ging weiter, ermutigt von den anderen Müttern. Sie hatten die strikte Anweisung erhalten, nicht zum Bahnhof zu kommen, sofern sie nicht mithalfen, doch das kümmerte die Frauen nicht im Geringsten. Ein paar ihrer Bekannten hatten sich zu Grüppchen zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu unterstützen, doch Maggie wollte heute allein sein. Sie wollte sich nicht von ihrem letzten Blick auf Angela ablenken lassen.
Der Bahnhofsvorplatz in der Liverpool Street war voll von Bussen, Taxis und Automobilen, die Kinder und Aufsichtspersonen absetzten. Die aufmunternden Rufe wurden von wütendem Hupen und aufgebrachten Stimmen verdrängt, und es herrschte eine gereizte, verzweifelte Atmosphäre. Überall hingen Wegweiser in Richtung der Züge, und sie kämpfte sich durch die Menge zum Gleis, wobei sie kurz das Schild ihrer Schule aus den Augen verlor und in Panik geriet. Sie beneidete die Mütter mit Kleinkindern auf dem Arm: Wenn Angela sechs Monate jünger gewesen wäre, hätte Maggie sie begleiten dürfen. Der Lärmpegel war unerträglich – Hunderte verwirrte Kinder, nervöse Eltern, angespannte Lehrkräfte, überstrapazierte Bahnangestellte, die sich Gehör verschaffen oder eine gewisse Ordnung beibehalten wollten –, und je weiter sie in den Bahnhof vordrang, desto mehr wirkte es, als wüsste niemand, was er zu tun hatte. Neben ihr riss die Schnur am Bündel eines kleinen Jungen, und seine Habseligkeiten fielen zu Boden. Er verzog das Gesicht, und sie wollte ihm helfen, doch die Masse schleifte sie unerbittlich weiter. Ein kleines Mädchen schrie über den Radau hinweg, es müsse aufs Klo.
An den Engpässen zu den Bahnsteigen wurde das Gedränge noch erdrückender. Maggie schubste sich hindurch, befürchtete, dass Angela in dem Chaos von ihren Klassenkameraden getrennt werden und im falschen Zug landen könnte, aber da entdeckte sie sie auf dem Bahnsteig, wo sie wundersamerweise immer noch neben Lizzie stand. Ein letztes Mal versuchte sie, in Rufweite zu gelangen, damit Angela wüsste, dass sie noch da war, doch ein Polizist schloss gerade das ausziehbare Gitter. »Hier ist Schluss«, rief er kaum hörbar. »Keine Eltern auf dem Bahnsteig. Zurückbleiben, bitte.« Sofort ertönte Protest, doch die Menge zog sich ein Stück zurück, und Maggie verlor Angie aus den Augen. Verzweifelt klammerte sie sich am Gitter fest und spähte durch die rautenförmigen Öffnungen, bis sie sie wieder entdeckte, diesmal näher am Zug. Angela schien sich nicht auf die Fahrt zu freuen, sondern wirkte verängstigter als je zuvor, und zum hundertsten Mal wünschte Maggie, ihre Tochter wäre abenteuerlustiger, so wie die Kinder, die sich aus den Fenstern streckten oder die Schaffner mit Fragen über die Lokomotive löcherten; nur zu gern würde sie in Vergessenheit geraten, solange Angela glücklich war. Ein Mann ging mit einer Tüte Süßigkeiten neben Angela in die Hocke, zückte ein Taschentuch und tupfte ihr die Tränen ab. Da lächelte sie, und Maggie unterdrückte die Wut darüber, dass ein Fremder ihr Kind trösten durfte, während sie tatenlos zusehen musste.
Zu ihrer Linken brach ein Handgemenge aus, und eine Mutter überwand das Gitter und schrie nach ihrer Tochter. Kurz wurde es stiller, während alle zusahen, wie sich die Frau ein verängstigtes Mädchen schnappte und tränenüberströmt mit ihm davonlief. Beinahe wollte Maggie es ihr gleichtun, und sie verfluchte sich innerlich dafür, dass sie so schwach gewesen war, aber Angela war verschwunden. Sie suchte den Bahnsteig nach ihr ab, doch ihre Kleine musste in den Zug gestiegen sein, als sie abgelenkt war. Eine Dampfwolke legte sich über das Gleis und verhüllte ihren Blick, während Waggontüren geschlossen wurden und ein schriller Pfiff ertönte. Der Zug war voll besetzt, bevor der Bahnsteig geräumt war, und setzte sich langsam in Bewegung. Winzige Hände winkten fieberhaft aus den Fenstern. Maggie suchte vergeblich nach Angelas Gesicht, doch ihre Tochter war verschwunden, auf dem Weg Gott weiß wohin.
Sie blieb noch eine Weile, um sicherzugehen, dass Angie nicht mit den anderen Kindern auf den nächsten Zug wartete. Schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen und auf die Postkarte mit neuen Informationen zu warten. Die Häuser in ihrer Straße wirkten kleiner und schutzloser als sonst; Backsteine und Mörtel schienen dem Angriff nicht gewachsen, mit dem alle so fest rechneten. Gott bewahre, dass ihnen etwas zustoße. Falls es sie treffen würde, könnte sie ihre Tochter nie davon überzeugen, dass sie sich getäuscht hatte, dass sie sie liebten und schätzten, sie die wertvollste Sache im Leben ihrer Eltern war. Der Gedanke war unerträglich, und sie versuchte, ihn abzuschütteln, während sie die Tür aufschloss und sich für die Stille im Inneren wappnete. Sie und Bob würden einen Pakt schließen müssen, ein feierliches Versprechen: Ihnen durfte nichts passieren, bevor sie alles wiedergutmachen konnten.
4
Lillian Herron hatte dem Zimmer zum letzten Mal mit einundzwanzig und voller Hoffnung den Rücken gekehrt. Sie nahm den kleinen Koffer vom Bett und strich die Tagesdecke glatt, dann riss sie die Vorhänge weit auf, um die Morgensonne hereinzulassen. Das Zimmer war schon immer dunkel gewesen, selbst als sie noch klein und die Zeder vor dem Fenster fünfzig Jahre jünger gewesen war, doch die Schatten waren länger geworden, und es fiel ihr schwer, sie von denen zu unterscheiden, die sie im Inneren begleiteten.
Außerdem durfte man sich als Frau nicht auf Hoffnung verlassen. Früher wäre sie nie auf diesen Gedanken gekommen, jung und verliebt, wie sie gewesen war. Sie hatte das Haus verlassen und alles, woran es sie erinnerte, und eine Zeit lang hatte ihre unerwartet glückliche Ehe sie tatsächlich davon überzeugt, sie habe sie verdient. Zehn Jahre später, als Richard mit einem Großteil seines Regiments in Gallipoli fiel, hatte sie erkannt, dass sie ihrem Glück nie richtig getraut hatte. Ihr war nichts anderes übrig geblieben, als nach Polstead zurückzukehren und den Rest des Kriegs mit ihrer Schwester und ihrem Bruder in ihrem Elternhaus auszuharren. Das sei die sinnvollste Lösung, hatte sie sich damals gesagt, und außerdem wäre es nur vorübergehend. Doch aus irgendeinem Grund war sie dortgeblieben, und wieder einmal machte sich der wilde Wein an der verfallenen Gartenmauer bemerkbar, verfärbte sie blutrot, obwohl es Lillian vorkam, als wäre er gerade erst wieder grün geworden. Wie konnte es sein, dass die Jahre so schnell vergingen, während die Tage sich unendlich in die Länge zogen?
Sie wandte sich wieder dem Zimmer zu und versuchte, es mit den Augen eines Fremden zu sehen. Wessen Kopf am Abend wohl auf dem Kissen ruhen würde? Es war die richtige Entscheidung, und im Grunde hatten sie auch keine Wahl; dennoch verspürte sie das unangenehme Gefühl, jemand würde in ihr Zuhause eindringen. War es wirklich eine gute Idee, ein Kind im Haus zu haben, selbst nach all den Jahren? Sie war allerdings nicht zu Hause gewesen, als die Frau vom Freiwilligendienst angeklopft hatte, und ihre Schwester – die gutherzige, naive kleine Florrie, die es immer allen recht machen wollte – hatte begeistert zugesagt, bevor Lillian Einspruch einlegen konnte. Vielleicht war es ja doch ein Segen. Schon so lange war in ihrem Haus nicht mehr gelacht worden, und seit Jahren teilten sie den gleichen Alltag, aßen die gleichen Mahlzeiten und schwiegen über das gleiche Thema, ohne einander näherzukommen. Womöglich würde ein Kind das ändern. Ein Teil von ihr sehnte sich danach, und wehmütig betrachtete sie die Kiste mit alten Spielsachen, die Florrie so vorfreudig entstaubt hatte: ein paar Puppen, die noch aus ihrer Kindheit stammten, einige Kuriositäten aus der medizinischen Sammlung ihres Vaters, deren rätselhaftes Glänzen stets eine größere Faszination ausgeübt hatte als ihre eigenen Spielsachen, und mehrere Bücher, die sie immer noch auswendig konnte. Sie zögerte kurz und zog dann die abgegriffene Ausgabe von Die drei Musketiere hervor, die ihrem Bruder gehört und ihnen zum Motto ihrer Kindheit verholfen hatte. Sie hielten sich immer noch daran, aber nun diente es einem Zweck: Der Tag, der sie untrennbar miteinander verband, drängte sie gleichzeitig auseinander, und sie bezweifelte, dass dieses neue Abenteuer etwas daran ändern würde – zumindest nicht zum Besseren.
Seufzend stellte Lillian das Buch ungeöffnet zurück und rückte das Kruzifix über dem Bett zurecht. Dann nahm sie den Koffer, der nur selten benutzt wurde, und ging über den kleinen Flur zum Zimmer ihrer Schwester. In der Tür blieb sie stehen. Nur wenig hatte sich verändert, seit ihre Eltern hier geschlafen hatten. Die Audubon-Drucke ihres Vaters über dem Bett, der Krimskrams ihrer Mutter auf dem Schminktisch, der Flakon mit dem vertrauten Freesienduft, den Florrie unbedingt tragen musste. Selbst der Staub schien derselbe, wurde lediglich hin und wieder vom Atemhauch der Erinnerung aufgewirbelt, jedoch nie ganz beseitigt. Sie wählte das Bett nahe der Tür – Florrie konnte Zugluft nicht ausstehen – und legte ihre Kleider in die untere Schublade, die ihre Schwester ihr freigeräumt hatte. Am liebsten hätte sie die hässliche Mahagonikommode ein Stück nach rechts geschoben, wo sie nicht das halbe Fenster versperren würde, doch es war schon schlimm genug, dass sie sich überhaupt ein Zimmer teilen mussten, da musste sie nicht noch nach belanglosen Ärgernissen suchen. Sie legte ihre Ausgabe von Middlemarch auf den Nachttisch, die sie jedes Jahr gewissenhaft las, doch sie wusste, dass eine gewisse Portion Optimismus in der Geste mitschwang. Ihre friedvollen Abende waren gezählt, und Florries Geplapper würde sie bis in ihre Träume verfolgen. Die arme Dorothea würde noch etwas länger in ihrer unglücklichen Ehe festsitzen und ihren Teil zu den Kriegsanstrengungen beitragen müssen.
Sie hörte, wie Edmund oben mit der Glocke läutete, die auf seinem Schreibtisch stand. Bevor sie bis zehn zählen konnte, war Florrie auch schon mit dem Tee an der Tür vorbeigerauscht, den ihr Bruder sich genauso gut selbst hätte holen können. Auf die Idee wäre er allerdings nie gekommen, und in der Hinsicht – wenn auch in sonst keiner – schlug er nach seinem Vater. Sie hätten sich eine Haushälterin leisten können, wenn sie an anderen Enden gespart hätten, doch keiner von ihnen wollte erneut eine Fremde im Haus riskieren, und Florrie übernahm es gern. Ihre Aufgabe war es, sich um ihre Geschwister zu kümmern, Neds bestand darin, das als selbstverständlich zu betrachten, und Lillian fiel es zu, die Rechnungen zu begleichen und mit dem Geld zu wirtschaften, das Richard ihr hinterlassen hatte. Sie wusste, dass die beiden sie damals deswegen angebettelt hatten, wieder nach Hause zu kommen: Ohne ihre kleine Erbschaft würden sie das Haus verlieren, und es gab zahllose Gründe, weshalb es dazu nie kommen durfte. Einer von ihnen müsste bis zum bitteren Ende bleiben, bis die anderen zu tot waren, um sich noch dafür zu interessieren, was in ihrer Abwesenheit zutage treten würde, und Lillian betete jeden Abend, dass es nicht sie treffen würde. Es wäre gnädiger vom Schicksal, Florrie mit der Vergangenheit allein zu lassen. Sie war hier von ihnen die Glücklichste.
Sie wollte nicht weiter darüber nachdenken und begab sich nach unten in die Küche, die nach hinten zum Garten hinausging. Florrie war seit Tagesanbruch wach und aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten. Der Duft von frisch gebackenem Brot und Brombeerkompott hing in der Luft. »Wie viele Kinder nehmen wir noch gleich auf?«, fragte Lillian mit Blick auf die Anrichte, auf der sich die Speisen türmten. »Damit können wir das ganze Dorf versorgen.«
»Sie hat sicher Hunger nach der Reise«, erklärte Florrie mit entwaffnender Vertrautheit, als wäre das fremde Kind eine Nichte, die sie schon seit Jahren besuchte. »Ich will bloß, dass sie es schön hat.«
Sie schaute auf. Aufregung und Ofenhitze hatten ihr die Röte ins Gesicht getrieben, und kurz überkam Lillian ein schlechtes Gewissen. Wer weiß, was ihre Schwester für eine Ehefrau und Mutter abgegeben hätte, wenn sie nicht als Erste die Flucht zum Altar angetreten und sie mit alternden Eltern und einem Bruder zurückgelassen hatte, der keinerlei Absichten hegte, auf eigenen Beinen zu stehen. »Es sieht auf jeden Fall toll aus«, fügte sie freundlicher hinzu. »Einen besseren Empfang kann man sich wirklich nicht wünschen.«
Florrie lächelte, befriedigt vom Lob ihrer Schwester, und räumte einen Stapel frisch gewaschener Geschirrtücher von einem Stuhl, damit sie Platz nehmen konnte. »Hast du dich oben eingerichtet?« Die gleiche Frage hatte sie vor einem Vierteljahrhundert gestellt, anscheinend ohne den Kummer ihrer frisch verwitweten Schwester zu bemerken.
»Ja, danke. Die Spielsachen und Bücher stehen noch da, wo du sie hingestellt hast. Ich wusste nicht, ob ich etwas damit machen soll, aber wenn du willst, kann ich sie gerne ausräumen.«
»Nein, lass nur. Das mache ich, wenn ich hier fertig bin. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Was magst du denn frühstücken? Die Hennen waren heute gut zu uns. Die sind bestimmt auch schon ganz aufgeregt.«
»Ich habe keinen großen Hunger, mir reicht eine Scheibe Toast. Aber ich kümmere mich selbst darum, du hast noch genug zu tun.«
»Sei nicht albern, Liebes. Ich habe alles im Griff, und du brauchst mehr im Bauch als nur ein bisschen Toast.« Sie nahm Lillian das Brotmesser weg und schnitt zwei dicke Scheiben aus der Mitte des Laibs, dann schlug sie ein Ei in die Pfanne auf dem Ofen und gab etwas Speck dazu. »Das wird wieder genau wie früher, als wir uns ein Zimmer geteilt haben«, fuhr sie fort, und Lillian stellte erschrocken fest, dass Florrie an dieser Tatsache anscheinend Gefallen fand. »Weißt du noch, wie wir uns immer in Mummys und Daddys Zimmer geschlichen haben, wenn wir dachten, sie merken es nicht? Und wie sie uns einmal mit Rosies Sachen erwischt haben? Daddy war so wütend, aber ich verstehe immer noch nicht, was daran falsch war. Die Spielsachen waren doch viel zu schade zum Verstecken, und sie haben ihr wirklich nur die schönsten Sachen gekauft.« Sie hielt mit dem Pfannenwender in der Luft inne und starrte in den Garten, während ihr das Fett auf die Hand spritzte. Zum tausendsten Mal fragte sich Lillian, wie zwei Menschen derart unterschiedlich mit derselben Erinnerung umgehen konnten. »Endlich werden wir wieder mal Spaß haben.« Florrie schüttelte sich zurück in die Gegenwart und arrangierte das unerwünschte Essen liebevoll auf einem Teller. »Ich freue mich auf die Gesellschaft, du nicht?«
»Ja, vielleicht.«
Lillian streckte die Hand nach dem Teller aus, um das Thema mit ein paar harmlosen Komplimenten in andere Bahnen zu lenken, doch Florrie taxierte sie prüfend. »Manchmal höre ich, wie du mitten in der Nacht auf und ab gehst, Liebes. Du kannst immer mit mir reden, das weißt du doch, oder?«
»Natürlich, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe bloß einen leichten Schlaf, das war schon immer so. Falls du Angst hast, dass ich dich stören könnte …«
Florrie wischte die Andeutung mit einer Handbewegung beiseite. »Sei nicht albern, Liebes. Ich bin froh, dass du bei mir im Zimmer bist. In solchen Zeiten sollte niemand allein sein.« Das kam darauf an, wen man fragte, dachte Lillian, verkniff sich jedoch einen Kommentar und hoffte, ihre Schwester mit einer wohlwollenden Bemerkung zum Legeeifer der Hennen abzulenken. »Du sollst bloß wissen, dass ich für dich da bin, mehr sage ich dazu nicht«, fuhr Florrie fort, während sie sich an ein Sieb mit Erbsenschoten machte. Ihr Schweigen wirkte nachdenklich, und Lillian wartete nervös ab, ob sie es tatsächlich dabei belassen würde. »Mummy wäre so stolz auf uns, glaubst du nicht? Dass wir jemandem ein Zuhause geben, der es braucht. Wieder eine Familie werden.«
Verärgert legte Lillian das Besteck ab. »Florrie, du darfst dich nicht zu sehr an das Kind hängen. Wer weiß, was als Nächstes in der Welt passiert? Im Moment ist alles so unsicher, und womöglich bleibt es gar nicht lange bei uns. Vielleicht mag es uns auch gar nicht oder ist unglücklich, egal, wie viel Mühe du dir gibst. Wenn wir das schon machen, will ich wenigstens nicht, dass du verletzt wirst.«
»Ich bin doch nicht dumm, Lillian. Ich war diejenige, die alles mit den Behörden geklärt hat, falls du dich daran erinnerst, und ich weiß, was von uns erwartet wird.« Kurz flammte Florries Wut auf, so wie immer, wenn sie glaubte, sie würde als Nesthäkchen abgetan, doch genauso schnell ebbte sie auch wieder ab. »Mir kommt es vor wie eine Gelegenheit, alles wiedergutzumachen, findest du nicht auch?«
»Nein. Ich finde, wir tun unsere Pflicht, so wie alle anderen auch, und wenn ich irgendetwas zu melden hätte, würde ich die Tür verriegeln, bis Hilary Lampton ihre geliebten Evakuierten irgendwo anders untergebracht hat.« Die Ironie der Vorstellung, ihre Mutter würde wohlwollend auf sie herablächeln, während sie sich um ein fremdes Kind kümmerten, erzürnte sie, wobei »beschämen« es wahrscheinlich besser träfe; Scham, die sich mit einem anderen Gefühl mischte, das sie verdächtig an Angst erinnerte. »Wir tragen unseren Teil bei, mehr nicht. Versuch bitte nicht, das hier in irgendeine wundersame Erlösung zu verwandeln. Wie sollten wir jemals wiedergutmachen, was …« Lillian brach ab, als sie den schmerzerfüllten Blick ihrer Schwester bemerkte, und wollte ihr mit logischen Argumenten nicht weiter zusetzen. »Wann sollen wir an der Schule sein?« Sie bemühte sich, weniger resigniert zu klingen, als sie sich fühlte.
»Ab halb zwölf, aber Edmund braucht das Auto heute Vormittag, also habe ich Mrs Lampton schon vorgewarnt, dass wir uns vielleicht etwas verspäten.«
»Was hat Ned denn so dringend zu erledigen?«
»Das weiß ich nicht, aber er hat mir versprochen, dass er uns spätestens um Viertel vor zwölf abholt.«
Lillian zögerte, bevor sie ein weiteres Tabu ansprach, doch sie konnte es nicht unausgesprochen lassen. »Wir werden doch gut aufpassen, oder? Ned und ein Kind unter einem Dach … Er ist so festgefahren in seinen Gewohnheiten.«
»Fünfzehn Minuten sind völlig ausreichend, am Ende sind wir noch vor den Kindern da«, fuhr Florrie fort, als hätte Lillian überhaupt nichts gesagt. »Es wäre schön, den Bus kommen zu sehen. Sie sind bestimmt ganz aufgeregt. Liebes, wenn du fertig bist, dann sei doch so gut und hol noch ein paar Äpfel. Ich habe gestern viel zu wenige gepflückt.«
»Natürlich, sofort.«
»Und wenn du schon im Obstgarten bist, kannst du vielleicht ein bisschen Ordnung machen. Da lässt sich bestimmt schön spielen, solange das Wetter hält, aber es liegt einiges an Fallobst herum, das ich noch nicht aufgesammelt habe, und wir wollen doch nicht, dass jemand gestochen wird. Auf der Terrasse steht ein Korb, den kannst du nehmen.«
Lillian schlüpfte in die Gemeinschaftsgummistiefel, die immer auf der Matte standen, und ging aus der heißen Küche in den Garten. Sie war froh um die frische Luft. Im Efeu, der die Rückseite des Hauses bedeckte, wimmelte es vor Fliegen, die in einem summenden Schwarm aufstiegen, als sie die Tür hinter sich schloss. Die Sonne sammelte ihre Kräfte für den Frühseptembertag, und das Gras war noch feucht. Frösche hüpften in Richtung der Beete davon, während sie über den Rasen zu dem Grüppchen Apfelbäume ging, das ihre Familie recht großspurig als Obstgarten bezeichnete. Ihr Garten war schmal, aber lang, und führte einen Abhang hinunter zu einem Waldstück und schließlich zu dem Bach, der die Grenze ihres Grundstücks bildete. Wie Florrie schon gesagt hatte: Früher war es ein wunderbarer Ort zum Spielen gewesen.
Der süßliche Duft faulender Äpfel lag in der Luft, und das ausgehöhlte Obst bot den trägen, gefährlichen Spätsommerwespen ein Zuhause. Sie beugte sich vor, um das Fallobst einzusammeln, wobei sie ihre neunundfünfzig Jahre am ganzen Leib spürte und hin und wieder innehielt, um ihrem schmerzenden Rücken eine Pause zu gönnen. Irgendwann würde der Unterhalt des Hauses sie überfordern, und was dann? Die blau-weiße Feder eines Hähers fiel ihr ins Auge – eine Markierung, so wie früher –, und sie versuchte, sich zu erinnern, ob der Vogel nun Glück oder Pech verhieß. Die alten Markierungen waren längst verschwunden und wirkten nicht mehr so unschuldig wie damals, doch sie konnte sich noch gut an die Namen erinnern: Prudence, Maisie, Violet, Matilda – alle betrauert, jedoch rasch vergessen, wenn die Nächste folgte. Damals war es ihr so harmlos vorgekommen. Phoebes Grab war natürlich nicht markiert worden, doch an seinen Ort würden sie sich auf ewig erinnern. Lillian sah das schmutzige Gesicht ihres Bruders vor sich, als wäre es gestern gewesen. Er rammte den Spaten tief in den durchweichten Boden, hob ihn immer wieder an, während es wie aus Kübeln goss, und schluchzte dabei wie das Kind, das er bis zu jenem Tag gewesen war. In ihrer Vorstellung hatte sich aus irgendeinem Grund der Anblick von Richard daran geheftet, wie er mit nasser, schmutziger Erde im Mund auf dem Schlachtfeld starb – all ihre Schreckenserlebnisse, die sich zu einem endlosen, ohrenbetäubenden Schmerzensschrei verwoben. Womöglich hatten sie die besten Absichten gehegt, doch sämtliche Männer in ihrem Leben – egal, wie sehr sie sie liebte – hatten sie im Stich gelassen.