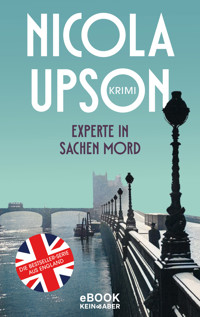16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Krimi
- Serie: Josephine Tey und Archie Penrose ermitteln
- Sprache: Deutsch
Auf der kleinen Insel St Michael’s Mount verbringen Krimiautorin Josephine Tey und Detective Chief Inspector Archie Penrose in illustrer Runde und mit Marlene Dietrich als Ehrengast ihre Weihnachtstage. Die festliche Stimmung schlägt jedoch schnell um, nach zwei Morden scheint jede und jeder verdächtig – dass die Insel auch noch durch Schneesturm und Flut vom Festland abgeschnitten ist, macht die Angst der Gäste nicht kleiner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Nicola Upson wurde 1970 in Suffolk, England, geboren und studierte Anglistik in Cambridge. Ihr Debüt Experte in Sachen Mord bildet den Auftakt der erfolgreichen, mittlerweile zehnbändigen Krimi-Reihe. Bei deren Hauptfigur Josephine Tey handelt es sich um eine der bekanntesten Krimi-Autorinnen des Britischen Golden Age. Mit dem Schnee kommt der Tod war nominiert für den CWA Historical Dagger Prize (2021). Nicola Upson lebt in Cambridge und Cornwall.
ÜBER DAS BUCH
Aufgrund einer überraschenden Einladung ändern Josephine Tey, ihre Partnerin Marta und Detective Chief Inspector Archie Penrose ihre Pläne, um auf der kleinen Insel St Michael’s Mount in Cornwall in illustrer Runde die Weihnachtstage zu verbringen – zusammen mit Marlene Dietrich als Ehrengast! Die weihnachtliche Stimmung schlägt jedoch um, als am Morgen des 25. Dezember 1938 eine brutal zugerichtete Leiche auf dem Kirchturm gefunden wird. Alle verdächtigen sich gegensetig – und dann geschieht auch noch ein zweiter Mord. Da die Insel durch Schneesturm und Flut vom Festland abgeschnitten ist, muss Archie die Jagd nach Verdächtigen auf eigene Faust aufnehmen. Doch wer könnte ihn dabei besser unterstützen als die Krimiautorin Josephine Tey?
Frohe Weihnachten für alle Leser:innen, Bibliothekar:innen und Buchhändler:innen.
KARTE DER INSEL
KARTE DER BURG
»Willst du entscheiden, welche Menschen leben, welche Menschen sterben sollen?«
Charles Dickens, EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE
ERSTER WEIHNACHTSTAG 1920
An jenem Tag wurde dem Weihnachtsfest jegliche Freude genommen, zumindest dachte er das später – alles war eine Parodie dessen, was es hätte sein sollen. Der Schnee war schmutzig und zertrampelt, die Kinder verängstigt und unterkühlt, und selbst das Rotkehlchen, das auf dem Rand einer Mülltonne saß, gab keinen Ton von sich, als wäre es mitschuldig an der Schreckensszene, die ihn im Haus erwartete. Und dann war da natürlich noch ihr Gesichtsausdruck. Noch Jahre später würde er bei dem Weihnachtslied, das er früher so gerne gemocht hatte, an ihren Blick denken müssen, eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie wenig Trost und Freude es wirklich auf der Welt gab.
Bei seiner Ankunft hatte sich bereits eine große Menschentraube gebildet, und als frischgebackener Detective Sergeant konnte er es kaum erwarten, sich einen Namen zu machen. Das Haus war in Notting Dale, einem Armenviertel aus überfüllten Straßen und heruntergekommenen Bauwerken, und obwohl der Schnee zahlreiche Mängel gnädig bedeckte, war es immer noch eine üble Ecke der Stadt. Ein düsterer, eintöniger Straßenzug reihte sich an den nächsten, und nichts wies darauf hin, dass sich die Bewohner um Weihnachten oder sonst irgendetwas scherten. Er parkte am Ende der Straße, auf der Molly Naylor und ihre Kinder gewohnt hatten, und ging zu Fuß zu den versammelten Nachbarn, die wortlos abwarteten, was als Nächstes passieren würde. Als er sich an den Schaulustigen vorbeischob, spürte er, wie ihm Feindseligkeit entgegenschlug, kalt wie die raue Dezemberluft. Eine Männerstimme murmelte sarkastisch: »Frohe Weihnachten.«
An der Haustür stand ein Uniformierter mit totenbleichem Gesicht – wahrscheinlich der örtliche Streifenpolizist, der zu seinem Pech zuerst vorbeigekommen war. »Wer hat sie gefunden?«, fragte er nach einer knappen Begrüßung.
»Der Nachbar im Nebenhaus, Sir. Seine Frau hat gestern Abend einen Streit gehört, aber nichts unternommen, weil sie mit dem Baby allein war, und außerdem wollte sie sich nicht einmischen. Und als heute Morgen kein Ton von nebenan zu hören war, kam ihr das seltsam vor. Anscheinend war bei ihr zu Hause die Hölle los. Sie wissen schon, Kinder an Weihnachten.« Er brach ab, als hätte er etwas Unpassendes gesagt. Vermutlich hatte ihn das wahre Ausmaß der Tragödie endlich mit voller Wucht getroffen. »Jedenfalls hat sie ihren Mann rübergeschickt, damit er mal nachsieht. Die Hintertür war offen, und dann hat er sie auch direkt gefunden. Nach dem ersten Zimmer hat er wohl sofort kehrtgemacht, und das glaube ich ihm gern. Würde jeder machen, der es sich aussuchen kann.«
»Wo ist der Mann jetzt?«
»Wieder zu Hause, Sir. Sah richtig übel aus. Meinte, er will seine Kinder in den Arm nehmen. Ich habe ihm schon gesagt, dass er mit Ihnen rechnen soll.«
»Und sonst war niemand in der Wohnung?«
Er schüttelte den Kopf. »Niemand außer mir. Ich dachte erst, ich kann die Leute nicht draußen halten, wenn es sich erstmal rumgesprochen hat, aber Fehlanzeige.«
»Es bleibt ihnen wohl nicht mehr viel übrig, außer Respekt zu zeigen.«
»Oder Angst.« Penrose warf ihm einen scharfen Blick zu, und er zuckte die Schultern. »So kommt es mir zumindest vor. Eine Frau, die ihren Kindern so was antun kann …«
»Für solche Mutmaßungen ist es noch zu früh. Kannten Sie die Familie?«
»Nein, Sir. Erst seit heute.«
Bald wäre ihr Name in aller Munde. Penrose bedankte sich, betrat das Haus und schloss die Tür hinter sich. Drinnen herrschte eine gespenstische, verstörende Stille, und obwohl er dem Constable für seine voreiligen Worte über den Mund gefahren war, verstand Penrose genau, was er gemeint hatte. Er hatte bei Mollie Naylors Nachbarn keinen Respekt gespürt, sondern pures Entsetzen – eine Art Aberglaube, als könnte das Grauen auch sie treffen, wenn sie ihm zu nahe kämen. Vielleicht lag es auch nur an der ernüchternden Erkenntnis, wozu das menschliche Herz in der Lage ist, wenn die Umstände unerträglich wurden. Die Stille war erdrückend, und Penrose zwang sich, weiterzugehen. Er schauderte – die Kälte in seinen Knochen war nicht nur dem Wetter und dem verfallenen Zustand des Hauses geschuldet.
Im Erdgeschoss gab es nur ein Zimmer, eine Wohnküche mit ein paar alten Möbelstücken, die ihre besten Tage hinter sich hatten. An manchen Stellen löste sich der Putz von der Decke, und die Tapete wölbte sich derart an den feuchten Wänden, dass er sich fragte, weshalb sich überhaupt jemand die Mühe gemacht hatte. Eine Wäscheleine war von einer Ecke in die andere gespannt, und hier und da waren die Dielen vom stetig heruntertropfenden Wasser verfault. Schimmelbefall verlieh dem Haus einen muffigen Geruch, in den sich etwas Metallisches, Ekelerregendes mischte, das hier nichts zu suchen hatte, ihm jedoch nur zu vertraut war. Immerhin dazu taugte die Kälte, dachte er bitter; im Sommer wäre der Gestank unerträglich gewesen. Die winzigen, fadenscheinigen Kleidungsstücke, die in der Nähe des Kamins hingen, taten ihm in der Seele weh, und er musste sich abwenden.
Die Verwahrlosung überraschte ihn nicht; nach dem Krieg waren die Mieten derart niedrig und Wohnraum derart knapp, dass die Vermieter keinen Anlass besaßen, auch nur die grundlegendsten Reparaturarbeiten auszuführen. Doch ihm fiel auf, wie sauber das Zimmer trotz allem war. Unter seinen Kollegen kursierte der Witz, dass die dunkelblauen Uniformen sich mit einem Besuch in den Armenvierteln jedes Mal braun verfärbten, doch bislang wirkte die Wohnung so gepflegt, wie es eben möglich war, und dieses kleine, trotzige Anzeichen von Stolz verlieh dem Schild über dem Kamin – »Gott schütze dieses Haus« – mehr als nur einen zynischen Beigeschmack.
Und dann war da noch der Baum, ein dürres, unwilliges Exemplar, an dem Dickens’ Ebenezer Scrooge seine helle Freude gehabt hätte. Doch er war liebevoll geschmückt worden, und Penrose trat einen Schritt näher, um die selbst gebastelten Sterne und Engel und den Watteschneemann in Augenschein zu nehmen, der an der Baumspitze hing; in seiner Kindheit waren solche Spielzeuge ungemein beliebt gewesen. Er ging in die Hocke. Unter dem Baum lagen sechs Geschenke, allesamt in Zeitungspapier eingeschlagen, und er konnte sich nicht erinnern, jemals etwas Deplatzierteres gesehen zu haben. Wodurch um alles in der Welt hatte sich das Schicksal der Familie innerhalb weniger Stunden derart dramatisch gewendet?
Zwei Umschläge lagen ordentlich nebeneinander auf einer Art Küchentisch; womöglich enthielten sie die Antwort, doch er wollte sich die Tragödie erst selbst ansehen. Er stieg die dunkle, enge Treppe hinauf, die direkt in das kleinere von zwei Schlafzimmern führte, und entdeckte die ersten Leichen bereits, bevor er oben angekommen war. Selbst seine von der Grausamkeit des Kriegs und der Natur seiner Arbeit genährte Vorstellungskraft hatte ihn nicht auf den grauenhaften Anblick vorbereiten können. Zwei kleine Mädchen – Zwillinge, etwa sieben oder acht Jahre alt – lagen zugedeckt im Bett, und ihr helles Haar schien auf dem Kissen miteinander verwoben, so nahe waren sie einander. Fast sah es aus, als schliefen sie in friedlicher Umarmung, wäre da nicht der leuchtend rote Fleck auf der Bettwäsche gewesen. Mit zitternden Händen zog er das blutstarre Laken zurück und zwang sich, die tiefen Wunden an den Kehlen genauer zu untersuchen; Luftröhre und Halsschlagader waren in beiden Fällen praktisch durchtrennt. Penrose hoffte inständig, dass es schnell vorbei gewesen war und die beiden nichts davon mitbekommen hatten. Alles andere wollte er sich nicht ausmalen. Die Mädchen trugen identische Nachthemden, spiegelten einander im Tod wider: bleiche Gesichter, die sich bereits verfärbten, Lider, die vor der schrecklichen Szene verschlossen waren. Auf den ersten Blick sah er keine blauen Flecken oder andere Anzeichen von anhaltendem Missbrauch, und erneut fragte er sich, wie es hierzu gekommen war.
Sachte deckte er sie wieder zu und bemerkte dabei die Tafel über dem Bett, auf der die Tage bis Weihnachten einer nach dem anderen abgehakt worden waren; die Vorfreude hatte sich in ein höhnisches Herunterzählen ihrer letzten Tage auf Erden verwandelt. Mit flauem Gefühl im Magen wandte er sich dem Nebenzimmer zu. Es war albern, in so einer Situation Rücksicht auf Privatsphäre zu nehmen. Dennoch zögerte er auf der Schwelle kurz; er wollte nicht stören, und außerdem hätte er am liebsten kehrtgemacht und wäre davongerannt. Ein kleiner Junge mit blondem Schopf war quer über das Bett geworfen worden, seine Kehle war ebenfalls aufgeschlitzt, und auf ihm ruhte seine tote Mutter. In einer Zimmerecke stand eine Schublade, die als Babybett fungierte, und Penrose entdeckte eine winzige Hand unter der grauen Decke. Die Luft war von Blutgeruch erfüllt, das Leid greifbar, und er durchquerte vorsichtig das Zimmer, wobei er über die Flecken auf den Dielen hinwegstieg. Die Klinge eines Messers mit weißem Griff steckte noch immer tief rechts in Mollie Naylors Hals. In ihren glasigen Augen bildeten sich rechts und links der Pupillen bereits bräunliche Dreiecke. Penrose suchte nach einer Erklärung, fand jedoch bloß seine eigenen voreiligen Schlüsse, ausgelutschte Klischees darüber, wie ihr Leben zu ihrem Tod geführt haben könnte. Draußen in der schmalen Gasse, die die Häuser voneinander trennte, pfiff ein Ahnungsloser »God Rest Ye Merry, Gentlemen«. Was sonst so selbstverständlich zum Weihnachtstag gehörte, wirkte plötzlich völlig fehl am Platz; Ruhe würde hier niemand finden, und er wünschte von ganzem Herzen, er hätte das Haus nie betreten.
Er schaffte es nicht, sich dem kleinen Bettchen zu nähern. Unten ging die Tür auf, und er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, bevor er die Treppe hinabstieg. Sein Vorgesetzter hielt die Umschläge vom Küchentisch in der Hand, und an der Wohnungstür wartete ein Tatort-Fotograf auf sein Zeichen. Penrose nickte ihm zu und wandte sich dann an Inspector Cornish. »Sieht aus, als hätte sie es geplant«, sagte Cornish.
»Hat sie ein Schreiben hinterlassen?«
»Sie hat wohl nur ihre wenigen Angelegenheiten in Ordnung gebracht. Das muss man der Frau lassen, sie wollte nicht mit Schulden sterben.« Er reichte Penrose die Umschläge und sah ihm dabei zum ersten Mal ins Gesicht. »Also ist es wirklich so schlimm. Sie sehen furchtbar aus.«
»So etwas habe ich noch nie gesehen, Sir.«
»Und nichts weist darauf hin, dass jemand anders die Finger im Spiel hatte?«
»Nicht, soweit ich es überblicken kann.«
In dem ersten Umschlag mit der Aufschrift »Miete für Mr Taylor« steckte ein bescheidener Betrag, der zweite war an den Wohltätigkeitsfonds der Eisenbahn adressiert, und Penrose las das knappe Anschreiben: »Sehr geehrte Herren, hiermit erkläre ich, dass ich keine Unterstützung Ihrerseits mehr benötige.« Die Handschrift war sauber und ordentlich, was Penrose ebenso überraschte wie der Inhalt des Schreibens. »Wissen wir irgendetwas über ihre Umstände?«, fragte er.
»Laut einer Nachbarin war sie verwitwet. Ihr Mann kam ein paar Monate vor der Geburt des kleinsten Kindes bei einem Zugunglück ums Leben, daher auch die finanzielle Unterstützung. Anscheinend war sie Einzelgängerin, aber ihre Kinder hat sie wohl über alles geliebt. Wie oft ich das schon gehört habe …«
In seiner Stimme lag ein sarkastischer Unterton, und Penrose musterte erneut die Geschenke unter dem Baum. »Wie viele Kinder hatte sie?«
Cornish zuckte die Schultern. »Wie viele sind denn da oben?«
»Vier, aber hier liegen sechs Geschenke, also fehlt vielleicht noch ein Kind. Oder zwei, falls sie nichts für sich selbst gekauft hat.«
Der Inspector nickte und rieb sich die Hände warm.
»Sehr aufmerksam, Penrose. Finden Sie das raus, und nehmen Sie auch die Aussage von dem Kerl nebenan auf. Ich geh wohl besser mal nach oben.«
Die Menschentraube vor der Tür schwoll stetig an, und inzwischen waren sicher ein oder zwei Reporter vor Ort, weswegen sich Penrose für die Hintertür entschied. Die Häuser hier hatten jeweils einen kleinen Garten, und der Schnee war tief und unberührt – ein erfrischender Kontrast zu der Mischung aus Schneematsch und Dreck, die auf den Straßen übrig geblieben war. Falls sie nach Spuren eines Eindringlings suchen würden, hätte ihnen der heftige Schneefall in den frühen Morgenstunden einen Strich durch die Rechnung gemacht; nun war Penrose jedoch dankbar, dass er etwas Sauberes, Erfrischendes betreten konnte, etwas Natürliches. Er blieb in der Mitte des Gärtchens stehen und hoffte, der Kälteschock würde ihm die Sinne benebeln, doch das Gesehene verfolgte ihn in schmerzhafter Deutlichkeit. Je mehr er versuchte, die Bilder beiseitezuschieben, desto unerbittlicher wurden sie. Ein Stück die Straße hinab begannen die Glocken von St Clement’s zu läuten.
Er wusste später selbst nicht, weshalb er beim Öffnen des Gartentors innegehalten hatte, ob er wegen eines Geräuschs zum backsteinernen Kohlenlager gegangen oder schlicht von der Ahnung getrieben worden war, dass die fehlenden Kinder – sofern es welche gab – sich nicht zu weit von zu Hause entfernen würden. Er wischte den Schnee von der Holzabdeckung und öffnete sie. Zwei tränenüberströmte Gesichter starrten ihm entgegen: ein etwa vierzehnjähriger Junge und ein etwas jüngeres Mädchen, das die Hand seines Bruders fest umklammert hielt. »Tut mir leid«, sagte der Junge unaufgefordert, und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte Penrose, er wolle ein Geständnis ablegen. »Ma war so böse. Die anderen konnte ich nicht mehr retten.«
ACHTZEHNWEIHNACHTSFESTESPÄTER
1
Je älter Josephine wurde, desto überzeugter war sie davon, Weihnachten bereite einem nur dann Freude, wenn man dem Fest aus dem Weg ging. Jedes Jahr im Januar nahm sie sich vor, beim nächsten Mal alles anders zu machen – weniger Geschenke, Karten nur an Leute, die sie leiden konnte, Gerichte, die wenigstens einer im Haus essen würde –, doch kaum wurde es Dezember, trat der Erwartungsdruck alle Jahre wieder seine Schreckensherrschaft an. Neben dem Kamin stapelten sich Winterbücher, für die sie aus unerfindlichen Gründen Zeit zu finden geglaubt hatte, und warteten darauf, wieder ins Regal gestellt zu werden; unzählige Listen bedeckten den Beistelltisch im Flur und erinnerten sie unablässig daran, was vor ihrer Abreise noch alles erledigt werden musste. Die weihnachtsverrückten Deutschen waren ihr eine Erklärung schuldig, dachte sie, und nicht nur wegen des drohenden Kriegs. Sie griff nach ihren Handschuhen und verließ Crown Cottage.
Auf der Straße fiel es ihr leichter, die Weihnachtsstimmung zu genießen, da sie nicht dafür verantwortlich war. Die Gegend rund um Inverness war um diese Jahreszeit immer besonders schön, und das winterliche Wetter in den letzten Wochen hatte der Stadt einen zeitlosen Zauber verliehen, der sich bestens für eine Weihnachtskarte eignen würde. Sie nahm den längeren Weg, um die Stimmung zu genießen. Die frische Luft war belebend, und sie zog ihren Pelz enger um sich, während sie langsam den Hügel hinabging. Der Winter in Schottland kam ohne Vorwarnung; die Kälte schlug bitter entschlossen zu, entstellte die Landschaft und hinterließ kahle Ödnis. Südlich der Grenze gingen die Jahreszeiten langsam ineinander über, fast schon entschuldigend, doch sie konnte sich an keinen Dezember hier oben erinnern, der nicht mit Pauken und Trompeten eingetroffen wäre.
Bis Weihnachten waren es nur noch wenige Tage, und entsprechend war in den Geschäften in Queensgate einiges los. Dennoch herrschte eine entspannte Atmosphäre, also sah sie sich ein wenig um, bevor sie zur Post ging. Dort hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet, und innerlich verfluchte sie ihre Freundin in Suffolk, deren Weihnachtskarte sie als einzige vergessen hatte, bis am Morgen mit einer gewissen Süffisanz ein in Ipswich abgestempelter Umschlag bei ihr eintrudelte. Sie stellte sich an und befand sich kurz darauf zwischen der örtlichen Zeitungshändlerin und einem Mieter ihres Vaters aus der Castle Street, an dessen Namen sie sich nicht erinnern konnte. »Sind Sie über Weihnachten zu Hause?«, fragte die Zeitungshändlerin, nachdem sie sich erschöpfend über das Wetter ausgetauscht hatten.
Wenn es einen Satz gegeben hätte, der ihr ein schlechteres Gewissen bereiten konnte, war er Josephine noch nicht untergekommen. »Dieses Jahr nicht«, erwiderte sie, wobei sie im letzten und im vorletzten Jahr die gleiche Antwort gegeben hätte. »Ich besuche jemanden in Cornwall.«
»Oh, da sind Sie aber eine Weile unterwegs. Sie machen keine halben Sachen, oder? Ist das zufällig der gleiche Jemand, mit dem Sie letztes Jahr in Amerika waren?«
»Nein. Ich kenne mehrere Leute.«
»Natürlich. Irgendwann müssen Sie die alle mal mit nach Hause bringen, damit wir sie kennenlernen können. Ihr Vater …«
»Bleibt hier, genau. Meine Schwestern kommen über die Feiertage zu Besuch.« Mit einem Blick auf die Uhr stellte Josephine überrascht fest, wie lange sie schon unterwegs war. »Moire sollte eigentlich sogar schon hier sein. Wir dachten, es wäre bestimmt nett, wenn wir vor meiner Abreise ein paar Tage zusammen verbringen würden.« Der Schalter wurde frei, was sie vor der Fortsetzung des Gesprächs rettete, und nachdem sie ihre Briefmarken gekauft hatte, machte sie sich auf den Heimweg. Das Auto ihres Schwagers stand in der Einfahrt, und Geschenke stapelten sich auf der Rückbank. Als sie die Haustür öffnete, erkannte sie den Flur kaum wieder. Anstatt ihr Gepäck auf ihr Zimmer zu bringen, hatte Moire bereits am Treppenabsatz alles ausgepackt, sehr zum Leidwesen der Haushaltshilfe. Der Boden war mit Kleidungsstücken, Schuhen und Kosmetikartikeln übersät. »Ging der Schlussverkauf dieses Jahr früher los?«, fragte Josephine trocken. »Ich komme mir vor wie im Erdgeschoss von Benzie’s.«
Moire stand lachend auf, um ihre große Schwester in den Arm zu nehmen. »Dein Sherry ist leer«, sagte sie zur Begrüßung. »Wir haben dir eine Flasche mitgebracht, aber ich hatte sie in einen von Donalds Pullovern gewickelt, damit sie nicht kaputtgeht, und jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Tasche sie ist.«
»Im Schrank unter der Treppe steht noch mehr. Heute Morgen kam eine Kiste, aber ich hatte noch keine Zeit, sie auszupacken.« Stirnrunzelnd musterte sie das Chaos. »Ich habe sie bloß versteckt, damit es hier ordentlich aussieht.«
»Ha! Hier ist er ja.« Moire schwenkte den Tío Pepe triumphierend durch die Luft und stopfte ihre verteilten Habseligkeiten willkürlich zurück in die Koffer. »Du hast wunderschön geschmückt«, sagte sie. »Ich wünschte, du wärst über Weihnachten hier. Da kommen wir mal nach Hause, und drei Tage später machst du dich aus dem Staub. Das könnte man ja fast persönlich nehmen. Es ist schon ewig her, dass wir mal wirklich Zeit miteinander hatten.«
Sie hatte recht, doch bevor Josephine etwas darauf erwidern konnte, steckte ihr Vater den Kopf zur Tür rein. »Ah, da bist du ja wieder. Schön. Chief Inspector Penrose hat angerufen, während du unterwegs warst.«
Josephine war leicht amüsiert – der Respekt ihres Vaters für Scotland Yard war derart ausgeprägt, dass er es nicht über sich brachte, Archies Vornamen auszusprechen, und das, obwohl sie schon seit über zwanzig Jahren mit ihm befreundet war. »Und was wollte er?«
»Es ging um Weihnachten. Er sagte, eine halbe Stunde sei er noch an seinem Schreibtisch, vielleicht erwischst du ihn ja.«
Die anderen ließen sie allein, und während sie darauf wartete, durchgestellt zu werden, beobachtete sie ihre Familie durch die Tür. Wie glücklich und lebhaft ihr Vater doch wirkte. Sie kamen zwar gut zurecht, obwohl das Haus viel zu groß für sie beide war, doch Crown Cottage war erst mit Moire und Donald wirklich zum Leben erwacht. Plötzlich tat es ihr leid, dass sie schon so bald abreisen musste. Ihr Vater wurde nicht jünger, und jetzt, da ein Krieg mit jedem Tag unausweichlicher schien und ihre mittlere Schwester mit einem Marineoffizier verheiratet war, gab es keine Garantie mehr für zukünftige gemeinsame Weihnachtsfeste. Moire hatte ihr keinen Vorwurf machen wollen – sie hatten einander schon immer nahegestanden, auch sie fand es schade, dass sie sich, abgesehen von gelegentlichen Mittagessen in London, wo Moire für die Gasgesellschaft arbeitete, oder kurzen Aufenthalten in Inverness kaum zu Gesicht bekamen.
»Josephine. Danke, dass du so schnell zurückrufst.« Archie unterbrach ihre Gedanken, bevor sie sich zu einem schlechten Gewissen ausweiten konnten, und sein warmer Ton erinnerte sie daran, wie sehr sie sich auf ihr Wiedersehen freute. »Der Plan für die Feiertage hat sich leider geändert.«
»Wieso? Ist dir auf der Arbeit etwas dazwischengekommen?«
»Nicht ganz. Was hältst du davon, Weihnachten auf einer Burg zu verbringen?«
Eigentlich hatten sie vorgehabt, auf dem Anwesen seiner Familie in Cornwall unterzukommen. »Das hängt davon ab, wie gut sie beheizt ist«, erwiderte sie. »Wo ist sie denn?«
»Auf St Michael’s Mount, also nur ein kleines Stück weiter. Hast du die Times von heute vorliegen?«
»Ja, ich glaube schon. Moment.« Sie legte den Hörer ab und holte die Zeitung aus dem Esszimmer, wo ihr Vater sie beim Frühstück gelesen hatte. »So, wonach soll ich suchen? Hast du wieder Schlagzeilen gemacht?«
Archie lachte, immer noch peinlich berührt von der Aufmerksamkeit, die ihm vor Kurzem beim Fall eines Mannes zuteilgeworden war, der seine Frau und drei Kinder brutal ermordet hatte. »Das reibst du mir sicher noch ewig unter die Nase, oder?«
»Gut möglich. Ich kenne sonst niemanden, der schon in der Wochenschau war.«
»Das liegt Gott sei Dank hinter mir. Und jetzt schau dir mal den Aufmacher auf Seite sechs an.«
Sie schlug die Seite auf und entdeckte einen Artikel namens »Findige Idee verhilft Flüchtlingshilfe zu Spendenflut«, und Archie wartete geduldig, während sie den Artikel las.
Auf eine Bekanntmachung dieser Zeitung am vergangenen Samstag folgte eine beispiellose Reaktion: Der Flüchtlingsfonds Lord Baldwins konnte den Spendenstand auf 155730 Pfund erhöhen. Hilaria St Aubyn hatte erklärt, sie werde ihren Familiensitz auf St Michael’s Mount in Cornwall über Weihnachten einer begrenzten Anzahl an Gästen öffnen, um Spenden für diesen so dringlichen Zweck zu sammeln. St Michael’s Mount, das vor der Küste nahe Penzance liegt und bei Ebbe über einen schmalen Dammweg zugänglich ist, wird von einer mittelalterlichen Kirche samt Burg dominiert, die von Geschichten und Legenden umrankt ist. Die einmalige Gelegenheit, das Weihnachtsfest in dieser Umgebung zu verbringen, stieß auf ein großzügiges Echo. Ein zukünftiger Gast – dessen Identität zunächst geheim bleiben soll – hat eine Spende in Höhe von zehntausend Pfund angekündigt. Der Fonds wurde vom ehemaligen Premierminister Baldwin ins Leben gerufen, um Tausende jüdische Kinder aus Nazideutschland in Herbergen und Privathaushalten unterzubringen. Miss St Aubyn, die für ihre Wohltätigkeitsarbeit bekannt ist, soll hocherfreut sein, dass ihr Vorhaben so erfolgreich war, und hat ihren Gästen ein unvergessliches Fest versprochen.
»Was für eine wundervolle Idee.« Josephine legte die Zeitung wieder hin. »Aber übernehmen wir uns da nicht? Mit zehntausend Pfund kann ich nicht mithalten, egal, wie gut der Zweck ist.«
»Musst du auch gar nicht. Hilaria und ich sind alte Freunde. Wir sind zusammen aufgewachsen, und du hast sie auch schon öfter bei Anlässen in London getroffen.«
»Der Name kam mir irgendwie bekannt vor.« Josephine erinnerte sich vage an eine große, elegante Frau Mitte vierzig, die über Reisen und Musik gesprochen hatte. »Ganz schön mutig, das eigene Zuhause gegen Höchstgebot zugänglich zu machen. Wer weiß, wer da am anderen Ende des Knallbonbons zieht.«
»Genau darum geht es«, erwiderte Archie. »Sie hat mich gestern Abend noch spät angerufen und wollte wissen, ob ich Weihnachten kommen und ein paar von meinen ›schillernden‹ Freunden mitbringen könnte. Anscheinend wurde die Sache viel begeisterter aufgenommen, als sie gedacht hatte, und sie hat einen ganz besonderen Gast, den sie nicht enttäuschen möchte.«
»Wahrscheinlich den, der zehntausend Pfund gespendet hat?«
»Ganz genau. Sie hat nicht mit der Spende einer Berühmtheit gerechnet, und jetzt befürchtet sie, die anderen Gäste könnten daneben langweilig wirken. Reich, aber langweilig. Ich habe dich und Marta vorgeschlagen, da war sie ganz begeistert.«
»Wie schmeichelhaft. Und um wen handelt es sich bei dem berühmten Spender?«
Archie schwieg, was sie genauso ärgerte wie die verschmitzte Anspielung in der Zeitung. »Ich will die Überraschung nicht verderben, aber glaub mir, du wirst nicht enttäuscht sein. Und Hilaria lässt ausrichten, dass du ihr einen Riesengefallen damit tun würdest und sie keine finanzielle Zuwendung von dir erwartet, wobei sie sicher nichts gegen eine kleine Spende hätte. Die Lage wird sich in nächster Zeit bestimmt nicht entspannen. Also, was meinst du? Hast du Lust?«
Josephine zögerte. Sie hatte sich schon darauf gefreut, Loe Estate im Winter zu erleben, und die Vorstellung eines Hauses voller Fremder, die sich gegenseitig übertrumpfen wollten, kam ihr nicht sehr weihnachtlich vor. Aber Archie hatte sich offensichtlich schon festgelegt, und Marta war immer für ein Abenteuer zu haben. »Na gut«, antwortete sie. »Das klingt sehr nett. Ich richte Marta aus, dass wir uns von unserer glamourösesten Seite zeigen müssen.«
»Gut. Hilaria wird sich riesig freuen, und ich habe auch nichts dagegen, mal wieder ein paar Tage dort zu verbringen. Mein letzter Besuch ist schon ewig her.«
»Und der Plan ist immer noch, Heiligabend anzureisen?«
»Darüber wollte ich auch noch mit dir sprechen. Ich muss separat anreisen, um den Ehrengast zu begleiten.«
»Ist sie wirklich so wichtig? Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine Frau handelt. Du hast so einen Ton in der Stimme.«
»Das stimmt doch gar nicht. Heiligabend steht jedenfalls noch. Ihr werdet in Marazion entweder mit dem Auto abgeholt oder mit dem Boot, je nachdem, wann ihr ankommt. Der Damm ist immer nur ein paar Stunden lang befahrbar.«
»An Weihnachten vom Rest der Welt abgeschnitten. Dieses Jahr ist das vielleicht tatsächlich zehntausend Pfund wert.« Die imposante Silhouette von St Michael’s Mount war ihr von Zugfahrten vertraut, doch sie wäre nie auf den Gedanken gekommen, sie könnte eines Tages dort übernachten. Allmählich regte sich Vorfreude in ihr.
»Schön, dass du einverstanden bist«, sagte er. »Wie ist die Lage in Inverness? Dein Vater klang am Telefon recht gut.«
»Ja, ihm geht es gut, und gerade ist unser Nesthäkchen eingetroffen, das hilft natürlich besonders.« Wie auf Kommando erschien Moire mit zwei Sherrygläsern im Türrahmen, und Josephine winkte sie vorbei. »Hast du viel zu tun auf der Arbeit?«
»Viel zu viel. Du weißt schon, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Gerade hat eine Frau in Ealing ihrem Mann die Kehle aufgeschlitzt, und wir haben drei kleine ausgehungerte Mädchen in unsere Obhut genommen, die irgendwer grün und blau geschlagen hat. Dann haben wir gestern Abend einen Kerl aus der Themse gezogen, der seine Schulden nicht zahlen konnte und nicht ohne Geschenke nach Hause kommen wollte.« Er klang verbittert, und Josephine fragte sich zum tausendsten Mal, wie er mit der erbarmungslosen Traurigkeit seiner Arbeit zurechtkam. »Weihnachten wird es immer elender als den Rest des Jahres. Dieser Zwang zum Frohsinn treibt die Leute zu den schrecklichsten Taten. In diesem Sinne … wir sehen uns in Cornwall. Richte Marta liebe Grüße aus.«
»Mach ich.«
Sie legte auf, und Moire lächelte sie vielsagend an. »Ich wollte euch nicht unterbrechen.«
»Hast du auch nicht.«
»Wie geht es deinem Polizisten?« Josephine würdigte die Frage keiner Antwort, doch Moire ließ sich davon nicht beirren. »Ich verstehe wirklich nicht, wieso ihr zwei nicht zur Sache kommt. Ihr seid schon seit Jahren so eng miteinander, und jünger werdet ihr auch nicht. Du sagst doch immer, was für ein netter Kerl er ist, da könntest du es wirklich schlechter treffen. Warum tust du dich nicht mit ihm zusammen? Für Papa finden wir schon eine Lösung.«
Josephine fielen hundertundein gute Gründe ein, doch sie hatte nicht vor, sie ihrer Schwester zu unterbreiten. »Wir sind nur miteinander befreundet.« Sie nickte in Richtung des kleinen Geschenks, das Moire in der Hand hielt. »Was hast du ihr dieses Jahr besorgt?«
»Eine Brosche. Und du?«
»Einen Ring von einem Markt in London. Der hätte ihr bestimmt gefallen.« Josephine sah zu, wie ihre Schwester das Geschenk unter den Baum legte, der unten am Treppenabsatz stand. Das Ritual hatte am ersten Weihnachtsfest nach dem Tod ihrer Mutter begonnen, ein persönlicher Akt der Erinnerung, der ihnen beiden viel bedeutete und sorgfältig gehütet wurde. Schon merkwürdig, überlegte sie, dass diese untypische Sentimentalität nur an Weihnachten hervortrat, wo doch ihre Mutter – genau wie andere Schottinnen ihrer Generation – nie viel Aufhebens um das Fest gemacht hatte. Wenn Josephine an ihre Mutter dachte, war es in ihrer Vorstellung stets Sommer, und sie schritt über den Strand in Nairn oder spielte mit ihren Töchtern in Daviot, dem Dorf, das sie alle so sehr geliebt hatten. Der Winter hatte ihr nie zugesagt, und trotzdem besorgten Josephine und Moire ihr Geschenke und weinten in ihren Sherry.
»Kaum zu glauben, dass sie schon seit fünfzehn Jahren nicht mehr bei uns ist«, sagte Moire.
»Unfassbar.« Sie drückte die Hand ihrer Schwester und hob ihr Glas. »Frohe Weihnachten.«
2
Hilaria St Aubyn saß am Fenster im Arbeitszimmer ihres Vaters und traf die letzten Vorbereitungen für Weihnachten, bevor sie alles mit ihrer Haushälterin besprechen würde. Der Größe des Hauses zum Trotz zog es sie immer wieder in eines der kleinsten Zimmer, wo ihr einfach alles gefiel: die eichenvertäfelten Wände mit den Familienporträts, die ihre lange Verbindung zu St Michael’s Mount würdigten, den alten Partnerschreibtisch, von dem aus sie das Anwesen verwaltete – wobei sie mit jedem Jahr, in dem ihr Vater älter und gebrechlicher wurde, neue Aufgaben übernahm –, den Sessel, auf dem sie abends oft saß, um den Sonnenuntergang über dem Meer zu betrachten und die Zufriedenheit zu genießen, die damit einherging, einen weiteren Tag sicher überstanden zu haben.
Die alljährlichen Traditionen rührten sie dieses Jahr besonders an, da es womöglich ihr letztes Weihnachtsfest auf der Insel war. Ihr Vater war inzwischen über achtzig, und der Verlust zweier geliebter Ehefrauen innerhalb weniger Jahre hatte seiner Gesundheit geschadet; wenn er starb, würden sein Titel und die Insel an Hilarias Cousin übergehen, und sie müsste das Leben verlassen, das sie seit Kindertagen kannte. Es war müßig, sich über das Erbrecht zu ärgern, und noch müßiger, sich in sentimentalen Gedanken über ihr geliebtes Zuhause zu ergehen, doch sie konnte sich nicht gegen die Angst wehren, mit ihrem Recht, hier zu wohnen, auch ihren Lebenszweck zu verlieren. Wie schon ihre Eltern fühlte sie sich den Leuten verpflichtet, die auf der Insel lebten und arbeiteten – schließlich war ihre Familie nicht die einzige, die seit Generationen hier zu Hause war, und sie liebte und respektierte die Inselbewohner für ihren Stolz und ihre Loyalität. Sie hatte gehofft, sie durch die schwierigen Jahre zu begleiten, die ihnen bevorstanden, doch es war unwahrscheinlich, dass sie einen weiteren Krieg hier verbringen würde. Während das Ende ihrer Zeit auf St Michael’s Mount unaufhaltsam näher rückte, nahm sie die wechselnden Jahreszeiten und wiederkehrenden Ereignisse des Inseljahres intensiver wahr. Schließlich war es womöglich das letzte Mal, dass sie die Narzissenernte beaufsichtigte oder an den Felsen von Cromwell’s Passage baden ging, das letzte Mal, dass sie nach Hause kam und die überwältigende Liebe in der Brust spürte, die der Anblick der Burg in ihr auslöste. Und nun stand ihr vielleicht ihr letztes Weihnachtsfest bevor, und die Unsicherheit raubte dem Anlass ein gutes Maß an Freude. So musste es sich anfühlen, wenn einem der sichere Tod bevorstand.
Da klopfte es an der Tür, gerade als die Standuhr in der Ecke zur vollen Stunde schlug, und sie war dankbar, dass Nora Pendean sie aus ihren Grübeleien geweckt hatte. »Der Blaue Salon sieht großartig aus.« Sie bat die Haushälterin mit einer Geste, Platz zu nehmen. »Jedes Jahr denke ich, der Baum kann nicht prachtvoller werden, und jedes Jahr beweisen Sie mir das Gegenteil.«
»Schön, dass er Ihnen gefällt, Miss«, erwiderte Nora. »Alle freuen sich auf morgen, und die Kinder sind schon ganz aufgeregt.«
»Gut. In Anbetracht der aktuellen Lage können wir alle ein bisschen Vorfreude gebrauchen. Wer weiß, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit sind?« Die Haushälterin nickte, und sie besprachen die Weihnachtsfeier für die Inselbewohner, die am nächsten Tag stattfinden würde. Die jährliche Tradition gab es schon, soweit Hilaria zurückdenken konnte – Bescherung für die Kinder am Nachmittag, gefolgt von einem frühen Abendessen auf der Burg und einem Weihnachtskonzert im Dorf –, und wenn sie ehrlich war, bereitete ihr der Tag mehr Freude als die förmlichen Feierlichkeiten am ersten Weihnachtstag. »Sie wissen ja, dass dieses Jahr alles etwas anders abläuft«, fuhr sie fort. »Wir haben übers Wochenende zwölf Gäste, darunter einen Fotografen der Times, und spätestens zum Tee an Heiligabend sollten alle hier sein. Die meisten waren noch nie hier, und mir ist wichtig, dass sie sich vom ersten Moment an wohlfühlen und jeden nur erdenklichen Luxus genießen. Niemand reist mit Personal, also habe ich die diejenigen notiert, um die wir uns kümmern müssen.« Sie schob einen Zettel über den Schreibtisch und wartete auf die Reaktion der Haushälterin angesichts des ersten Namens auf der Liste, doch sie fiel verhaltener aus, als Hilaria erwartet hätte. »Stimmt etwas nicht, Miss Pendean?«
»Nein, Miss, alles in Ordnung. Ich sorge dafür, dass die Damen mit allem versorgt sind.«
»Davon gehe ich aus. Ich dachte bloß, Sie wären etwas begeisterter bei der Sache. Wir haben ja nicht jeden Abend berühmte Schauspielerinnen zu Gast.« Sie wartete auf eine Erklärung für die offensichtliche Verstimmung der Haushälterin. »Also, was ist los?«
»Ich will mich nicht im Ton vergreifen, Miss.«
»Ich bitte Sie, Miss Pendean, verraten Sie mir einfach, was Sie belastet.«
»Na gut. Es geht nicht darum, wie berühmt sie ist, sondern woher sie kommt. Sie haben es doch selbst gesagt – in Anbetracht der aktuellen Lage bin ich mir nicht sicher, ob das Personal darüber erfreut sein wird, eine Deutsche zu bedienen.«
Hilaria war von ihrer Offenheit überrascht, doch mit der Reaktion hätte sie rechnen sollen. »Darf ich Sie daran erinnern, dass die Kinder, für die wir Spenden sammeln, ebenfalls Deutsche sind? Dort drüben gibt es zahlreiche Menschen, die ebenso entsetzt sind wie wir. Vielleicht sogar noch mehr, da es sich um ihr Vaterland handelt. Ich hoffe, ich kann darauf zählen, dass alle Gäste in unserem Haus höflich und respektvoll behandelt werden, egal, woher sie kommen?«
»Natürlich, Miss.«
»Gut. Dann richten Sie Mrs White jetzt bitte aus, dass ich die Menüplanung für das Wochenende bis heute Mittag benötige. Das wäre alles.«
Normalerweise entließ sie ihr Personal nicht derart grob, und sie bereute es, noch bevor Mrs Pendean das Zimmer verlassen hatte. »Ach, Mrs Pendean«, rief sie. »Am Sonntag in der Kirche ist mir aufgefallen, dass eine der Krippenfiguren beschädigt ist. Könnten Sie die bitte zu Mrs Soper bringen, damit sie bis Heiligabend repariert ist? Die Kirche sieht dank Ihnen um diese Jahreszeit immer besonders spektakulär aus, und unsere Gäste werden sicher begeistert sein. Immerhin steht sie an Weihnachten ja im Mittelpunkt.«
Die Haushälterin nickte, doch das Lob auf die Kirche – eigentlich ihr ganzer Stolz – stieß diesmal nicht auf die gewohnte Warmherzigkeit. Bestimmt fehlte Nora Pendean ihre Tochter, besonders jetzt an Weihnachten. »Wie geht es Jenna?«, fragte Hilaria sanfter. »Ich kann kaum glauben, dass sie schon seit fast einem Jahr nicht mehr bei uns ist.«
»Ihr geht es gut, Miss, vielen Dank«, antwortete Nora. »Zumindest gehe ich davon aus. Wir dürfen uns nur einmal im Monat schreiben, aber in letzter Zeit hat es nicht immer geklappt.«
»Bestimmt bereitet sie sich im Moment auf ihr letztes Gelübde vor.«
»Ja, im Februar ist es so weit.«
»Sie macht der Insel alle Ehre, genau wie Ihnen und Ihrem Mann. Sie sind sicher sehr stolz auf sie.«
Für den Bruchteil einer Sekunde rang die Haushälterin um Fassung, und auf ihrem Gesicht zeichneten sich Zorn und Ablehnung ab, gemischt mit einem Anflug von Mitleid. Hilaria spürte den Vorwurf so deutlich, als hätte Mrs Pendean ihn ausgesprochen: Sie würde die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind nie verstehen, genauso wenig wie der Kummer, der damit einherging. Sie schwieg, und so blieb es Mrs Pendean überlassen, die Ordnung wiederherzustellen. »Wenn das alles wäre, mache ich mich mal wieder an die Arbeit.«
Sie ging aus dem Zimmer, und Hilaria wandte sich wieder zum Fenster. Der kurze Austausch hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Gerade war Flut, und die Wellen brandeten gegen die Felsen, trafen mit einem hohlen Geräusch auf die Mauern, das sie schon immer als seltsam tröstlich empfunden hatte. Normalerweise gaben ihr die Stunden, in denen der Dammweg überflutet und die Insel weniger zugänglich war, ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit – als wäre man auf dem offenen Meer, aber keiner Gefahr ausgesetzt –, doch heute bestärkten sie lediglich die Zweifel an ihrem Plan, und sie sehnte sich nach den vertrauten Traditionen. An Weihnachten sollte man daran festhalten, was einem lieb und teuer war, statt Fremde einzuladen. Sie wünschte inständig, sie hätte sich nicht von ihren guten Absichten übertölpeln lassen, doch für eine Planänderung war es zu spät. Sie würden eben das Beste daraus machen müssen.
3
Nora Pendean überquerte die Südterrasse und betrat die winzige mittelalterliche Kirche, die auf dem höchsten Punkt der Insel thronte – das geistliche Herz, um das der Rest der Burg erbaut worden war. Die Holzfiguren der Weihnachtskrippe standen an ihrem gewohnten Platz direkt hinter dem Nordeingang; es waren dieselben wie schon zu ihrer Kindheit, geschnitzt von einer vergessenen Hand zu Zeiten von Queen Victoria. Ihre Gesichtszüge waren ihr so vertraut wie die guter Freunde, und schnell hatte sie die beschädigte Figur ausgemacht: einen der drei Könige, an dessen bemalter Krone ein Stück abgesplittert war und das darunterliegende Holz freilegte. Sie nahm die Figur und hielt kurz inne, um Maria an der Krippe zu betrachten, eine gewöhnliche Frau mit ihrem neugeborenen Kind. Hatte sie sich am Ende betrogen gefühlt? Hatte sie auf die Jahre voller Liebe zurückgeblickt und sich gefragt, wozu das alles gut gewesen war?
Das Wetter schlug gerade um, und gegen Ende ihres Abstiegs zum Dorf wogte der Regen bereits wellengleich über die Insel, strich über den Wald im Hintergrund und verdunkelte die Steinmauern der Burg. Sie zog den Mantel enger um sich und verfluchte die schwere Figur, während sie auf das kleine Museum am Hafen zusteuerte. Ihr Mann arbeitete auf dem Hafenkai, beaufsichtigte die Anlieferung von Kohle und Feuerholz, und sie bog ab, um kurz mit ihm zu reden. Er winkte ihr zu, ließ sich jedoch nicht von der Arbeit ablenken, als würde sie es sich dadurch anders überlegen und ihm die Frage ersparen. »War die Post schon da?«, rief sie.
»Ja, vor einer halben Stunde.«
»Und?«
»Nichts von Jenna, Schatz. Sonst hätte ich es dir sofort gebracht.« Obwohl sie damit gerechnet hatte, konnte sie ihre Enttäuschung nicht verhehlen, und Tom legte ihr eine Hand auf den Arm. »Bis Weihnachten sind es noch ein paar Tage. Gib die Hoffnung nicht auf.« Er meinte es bloß gut, doch sie schüttelte ihn ab und versuchte, seinen verletzten Blick zu ignorieren. Er nickte in Richtung der Holzfigur. »Was hast du denn mit dem vor?«
»Reparieren lassen. Anscheinend muss alles perfekt in Schuss sein. Keine Ahnung, warum wir uns diese ganze Mühe für einen Haufen Fremder mit mehr Geld als Verstand machen.«
»Es ist doch für einen guten Zweck. Stell dir mal vor, du hättest in dem Alter dein Zuhause verlassen müssen.«
Sie war nicht gerade in großzügiger Stimmung gegenüber anderen Eltern, die ihre Kinder verloren, selbst wenn es sich dabei um Flüchtlinge handelte, und zuckte die Achseln. Diese Gefühlskälte war untypisch für sie, und Tom wurde langsam ungeduldig. »Das hat sie sich eben gewünscht. Jenna ist glücklich, auch wenn wir das nur schwer verstehen.«
»Du hörst dich genauso an wie sie.« Nora nickte Richtung Burg. »Ich kann es nicht mehr ertragen, dass mir alle erzählen, was das Beste ist und wie glücklich ich mich schätzen soll. Ich wünsche mir doch bloß, dass diese ganzen Jahre etwas bedeutet haben, dass sie uns so sehr vermisst wie wir sie. Wieso bist du nicht auf meiner Seite?«
Er hatte keine Lust, diesen Streit zu wiederholen, und wandte sich ab. Sie sah ihm hinterher, wie er den Hafen entlangging und die erste Ladung Kohle in die Standseilbahn schaufelte, die Waren und Gepäck hinauf zur Burg brachte. Egal, wie sehr sie ihn liebte und es auch versuchen mochte – sie konnte keinen Trost bei ihm finden. Er wollte ihr reichen, so wie sie ihm reichte, doch das konnte sie nicht einmal aus Nettigkeit vortäuschen. Vor ihr lag ein leeres, trostloses Weihnachtsfest, und sie fragte sich, woher sie die Kraft nehmen sollte, es zu überstehen.
4
Die nächtliche Straßenbahn schob sich trotzig über die Blackfriars Bridge, ein Rechteck aus warmem gelbem Licht, das sich, umringt von herabfallendem Schnee, langsam der Stadt näherte. Alex Fielding wartete, bis sie vorbeigefahren war, und überprüfte dann die Kameraeinstellungen für die letzten Aufnahmen. Es war die Aufgabe eines Fotografen, vertraute Dinge wie zum ersten Mal zu sehen, und selbst wenn man dem melancholischen Wasserstreifen, der das Herz der Stadt durchschnitt, sein Leben widmete, konnte man ihm unmöglich vollständig gerecht werden. Bei Sonnenuntergang zeigte sich die Themse stets von ihrer besten Seite, dachte Fielding, während die ölige Oberfläche den Schnee verschluckte; irgendwie ergab das Wirrwarr aus Dächern, Kaminen und Türmen in der Dunkelheit mehr Sinn. Die Umrisse der Stadt wirkten simpler und dadurch beruhigender, und ein paar tröstliche Stunden lang ließ sich fast glauben, dass sich das Leben ebenso einfach ordnen ließ.
Ein Polizeiboot, das unter der Brücke hindurchtuckerte, zerstörte die Illusion, und im Schein der Navigationslichter machte Fielding zwei vornübergebeugte Gestalten im Heck aus. Der Motor wurde abrupt ausgestellt, und das Boot glitt kurz lautlos dahin, dann klatschte der Anker ins Wasser, auf der Suche nach einer verlorenen Seele, die die Weihnachtszeit nicht ertragen hatte. Eigentlich hätte sofort der berufstypische Instinkt für Schlagzeilen übernehmen sollen, doch es war nicht die richtige Jahreszeit für anderer Leute Tragödien, und Fielding machte sich wieder auf den Weg ins Büro, um die Polizei ihrer tristen Arbeit zu überlassen. In der Ferne schlug Big Ben zur vollen Stunde.
Selbst abseits des Ufers war die Luft inzwischen nasskalt, doch die hell erleuchteten Fenster auf der Nordseite der Straße mäßigten die Trostlosigkeit, die sich über Fielding gelegt hatte wie ein frühmorgendlicher Nebelschleier. Der Hauptsitz der Times, ein schlichter roter Backsteinbau gegenüber der U-Bahn-Station Blackfriars, befand sich ein Stück entfernt von der restlichen Presse in der Fleet Street, als wollte er auf seiner Überlegenheit beharren. Der frische Schnee dämpfte die vertrauten Abendgeräusche der Stadt, und Fielding – die Begeisterung für die Arbeit immer noch frisch und unverdorben, wie die weißen Straßen und Gehwege – überquerte die Straße, um die Aufnahmen des Tages abzuliefern.
Der Zigarettenqualm auf der dritten Etage war weniger dicht als sonst, ein deutliches Anzeichen der vor Weihnachten einkehrenden Ruhe. Fielding klopfte am Büro des Chefredakteurs und wurde wie gewöhnlich mit einem knappen Laut hereingebeten. Dick Robertson hielt gerade einem Nachwuchsreporter eine Standpauke, der die Gelegenheit zur Flucht dankbar nutzte. Die Dienstagsausgabe lag offen auf dem Schreibtisch, auseinandergepflückt und mit Kommentaren versehen, und an die Stelle alter Nachrichten traten Artikel, die nach Redaktionsschluss eingetroffen waren. Ob Robertson überhaupt ein Zuhause hatte? Egal zu welcher Schicht, er hielt sich stets irgendwo im Haus auf. »Sie wollten mit mir sprechen, Sir?«
»Ja, schon vor Stunden. Wo zum Teufel waren Sie?«
»Unten am Fluss. Ich habe noch ein paar Bilder für den Artikel morgen –«
»Jaja, schon gut«, unterbrach Robertson gereizt. »Manchmal frage ich mich, wieso ich überhaupt hier arbeite. In ganz Europa ist die Hölle los, und trotzdem wollen alle bloß den Wetterbericht lesen. Was stimmt nicht mit den Leuten? Wieso können die nicht einfach aus ihrem verdammten Fenster schauen?«
»Es ist fast Weihnachten. Vielleicht machen sie ja alle Reisepläne für die Feiertage.«