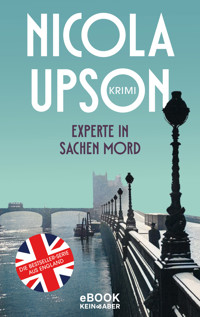
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Krimi
- Serie: Josephine Tey und Archie Penrose ermitteln
- Sprache: Deutsch
Ein Mord, der das flirrende Theatermilieu des Londoner West Ends gewaltig aufwirbelt. Im Auge des Orkans: die gefeierte Autorin Josephine Tey. Gemeinsam mit ihrem alten Freund Detective Archie Penrose muss sie sich der Frage stellen: Inwiefern steht die Tat mit Josephines erfolgreichem Theaterstück in Verbindung?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Nicola Upson wurde 1970 in Suffolk, England, geboren und studierte Anglistik in Cambridge. Ihr Debüt Experte in Sachen Mord bildet den Auftakt der erfolgreichen, mittlerweile zehnbändigen Krimi-Reihe. Bei deren Hauptfigur Josephine Tey handelt es sich um eine der bekanntesten Krimi-Autorinnen des Britischen Golden Age. Mit dem Schnee kommt der Tod war nominiert für den CWA Historical Dagger Prize (2021). Nicola Upson lebt in Cambridge und Cornwall.
ÜBER DAS BUCH
März 1934. Josephine Tey fährt mit dem Highland Express von Schottland nach London, um den Triumph ihres Theaterstücks zu feiern – doch ihre Ankunft wird von dem Mord an einer jungen Mitreisenden überschattet. Detective Inspector Archie Penrose ist überzeugt, die Tat stehe in Verbindung mit Josephine. Irgendwo in der extravaganten Theaterwelt lauere ein skrupelloser Mörder darauf, sie zum Opfer ihres eigenen Erfolgs zu machen. Können die beiden den Fall lösen, bevor er erneut zuschlägt? Während ihrer Ermittlungen tauchen sie tief ein in das Londoner West End mit all seinen Intrigen und Verlockungen. Sie merken: Je tiefer sie graben, desto häufiger stoßen sie auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die für immer hätten verborgen bleiben sollen.
Für Phyllis und Irene, für ihre Weisheit und ihren Glauben,in Liebe von uns beiden.
Als er sich endlich hinsetzte, um loszuschreiben, senkte sich gerade die Nacht herab. Er blickte in den Garten hinaus und beobachtete, wie der dunkelgraue Himmel Zentimeter für Zentimeter einer Schwärze wich, die sich wie ein Leichentuch über die Büsche am Rand seines Sichtfelds legte. Wie jedes Jahr hatte der Winter die Landschaft zu eintöniger Trostlosigkeit verwoben und allem, was er vom Fenster aus erkennen konnte, eine müde wirkende Gleichförmigkeit verliehen. Die Kälte hatte den Reichtum der Welt abgetötet. Morgen früh würde der Fenstersims mit Frost bedeckt sein.
Er konnte es nun kaum erwarten, seine Vergangenheit zu übergeben. Nachdem er sich den letzten Rest Wärme aus der Whiskeyflasche auf dem Schreibtisch eingegossen hatte, leerte er sein Glas und nahm sich einen Bogen Briefpapier. Mit Befriedigung dachte er, dass es sich um eine originelle Art des Vermächtnisses handelte. Als wollte es der Bedeutsamkeit des Moments Respekt zollen, verstummte das Haus, das sonst so voller leiser, aber vertrauter Geräusche steckte. Er griff nach dem schmalen, braunen Buch, das vor ihm auf dem Tisch lag, und blätterte durch die Seiten, bis er zu dem Absatz gelangte, aus dem er zitieren wollte; die Zeilen waren ihm immer schon seltsam treffend erschienen, heute mehr denn je. Mit einem bitteren Lächeln, das halb dem Bedauern und halb der Resignation geschuldet war, nahm er den Füllfederhalter zur Hand und begann zu schreiben, wobei seine Lippen stumm die Worte mitsprachen: »Es kann nicht so schwer sein, ein Experte in Sachen Mord zu werden.«
1
Wäre Josephine Tey abergläubisch gewesen, hätte sie es vielleicht als schlechtes Omen betrachtet, dass ihr Zug, der Morgenexpress aus den schottischen Highlands, schon bei der Abfahrt eineinhalb Stunden Verspätung hatte. Als sie um sechs Uhr morgens die Treppe zum Bahnsteig hinuntergegangen war, hatte sie mit dem aufgeregten Durcheinander gerechnet, das stets das Einsteigen der Passagiere und das Aufladen der Gepäckstücke vor Abfahrt eines Zuges begleitete. Was sie stattdessen sah, verhieß eine lange Wartezeit: Die Waggons waren dunkel, die Lokomotive stumm, und entlang des kalten, grauen Bahnsteigs häufte sich ein Berg aus Gepäckstücken an. Aber Josephine hatte wie die meisten Menschen ihrer Generation Krieg und Verlust erlebt und sich eine gewisse Gelassenheit angeeignet, und so war der für die Verspätung verantwortliche technische Defekt für sie kein unheilvolles Zeichen, sondern bedeutete lediglich einen lästigen Aufenthalt in der Bahnhofswirtschaft. Erstaunlicherweise würde bis zum folgenden Morgen nichts ihre Gemütsruhe stören, obwohl dies der Tag des ersten Mordes war.
Nachdem sie drei Tassen faden Kaffee getrunken hatte, schien der Zug endlich abfahrbereit zu sein. Sie verließ die überfüllte Wärme der Wirtschaft und machte sich erneut auf den Weg zum Bahnsteig. An dem neuen kleinen Verkaufsstand bei den Gleisen erstand sie eine Ausgabe der gestrigen Times und eine Tafel Schokolade von Fry’s. Als sie ihren Platz im Abteil einnahm, kam sie nicht umhin, trotz der Verspätung freudige Erregung zu verspüren: Schon am Nachmittag würde sie in London sein!
Die verschnörkelte Bahnhofsuhr verriet, dass es Viertel nach acht war, als der Zug endlich den Bahnhof verließ und langsam hinaus in die Landschaft rollte. Josephine lehnte sich auf ihrem Sitz zurück und ließ auch den letzten morgendlichen Frust von dem sanften Vibrieren der Räder vertreiben. Sie zog ihre Handschuhe aus, holte ein Taschentuch hervor und rieb am beschlagenen Abteilfenster ein kleines Guckloch frei, um zuzusehen, wie das zunehmende Tageslicht dem kalten Märztag ein wenig von seiner Schläfrigkeit nahm. Alles in allem war der Winter gnädig gewesen. Die Schneeberge und Winterstürme, die die schottische Eisenbahn im Vorjahr abrupt zum Stillstand gezwungen hatten und Josephine und viele andere über Nacht in Wartesälen hatten stranden lassen, waren Gott sei Dank ausgeblieben. Damals waren die Lokomotiven mit Schneepflügen ausgestattet worden, um sich einen Weg durch die Verwehungen zu bahnen, und Josephine würde es nie vergessen, wie sie in vollem Tempo gegen die Schneeberge gedonnert waren und riesige Eisklumpen mehr als zehn Meter in die Luft geschleudert hatten.
Beim Gedanken daran fröstelte sie. Sie schlug ihre Zeitung auf und wandte sich den Kritiken zu, wobei sie mit Erstaunen feststellte, dass die Crime Book Society »eine spannungsgeladene Geschichte« mit dem Titel Mr Munt macht weiter empfahl. Die können das Buch nicht gelesen haben, dachte sie. Sie selbst hatte es versucht und fand, Mr Munt habe schon viel zu lange weitergemacht, um sieben Shilling und sechs Pence wert zu sein. Als sie bei den Theaterkritiken ankam, die sie sich bis zum Schluss aufgehoben hatte, schmunzelte sie bei der Verkündung, Richard von Bordeaux – ihr eigenes Stück, inzwischen das am längsten laufende von ganz London – gehe nun in seine letzte Woche.
Während der Zug Richtung Süden ratterte und sich mühelos durch vierhundert Meilen Felder und Ortschaften fraß, fiel ihr auf, wie früh der Frühling in diesem Jahr nach England gekommen war – er hatte die sanften Ebenen ebenso rasch mit Grün geschmückt, wie er die Dramatik der schottischen Berge vor dem Hochlandhimmel verstärkt hatte. Sie fand es wunderbar, welche Ausblicke auf die Landschaft Zugreisen eröffneten – mit dieser ausgedehnten Weite konnte die Enge eines Automobils einfach nicht mithalten. Sie liebte Eisenbahnfahrten schon, seit sie als junges Mädchen sämtliche Ferien dazu genutzt hatte, die einspurige Strecke zwischen Inverness und Tain zu erkunden. Noch jetzt, über zwanzig Jahre später, konnte sie Schottland nicht in einem Zugwaggon verlassen, ohne an den Sommer zurückzudenken, in dem sie ihren siebzehnten Geburtstag gefeiert hatte. Damals hatten sie und ihr Freund Jack das schreckliche Wetter ignoriert und das schottische Hochland mit dem Zug erobert, indem sie vom Bahnhof Daviot aus jeden Morgen eine andere Strecke befahren hatten. Als fast genau ein Jahr später der Krieg ausgebrochen war, hatte sich ihre Welt für immer verändert. Die besondere Bindung jedoch, die sie zur damaligen, längst vergangenen Zeit spürte, war geblieben, und so würde es vermutlich auch immer sein.
Seit Josephine im letzten Jahr unerwartet im Blickpunkt der Öffentlichkeit gelandet war, fiel es ihr allerdings zunehmend schwer, die Verbindung zu jener Vergangenheit aufrechtzuerhalten. Es hatte dreizehn Monate und vierhundertsechzig Aufführungen gedauert, bis sie sich halbwegs daran gewöhnt hatte, die Verfasserin des beliebtesten Theaterstücks von London zu sein. Noch immer besaß der Ruhm einen eigenartigen Beigeschmack für sie. Richard von Bordeaux hatte ihr Erfolg gebracht, und dieser Erfolg ging mit einem Verzicht auf Privatsphäre einher, der ihr – wenngleich nötig – keineswegs leichtfiel. Jedes Mal, wenn sie Richtung Süden reiste, war sie hin- und hergerissen zwischen der Berühmtheit, die sie in London genoss, und der Verbundenheit, die sie zu Inverness verspürte. Keins von beidem war ihr gänzlich geheuer. Doch während der vielen Meilen, die dazwischenlagen, während der kostbaren Stunden im Zug, ließ sie sich von der Erinnerung daran trösten, wie sie sich mit siebzehn gefühlt hatte, als sie noch genau gewusst hatte, was sie wollte.
Heute war es mit der Ruhe und Anonymität früher vorbei als erwartet. In Berwick-upon-Tweed stieg eine liebenswürdig aussehende junge Frau zu und schob kurz darauf die Tür zu Josephines Abteil auf. Sie mühte sich peinlich berührt mit ihrem Gepäck ab, bis ein Kavalier aufsprang, um ihr dabei zu helfen, eine große, aufwendig bestickte Reisetasche in das Gepäcknetz über den Sitzen zu hieven. Sie lächelte ihm dankbar zu, als er ihr seinen Fensterplatz anbot. Während es sich die junge Frau bequem machte, starrte Josephine sie fasziniert an, was weniger an ihren Gesichtszügen lag als an dem bemerkenswerten Hut, der diese einrahmte: Es war ein Glockenhut aus feinem schwarzem Stroh, der auf einer Seite von einer gebogenen, weiß, beige und braun gesprenkelten Straußenfeder akzentuiert wurde, befestigt mit einer langen, mit schwarzer Spitze bezogenen Hutnadel. Josephine selbst hätte niemals eine derart extravagante Kopfbedeckung getragen, neben der ihr eigener schlichter Samthut regelrecht langweilig wirkte. Und doch bewunderte sie die grazile Schönheit dieses Kunstwerks.
Die junge Frau bemerkte ihren Blick und strahlte sie an. Schnell wandte sich Josephine wieder ihrer Zeitungslektüre zu, hatte beim Überfliegen der Resultate der Pferderennen jedoch das unbehagliche Gefühl, beobachtet zu werden. Als sie aufsah, senkte die junge Frau beschämt den Blick auf ihre Zeitschrift und begann mit übertriebenem Interesse, die Seiten zu studieren. Josephine wusste, dass die Fahrt für sie beide entspannter verlaufen würde, wenn sie die unausgesprochene Spannung aus dem Weg räumte. Also brach sie das Eis: »Wissen Sie, bei dem Unsinn, den diese Pferdefachleute schreiben, denke ich mir manchmal, ich könnte bei der Zeitung anheuern und die Rennkommentare selbst übernehmen.«
Die junge Frau lachte und freute sich über die Gelegenheit zu einem Gespräch. »Solange Sie dadurch nicht für die Bühnenwelt verlorengehen«, antwortete sie und wirkte umgehend ein wenig erschrocken. »Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen zu nahegetreten bin«, fuhr sie rasch fort. »Ich möchte Sie wirklich nicht stören, aber ich musste einfach etwas sagen. Sie sind es doch, oder? Ich habe Sie sofort erkannt, nachdem ich Ihr Bild in diesem reizenden Artikel gesehen hatte. Was für ein wunderbarer Zufall!«
Josephine zwang sich zu einem Lächeln und verfluchte stumm die Fotografie von sich, die in einem zweitklassigen Theaterblättchen erschienen war. Dieses hatte seiner Handvoll Leserinnen und Leser außerdem bestätigt, dass Gordon Daviot – das Pseudonym, unter dem sie schrieb – nicht ihr Geburtsname war. »Wie aufmerksam von Ihnen«, sagte sie und nahm verlegen zur Kenntnis, wie die übrigen Insassen des Abteils sich ebenfalls für ihre Mitreisende zu interessieren begannen. »Der Artikel ist schon ein Jahr alt. Mich überrascht, dass Sie sich noch daran erinnern.«
»Das ist es ja gerade: Ich habe ihn erst neulich wieder gelesen, nachdem ich erfahren hatte, dass ich nach London fahren würde, um mir Richard noch ein letztes Mal anzusehen. Ich habe ihn hier bei mir.« Als Beweis für den glücklichen Zufall zeigte sie auf ihre Reisetasche. »Sie denken jetzt hoffentlich nicht, ich würde das nur sagen, um Ihnen zu schmeicheln, denn so ist es nicht. Ich liebe dieses Stück einfach! Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich in der Vorstellung war. Bestimmt werde ich es schrecklich vermissen.« Sie hielt inne und zwirbelte sich geistesabwesend eine braune Locke um den Finger, während sie aus dem Fenster blickte. »Die meisten Menschen finden es wahrscheinlich albern, sich so fürs Theater zu begeistern und Geschichten, die sich andere Leute ausgedacht haben, so viel Bedeutung beizumessen, aber für mich ist es viel mehr als nur ein Theaterstück.« Sie sah wieder Josephine an. »Ich sollte nicht so vertraulich mit Ihnen reden, ich weiß. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt, und Sie wollen sicher Ihre Zeitung lesen. Trotzdem, ich muss die Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen bedanken. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, und seither ist alles furchtbar traurig für meine Mutter und mich. Ihr Stück hat mir sehr geholfen, diese Zeit durchzustehen, weil ich endlich einmal alles andere vergessen konnte.«
Josephine faltete gerührt ihre Zeitung zusammen und legte sie beiseite. »Was sollte daran albern sein?«, fragte sie. »Wenn man auf die Leute hören würde, die so etwas albern finden, hätte man überhaupt keine Freude im Leben. Das mit Ihrem Vater tut mir sehr leid. Kam sein Tod überraschend?«
»Nein, nein, er war schon lange krank. Er hat an der Front gekämpft, müssen Sie wissen, und sich nie wirklich vom Krieg erholt.« Sie lächelte bedauernd. »Manchmal glaube ich, dass meine Mutter sich nie von meinem Vater erholen wird. Sie war am Boden zerstört, als er starb – das waren wir beide. Erst jetzt, nach einem Jahr, geht es ihr allmählich besser. Zum Glück arbeiten wir zusammen, dadurch kann ich sie ein bisschen im Auge behalten.«
»In welcher Branche?«, fragte Josephine mit aufrichtigem Interesse.
Die junge Frau hob den Blick und lachte verschmitzt. »Haben Sie das noch nicht erraten? Wir stellen Hüte her.« Sie streckte ihre Hand aus. »Ich bin übrigens Elspeth. Elspeth Simmons.«
»Nennen Sie mich doch Josephine. Er ist wunderschön – Ihr Hut.« Elspeth errötete und wollte protestieren, aber Josephine unterbrach sie. »Nein, im Ernst: Wenn ich hier sitzen und Komplimente entgegennehmen muss, müssen Sie auch Ihren Anteil akzeptieren. Sie haben wirklich Talent – was offenbar in der Familie liegt.«
»Vielleicht. Darüber kann ich leider nur spekulieren, ich bin nämlich adoptiert«, erklärte Elspeth freimütig. »Meine Eltern haben mich als Baby bei sich aufgenommen. Sie haben schon recht: Meine Adoptivmutter hat mir alles beigebracht, was sie weiß, aber sehr ähnlich sind wir uns nicht, auch wenn wir uns hervorragend verstehen. Meine Vorliebe fürs Theater bringt sie auf die Palme, sie hasst Theaterstücke, von ein bisschen Varieté an Weihnachten einmal abgesehen. Also begleitet mich normalerweise mein Onkel. Wenn ich ihr erzähle, dass ich Sie im Zug kennengelernt habe, wird sie wahrscheinlich gar nicht wissen, wovon ich rede. Na ja, was solls?«, sagte sie ein wenig wehmütig. »Ich stelle mir manchmal vor, meine leiblichen Eltern hätten einen Hang zum Theater gehabt.«
Josephine warf erneut einen Blick auf den extravaganten Hut und konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass auch Elspeths Adoptivmutter einen gewissen Sinn für Dramatik besaß. Obwohl die junge Frau ihre anfängliche Schüchternheit fast gänzlich überwunden hatte und mit Feuereifer ihre Theaterleidenschaft schilderte, bedauerte Josephine den Verlust ihrer heiß geliebten Ruhe kein bisschen. In ihr wuchs vielmehr Bewunderung für Elspeths lebendiges Naturell heran, für die Tatsache, dass ihr Selbstmitleid vollkommen fremd zu sein schien. Ihr fröhliches Geplauder konnte trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr das Leben bereits eine ganze Reihe schwerer Schicksalsschläge auferlegt hatte: als Baby alleingelassen, von neuen Eltern adoptiert, nur um ihre zweite Chance auf eine glückliche Kindheit durch die Probleme ihres Adoptivvaters getrübt zu sehen, die sie in ihrem Alter noch gar nicht verstehen konnte – wenn es überhaupt ein Alter gab, in dem man so etwas verstand. Es mochte Tausende wie Elspeth geben, aber der Umstand, dass sie ihr Leid mit so vielen anderen teilte, machte es für sie selbst bestimmt nicht leichter erträglich. Josephine wusste das besser als jede andere. Zwanzig Jahre nach Kriegsausbruch erlebte eine zweite Generation nun erneut Leid und Verlust, weil sie zum Zusammenleben mit den äußerlich und innerlich Versehrten gezwungen war, deren Schmerz von den verstreichenden Jahren nur noch verschärft wurde. Nach der langen Krankheit und dem anschließenden Tod ihres Vaters konnte es Elspeth niemand verübeln, dass sie Zuflucht suchte in den weniger fordernden Emotionen der Bühne, oder dass sie mit einer anderen, glamouröseren Identität liebäugelte. Auch Josephine führte im Grunde ein Doppelleben – hier die fürsorgliche Tochter, die sich um ihren gesundheitlich fragilen Vater kümmerte, dort die gefeierte Bühnenautorin.
»Ich hoffe, Sie finden meine Frage nicht unhöflich«, fuhr Elspeth fort. »Werden Sie traurig sein, wenn Ihr Stück nicht mehr im West End aufgeführt wird?«
Genau dasselbe hatte sich Josephine vorhin, als sie die Pressemitteilung gelesen hatte, auch gefragt. Die Antwort hatte kein langes Nachgrübeln erfordert, auch wenn es unangemessen gewesen wäre, das wahre Ausmaß ihrer Erleichterung zuzugeben. »Nein, nicht wirklich«, sagte sie. »Es geht ja anschließend auf Tournee, und mir gefällt der Gedanke, dass es sich Menschen im ganzen Land ansehen werden. Ich habe außerdem noch ein anderes Stück in Arbeit, eigentlich sogar zwei, und mein Verleger möchte irgendwann einen zweiten Kriminalroman sehen. Über mangelnde Beschäftigung kann ich mich also nicht beklagen.« Sie erwähnte es Elspeth gegenüber nicht, aber es gab noch einen Grund dafür, dass sie nicht mehr allzu sehr an dem Stück hing, das sie berühmt gemacht hatte. Die Sache mit Elliott Vintner im letzten Jahr hatte ihr die anfängliche Freude über ihren Erfolg gründlich vergällt. Immer wieder hatte sie sich eingeredet, sie trage keine Schuld an dem Gerichtsverfahren oder seinem Nachspiel, doch allein der Gedanke daran, dass sich ein Mensch wegen ihres Triumphs das Leben genommen hatte, erfüllte sie mit einer eisigen Kälte, die sich durch kein noch so rationales Argument vertreiben ließ.
Bevor Josephine weiter darüber nachdenken konnte, ging zum Glück ein Kellner durch die Abteile: Der Speisewagen sei bereit, Mittagsgäste zu empfangen. »Lassen Sie uns etwas essen gehen«, schlug sie Elspeth vor, da sie gemerkt hatte, dass die Begeisterung der jungen Frau durch die Anwesenheit der übrigen Fahrgäste gedämpft wurde. »Es war ein langer Vormittag.«
Die Verspätung des Zugs hatte bei den Passagieren für großen Appetit gesorgt, und so war der Speisewagen schon beinahe voll, als sie dort eintrafen. Ein Kellner brachte sie an den letzten freien Tisch.
»Meine Güte, ist das elegant hier!«, schwärmte Elspeth und betrachtete die Bronzeleuchten, die vornehmen Teppiche und die Wandtäfelung aus Walnussholz. »Ich glaube nicht, dass ich schon mal in einer so luxuriösen Umgebung gegessen habe!« Sie nahm ihren Hut ab und sah sich nervös nach einem Ort um, an dem sie ihn unterbringen konnte, bis ihr ein Kellner zu Hilfe eilte und ihn mit einem Zwinkern entgegennahm. »Ich bin es nicht gewohnt, erster Klasse zu reisen«, gestand sie und griff nach einem silbernen Buttermesser, um das Wappen der Eisenbahngesellschaft auf dem Griff zu bewundern. »Die Fahrkarte war ein Geschenk. Können Sie für uns bestellen? Ich bin mir sicher, dass alles köstlich ist!«
Josephine lächelte. »Wenn ich ehrlich bin, wimmelt es in Inverness auch nicht gerade von noblen Restaurants, daher finde ich, wir sollten uns einfach wie in einem schicken Café fühlen und essen, wonach uns ist. Ich nehme die Seezunge – und Sie?« Elspeth studierte die Speisekarte und entschied sich, als der Kellner kam, für eine schlichte Fleischpastete. »Ein Glas Wein dazu, Miss?«, fragte er.
»Das wäre schön, aber ich wüsste gar nicht, welcher am besten zu diesem Essen passt«, antwortete Elspeth und sah Josephine Hilfe suchend an.
»Der Burgunder würde gut zu Ihrer Pastete passen, also nehmen wir den doch beide«, schlug sie vor und beobachtete amüsiert, wie der Kellner Elspeths Serviette entfaltete und mit einem erneuten Zwinkern eine Silbervase mit Blumen näher an sie heranschob. Elspeths Wangen röteten sich.
»Ich würde so gern mehr über das Ensemble erfahren!«, sagte sie, als die Getränke eintrafen. »Sind John Terry und Lydia Beaumont privat genauso unzertrennlich wie auf der Bühne? Ich werde es niemandem verraten, falls es ein Geheimnis ist. Die beiden sind so ein wunderbares Paar als Richard und Anne!«
Josephine schmunzelte, weil sie wusste, wie sehr sich Terry über das Gerücht gefreut hätte, er habe eine Romanze mit der glamourösen Hauptdarstellerin. Aber sie musste Elspeths Hoffnung zunichtemachen. »Nein, sie sind beide … na ja, sie sind nur gute Freunde«, sagte sie. »Es würde vermutlich auch die Zusammenarbeit erschweren, wenn echte Gefühle im Spiel wären. Zumal die beiden in meinem nächsten Stück wieder Seite an Seite spielen werden.«
»Darf ich fragen, was das für ein Stück ist?«
»Natürlich. Es handelt von Maria Stuart. Tatsächlich habe ich es Lydia auf den Leib geschrieben. Sie wollte immer schon die Königin von Schottland spielen.«
»Wie besonders, wenn jemand einem ein Stück auf den Leib schreibt! Sie muss vor Freude platzen. Ich kann es kaum erwarten, sie als Maria Stuart zu sehen!«
»Sie werden sie sogar schon früher sehen. Sie will mich nämlich in King’s Cross abholen, vorausgesetzt, unser Zug trifft ein, bevor sie für die Abendvorstellung im Theater sein muss«, erklärte Josephine und ließ sich dann ihren Fisch schmecken, nachdem sie Elspeth dazu ermuntert hatte, ebenfalls ordentlich zuzulangen. »Wenn Sie sie kennenlernen möchten, mache ich Sie beide miteinander bekannt.«
»Oh, das wäre großartig! Ich muss unbedingt Onkel Frank davon erzählen! Er hat Richard schon fast genauso oft gesehen wie ich.«
»Kommen Sie auch bei ihm unter?«
»Ja, wie immer, wenn ich in London bin. Meine Tante Betty und er haben ein Geschäft in Hammersmith – Schuhe und Strickwaren, solche Dinge.«
»Fahren Sie oft nach London?«
»Ungefähr ein Mal im Monat. Ich bringe neue Hüte für den Verkauf mit und helfe im Laden aus. Es ist ein Familienunternehmen, also trägt jeder seinen Teil bei. Onkel Frank ist ganz verrückt nach Theater. Er sammelt alles, was damit zu tun hat, und treibt Tante Betty in den Wahnsinn, weil die beiden nur eine kleine Wohnung über ihrem Geschäft haben und er sie mit Zeug vollstopft. Wenn ich in London bin, verbringen er und ich so viel Zeit im West End, wie wir nur können. Er wird begeistert sein, wenn ich ihm von der heutigen Fahrt erzähle. Meinen Sie, Sie könnten ein Programmheft für ihn signieren und es am Bühneneingang hinterlegen? Wenn es nicht zu viele Umstände macht …«
»Nein, nein, absolut nicht. Ich signiere auch gern Ihre Zeitschrift, wenn Sie möchten.« Josephine dachte einen Moment nach und fügte dann hinzu: »Haben Sie schon Eintrittskarten für die Vorstellung? Ich habe ein Kontingent für die ganze kommende Woche und würde mich freuen, wenn Sie mich an einem Abend begleiten.« Es sah ihr gar nicht ähnlich, Fremde so nah an sich heranzulassen, aber aus irgendeinem Grund hatte sie das Gefühl, die junge Frau, die ihr gegenübersaß, unter ihre Fittiche nehmen zu müssen. Zu ihrer großen Überraschung bestand die Reaktion auf ihre Frage in einem langsamen Erröten, das sich von Elspeths Hals über ihr ganzes Gesicht ausbreitete.
»Für morgen Abend bin ich schon verabredet. Er hat uns Plätze in der höchsten Preiskategorie besorgt«, erklärte sie. »Wir sind schon ein paarmal miteinander ausgegangen, und er ist wirklich reizend. Es ist seine erste Anstellung beim Theater, und er hat nicht viel Freizeit, daher ist es vermutlich das Letzte, was er gebrauchen kann, das Stück noch ein zusätzliches Mal über sich ergehen zu lassen«, stammelte sie und machte dann ein erschrockenes Gesicht. »Nicht, dass er es nicht toll finden würde, aber …«
Sie brach verlegen ab und schien nicht zu wissen, wie sie ihren Fauxpas wieder ausbügeln konnte. Josephine kam ihr zu Hilfe: »Machen Sie sich bitte keine Gedanken – wenn ich wählen könnte zwischen einem weiteren Abend mit Richard und einem guten Abendessen im Cowdray Club, müsste ich keine Sekunde überlegen. Selbst an schönen Dingen hat man sich irgendwann sattgesehen. Wie unterhaltsam eine Inszenierung auch fürs Publikum sein mag, wenn man im Theater arbeitet, möchte man lieber raus und etwas anderes erleben. Dass er sich überhaupt das Stück mit Ihnen ansehen will, beweist wohl, wie viel ihm an Ihnen liegt.«
Elspeth errötete erneut und entschuldigte sich für einen Moment. Josephine bat derweil um die Rechnung. Belustigt beobachtete sie, wie der Kellner seine Aufmerksamkeit von Elspeth auf einen anderen Tisch verlagerte, wo er für eine junge Dame, die allein speiste, deutlich länger als notwendig ein Kristallglas polierte. Dieses Mädchen begegnete seinen Avancen aufgeschlossener. Josephine sah dem jungen Mann dabei zu, wie er sie hofierte, und fragte sich, was wohl dabei herauskommen würde. Als Elspeth zurückkehrte, wehrte Josephine die Versuche ihrer Begleiterin ab, die Rechnung zu teilen, und sie machten sich wieder auf den Weg in ihr Abteil.
Endlich schlängelten sich die Waggons durch die Außenbezirke Londons. Wie Englands Städte sich doch verändert haben, dachte Josephine und betrachtete die kleinen, modernen Häuser und die riesigen Lichtspielpaläste, die überall aus dem Boden geschossen zu sein schienen. Als der Zug seine Fahrt noch weiter verlangsamte und in einen Tunnel fuhr, erlosch das schwindende Tageslicht vollends. Als es wieder auftauchte, zeichneten sich die dunklen Umrisse von St. Pancras und dem Midland Grand Hotel davor ab, einem Gebäude, das besser in ein Schauermärchen gepasst hätte als neben den eher gewöhnlichen Bahnhofsbau von King’s Cross. Josephine hatte gehört, dass Lokführer die Route von Schottland nach London mit Stolz befuhren und sich gern Wettrennen gegen den Fahrplan und gegeneinander lieferten. Dadurch erreichten sie Geschwindigkeiten von mehr als neunzig Meilen pro Stunde. Sie war nicht der einzige Fahrgast an Bord dieses Zuges, der ein stummes Dankesgebet sprach, weil sie dieser Kampfgeist mit weniger als einer Stunde Verspätung ans Ziel gebracht hatte.
Lydia Beaumont stampfte mit den Füßen, um die Kälte zu vertreiben. Sie war dennoch bemerkenswert gut gelaunt, denn als Vollblutschauspielerin spürte sie immer eine tiefe Verbundenheit mit Orten wie King’s Cross, die für Veränderung und Vergänglichkeit standen. Die Anonymität der unsteten Masse aus Reisenden und Straßenhändlern faszinierte sie, und das farbenfrohe Gewimmel entsprach ganz ihrem Sinn für Selbstdarstellung und ihrem Talent für Nachahmung.
Der zweite Grund für Lydias unerschütterlich gute Laune stand neben ihr. Marta Fox und sie waren, um es mit den Worten der Figur auszudrücken, die sie in Richard von Bordeaux spielte, noch an einem Punkt ihrer Beziehung, »an dem der Himmel über ihnen einstürzen konnte, ohne dass sie größeren Schaden davontrugen«. Es war März, und in anderen Jahren wäre es nicht ungewöhnlich gewesen, dass Lydia bereits drei verschiedene Versionen der Liebe ihres Lebens durchgespielt hätte, aber Marta ging nun bereits siegreich in den vierten Monat, es handelte sich also – für Lydias Verhältnisse – um eine äußerst beständige Beziehung.
Josephine entdeckte ihre Freundin bereits aus dem einlaufenden Zug heraus und verspürte die gleiche Mischung aus Bewunderung und Nervosität, die jedem ihrer Treffen vorausging: Bewunderung für Lydias anmutigen Charme und ihre kindliche Verschmitztheit, für den Schalk, der so oft in ihren Augen blitzte und ihre Mundwinkel zucken ließ; und Nervosität, weil die Berühmtheit anderer Josephine fast genauso unangenehm war wie ihre eigene. Mit Lydia hatte sie dennoch von Anfang an eine gegenseitige Wertschätzung verbunden, ein aufrichtiges Vertrauen, das darauf beruhte, dass sie die gleiche Offenheit für Unkonventionelles und den gleichen Abscheu vor Eitelkeit in jeglicher Gestalt teilten. Josephine genoss die vertrauensvolle Zuneigung, die die Schauspielerin ihr entgegenbrachte, und sie staunte manchmal noch immer darüber, dass sie ausgerechnet ihr galt. Aus alter Gewohnheit ließ sie abschätzend den Blick über die Frau gleiten, die neben Lydia auf dem Bahnsteig stand, und stellte erfreut fest, dass ihr eigener erster Eindruck sich mit der Beschreibung aus Lydias Briefen deckte. Selbst aus der Entfernung strahlte die Frau eine große Ruhe aus, und es lag eine stille Schönheit in ihrer gelassenen, selbstbewussten Körperhaltung. Wenn sich Marta als genauso stark erwies, wie sie wirkte, war sie vielleicht genau das richtige Gegengewicht zu der Unbeständigkeit von Lydias Theaterleben.
Elspeth war so aufgeregt, als sie Anne von Böhmen weniger als fünfzig Meter entfernt gesund und munter auf dem Bahnsteig stehen sah, dass Josephines dezentes Winken dagegen vollkommen unterging. Begierig darauf, den Zug zu verlassen und Lydia kennenzulernen, griff ihre junge Begleiterin nach oben, um ihre Reisetasche aus dem Gepäcknetz zu ziehen. Dabei vergaß sie völlig, dass sie die Tasche geöffnet hatte, um die Zeitschrift herauszunehmen, damit Josephine sie signieren konnte. Als nun der Inhalt ihres Handgepäcks auf den Boden prasselte, machte sie ein zutiefst erschrockenes Gesicht, und Josephine, deren erster Impuls es war, in Gelächter auszubrechen, wurde angesichts der Verletzlichkeit der jungen Frau von Mitgefühl überwältigt und beeilte sich, ihr zu helfen. Während sie zu zweit auf dem Boden des Abteils herumkrochen und nach davongekullerten Bonbons und Münzen tasteten, sahen sie sich durch die Beine der übrigen Fahrgäste hindurch an. Es dauerte nicht lang, da gewann das Lachen doch noch die Oberhand. Sie stellten sich ans Fenster, damit alle anderen ihr Gepäck zusammensuchen konnten, und gönnten sich eine Minute, um sich zu sammeln, bevor auch sie das Abteil verließen. Josephine wollte gar nicht wissen, was für einen Anblick sie den Wartenden auf dem Bahnsteig geboten hatten.
»Da ist sie ja endlich!«, sagte Lydia und zeigte zur Waggontür. »Ach du meine Güte, hast du diesen Hut gesehen?« Marta warf einen einzigen Blick in Richtung Zug und murmelte dann etwas davon, dass sie sich in die Taxischlange einreihen wolle. »Noch ein Minütchen, dann sind wir bei dir!«, trällerte Lydia hinter ihr her.
Als sie sich wieder dem Zug zuwandte, war Josephine bereits auf dem Weg zu ihr, zusammen mit der jungen Frau, die bei der Ankunft des Zugs ungewollt Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte. Hätte Lydia Josephine nicht gekannt, sie wäre nie auf die Idee gekommen, dass diese wortkarge Schottin mit dem schlichten schwarzen Kostüm und der Perlenkette Urheberin des größten Kassenschlagers im West End war. Nichts an ihr hatte sich verändert, seit Lydia sie zum ersten Mal während der Proben als schemenhafte Gestalt im Zuschauerraum entdeckt hatte. Sie sah immer noch eher wie eine Lehrerin aus oder eine jener alleinstehenden Damen, die man in der Ecke eines Hotelfoyers beim Briefeschreiben sah. Es war nicht leicht gewesen, sich mit ihr anzufreunden, denn Josephine widersetzte sich gern allzu großer Nähe und schenkte nur selten jemandem ihr uneingeschränktes Vertrauen, aber die Mühe hatte sich gelohnt. Josephine war aufmerksam und sensibel, interessierte sich für alles und jeden und besaß einen koboldartigen, sarkastischen Witz, der sich in Gesprächen ebenso zeigte wie in ihren Texten.
Josephine begrüßte Lydia mit einer Umarmung und stellte ihr die junge Frau dann als eine Freundin vor, die sie während der Reise kennengelernt habe. Die Schauspielerin war wie immer gnädig mit ihrem Publikum und durchlief geduldig die Prozedur aus oberflächlichem Geplauder und Autogrammen, die ihr zur zweiten Natur geworden war. Dabei gab sie Elspeth das Gefühl, dass sie der erste Mensch auf Erden war, der ihr je gesagt hatte, wie erschütternd er die Sterbeszene fand. Nach einem höflich bemessenen Austausch von Charme ihrerseits und Bewunderung Elspeths fielen ihr Marta und das wartende Taxi ein. »Komm, wir müssen dich sicher in das Tollhaus bringen, in dem du übernachtest«, sagte sie zu Josephine. »Du kannst bestimmt eine Pause gebrauchen nach dem langen Tag, und ich muss rechtzeitig im Theater sein, sonst ist Johnny während des gesamten ersten Akts ein Nervenbündel. Man sollte meinen, er hätte sich mittlerweile daran gewöhnt.« Sie warf Elspeth ein gewinnendes Lächeln zu und griff nach Josephines Reisekoffer. »Wird dir dein restliches Gepäck nachgeschickt?«, fragte sie.
Als sie das Wort »Gepäck« hörte, trat ein panischer Ausdruck in Elspeths Gesicht. »Ich glaube es nicht!«, rief sie. »Nach der ganzen Aufregung habe ich meine Reisetasche doch noch im Zug vergessen! Ich muss zurück und sie holen, und dann gehe ich besser schnell meinen Onkel suchen. Die gesamte neue Kollektion meiner Mutter ist da drin«, erklärte sie und zeigte auf einen Berg Hutschachteln, den ein unglückseliger Gepäckträger gerade aus dem Zug auf einen Gepäckwagen lud. »Sie bringt uns um, wenn wir die Hüte nicht unbeschadet bei Tante Betty abliefern.« Sie umarmte Josephine fest und versprach ihr, sich bei ihr zu melden, wenn sie mit ihrem Schatz ins Theater kam. Dann verschwand sie wieder in dem Waggon, aus dem sie vorhin gehastet war. Sie war so besorgt um ihre Reisetasche, dass sie nicht bemerkte, wie sich die Straußenfeder von ihrem Hut gelöst hatte und nun auf dem Bahnsteig lag. Josephine bückte sich, um sie aufzuheben.
»Behalte sie – steht dir bestimmt gut«, zog Lydia sie auf und betrachtete ihre Freundin halb bewundernd, halb mitleidig. »Du hast wirklich eine Engelsgeduld. Außer dir kenne ich niemanden, der einen ganzen Tag mit so viel jugendlichem Enthusiasmus verbringen könnte und am Ende noch bei voller geistiger Gesundheit wäre.«
Josephine lächelte. »Ich war selbst überrascht, wie viel Freude mir ihre Gesellschaft bereitet hat. Die muss ich ihr zurückgeben«, sagte sie und drehte sich mit der Feder zum Zug um. »Sie wäre sicher traurig, wenn sie sie bei ihrem Rendezvous mit ihrem jungen Verehrer nicht mehr hätte.«
Lydia packte ihren Arm. »Wir müssen wirklich los, Josephine, ich darf nicht zu spät kommen. Gib ihr die Feder doch, wenn ihr euch im Theater trefft.«
Josephine zögerte. »Du hast recht. Ich sehe sie wahrscheinlich schon morgen wieder. Dann lass uns zu Marta gehen – ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen!«
»Ja, dann kannst du mir sagen, ob der Roman, den sie schreibt, etwas taugt. Sie ist ein viel zu himmlisches Wesen, als dass ich selbst seine Qualität beurteilen könnte. Marta könnte auch den Seewetterbericht zu Papier bringen, und ich würde ihn für wahre Dichtkunst halten!« Die beiden Frauen lachten und machten sich auf den Weg zum Ausgang, zu vertieft in ihr Gespräch, um die Gestalt zu bemerken, die sich hinter ihnen auf den Zug zubewegte.
Im Abteil stellte Elspeth erleichtert fest, dass ihre Reisetasche noch immer auf dem Boden stand, wo sie sie abgestellt hatte. Der Zug wirkte beinahe menschenleer, nur vom Ende des Waggons, wo sich das Personal vermutlich auf die nächste Fahrt vorbereitete, drangen gedämpfte Geräusche herüber. Elspeth senkte den Blick auf die Zeitschrift in ihrer Hand, in der sich nun schon zwei kostbare Autogramme verbargen. Sie lächelte und schob sie vorsichtig zurück in die Seitentasche. Voller Vorfreude dachte sie darüber nach, wie viel schöner es nun sein würde, das Stück zu erleben, da sie schon zwei Mitwirkende persönlich kannte. Während sie die Seitentasche zuknöpfte und sich dieses Mal vergewisserte, auch den Rest der Reisetasche fest verschlossen zu haben, hörte sie hinter sich an der Abteiltür ein Geräusch. Sie drehte sich um, um dem Schaffner zu erklären, dass sie etwas vergessen hatte und schon auf dem Weg nach draußen war, und blickte plötzlich in ein vertrautes Gesicht, mit dem sie hier im Zug niemals gerechnet hätte. Bevor sie Gelegenheit hatte, sich darüber zu wundern, streckte sie instinktiv die Hand aus und nahm das Geschenk entgegen, das ihr Gegenüber ihr mit einem Lächeln hinhielt. Sie blickte auf die Puppe hinab, ein Souvenir von ihrem geliebten Theaterstück, das sie sich schon lange gewünscht hatte. Als ihr unerwarteter Besuch das »Bitte nicht stören«-Schild vom Haken nahm, es draußen vor die Abteiltür hängte und anschließend rasch ans Fenster trat, um die Rollos herunterzuziehen, öffnete Elspeth den Mund, um zu protestieren, aber es war bereits zu spät.
Ein Arm packte sie und zog sie in eine tödliche Umarmung, die wie eine Verhöhnung jener körperlichen Zärtlichkeiten wirkte, die sie in den letzten Monaten zum ersten Mal erlebt hatte. Ihr blieb keine Zeit zu schreien. Die Hand, die an ihrem Nacken lag und sie festhielt, war unerbittlich, zumal sie inzwischen keine Kraft mehr anwenden musste. Elspeths anfängliche Überraschung war einem lähmenden Entsetzen gewichen, und sie besaß nicht mehr Kontrolle über ihre Gliedmaßen als die Puppe, die zu Boden fiel und nach oben starrend liegen blieb, eine gleichgültige Zeugin von Elspeths letzten Momenten. Sie versuchte, normal zu atmen und ruhig zu bleiben, doch ihr Gesicht wurde gegen die fremde Brust gedrückt, und sie spürte Panik in sich aufsteigen. Ihr ging auf, dass sie dem Tod nahe war. Bitte, lieber Gott, dachte sie, nicht jetzt, nicht, wenn ich gerade so glücklich bin!
Als das todbringende Metall ihre Haut durchdrang, spürte sie nichts als einen kleinen Stich unterhalb ihrer Rippen. Sie hatte keine Gelegenheit mehr, dankbar zu sein für das Ausbleiben von Schmerz, oder sich darüber zu wundern, dass ihr Körper sich so gänzlich ohne Widerstand ergab. In jenem kurzen Moment, in dem sie zwischen Bewusstsein und Besinnungslosigkeit schwebte, zwischen Leben und Tod, wurden ihr all die Dinge bewusst, die sie nun versäumen würde. Doch ihre Wehmut war nur von kurzer Dauer, und als sie auf die Knie sank, trat ein anhaltender, aber viel zu früh eingetretener Frieden an ihre Stelle.
2
Detective Inspector Archie Penrose konnte sich nicht in der Gegend um King’s Cross aufhalten, ohne von Schwermut übermannt zu werden. Für ihn war der Norden Londons der abstoßendste und, obwohl sich die Straßen hier verbreiterten, klaustrophobischste Teil der Stadt. Er fuhr eine wenig reizvolle Durchgangsstraße hinunter, deren triste Häuser vermutlich noch nie renoviert oder auch nur gereinigt worden waren, und passierte anschließend die schäbige Ansammlung von Gebäuden, die die Euston Station bildeten. Dann kam King’s Cross, dessen Fassade – zwei große Bögen, die einen Uhrenturm aus hässlichem gelbem, im Laufe der Jahre schwärzlich verfärbtem Backstein umrahmten – ihn eher an den Eingang eines Zuchthauses erinnerte als an einen Bahnhof, das Eintrittstor zur Hauptstadt. Für einen Mann, der auf dem Weg zu einer Mordermittlung war, war diese Assoziation ganz sicher nicht hilfreich.
Am Zugang zu Bahnsteig acht hatte sich eine beachtliche Menschenmenge versammelt, die ihm die Sicht auf den Zug versperrte, in dem vor weniger als einer Stunde von einem jungen Eisenbahnmitarbeiter die Leiche der jungen Frau gefunden worden war. Laut Sergeant Fallowfield, der den Tatort als Erster erreicht hatte, stand der junge Mann unter Schock. Das erklärte er Penrose, nachdem er sich mit wenig Verständnis für deren Schaulust seinen Weg durch die Zaungäste gebahnt hatte.
»Man sollte meinen, die Leute hätten an einem Freitagabend Besseres zu tun. Verdammte Aasgeier, alle miteinander!«
Diese Bemerkung sah dem Sergeant überhaupt nicht ähnlich, der für gewöhnlich mit großem Optimismus auf die menschliche Natur blickte, obwohl ihn seine jahrelange Erfahrung als Polizeibeamter etwas anderes gelehrt hatte. Was auch immer er dort im Zug gesehen hatte, es ging ihm sichtlich an die Nieren. »Armes Kind, sie kann nicht älter als zwanzig gewesen sein«, sagte Fallowfield, als hätte er Penrose’ Gedanken erraten. »Sie hatte kaum Gelegenheit, ihr Leben richtig zu beginnen, geschweige denn, es zu genießen.«
»Wissen wir schon, wer sie war?«, fragte Penrose.
»Wenn wir davon ausgehen, dass die Reisetasche im Abteil ihr gehörte, hieß sie Elspeth Simmons und stammte aus Berwick-upon-Tweed – zumindest ist sie dort in den Zug gestiegen. Die Rückfahrkarte hatte sie auch schon. Ein widerwärtiger Mord, Sir, so bösartig, wie ich es kaum je erlebt habe. Ich denke, wir haben es mit einer kranken Persönlichkeit zu tun.«
Als er sah, was ihn in dem abgeriegelten Abteil erwartete, konnte ihm Penrose nur zustimmen. Die tote junge Frau saß auf dem mittleren der drei rechten Sitze des Abteils – oder schien vielmehr dort platziert worden zu sein –, und unterhalb ihres Brustbeins ragte eine verschnörkelte Hutnadel aus ihrem Kleid. Ihre Hände waren aneinandergelegt, als würde sie – welch Hohn – dem Schauspiel applaudieren, das jemand für sie auf den gegenüberliegenden Sitzen inszeniert hatte. Dort standen sich zwei Puppen gegenüber – eine männliche und eine weibliche –, als handelte es sich um Schauspieler auf einer Bühne. Sie umarmten sich mit halb einander zugewandten Körpern, und Penrose fiel auf, dass die linke Hand der weiblichen Puppe – die Hand mit dem Ehering – abgerissen war und vor dem Paar lag wie eine unheimliche Requisite aus einem Gruselfilm. In der Nähe der Puppen befand sich eine handgeschriebene Notiz auf teuer aussehendem Papier. »Lilien sind eleganter«, stand darauf, und auf dem Boden lag tatsächlich eine Blume, eine Schwertlilie.
Penrose war sofort klar, dass dies kein zufälliger oder spontaner Mord war, sondern eine genau durchdachte und vermutlich höchst persönliche Gewalttat. Jeder Gegenstand, den der Täter – oder die Täterin – an der Leiche oder um sie herum platziert hatte, schien eine Botschaft zu vermitteln. Und doch glaubte Penrose keine Sekunde, dass er oder sie damit bezweckte, sich leichter identifizierbar zu machen. Es handelte sich um ein Verbrechen, das eine enorme Kaltblütigkeit erforderte, so viel stand fest.
»Waren die Rollos oben oder unten, als sie gefunden wurde?«, fragte er.
»Beide unten, Sir. Der junge Eisenbahnmitarbeiter hat erzählt, er hätte eins nach Betreten des Abteils geöffnet, um besser sehen zu können.«
Es musste einige Minuten gedauert haben, nach dem Tod der jungen Frau die Puppen, die Nachricht und die Blume zu arrangieren, dachte Penrose, was ein größeres Risiko bedeutet hatte, als es die meisten Menschen ertragen hätten. Aber genau das war der springende Punkt: Bei einer symbolhaften Tat wie dieser hatten sie es nicht mit den Ängsten und Zweifeln einer normalen Person zu tun, sondern mit der Arroganz und dem Gefühl von Unverwundbarkeit, die das Böse stets begleiteten.
»Wurde sie genauso gefunden, wie sie jetzt dasitzt?«
»Ja. Sagt zumindest der junge Mann, Thomas Forrester ist sein Name. Er hat den Schreck seines Lebens davongetragen. Maybrick hat den Wartesaal räumen lassen und ihn mit einer Tasse Tee dorthin gebracht. Armer Kerl. In seinem Alter wäre ich auch nicht gern nichts ahnend über so eine Gräueltat gestolpert. Allein die Puppen hätten jedem einen Schauer über den Rücken gejagt – und dann musste er auch noch die Leiche finden.«
Penrose drehte sich zu den Puppen um. Sie waren etwa dreißig Zentimeter groß und aufwendig mit fransenbesetzten Umhängen und altmodischen Kopfbedeckungen gekleidet. Fasziniert trat er ein wenig näher an sie heran, betrachtete die fein gearbeiteten Gesichter, die an diesem Ort des Todes auf makabre Weise lebendig wirkten. »Das sind nicht einfach nur irgendwelche Puppen, Bill. Ich frage mich, ob sie der jungen Frau gehörten, oder ob der Mörder sie mitgebracht hat. Das sind Souvenirs, die man im Theater kaufen kann, sie gehören zu einem historischen Stück, das gerade im West End läuft: Richard von Bordeaux. Darin geht es um Richard II. Die Puppen wurden nach dem Vorbild der Hauptdarsteller gefertigt. Und auf diesem Blatt Papier«, fuhr er fort und zeigte auf den Zettel auf dem Sitz, »steht ein Zitat aus dem Stück: ›Lilien sind eleganter.‹ Ich glaube, das sagt Königin Anne irgendwann.«
Fallowfield hatte noch nie von dem Stück gehört, aber es überraschte ihn nicht, dass sein Vorgesetzter alles darüber wusste. Neben der Polizeiarbeit war das Theater Penrose’ große Leidenschaft, und er wusste nicht nur außergewöhnlich gut über das Thema Bescheid, sondern hatte auch einige Freunde und Verwandte, die in der Branche arbeiteten. »Ich dachte, die Notiz wäre eine seltsame Art von Liebesbrief«, sagte Fallowfield.
»Ist sie vermutlich auch«, antwortete Penrose. »Die Frage ist nur: Von wem stammt sie? Und wie wird der Absender reagieren, wenn wir ihm die Nachricht übermitteln, dass Miss Simmons tot ist?«
»Sie meinen, er weiß vielleicht längst davon?«, beendete Fallowfield seinen Gedankengang. »Wäre das nicht ein bisschen zu offensichtlich, Sir? Ich meine, es lässt sich sicher leicht herausfinden, ob es jemanden gab, der ihr den Hof machte. Wenn es wirklich ihr Verehrer war, der sie umgebracht hat, hätte er genauso gut gleich seine Adresse am Tatort zurücklassen können. Das hätte uns ein wenig Zeit erspart.«
»Da könnten Sie recht haben. Allerdings wird es wohl nicht so einfach, wie Sie es darstellen. Zunächst einmal haben wir keine Garantie, dass es sich wirklich um einen Liebesbrief handelt. Den anderen Gegenständen nach zu urteilen, die hier aus einem bestimmten Grund drapiert wurden, gibt es eine weit tiefere Bedeutung als nur eine schiefgelaufene Romanze. Apropos: Finden Sie nicht, dass die Hutnadel als Tatwaffe eine seltsame Wahl ist? Kein besonders maskuliner Mord. Wenn es ein Agatha-Christie-Roman wäre, hätte er fünfzehn leicht zu lesende Kapitel und würde Mord im Highland-Express heißen.«
»Vielleicht sind also alle die Mörder, Sir. Im Übrigen sind es nur neun Kapitel«, korrigierte ihn Fallowfield und ließ damit eine Kenntnis der aktuellen Kriminalliteratur erkennen, die Penrose immer wieder überraschte. Er sah seinen bodenständigen Sergeant vor sich, wie er jeden Abend von Scotland Yard nach Hause eilte, um am Kamin den neuesten Krimi zu verschlingen – oder besser noch, selbst einen zu verfassen! Der Gedanke, dass sich Miss Dorothy L. Sayers als mittelalter, korpulenter Gesetzeshüter mit Schnurrbart herausstellen könnte, war zu lustig. Er nahm sich vor, Josephine davon zu erzählen, wenn er sie morgen Abend traf.
Allerdings würde er sie nun früher sehen müssen als geplant, und es würde kein vergnügliches Treffen werden. Aus irgendeinem Grund stand der Mord an dieser jungen Frau mit Josephines Stück in Verbindung, und auch wenn sich dieser Grund als völlig harmlos herausstellen sollte, konnte er ihr diesen Umstand nicht vorenthalten. Zumal sie das auch gar nicht gewollt hätte. Er hätte ihr die Sache gern ein wenig erleichtert, indem er ihr eine schnelle, saubere Aufklärung in Aussicht stellte, wie die, mit der sie ihren ersten Kriminalroman beendet hatte, doch er konnte ihre Intelligenz nicht auf diese Weise beleidigen. Damit hätte sie ihn auf keinen Fall davonkommen lassen. Er konnte sich noch so sehr nach dem Glück sehnen, das seinem fiktiven Pendant Inspector Alan Grant bei seinem ersten literarischen Auftritt hold gewesen war, aber Josephine und er wussten beide, dass die Realität anders aussah. Im echten Leben hatte der Tod Chaos und Leid im Gepäck und sorgte für Brüche und Gräuel, die sich nicht auf die Seiten eines Romans bannen ließen.
Peinlich berührt bemerkte er, dass Fallowfield nicht bei Agatha Christie verharrt, sondern das Gespräch fortgesetzt hatte. Der Sergeant war es zum Glück gewohnt, dass Penrose’ Gedanken abschweiften, und wiederholte geduldig, was er gesagt hatte: »Es ging um die Hutnadel, Sir. Elspeth Simmons hat anscheinend ihr Geld damit verdient. Mit dem Hutmacherhandwerk, meine ich. Die Nadel war also vielleicht einfach zur Hand, und der Mörder hat sie deshalb damit erstochen.«
Penrose warf einen Blick auf den Hut, der zerschrammt und zerknautscht in der Nähe der Leiche auf dem Boden lag, ein weiteres Opfer der Gewalt, die hier stattgefunden hatte. »Ja, vielleicht.« Er sah die junge Frau aufmerksam an und versuchte, über die vom Tod abgestumpften Gesichtszüge hinauszublicken, sich vorzustellen, wie sie noch vor wenigen Stunden gewesen war, zu ermitteln, was ihm an ihr aufgefallen wäre, wenn sie ihm auf der Straße begegnet wäre. Bei jeder Mordermittlung bestand er darauf, den Toten eine Würde und Individualität zuzugestehen, die sie zu Lebzeiten womöglich gar nicht genossen hatten. Der alte Spruch war zutreffend: Es gab nur wenige echte Mordmotive – angeführt wurde die Liste von enttäuschter Liebe, Habgier und Rache –, aber jedes Opfer war anders und hatte das Recht, als individueller, einzigartiger Todesfall behandelt zu werden. Penrose bewegte sich näher an die Leiche heran, nah genug, dass ihm ein Blutfleck an ihrem Kragen auffiel. Der Fleck war Hinweis auf eine kleine Schnittwunde seitlich am Hals, die er ansonsten vielleicht übersehen hätte. Der Kopf des Opfers war zur Seite gesackt und hing leicht nach vorn. Penrose entdeckte eine kahle Stelle am Nacken, wo der Mörder die Haare grob abrasiert und dabei die Haut eingeritzt hatte, offensichtlich zu sehr in Eile, um sich darum zu kümmern. Ein paar Strähnen lagen noch auf der linken Schulter der jungen Frau. Was für eine eigenartige Handlung, dachte Penrose – so willkürlich und gleichzeitig so demütigend.
Die Luft im Abteil war schwül und drückend, und er war froh, als er hinaus in den Gang trat. »Wo ist eigentlich ihr Gepäck?«, fragte er Fallowfield. »Sollte es ihr in ihre Unterkunft geliefert werden, oder hatte sie vor, es selbst mitzunehmen?«
»Ich habe es im Schaffnerabteil einschließen lassen, Sir. Es gab keine Lieferanweisungen.«
»Dann muss jemand gekommen sein, um sie und das Gepäck abzuholen. Gehen Sie besser los und schauen Sie, wen Sie in der Menschenmenge aufstöbern können, Sergeant. Wer auch immer es ist, er wird inzwischen krank vor Sorge sein. Es sei denn, er oder sie hat etwas zu verbergen. Wir überlassen den Tatort jetzt den Kollegen von der Spurensicherung. Sagen Sie ihnen, ich will alles fotografiert haben, jedes kleinste Detail. Auch die Schnittwunde am Hals. Und wir sollten uns die Passagierliste vornehmen – je eher Sie mir diese und eine Liste des diensthabenden Personals beschaffen können, desto besser. Ich gehe jetzt und frage diesen Thomas Forrester, ob er uns mehr verraten kann, als wir bereits wissen. Da Sie es vorhin erwähnt haben: Ich könnte jetzt auch ein Tässchen von Maybricks Tee vertragen. Sollten Sie in der Zwischenzeit herausfinden, dass tatsächlich jemand auf die junge Frau gewartet hat, möchte ich das sofort erfahren. Haben Sie ihre Reisetasche durchsucht?«
»Ich habe einen kurzen Blick hineingeworfen, Sir. Ein paar persönliche Dokumente und Wochenmagazine. Das hier war in der Seitentasche, zusammen mit ihrer Fahrkarte«, sagte Fallowfield und hielt ihm eine Zeitschrift hin. »Sehen Sie sich Seite vierzehn an.«
Penrose kam der Aufforderung nach. Als er die mit dem heutigen Datum versehene Widmung las, wurde ihm das Herz schwer: »Für die wunderbare Elspeth, vielen Dank für die unvergessliche Reise. Ich hoffe, wir sehen uns wieder! Alles Liebe, Josephine (Gordon).« Josephine hatte die junge Frau also auch gekannt und war vielleicht einer der letzten Menschen, die sie lebend gesehen hatten. Er brauchte plötzlich etwas Stärkeres als einen Tee.
Als sein Blick auf die einzige Person fiel, die einem Zeugen nahekam – der junge Bahnmitarbeiter saß noch immer im Wartesaal und umklammerte einen vollen Becher Tee, der inzwischen kalt sein musste –, ging Penrose auf, wie unwahrscheinlich es war, dass er etwas Nützliches in Erfahrung bringen würde. Fallowfield hatte Forresters Zustand richtig eingeschätzt: Der Schock, unter dem dieser stand, war nicht zu übersehen und keineswegs überraschend. Die meisten Menschen hatten das Glück, sich frühestens in mittleren Jahren der Vergänglichkeit des Lebens bewusst zu werden und diese Last fortan mit sich herumzuschleppen. Der Krieg hatte Penrose’ Generation diesen Luxus verwehrt, und so hatte er mehr als genug Erfahrung damit, den Moment zu erkennen, in dem jemand erstmalig mit seiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert war.
Bei ihm selbst war dieser Moment gekommen, bevor er Gelegenheit gehabt hatte, etwas über sich selbst herauszufinden, zu wissen, wer er vielleicht geworden wäre, wenn die Welt eine andere gewesen wäre. Er konnte sich noch gut an jene Woche Anfang September erinnern, in der der Krieg ausgebrochen war. Es war etwa einen Monat vor seiner Rückkehr nach Cambridge gewesen, wo er das letzte Jahr seines Medizinstudiums hätte antreten sollen. In Cornwall war es ungewöhnlich heiß gewesen für September, und er hatte seine letzten Wochen zu Hause genossen. Der Himmel war tiefblau, und die Hitze wurde nur unwesentlich von der Seeluft gemildert. Wiesen und Gärten waren verdorrt, weil es so lange nicht mehr geregnet hatte, und die Äpfel, Birnen und Eicheln waren lange vor ihrer Zeit von den Bäumen gefallen. Im Dorf beschloss man, das Erntefest wie geplant durchzuziehen, trotz der Widrigkeiten des Kriegs. Penrose war also mit dem Rest seiner Familie zu dem Kirchlein oben auf der Klippe gewandert, das sich am Rand des Anwesens seines Großvaters befand, um wie jedes Jahr den Worten seines Onkels, des Gemeindepfarrers, zu lauschen, der Gott für eine prächtige Ernte und das anhaltend schöne Wetter danken würde, das es ihnen erlaubt hatte, sie einzufahren.
Sobald er den großen Union Jack erblickte, der statt des üblichen Behangs an der Kanzel befestigt war, ging ihm auf, dass Gottes Stellvertreter – ein scheinheiliger Frömmler, auch wenn er zur Familie gehörte – etwas anderes im Sinn hatte als die übliche Dankesrede. Nachdem sein Onkel eine flammende Predigt über rühmliche Schlachten gehalten hatte, in der er Verstümmelung, Gemetzel und Blutvergießen im Namen einer höheren Macht verherrlichte, drängte er zunächst sämtliche junge Männer des Dorfes, sich als Soldaten zu melden, um ihre Nation und die Gerechtigkeit zu verteidigen. Was er nicht erwähnte, war die Tatsache, dass Tausende von ihnen den Kampf mit ihrem Leben bezahlen würden. Seine ungewöhnliche Erntepredigt zeigte dennoch Wirkung: Bis zum Ende des Jahres war jeder kampffähige Mann im Dorf Kitcheners neuer Armee beigetreten, ein Exodus, der sich im ganzen Land vollzog. Im Laufe von nur vier Monaten schwoll das Heer um fast eine Million Soldaten an. Einige erwarteten wohl, nah der Heimat stationiert zu werden, während die Berufssoldaten auszogen und das wahre Kriegshandwerk erledigten. Die meisten glaubten den Zeitungen, wenn diese schrieben, es würde ein kurzer Krieg werden, der allerhöchstens bis Weihnachten dauern würde. Sie alle täuschten sich, und Penrose wurde noch heute übel beim Gedanken an jenen Aufruf von der Kanzel, die jungen Männer sollten sich zu Ehren Gottes für acht Shilling und neun Pence die Woche der Armee andienen.
In seinen dunkleren Momenten, wenn es ihm besonders schwerfiel, eine Verbindung zum Leben aufrechtzuerhalten, fragte er sich, ob ihn vielleicht genau das mit seiner Arbeit weitermachen ließ: kein abstrakter Wunsch nach Gerechtigkeit oder der Glaube, das Böse eindämmen zu können, das manche Menschen von Geburt an in sich trugen, sondern das verzweifelte Bedürfnis, die Schuldgefühle in Schach zu halten, die ihn seit jenen Tagen begleiteten. Manchmal gelang es ihm. Dann vertrieb der Verlauf einer Ermittlung, bei der die Menschlichkeit einer Person an erster Stelle stand, die Gedanken an Tod und Verderben und Sinnlosigkeit. Doch solche Momente waren selten, und der Groll, der seit dem Krieg ein Teil von ihm war, schien sich mit den Jahren immer fester in ihm zu verankern.
»Was haben Sie gemacht, bevor Sie Miss Simmons in dem Abteil gefunden haben?«, fragte er den jungen Mann im Wartesaal sanft.
»So hieß sie also?«
»Ja. Ihr Vorname war Elspeth. Was wollten Sie in dem Abteil?«
»Mich vergewissern, dass es sauber und aufgeräumt ist für die nächste Fahrt.«
»Aber das war doch eigentlich nicht Ihre Aufgabe, oder? Sie sind Kellner, und kein Schaffner.«
Tommy Forrester sah den Detective Inspector an und wusste sofort, dass es sinnlos war, besonderen Arbeitseifer vorzuschützen. »Da war dieses Mädchen, wissen Sie. Im Speisewagen. Sie hat mir die ganze Zeit schöne Augen gemacht, also habe ich die Kollegen gefragt, ob ich nicht versuchen könnte, die Abteile nach ihr abzusuchen. Sie musste ja irgendwo sein. Ich dachte, ich kann sie vielleicht noch erwischen, bevor sie aussteigt, und sie fragen, ob sie später Lust hat, mit mir was essen zu gehen. Ist ja nichts Schlimmes dabei«, beendete er trotzig seine Erklärung.
»Und, ist es Ihnen gelungen?«
»Ist mir was gelungen?«
»Sie zu erwischen, bevor sie ausgestiegen ist?«
»Ja. Wir wollten uns nach meiner Schicht vor dem Bahnhof treffen. Wahrscheinlich hat sie es inzwischen aufgegeben, auf mich zu warten«, sagte Tommy mit einem sehnsüchtigen Blick Richtung Ausgang.
»Hat dieses Mädchen, von dem Sie reden, auch einen Namen?«
»Ivy. Ihren Nachnamen kenne ich nicht. So weit waren wir noch nicht.«
»Und Sie wollten in jenem Abteil nicht in Wahrheit nach Miss Simmons suchen?«
In Penrose’ Stimme lag eine gewisse Schärfe, und Tommy dämmerte plötzlich, dass sein Bemühen um eine Verabredung ihm mehr Ärger eingehandelt hatte als erwartet. »Sie denken doch nicht, dass ich sie ermordet habe?«, rief er entsetzt. »Ich weiß, ich habe ihr im Speisewagen zugezwinkert, aber das war nur aus Freundlichkeit, das mache ich mit allen so. Ich könnte niemals einem Mädchen etwas antun. Außerdem dachte ich, sie wäre längst ausgestiegen. Ich habe sie auf dem Bahnsteig stehen sehen, als ich mit Ivy geredet habe.«
»Schon gut, beruhigen Sie sich.« Penrose schickte Maybrick los, für den unwahrscheinlichen Fall, dass diese ominöse Ivy tatsächlich nichts Besseres zu tun hatte, als den ganzen Abend vor einem Bahnhof herumzustehen und auf ihren Essenscoupon in Gestalt von Thomas Forrester zu warten. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Kellner zu. »Nein, ich denke keineswegs, dass Sie etwas mit dem Tod von Miss Simmons zu tun haben. Aber seien Sie vollkommen ehrlich zu mir und erzählen mir genau, was Sie wann getan haben. Sie sagen, Sie hätten Miss Simmons auf dem Bahnsteig stehen sehen. Dort herrschte doch sicher ein reges Kommen und Gehen – warum ist sie Ihnen dennoch aufgefallen?«
»Ihr Hut«, antwortete Tommy. »Man konnte sie unmöglich übersehen. Und wegen ihrer vielen Gepäckstücke. Ich weiß noch, wie froh ich war, kein Gepäckträger zu sein und das ganze Zeug vom Zug laden zu müssen.« Er hielt einen Moment inne und griff dann auf das Kriterium zurück, das in seiner Welt am wichtigsten war: »Außerdem war sie ganz ansehnlich. Nicht so hübsch wie Ivy, das ist klar, aber man hätte sich an ihrer Seite durchaus blicken lassen können.«
»Und nachdem Sie Miss Simmons auf dem Bahnsteig gesehen hatten, wie lange hat es dann gedauert, bis Sie ihre Leiche fanden?«
»Ich weiß nicht – zehn oder fünfzehn Minuten, nehme ich an. Ich habe Ivy getroffen, als sie gerade aus dem Zug steigen wollte. Sie hatte sich Zeit damit gelassen und gehofft, dass ich nach ihr suchen würde. Wir unterhielten uns ein paar Minuten direkt neben der Waggontür. Und dabei fiel mir, wie gesagt, Miss Simmons auf, die ein Stück weiter mit mehreren Frauen redete. Dann sah ich Mr Folkard auf mich zukommen – das ist mein Chef –, also machte ich schnell etwas mit Ivy aus und verduftete wieder, bevor er mich fragte, was ich hier wollte. Um einen Vorwand zu haben, ging ich durch die Abteile und sah nach, ob jemand etwas vergessen hatte. Und dabei betrat ich auch das Abteil, in dem …«
»Haben Sie irgendjemanden in der Nähe herumlungern sehen?«
»Gesehen habe ich niemanden, nein.«
»Aber?«
»Na ja, als ich das erste Mal an der Tür vorüberging, hing das ›Bitte nicht stören‹-Schild an der Tür, also habe ich nur geklopft und gesagt, die Gäste mögen sich beeilen. Dann bin ich zum nächsten Abteil weitergegangen.«
»Woher wussten Sie, dass jemand drin war? War es nicht wahrscheinlicher, dass jemand einfach das Schild hängen gelassen hatte und längst ausgestiegen war?«
»Ich habe gehört, wie sich jemand im Abteil bewegt hat.« Tommy senkte verlegen den Blick. »Ich dachte, das sind zwei Passagiere, die ein wenig … na ja, Sie wissen schon. Daher habe ich sie allein gelassen und bin ein paar Minuten später wieder zurückgekommen, nachdem ich gehört hatte, wie jemand die Abteiltür geschlossen hatte und davongegangen war.«
»Und was genau haben Sie aus dem Abteil gehört?«
»Nur ein Rascheln, sonst nichts.« Er blickte zu Penrose auf und fügte angriffslustig hinzu: »Sie glauben doch wohl nicht, dass ich sie im Stich gelassen hätte, wenn ich gewusst hätte, was da drinnen vor sich geht? Woher hätte ich denn ahnen sollen, dass ein verdammter Psychopath im Zug war?«
Deshalb war der Junge also so defensiv. Es war nicht nur der Schreck darüber, eine Leiche entdeckt zu haben, der ihn derart getroffen hatte, sondern auch die Erkenntnis, wie nah er dem Mord gekommen war, und seine Schuldgefühle, weil er ihn nicht verhindert hatte. Penrose fuhr mit sanfterer Stimme fort: »Was haben Sie gesehen, als Sie das Abteil betraten?«
»Es war fast vollkommen dunkel darin, weil die Rollos heruntergezogen waren. Ich konnte trotzdem sehen, dass noch jemand anwesend war. Ich dachte, die Person würde vielleicht schlafen, und ging zum Fenster, um ein Rollo zu öffnen. Als ich mich umdrehte, entdeckte ich die junge Frau und zwei seltsame Puppen auf den Sitzen gegenüber.«
»Wie lang waren Sie in dem Abteil?«
»Bestimmt nicht länger als ein oder zwei Minuten, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ich wäre nicht so lang geblieben, wenn mir nicht plötzlich der Gedanke gekommen wäre, dass der Täter vielleicht noch irgendwo herumlungert. Dann fiel plötzlich eine Blume vom Sitz, und ich bekam es mit der Angst zu tun und rannte raus. Albern, ich weiß.«
»Haben Sie irgendetwas angefasst?«
»Nur das Rollo.«
»Und die Frauen, mit denen sich Miss Simmons auf dem Bahnsteig unterhalten hat – haben Sie die vielleicht von der Zugfahrt wiedererkannt?«
»Nur eine, die Größere mit den dunklen Haaren und dem eleganten Kostüm. Sie war schon seit Edinburgh im Zug, und die beiden haben zusammen im Speisewagen zu Mittag gegessen. Haben die ganze Zeit gequasselt.«
»Sie schienen sich also gut zu kennen?«
»Das weiß ich nicht, aber sie haben sich blendend verstanden, das war offensichtlich.«
»Und was ist mit der anderen Frau?«
»Ich glaube nicht, dass ich sie vorher schon mal gesehen habe. Andererseits haben wir so viele Gäste im Speisewagen, vielleicht ist sie mir einfach nicht aufgefallen. Mit ihr hat sie auf jeden Fall nicht an einem Tisch gesessen.«
»Wie sah sie aus?«
»Für ihr Alter war sie ziemlich attraktiv – sie muss schon Mitte vierzig gewesen sein, denke ich. Lange Haare. An mehr erinnere ich mich nicht.«
Penrose hatte genug gehört, um zu wissen, dass Elspeths Begleiterinnen die Urheberinnen der beiden Widmungen in ihrer Zeitschrift waren. »Waren die zwei Frauen immer noch bei ihr, als sie wieder in den Zug gestiegen ist?«, fragte er und bemühte sich, sich nicht anmerken zu lassen, wie bang ihm mittlerweile ums Herz war.
»Das habe ich doch bereits gesagt: Ich weiß es nicht. Als ich erneut hingesehen habe, waren sie verschwunden, und ich bin davon ausgegangen, dass sie aufgebrochen waren. Ich habe niemanden wieder in den Zug einsteigen sehen, aber Sie wissen ja, wie es ist, wenn die Leute aussteigen und überall Gepäck herumsteht – dann herrscht ein so großes Gewimmel, man kann gar nicht alles mitbekommen.«
»Nun gut, dann lassen wir es fürs Erste dabei bewenden. Erzählen Sie niemandem, was Sie im Zug gesehen haben – haben Sie das verstanden?«, fragte er streng, ohne wirklich damit zu rechnen, dass seine Worte erhört wurden. Der Junge würde aller Wahrscheinlichkeit nach mit jemandem über sein Erlebnis reden. Penrose wusste aus eigener Erfahrung, dass es nichts Schlimmeres gab, als der Erste zu sein, der eine Leiche sah, und anschließend damit allein zu bleiben. Die Einsamkeit war unerträglich.
Maybrick kam zurück und nickte knapp. »Also, Tommy«, sagte Penrose. »Es sieht aus, als wäre Ihre Ivy begeisterter von Ihnen, als Sie dachten. Sie hat uns bestätigt, was Sie uns erzählt haben, also teilen Sie bitte dem Constable mit, wo wir Sie finden, falls wir Sie noch einmal brauchen. Danach können Sie gehen. Lassen Sie das Mädchen besser nicht noch länger warten. Und denken Sie daran: Verraten Sie niemandem irgendwelche Details.«





























