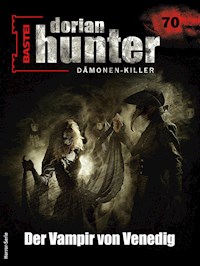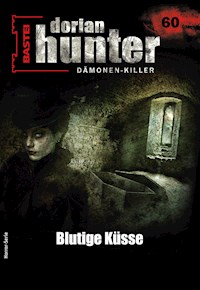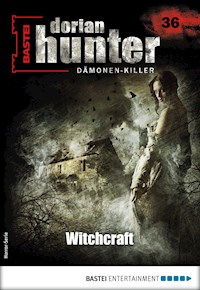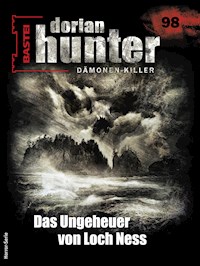
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
»Weg, Junge!«, schrie Harry Bogdan dem Schiffsjungen zu und zerrte ihn hinüber zum Niedergang. John Lagally aber blieb bei Tusher, der mit dem Kaffeebecher, der vor ihm auf dem Kompass stand, die Glasscheibe des Signalkastens einschlug und die Leuchtpistole vom Haken zerrte.
Der unheimliche neblige Schwaden, jetzt in giftig-grellen Farben leuchtend, kroch näher. Und dann waren die seltsamen Laute zu vernehmen. Stimmen schienen da zu klagen, spitze Schreie auszustoßen, heiser zu stöhnen.
»Schieß doch!« John Lagally hielt sich die Ohren zu, fiel auf seine Knie und schlug ein Kreuzzeichen.
Als Tusher nicht reagierte, sprach Lagally wieder auf, entriss ihm die Pistole und richtete die Mündung der Signalpistole auf die herankriechende Wolke. Er schloss die Augen und drückte ab ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DAS UNGEHEUER VON LOCH NESS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen zu jagen – doch diese schlagen zurück und zersetzen die »Inquisitionsabteilung« des Secret Service, der Dorian vorübergehend unterstützt hat. Der ehemalige Leiter der Inquisitionsabteilung, Trevor Sullivan, gründet in der Londoner Jugendstilvilla in der Baring Road die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt als zweiter Rückzugsort das Castillo Basajaun in Andorra, in dem er seine Mitstreiter um sich sammelt: die Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; den Hermaphroditen Phillip, dessen Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie Ex-Secret-Service-Agent Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Beinahe wird die schwangere Coco Zamis ein Opfer der Machtkämpfe innerhalb der Schwarzen Familie, doch nach einer Flucht um den halben Erdball bringt Coco ihr Kind sicher zur Welt – und versteckt es an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält. Cocos Vorsicht ist berechtigt, da bald eine neue, »alte« Gegnerin auftaucht: Hekate, die Fürstin der Finsternis, wurde von Dorian einst in seinem vierten Leben als Michele da Mosto verraten, sodass ihre frühere Liebe sich in glühenden Hass verwandelt hat.
Die Erinnerung an seine Existenz als da Mosto veranlasst Dorian, nach der Mumie des Dreimalgrößten Hermes Trismegistos zu forschen. Im Golf von Morbihan stößt er auf die versunkenen Stadt Ys und birgt aus ihr einen Handspiegel, dem unheimliche Kräfte innewohnen. Der Spiegel scheint mit seinem jeweiligen Besitzer eine Art Beziehung einzugehen, ihm Lebensenergie zu entziehen. Aber Dorian ist auf den Spiegel angewiesen – er stellt die einzig wirksame Möglichkeit dar, den Erzdämon Luguri in die Schranken zu weisen, bevor dieser die Welt endgültig ins Chaos stürzt.
DAS UNGEHEUER VON LOCH NESS
von Gay D. Carson
Da war zuerst nur ein weißer, milchiger Schwaden, der über der See lag. Seine Ausdehnung mochte höchstens einige Hundert Meter betragen. Er wurde vom aufkommenden Wind erfasst, ohne sich jedoch aufzulösen. Die Ränder dieses Schwadens fransten zwar ein wenig aus, ließen sich ein Stück wegtragen, kehrten aber erstaunlicherweise gegen den auffrischenden Wind zurück.
Pete Tusher, der Eigner und Kapitän des kleinen Fischkutters, blinzelte in die grelle Nachmittagssonne und war plötzlich nicht mehr so schläfrig. Nebel war hier draußen im Moray Firth nicht gerade ungewöhnlich, doch dieser Schwaden passte nicht in das gewohnte Bild. So etwas hatte er noch nie gesehen. Er traute diesem feinen Nebelschwaden nicht, der jetzt rotierte, sich verdichtete und zusammenschrumpfte. Aus dem Zentrum dieses feinen Nebels stieß plötzlich eine Art Finger hoch, der sich in den Himmel bohren wollte.
»Pete, was ist das?« Harry Bogdan erschien neben der geöffneten Tür des kleinen Ruderhauses. Bogdan war etwa fünfzig Jahre alt, auf See groß geworden und kaum zu beeindrucken. Jetzt stand Angst in seinem Gesicht.
1. Kapitel
»Keine Ahnung, woher das stammt«, erwiderte Pete Tusher nervös.
Der Eigner des Kutters, groß, hager, vielleicht vierzig Jahre alt, bewegte das Ruder. Er ließ den Kutter nach Backbord fallen. Er wollte weg von diesem unheimlichen Schwaden, dessen Farbe sich nun veränderte. Der hoch in die Luft ragende Finger lief violett an und färbte sich dann rot; und dieser eben noch gerade Finger krümmte sich, schien zu einer Kralle zu werden, die sich auf den kleinen Fischkutter senkte.
»Pete, volle Kraft!«, stöhnte Harry Bogdan und zog unwillkürlich den Kopf ein. »Mann, gib Vollgas!«
Pete Tusher hatte längst reagiert. Der Bug des kleinen Kutters hob sich aus dem Wasser und nahm große Fahrt auf.
Harry Bogdan sah sich nach den übrigen Besatzungsmitgliedern um. Da waren noch John Lagally und der kleine Ben. Sie saßen auf der vorderen, geschlossenen Ladeluke und flickten Netze. Als der Kutter nach vorn schoss, wurden sie aufmerksam. Sie schauten irritiert zum Ruderstand hinüber und entdeckten erst jetzt den roten, riesigen Finger und die jetzt giftig-grünen Schwaden.
Lagally und Ben, der Schiffsjunge, ließen die Netze fallen und hetzten zum Ruderhaus. Dort angekommen beobachteten sie den unheimlichen, krallenartigen Finger, der sich seitlich wegbewegte, plötzlich wieder auseinander floss und dann in sich zusammenfiel.
John Lagally bekreuzigte sich. Der alte Mann, fast schon sechzig Jahre auf See, hatte solch eine unheimliche Erscheinung noch niemals beobachtet. Für ihn war es klar, dass der Satan hier seine Hand im Spiel haben musste.
»Die Wolke kommt näher!«, stöhnte Harry Bogdan. »Die kommt wie 'ne Flutwelle!«
Sein Vergleich stimmte.
Die Schwaden rollten heran, waren kompakt geworden, nun auch nicht mehr durchsichtig. Der Frontsaum der Wolke, die jetzt braun-schwarz geworden war, mochte etwa acht oder zehn Meter hoch sein. Ihre Geschwindigkeit war nur gering. Fast quälend langsam bewegte sie sich jetzt auf sie zu.
Pete Tusher, der große, hagere Mann, spürte die tödliche Bedrohung. Ohnmächtiger Zorn packte ihn. Er wollte sich nicht ohne den Versuch einer Gegenwehr umbringen lassen. Verzweifelt schaute er sich im Ruderstand um, suchte nach einer Waffe und entdeckte die Signalpistole im flachen Glaskasten neben dem Barometer.
»Weg, Junge!«, schrie Harry Bogdan dem Schiffsjungen zu und zerrte ihn hinüber zum Niedergang. Er wollte mit ihm unter Deck. John Lagally aber blieb bei Tusher, der mit dem Kaffeebecher, der vor ihm auf dem Kompass stand, die Glasscheibe des Signalkastens einschlug und die Leuchtpistole vom Haken zerrte.
Der unheimliche neblige Schwaden, jetzt in giftig-grellen Farben leuchtend, kroch inzwischen näher. Der obere Rand des Frontsaums wölbte sich vor, zeigte Risse. Und dann waren plötzlich seltsame Laute zu vernehmen.
Pete Tusher sah seinen alten Freund Lagally überrascht an. Er wusste diese Laute nicht zu deuten. Stimmen schienen da zu klagen, spitze Schreie auszustoßen, heiser zu stöhnen.
»Schieß doch!« John Lagally hielt sich die Ohren zu und brüllte seine Forderung gleichsam heraus. Er fiel auf seine Knie und schlug erneut das Kreuz.
Pete Tusher spürte ganz deutlich, wie diese Töne ihn lähmten. Hatte er eben noch an Gegenwehr gedacht, so breitete sich in ihm jetzt eine grenzenlose Gleichgültigkeit aus.
Der alte Lagally sah sein Zögern, fuhr mit der rechten Hand vor und riss ihm die Signalpistole aus der Hand. Er richtete die große Mündung entschlossen auf die herankriechende Wolke, schloss die Augen und drückte ab.
Pete Tusher beobachtete die leuchtende Flugparabel, die auf die schillernde Wolke zuhielt. Die Signalpatrone platzte auseinander und wurde zu vielen kleinen und roten Sternen, deren magisches Licht von der Materie dieses unheimlichen Nebels verschluckt wurde. Sekunden später türmte die Wolke sich wieder hoch. Sie franste auseinander, verlor ihre Farbe, war plötzlich wieder nur noch milchig-weiß.
»Was war das?«, fragte der alte Lagally und drehte sich verblüfft zu Tusher um.
»Die Wolke ist verschwunden«, stellte Tusher fest und schüttelte ratlos den Kopf.
Von den milchigen Schwaden war nichts mehr zu sehen. Sie schienen nie existiert zu haben.
Der alte Lagally aber deutete zum Himmel hinauf. »Da oben!«, sagte er leise. »Sie treibt nach Westen ab.«
Nein, es war eigentlich keine Wolke, die er hoch oben am Himmel ausgemacht hatte. Ein feiner Schleier trieb in Richtung Küste. Diese Schleier sahen vollkommen harmlos aus, konnten mit dem, was sie eben erst gesehen hatten, überhaupt keine Verbindung haben.
»Das trage ich ins Logbuch ein«, sagte Pete Tusher, der wieder normal reagierte. »Aber das wird uns kein Mensch glauben, John. Kein Mensch.«
»Gib lieber einen Funkspruch an die Küstenwache durch!«, meinte der alte Lagally ernst. »Wer weiß, wo diese verdammte Wolke wieder auftauchen wird.«
»Und was soll ich rausfunken?«, erkundigte sich Pete Tusher kopfschüttelnd. »Dass wir 'ne schreiende Wolke in giftigen Farben gesehen haben, die wie 'ne Flutwelle auf uns zugerollt ist?«
Jeff Parker betrat die Brücke der Sacheen und sah sich nach seinem Steuermann Mignone um, der um diese Zeit Wache hatte. Er nickte Gianni Branca zu, der ihm lässig zuwinkte und durch Anheben seines Daumens anzeigte, dass hier oben alles in Ordnung war.
Jeff Parker, Freund und Vertrauter des Dämonenkillers Dorian Hunter, war ein durchtrainierter Sportsmann, weit über ein Meter achtzig groß, breitschultrig, braun gebrannt und blond. Seinem unbekümmerten Jungengesicht sah man nicht an, dass er ein mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann war. Dank seiner Cleverness und Tüchtigkeit liefen seine Geschäfte inzwischen allein. Erstklassige Manager an den entscheidenden Stellen sorgten für den reibungslosen Ablauf. Jeff Parker konnte sich immer mehr seinen privaten Neigungen hingeben. Seit seinem Kontakt mit Dorian Hunter widmete er sich der Bekämpfung von Dämonen und war Mitglied der Magischen Bruderschaft geworden.
Die Sacheen, eine schneeweiße moderne Jacht von dreißig Meter Länge, kreuzte an diesem Nachmittag auf der Höhe von Fraserburgh, einer kleinen Fischerstadt im Nordosten von Schottland. Jeff Parker vertrieb sich hier draußen auf See keineswegs die Zeit. Schon seit Tagen suchte er nach der Todeswolke, auf die Coco ihn von Finnland aus aufmerksam gemacht hatte. Nach ihren Informationen sollte sie auf den Norden Schottlands zutreiben.
Außer Parker gab es nur noch drei Männer, die wirklich Bescheid wussten, die sich auch ausrechnen konnten, dass ein Kontakt mit dieser Wolke lebensgefährlich sein konnte. Diese drei Männer gehörten zur früheren Stammbesatzung der Jacht: Steuermann Andrea Mignone, der Maschinist Lutz Panino und der Rudergänger Gianni Branca. Die restlichen fünf Besatzungsmitglieder waren neu angeheuert worden und glaubten, sich auf der Jacht eines Playboys zu befinden. Sie genossen den legeren Dienst und den Komfort an Bord. Jeff Parker war ein Mann, der auf unnötige Formalitäten noch nie Wert gelegt hatte.
»Ich habe da gerade 'ne komische Funkwarnung bekommen«, sagte Andrea Mignone, der Steuermann der Jacht. Er war ein kleiner, breitschultriger Italiener, der sein seemännisches Handwerk verstand. Mignone kam aus dem Funkraum und hielt einen Zettel in der Hand.
»Klingt gut«, meinte Jeff Parker. Er sah es Mignone an der Nasenspitze an, dass die Funkwarnung ungewöhnlich sein musste.
»Die Warnung stammt von 'nem Fischkutter, der Kurs auf Latheron nimmt«, redete Mignone weiter. »Die Besatzung will so was wie 'ne schreiende Wolke, die ihre Farbe ständig veränderte, gesehen haben.«
»Das ist sie!«, rief Jeff Parker sofort. Er war wie elektrisiert. »Das muss sie sein, Andrea! Wie alt ist die Funkwarnung?«
»Die ist taufrisch. Sie kam vor wenigen Minuten durch.«
»Gehen wir in den Kartenraum. Ich will mir die Position des Fischkutters ansehen.«
»Gibt's was?«, rief Gianni Branca vom Ruder herüber.
»Sieht nach Kontakt aus«, erwiderte Steuermann Mignone. »Ich werde dir gleich den neuen Kurs angeben, Gianni.«
»Gegen 'ne kleine Abwechslung ist absolut nichts einzuwenden«, meinte Branca unternehmungslustig.
»Es kann sich aber auch um eine verdammt gefährliche Abwechslung handeln«, warnte Jeff Parker.
»Die schlucken wir schon«, lautete Brancas Antwort. »Hauptsache, es tut sich was.«
Jeff Parker ging zusammen mit seinem Steuermann ins Kartenhaus. Andrea Mignone tippte auf eine ausgebreitete Karte, die den Moray Firth zeigte. Er brauchte nicht in die Details zu gehen. Jeff Parker war ein erfahrener Seemann. Die beiden Männer verglichen die Position mit der des Fischkutters.
»Fünfundsiebzig Meilen bis zum Kutter«, errechnete Mignone blitzschnell. »Da die Wolke inzwischen weiter in Richtung Südwest abgetrieben sein soll, könnten wir sie etwa hier erwischen.«
Während er noch sprach, tippte er mit der Spitze des Zirkels auf einen bestimmten Punkt der Seekarte.
»Das wären dann für uns nur noch knappe fünfzig Meilen, vielleicht sogar noch etwas weniger.« Jeff Parker nickte. »Mit voller Fahrt könnten wir das in knapp zwei Stunden dicke schaffen, oder?«
»Leicht«, bestätigte Steuermann Mignone. »Ich werde mal mit Panino unten an der Maschine sprechen. Vielleicht kitzelt er noch ein paar Umdrehungen mehr raus.«
»Und ich werde mich mal mit dem Radar befassen«, sagte Jeff Parker. »'ne normale Wolke müsste der Schirm ja liefern.«
»Ist es eine normale Wolke?« Steuermann Mignone sah Parker ruhig und gelassen an.
»Bestimmt nicht, wenn auch nur ein Zehntel von dem stimmt, was Coco uns übermittelt hat.«
»Irgendwie bin ja sehr neugierig«, bekannte Mignone, »aber ich gebe auch zu, dass ich Angst habe. Eine schreiende Wolke mit andauernd wechselnden Farben – besonders einladend klingt das gerade nicht.«
»Wir werden auf Distanz bleiben«, erklärte Jeff Parker. »Reicht ja vollkommen, dass wir sie uns aus der Entfernung ansehen. Laut Cocos Beschreibung soll sie nicht gerade harmlos sein.«
Jeff Parker wusste mehr, doch darüber sprach er nicht. Diese Todeswolke war aggressiv. Sie war mehr als nur eine unheimliche Naturerscheinung. Coco vertrat die Ansicht, dass es sich dabei um die Materialisation verdammter Seelen handeln müsste. Einzelheiten wollte sie ihm mündlich mitteilen. Coco, die Geliebte des Dämonenkillers, von dem sie ein Kind hatte, befand sich bereits auf dem Weg nach Schottland.
Jeff Parker dachte an ihre Warnung. Sie hatte ihn fast beschworen, sie nur aus weiter Entfernung zu beobachten und ihren wahrscheinlichen Kurs zu bestimmen.
Um jede weitere Diskussion über die angekündigte Todeswolke zu vermeiden, beschäftigte Jeff Parker sich mit dem Radargerät.
Andrea Mignone verließ den Kartenraum und ging hinaus auf die Brücke, um den neuen Kurs anzugeben. In der schmalen Tür blieb er kurz stehen und wandte sich zu Jeff Parker um. »Wenn die Sache mit der schreienden Wolke stimmt, sehe ich schwarz für Nessie«, meinte er ironisch.
»Nessie?« Jeff Parker sah hoch, wusste im ersten Moment nicht, worauf sein Steuermann anspielte.
»Ich meine das Ungeheuer von Loch Ness«, redete Mignone lächelnd weiter. »Was ist Nessie schon gegen solch eine Wolke? Es kann dann einpacken.«
Pattrick McIntosh hatte die breite Uferstraße kurz hinter der kleinen Stadt Urquhart Castle vorsichtig überquert und befand sich jetzt auf dem schmalen Feldweg, der hinunter zum Loch Ness führte. Er kannte diesen Weg in- und auswendig, ging ihn fast jeden Tag. Auf diesen nachmittäglichen Spaziergang hätte er freiwillig niemals verzichtet; er war Teil seines Lebensabends geworden.
Pattrick McIntosh war achtundsechzig Jahre alt, mittelgroß und rundlich. Natürlich trug er keinen Hut, und er hatte auch auf den Mantel verzichtet, obwohl es am späten Nachmittag hier draußen schon recht frisch sein konnte.
Er sah ein wenig skurril aus in seinen weiten, flatternden Hosen, der karierten Weste und der Jacke aus derbem handgewobenem Wolltuch.
Auf seinem kleinen Bauch schaukelte der Feldstecher, dessen Lederhülle längst abgegriffen war.
McIntosh war ein liebenswürdiger alter Herr, der ein wenig zerstreut wirkte. Seine Augen verrieten, dass er noch wie ein Kind träumen konnte. Ihm war natürlich längst klar, dass man ihn insgeheim belächelte. Nach Jahren der Verbitterung lächelte er aber nun seinerseits über seine Mitmenschen. Er wusste mehr als sie, sprach aber nicht mehr darüber. Er hatte es aufgegeben, für die Wahrheit zu streiten. Er hatte die letzte Gewissheit, das genügte ihm inzwischen vollkommen.
Pattrick McIntosh hatte seine Bank erreicht und nahm darauf Platz. Still und friedlich lag vor ihm ein Ausschnitt des Loch Ness, jenes fünfunddreißig Kilometer langen und durchschnittlich anderthalb Kilometer breiten Binnensees, der sich wie ein tiefer Graben quer durch das schottische Hochland zieht.